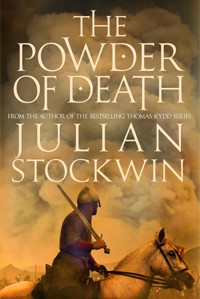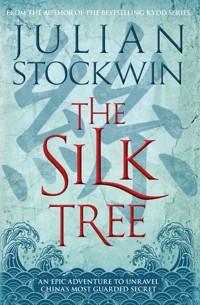5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Thomas-Kydd-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Was zählt auf den Weltmeeren wirklich? Der abenteuerliche Seefahrerroman »Offizier des Königs« von Julian Stockwin jetzt als eBook bei dotbooks. England, 1798: Nach dem glorreichen Sieg bei der Seeschlacht von Camperduin wird Thomas Kydd in den Rang eines Leutnants der Royal Navy erhoben – doch die anderen Offiziere der »Tenacious« können ihn nicht akzeptieren. Eine adelige Abstammung zählt auf dem Achterdeck mehr als Stärke, Mut und Disziplin! Selbst die Hilfe des aristokratischen Nicholas Renzi ist vergebens. Dann aber führt ein Befehl das 64-Kanonen-Linienschiff an die kanadische Ostküste. In dramatischen Seeschlachten kann Kydd die Bewunderung der Mannschaft gewinnen – und ein riskanter Auftrag scheint die Gelegenheit zu sein, sich endgültig zu beweisen: Er soll Verhandlungen mit den Amerikanern führen, um den französischen Feind in die Enge zu treiben. Doch selbst in der neuen Welt ist er nicht sicher vor Intrigen … Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin wurde zum Bestsellerautor, weil er seine Leser mitten zwischen die Männer stellt, die vor dem Mast fuhren.« Daily Express Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der marinehistorische Roman »Offizier des Königs« von Julian Stockwin – Band 5 der Erfolgsreihe um Thomas Kydd und seinen Aufstieg vom einfachen Matrosen zum Helden der See. Ein Lesevergnügen für alle Fans von Patrick O’Brian und C. S. Forester. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Ähnliche
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Anmerkungen des Autors
Lesetipps
Über dieses Buch:
England, 1798: Nach dem glorreichen Sieg bei der Seeschlacht von Camperduin wird Thomas Kydd in den Rang eines Leutnants der Royal Navy erhoben – doch die anderen Offiziere der »Tenacious« können ihn nicht akzeptieren. Eine adelige Abstammung zählt auf dem Achterdeck mehr als Stärke, Mut und Disziplin! Selbst die Hilfe des aristokratischen Nicholas Renzi ist vergebens. Dann aber führt ein Befehl das 64-Kanonen-Linienschiff an die kanadische Ostküste. In dramatischen Seeschlachten kann Kydd die Bewunderung der Mannschaft gewinnen – und ein riskanter Auftrag scheint die Gelegenheit zu sein, sich endgültig zu beweisen: Er soll Verhandlungen mit den Amerikanern führen, um den französischen Feind in die Enge zu treiben. Doch selbst in der neuen Welt ist er nicht sicher vor Intrigen …
Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin wurde zum Bestsellerautor, weil er seine Leser mitten zwischen die Männer stellt, die vor dem Mast fuhren.« Daily Express
Über den Autor:
Julian Stockwin wurde 1944 in England geboren und trat bereits mit 15 Jahren der Royal Navy bei. Nach achtjähriger Dienstzeit verließ er die Marine und machte einen Abschluss in Psychologie und Fernöstliche Studien. Anschließend lebte er in Hong Kong, wo er als Offizier in die Reserve der Royal Navy eintrat. Für seine Verdienste wurde ihm der Orden des MBE (Member of the Order of the British Empire) verliehen, bevor er im Rang eines Kapitänleutnants aus dem Dienst ausschied. Heute lebt er als Autor in Devon und arbeitet an den Fortsetzungen der erfolgreichen Thomas-Kydd-Reihe.
Julian Stockwin im Internet: https://julianstockwin.com/
Bei dotbooks erscheinen in der Thomas-Kydd-Reihe von Julian Stockwin:
»Zur Flotte gepresst«
»Bewährungsprobe auf der Artemis«
»Verfolgung auf See«
»Auf Erfolgskurs«
»Im Kielwasser Nelsons«
»Stürmisches Gefecht«
»Im Pulverdampf«
***
eBook-Neuausgabe August 2019
Dieses Buch erschien bereits 2005 unter dem Titel »Kydd – Offizier des Königs« bei Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005
Copyright © der englischen Originalausgabe 2004 by Julian Stockwin
Die englische Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Quarterdeck« bei Hodder & Stoughton, London.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2005 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der eBook-Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Samuel Scott und shutterstock/M. Kunz
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96148-889-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Offizier des Königs« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julian Stockwin
Offizier des Königs
Ein Thomas-Kydd-Roman
Aus dem Englischen von Karin König
dotbooks.
In frischer Erinnerung an Leutnant Chris Walklett,Royal Navy, einen wahrhaft mutigen Mann
Prolog
In der Stille war das laute Ticken einer Uhr zu hören. Die drei Prüfer, alles erfahrene Kapitäne zur See, betrachteten den Kandidaten unerbittlich und warteten auf seine Antwort.
Der diensttuende Leutnant Thomas Kydd hatte allen Grund, sich wie gelähmt zu fühlen: Ein Versagen bei dieser Prüfung würde ihn seinen gegenwärtigen Rang kosten, so daß er ruhmlos zu seinen alten Schiffskameraden zurückkehren müßte.
»Eh, nun, ich würde ...«
»Sir, eine nur allzu leichte Frage! Ihre Dienstpapiere weisen Ihre Fahrenszeit auf der Artemis aus, der großartigsten Fregatte, die ich je gesehen habe. Sie müssen mehr als ein Dutzend Mal ein fliegendes Ankermanöver gesehen haben.«
Es war nicht fair! Kydd sollte in diesem einschüchternden Sitzungssaal des Navy Office eines der riskantesten Manöver beschreiben, bei dem die Anker mit Fahrt über Grund gesetzt wurden. Man segelt zuerst bis zum Ende des Ankerkabels, wo dann ein weiterer Anker ausgebracht wird, bevor das Schiff von beiden Ankern aufgestoppt wird. Black Jack Powlett von der Artemis würde das Schiff nie auf diese Weise riskieren, dachte Kydd entrüstet und atmete dann tief durch.
»Wenn man zum Ankerplatz aufkommt, sollte man, äh, beide Ankertrossen auf dem Geschützdeck in langen Buchten aufschießen – die fierende Abteilung ist natürlich doppelt besetzt – und den besten Buganker fallen lassen, sobald das Kabel ausgerauscht ist. Dann ...«
»Sie halten es nicht für angebracht, Ihr Ankertau zuerst auf den Betinghölzern zu belegen, Sir?« unterbrach der erste Prüfer.
Dann meldete sich der zweite: »Und wir haben nichts darüber gehört, diesen Buganker klar zum Fallen in Bereitschaft zu halten.«
»Das heißt, sofern Ihr Schiff über keinen Trickstopper oder etwas dergleichen verfügt«, fügte der erste selbstgefällig hinzu.
Kydd zwang sich zu eiserner Konzentration: »Ja, Sir – ich habe vielleicht versäumt zu erwähnen, daß es, wenn man den Anker am Bug ausbringen will, zunächst notwendig ist ...«
Es schien zu funktionieren. Kydd wagte einen Blick zum dritten Mitglied des Ausschusses, Captain Essington, der mit unbewegtem Gesicht schweigend dasaß, der Kapitän der Triumph, auf der er bei der blutigen Schlacht von Camperdown gedient hatte.
»Womit wir zur Navigation kommen«, sagte der erste Prüfer kühl.
Kydds Sorgen wurden nicht weniger. Er hatte seine navigatorischen Kenntnisse beim Kapitän eines Handelsschiffes erworben, der ihm ein simples, aber durchaus solides Verständnis für das Handwerk vermittelt hatte, doch Kydd wußte, daß die Royal Navy hintergründige Beschreibungen und Erklärungen liebte.
»Lassen Sie uns mit dem Basiswissen beginnen, Mr. Kydd. Was ist Ihre Vorstellung von einem Großkreis?«
»Eh, die Krümmung des Äquators wird zu einer geraden Linie, wenn er vom Erdmittelpunkt aus auf eine tangentiale Berührungsebene projiziert wird ...«
»Danke. Das Berechnen einer Gestirnshöhe wird Ihnen zweifellos bekannt sein, also erklären Sie mir bitte, wie Sie die Korrektur der Rektaszension der mittleren Sonne vornehmen.«
Kydd bemühte sich, sah aber, wie unzufriedene Blicke gewechselt wurden. Sein Versagen schien bereits greifbar nahe, und kalte Furcht beschlich ihn. Wenn sie ihn nur fragen würden ...
»Mr. Kydd, Sie befinden sich an Bord eines Zweideckers.« Es war Essington, der sich nun vorbeugte, und Kydd wandte sich ihm direkt zu. In den Augen des Mannes konnte er keine Spur von Mitleid lesen. »Sagen wir, in der Karibik. Sie laufen vor einem steifen Hurrikan ab und sichten Land – unmittelbar an Backbord. Sie werfen beide Buganker.« Die übrigen Prüfer sahen Essington jetzt neugierig an. »Einer nach dem anderen wird jedoch fortgerissen. Ihnen bleibt nur ein Notanker, um zu verhindern, daß das Schiff strandet. Beschreiben Sie bitte detailliert Ihre Vorgehensweise, Sir, um einem Schiffbruch und dem schmerzlichen Verlust von Leben zuvorzukommen.« Er lehnte sich zurück, während er Kydd mit seinem unbewegten Blick zermürbte. Seine Kapitänskollegen schienen überrascht, als Essington scharf endete: »Gehen Sie davon aus, daß Sie Korallenbänke unter dem Kiel haben!«
Kydd suchte nach Worten, nach den richtigen Maßnahmen, um eine solche Extremsituation zu bewältigen – aber dann dämmerte es ihm: Er hatte sich, vom Segelmeister persönlich zum Rudergänger auf der Leeseite des Ruders ernannt, auf der alten Trajan in genau dieser mißlichen Lage befunden. Er war damals damit betraut worden, das Ankerkabel zu umwickeln, um ihren letzten Anker zu erhalten. »Also, Sir«, begann er forsch, »zunächst müssen wir den gröbsten Sturm überstehen. Das Vorhandensein von Korallenbänken bedeutet, daß wir auf die ersten zwei oder drei Fadenlängen nach dem Ankerrohring jede Menge schützende Schmartings aufbringen müssen, und dann ...« Jene Stunden der Verzweiflung abseits der unbekannten Insel hatten sich in sein Bewußtsein eingebrannt: die nicht enden wollende Nacht, der heulende Orkan, die Kälte in der Dämmerung und die Bemühungen der Männer, vom Strand abzuhalten. Sich all dies in Erinnerung zu rufen, gab ihm Halt. »Es wird ziemlich schwer sein, auf die offene See zu gelangen, und wir müssen darauf warten, daß der Wind um ein oder zwei Grad dreht, aber dann sollten wir die Chance wahrnehmen. Und es wird nur eine einzige Chance geben. Nur wenige Segel setzen, zum richtigen Zeitpunkt das Ankerkabel kappen und hinaus aufs offene Meer halten.«
Die Prüfer nickten mit ausdrucksloser Miene. »Ich denke, das genügt, Gentlemen, nicht wahr?« sagte Essington.
Kydd hielt den Atem an. Die Männer berieten sich leise und mit großem Ernst. War es möglicherweise mehr als nur ein Zufall, daß Essington diesen speziellen Sachverhalt als Prüfungsstoff gewählt hatte? Oder wußte er genau über Kydds Vergangenheit Bescheid und ...
»Wo sind Ihre Dienstzeugnisse?«
Sie fragten nach den Bestätigungen für seine Disziplin, seinen Gehorsam, seinen Fleiß und sein Können als Seemann. Kydd reichte ihnen mit wachsender Hoffnung die Journale und alle anderen Dokumente. Wenn er versagt hätte – würden sie dann noch Zeit für diese Formalitäten verschwenden?
Die seit Jahren akribisch geführten Dienstbücher wurden durchgeblättert, und auch die Bescheinigungen über seine Dienstzeiten als Gepreßter schienen akzeptiert zu werden. Sein Herz tat einen Satz: Die letzte Hürde war vermutlich genommen.
»Wenn meine Berechnung stimmt, haben wir ein Problem.« Einer der Prüfer hielt die urschriftliche, wenn auch zerknitterte Dienstbescheinigung von Kydds erstem Schiff, der Duke William, in der Hand. »Hiernach sieht es so aus, als fehle Mr. Kydd, gemäß den Bestimmungen, ein Jahr zur See.«
Kydd hatte von dieser Fehlzeit gewußt und gebetet, daß die Bestimmungen nicht allzu streng gehandhabt würden. Auch Horatio Nelson war vorzeitig zum Leutnant befördert worden, aber wenn ein Bevollmächtigter des Ausschusses darauf herumreiten wollte, konnte man nicht viel dagegen tun.
Essington griff nach dem Dokument und blickte dann mit listigem Grinsen auf. »Ja, aber dies ist ohne Belang! Es ist vielmehr ein Irrtum! Ich selbst erinnere mich genau daran, als Kapitän Caldwell von der Royal Billy auf die Culloden versetzt wurde und könnte mir gut vorstellen, daß wir ein anderes Datum genannt bekämen, wenn wir ihn direkt befragen könnten. Leider befindet sich Kapitän Caldwell derzeit als Admiral des Leeward-Geschwaders in den Westindischen Gewässern, wenn ich mich recht erinnere, und ich bezweifle, daß man ihn wegen dieser Nichtigkeit behelligen sollte.«
Damit erstickte er jegliche Diskussion. Die übrigen Prüfer sammelten die Papiere ein und reichten sie Kydd zurück.
»Nun, offensichtlich sind wir uns einig. Wir werden dem Navy Office empfehlen, Ihre Beförderung in den Rang eines Leutnants zu bestätigen. Guten Tag, Sir.«
Kapitel 1
Die Portsmouth-Postkutsche kam auf der Landstraße südlich von London zügig voran. Im Inneren roch es stark nach Leder und altem Staub, aber Thomas Kydd kümmerte das nicht. Um seine zunehmende Aufregung zu dämpfen, bedurfte es anderer Kaliber.
Nach seiner Prüfung hatte Kydd einige Tage in Yarmouth verbracht, wo die Tenacious zwecks Reparatur der Gefechtsspuren außer Dienst gestellt war, und er hatte den Ausstatter der Navy dazu gebracht, eine prächtige Leutnantsuniform anzufertigen, weil er gut aussehen wollte, wenn er auf Urlaub nach Hause fuhr.
Er blickte auf die friedliche Winterlandschaft mit den sanften Wiesen und den knorrigen Eichbäumen. Nach so vielen Jahren in der Fremde genoß er es in England, endlich in der Heimat zu sein. Das mächtige Horn des Postillions schmetterte, und Kydd lehnte sich aus dem Fenster. Er sah Cobham, Guilford war nicht weit entfernt, und er wandte sich an seinen neben ihm sitzenden Freund: »Noch eine Stunde, Nicholas – nur eine einzige Stunde, und ich sehe meine Familie wieder!«
Nicholas Renzi war seit London sehr still gewesen, seine in sich gekehrte, verschlossene Miene verbot ein Gespräch. Jetzt nickte er höflich, lächelte und schaute dann ins Weite. Der Himmel allein wußte, worüber er nachdachte. Ihre gemeinsamen Jahre waren von Gefahren und Abenteuern erfüllt gewesen, aber Renzis Freundschaft hatte Kydd einen Zugang zum Lernen verschafft sowie Respekt vor den Gebildeten. Und nun kehrten sie beide dorthin zurück, wo ihr Abenteuer vor langer Zeit begonnen hatte.
Kydd rief sich in Erinnerung, wie er sein Zuhause beim letzten Mal verlassen hatte, wie er und Renzi sich wieder auf die See davongestohlen hatten – auf die berühmte Fregatte Artemis –, nachdem er eine Schule gegründet hatte, um das Auskommen seiner Familie zu sichern. Es war eine Weltreise gefolgt, die mit einem Schiffbruch endete, und dann kamen aufregende Zeiten in der Karibik und Abenteuer im Mittelmeer. Es kam Kydd wie ein halbes Leben vor, doch waren es nicht mehr als vier Jahre gewesen. Und nun war er also wieder hier, gerade mal fünfundzwanzig Jahre alt und ...
Die Kutsche hielt ruckartig an, und für die letzte Teilstrecke nach Guildford wurden die Pferde gewechselt. Die Tür öffnete sich schwungvoll, und jemand half einer jungen Dame die Stufen hinauf, deren großer Hut sich am Kutschenverdeck verfing. Dann ließ sie sich in raschelnder, hellblauer Seide und mit gesenktem Blick gegenüber von Kydd nieder. Ein älterer Gentleman folgte, grüßte Kydd und Renzi und setzte sich dann neben die junge Dame. Der Stallknecht bot einen heißen Ziegelstein in einem abgenutzten Sergeüberzug als Heizung an, den der Mann unter die Füße der jungen Dame schob.
»Ich danke dir, lieber Papa«, sagte sie sittsam und schmiegte ihre Hände in ihren Muff.
Der Mann bevorzugte einen Bauchwärmer, den er in seinen langen Mantel schob. »Ungewöhnlich kalt für diese Jahreszeit!« brummte er.
Kydd, der lange weitaus schlimmere Bedingungen erdulden mußte, fing Renzis belustigten, aber diskreten Seitenblick auf. »Äh, da haben Sie gewiß recht.«
Das Mädchen schaute auf und registrierte die Uniformen. »Oh!« hauchte sie anmutig, eine Hand am Mund, »Sie sind gewiß Matrosen!«
Der Mann hustete gereizt. »Die Herren sind Offiziere, meine Liebe, Seeoffiziere, und keine Matrosen, verstehst du?«
»Das wollte ich sagen, Papa. Verzeihung, Sirs. Haben Sie an dieser schrecklichen Schlacht vor Camperdown teilgenommen? Ich habe gehört, es sei die entsetzlichste Schlacht des Jahrhunderts gewesen!«
Ihr Vater schnalzte mit der Zunge, aber Kydds Herz schwoll vor Stolz. In der Kutsche befanden sich noch immer die Lorbeerzweige für die eilig angesetzten Feierlichkeiten, die erst vor ungefähr einer Woche stattgefunden hatten.
»Das haben wir in der Tat, Miß, und Sie werden verstehen, daß wir ziemlich erschöpft sind, so daß wir uns eine Zeitlang nach der Wohltat des Friedens und der Zurückgezogenheit sehnen ...«, sagte Renzi ruhig.
»Natürlich, Sir, bitte verzeihen Sie.« Ihr Blick ruhte noch einmal kurz auf Kydd. Dann wandte sie sich ab und sah aus dem Fenster.
Kydd war etwas verärgert, verstand aber, daß Renzi ihm eine müßige Konversation ersparen wollte, damit er sich voll der Vorfreude auf seine Heimkehr widmen konnte.
Die Erwähnung von Camperdown, Kydds erste große Flottenschlacht, rief erneut Gefühle hervor, die noch sehr unverarbeitet waren, Bilder des Albtraums der Großen Meuterei in der Nore und deren Auswirkungen. Er scheute immer noch davor zurück und gab sich statt dessen dem Gedanken an die unglaubliche Tatsache hin, daß er in der Schlacht befördert und jetzt offiziell bestätigt worden war. Nun war er Leutnant Kydd, ein noch zu berauschender Gedanke, so daß er sich lieber wieder auf seine aufregende Heimkehr konzentrierte.
Die Kutsche holperte über die berüchtigten Schlaglöcher in Abbotswood, und Guildford Town war nur noch Minuten entfernt. Zur Linken war das quadratische, aus grauem Stein erbaute, elisabethanische Gymnasium kurz zu sehen, die Stadt präsentierte sich mit den vertrauten Gebäuden an der Hauptstraße, und das Schmettern des Posthorns hallte vom Armenhaus gegenüber der Kirche Holy Trinity wieder und zog die neugierigen Blicke der Bürger auf sich.
Die Postkutsche fuhr klappernd die alte, gepflasterte Straße unter der großen Uhr entlang, und der Kutscher manövrierte sie durch die schmale, schwarz-weiße, halb gezimmerte Einfahrt der Angel-Poststation.
Kydd und Renzi ließen ihr Gepäck bei dem diensteifrigen Wirt, gingen dann die Hauptstraße entlang und wandten sich schließlich nach links, an den Geschäften und Gassen vorbei, die Kydd wohlvertraut waren. Die Gerüche und die Farben der Stadt, die Geschäftigkeit und der Lärm, die vorüberziehenden Menschenmengen – das alles schien wie in einem Traum auf die jungen Männer einzuwirken.
Einige Bürger betrachteten die beiden voller Neugier, die anderen mit Bewunderung. Kydd wartete selbstbewußt darauf, daß ihn jemand erkannte, aber vielleicht wurde das durch das Dunkelblau, Weiß und Gold seiner stattlichen Uniform verhindert. Dann sah er Betty, die attraktive Tochter des Fischhändlers, die bei seinem Anblick stehenblieb und ihn erschrocken anstarrte. Höflich lüpfte er seinen brandneuen Zweispitz.
Dann kamen Renzi und er an der aus roten Ziegelsteinen erbauten Kirche Holy Trinity vorbei, bogen an den Pfarrland-Cottages zur Schoolhouse Lane ab, wie sie nun hieß, und die kleine Seemannsschule vor ihnen war unverkennbar: eine riesige, blaue Flagge flatterte für alle Welt sichtbar darüber, die Flagge, unter der Kydd bei Camperdown gekämpft hatte. Als sie sich weiter näherten, konnten sie den gedämpften Singsang hören: »... drei mal sieben sind einundzwanzig, vier mal sieben sind achtundzwanzig, fünf mal sieben ...«
Sie betraten den winzigen Schulhof wie zwei Offiziere, die von See heimkehrten. Ein Junge kam gerade aus einem der Klassenräume gerannt und blieb jäh stehen. Dann riß er seine Mütze vom Kopf und kreischte: »Ich hole den Bootsmann, Sir!«
Jabez Perrott trat aus dem Gebäude und stapfte gewichtig auf die beiden zu. Dann weiteten sich seine Augen, und er keuchte: »Ich glaub's nich'. Es is' Master Kydd, bei Gott!«
Kydd wollte etwas sagen, aber Perrott, der vor Freude rot anlief, griff bereits nach seiner Silberpfeife und stieß einen durchdringenden Pfiff aus. Dann brüllte er mit seiner Unterdecksstimme, die im Laufe der Jahre nicht milder geworden war: »Aaalle Mann! Antreten zum Appell – raus aus dem Unterdeck, ihr Schwabber! Aaantreten zum Appell!«
Die Kinder liefen aus den Klassenräumen herbei und jubelten vor Vergnügen über die Mätzchen ihres gestrengen Bootsmanns.
»Mr. Perrott! Mr. Perrott! Was soll das?«
Kydd erkannte die Stimme und ging, während er die Tränen zurückdrängte, seiner Mutter entgegen.
»Oh! Tom! Du bist es! Mein lieber Junge, du bist es! Und du bist ...« Der Rest ging in der heftigen Umarmung unter, die endlos dauerte und bei der seine Kopfbedeckung verrutschte.
»Mutter! So lange ...«
Kydds Vater war gealtert, seine Gestalt war gebeugt und die Augen blicklos. Dennoch hielt er sich in seiner schwarzen Kniehose eines Schulleiters vortrefflich. »Eh, bist du das, Sohn?«
»Er ist es, Walter!« rief Kydds Mutter, während der alte Mann unsicher auf seinen Sohn zutrat und eine Hand ausstreckte.
Kydd ergriff sie und umarmte ihn dann.
»Walter, Tom ist Offizier!« Sie schaute Bestätigung heischend bange zu Kydd – die Tatsache war so ungeheuerlich.
»Ja, Mutter, ich bin Leutnant Kydd, Royal Navy, wie ihr mich jetzt nennen müßt, sonst lege ich euch alle in Eisen!« Er sprach laut, damit sein Vater ihn gut verstehen konnte.
»Kann ich fortfahren, Sir?« fragte Perrott Kydd und tippte an seinen Hut.
»Ja, ich bitte darum«, erwiderte Kydd.
»Alle Mann, angetreten! In zwei Reihen vor den Mast – los!« brüllte er die Kinder an, die eifrig die beiden Glieder bildeten. »Jetz' dippen wir unsre Flagge für zwei Helden, die grade von »'ner Schlacht zurückgekommen sind, wie es sie noch nie gegeben hat, und wir wer'n ihnen zeigen, wie sehr wir sie bewundern!«
Die Leutnants Kydd und Renzi standen ernst und still da, während die Kinder mit großen Augen God Save The King und Rule Britannia sangen.
Ein durchdringender Pfiff aus der Bootsmannspfeife ließ alle erstarren, und die Flagge wurde ehrfurchtsvoll auf Halbmast gedippt. Perrott wandte sich sehr würdevoll zu Kydd und nahm seinen Hut ab. Kydd zog überrascht ebenfalls den Zweispitz, woraufhin die Flagge wieder geheißt wurde.
»Ruhe!« donnerte Perrott die ehrfürchtigen Kinder an. »Leutnant Kydd wird jetz' zu euch über eure Pflichten sprechen.«
Kydd gelang es, einige Worte hervorzubringen: »Eure Pflicht ist ... Standfestigkeit bei jeder Wetterlage ... Mut im Angesicht feindlicher Geschütze ... für König und Vaterland.«
Das genügte anscheinend.
Ein Junge trat eifrig vor und hob die Hand. »Bitte, Sir, ich möchte Seemann werden. Wie werde ich ein Seemann?«
Und im nächsten Moment wurde Kydd, dessen Gesicht sich bei der kleinen Rede gerötet hatte, von schreienden Jungen bedrängt.
»Klappe halten, ihr ungezähmte Bande, und hört dem Leutnant zu!« polterte Perrott gutmütig.
Kydd schaute zu seiner Mutter, die vor Stolz strahlte, und wußte, was er zu tun hatte. Er wandte sich seinem Vater zu und tippte an seinen Hut: »Käpt'n, Sir, bitte um Landgang für beide Wachen.«
»Oh, eh, Landgang?« stotterte sein Vater. »Ja, ja, eh, Leutnant Kydd. Einen halben Tag frei für, eh, alle Deckshände!«
Die Kinder schrien begeistert und rannten aus der Schule, während die überwältigte, glückliche Familie Kydd auf dem Schulhof zurückblieb.
»Dann werde ich mich jetzt zurückziehen, wenn es genehm ist«, sagte Renzi ruhig.
»Nein, nein, Mr. Renzi«, beharrte Mrs. Kydd, »Sie müssen bleiben und uns erzählen, wo auf dem Meer Sie gewesen sind – ihr müßt beide erzählen!« Sie wandte sich Kydd zu. »Ich werde Mr. Partington bitten, dir sein Zimmer zu überlassen – er kann bei seinem Freund Jonathan unterkommen. Für Mr. Renzi ...« Sie brach ab, dann fuhr sie bedruckt fort: »Nun, andererseits wird Thomas jetzt, da er so berühmt ist, sein eigenes Domizil haben wollen.«
Die Worte seiner Mutter konnten die Veränderungen der Lage nicht verbergen, und Kydd verspürte ein bedauerndes Schaudern, als er sein einfaches Leben dahinschwinden sah. Er sah, wie sie errötete. Sie hatte begriffen, daß ihr Sohn nicht mehr nur ihr gehörte. Von jetzt an waren bei gesellschaftlichen Anlässen und Einladungen strikte Unterschiede zwischen den Kydds zu machen.
»Wir werden erst einmal im Gasthof Angel übernachten«, schlug Renzi einfühlsam vor. »Und später werden wir uns eine bescheidene Unterkunft in der Stadt suchen.«
Kydd murmelte zustimmend.
»Nun, dann ist das geregelt«, sagte seine Mutter tapfer. »So ist es natürlich am besten. Kommt herein und nehmt einen heißen Molketrank. Ihr seid nach eurer Reise gewiß durchgefroren.«
Während Kydd am Küchentisch einen Becher heiße, dicke Milch in Händen hielt, lauschte er dem ununterbrochenen Geplauder seiner Mutter, spürte die ruhige Gegenwart seines Vaters und war sich auch des kurzen, neugierigen Blicks des Dienstmädchens bewußt. Er schaute selbst immer wieder an seiner Uniform hinab, deren Blau und Gold so eindrucksvoll schimmerten. Wer konnte wissen, was die Zukunft jetzt für ihn bereithielt? Er seufzte unwillkürlich. Dann hörte er, wie sich langsame Schritte näherten.
Kydds Mutter lächelte. »Ah, das muß Cecilia sein – sie wird sehr überrascht sein, dich zu treffen!«
Das letzte Mal hatte er seine Schwester auf einem beschädigten Boot in der Karibik gesehen. Er erinnerte sich ihrer Todesangst, während sie gegen Haie um ihr Leben gekämpft hatten. Wie würde sie nun über ihn denken?
»Sie macht sich bei Lord und Lady Stanhope sehr gut, Thomas, ist jetzt sozusagen die Gesellschafterin der Lady«, sagte Mrs. Kydd stolz. »Und bitte streite nicht mit ihr. Du weißt, wie sehr das deinen Vater aufregt.«
Die Außentür klapperte, und Cecilias Stimme hallte durch den Flur. »Vater – was ist los? Ich sah viele deiner Schüler auf der Straße und ...« Ihre Stimme erstarb, als sich die beiden Männer erhoben. Sie schaute ungläubig von einem zum anderen. »Thomas? Du ... du ...«
Kydd streckte unbeholfen die Hände aus. »Mutter sagt, es geht dir gut ...«
Ihre Miene wurde plötzlich weitaus weicher, und sie umarmte ihren Bruder heftig. »Oh, Thomas! Ich habe dich so vermißt!«
Er spürte, daß sie schluchzte, und als sie ihn wieder anblickte, sah er Tränen in ihren Augen glitzern.
Seine Stimme war ebenfalls vor Rührung rauh, als er sagte: »Schwesterherz, ich mußte eben an das Boot denken ...«
Sie legte ihm einen Schweigen gebietenden Finger auf die Lippen und flüsterte: »Mutter!« Dann ließ sie ihn los, ging zu Renzi hinüber und küßte ihn freigebig auf beide Wangen. »Lieber Nicholas! Wie geht es dir? Du bist noch immer sehr dünn, weißt du.«
Renzi antwortete höflich, und Cecilia wandte sich wieder ihrem Bruder zu. »Thomas und Nicholas werden bei Murchison's eine Schokolade mit mir trinken und mir alle ihre Abenteuer erzählen, während du, Mutter, für die beiden Weltenbummler einen großen Empfang bereitest«, verkündete sie. Plötzlich riß sie die Augen weit auf. »Du meine Güte – und wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche, Thomas, dann bist du ...«
»Leutnant Kydd, Cec«, sagte er froh.
Das Abendessen war ein voller Erfolg. Kydd wurde vom vielen Reden heiser, und Renzi war von der Herzlichkeit des Empfangs überwältigt. Cecilia konnte von Kydds Beschreibungen vom Venedig Casanovas nicht genug bekommen, selbst als ihr Bruder protestierte und erklärte, daß er durch die Gefährlichkeit der Mission kaum in der Lage gewesen sei, die Attraktionen der Republik zu genießen.
Draußen erklangen ferne, dumpfe Schläge und ein jähes Knistern. Cecilia klatschte in die Hände. »Das Feuerwerk – das hätte ich beinahe vergessen! Heute abend treffen wir Admiral Onslow – er wird Baronet und weilt derzeit mit seinem Bruder, dem Earl, in Clandon. Es heißt, er wird vom Balkon des Rathauses eine Ansprache halten! Gentlemen – ich möchte daran teilhaben! Ich bin sofort wieder bei euch.« Sie fegte schwungvoll aus dem Raum und kehrte kurz darauf in einem hochmodischen Damenmantel zurück: zitronengelbe Seide, blau gesäumt und mit blauen Aufschlägen verziert. Sie warf einen Blick auf die jungen Männer. »Und welcher der Gentlemen wird mein Begleiter?«
Kydd zögerte, und Renzi verbeugte sich augenblicklich tief und bot ihr seinen Arm. »Darf ich bemerken, daß Mademoiselle heute abend ausgesprochen hübsch ist?« sagte er mit höfischem Charme.
Cecilia neigte den Kopf und nahm seinen Arm. Dann begaben sie sich hinaus auf die Straße, ohne Kydd noch eines Blickes zu würdigen, während Cecilias Lachen Renzis Phantasie anspornte.
Kydd sah ihnen hilflos nach. Seine Schwester hatte sich verändert, da war keine Spur kindlicher Pausbäckigkeit mehr erkennbar. Ihre energischen Züge hatten etwas auffallend Geheimnisvolles und eine sinnliche Eleganz angenommen, und ihre Stellung bei Lady Stanhope hatte ihr ein Selbstvertrauen und eine Gewandtheit eingebracht, um die er sie nur beneiden konnte. Er folgte den beiden und bemühte sich, lässig zu wirken.
Überall drängten sich Menschen, die aufgeregt plauderten, der Geruch des Feuerwerks hing in der Luft. Einige Menschen wichen respektvoll zurück, und Kydd war sich nicht sicher, ob man sie für vornehme Leute hielt oder ob es an der Navy-Uniform lag. Als sie sich dem fackelbeleuchteten Balkon näherten, wurde die Menschenmenge dichter, und sie mußten in einiger Entfernung stehen bleiben.
Cecilia hielt Renzis Arm fest, zog aber auch Kydd vorwärts, während neidische Blicke von anderen Damen auf ihr lagen. »Oh, ich bin so stolz auf euch!« rief sie aus, ihre Stimme über das aufgeregte Geplapper der Menge erhoben. Sie lächelte beiden zu, und Kydd fühlte sich augenblicklich besser.
»Der Admiral hat mir meine Beförderungsurkunde überreicht, Cec – in der großen Kajüte der Monarch.« Kydd hielt inne und erinnerte sich der Szene. »Aber Käpt'n Essington hat mich protegiert.«
Von der anderen Seite der Hauptstraße weiter unten erklang ein dumpfes Stampfen: Die Royal Surreys rückten bei diesem Navy-Anlaß zum Dienst aus. Der schwache Klang von Querpfeife und Trompete stieg über dem Tumult auf und wurde beim Herannahen lauter. Dann brach er ab, und laute Doppelschläge auf der Baßtrommel erschallten.
Die Menge drängte sich unter dem Balkon und verharrte in angespannter Erwartung. Fackelschein beleuchtete die aufwärts gewandten Gesichter, fing das Glitzern der Augen ein, das Schimmern von Goldspitze. Beim ersten Anzeichen einer Bewegung im Inneren des Gebäudes konnte man die Erwartung fast knistern hören. Der Bürgermeister trat in seinem besten, scharlachroten Gewand mit Dreispitz und funkelnder Amtskette auf den Balkon.
»Mylords, Ladies und Gentlemen! Ich bitte um Ruhe für den bedeutenden Sieger der großen Schlacht von Camperdown, unseren – Admiral Onslow!«
Der freundliche Seeoffizier, den Kydd gut in Erinnerung hatte, betrat den Balkon. Grandioser Jubel begrüßte ihn aus vollem Herzen mit patriotischem Beifall. Onslow, in voller Admiralsuniform, mit Degen und Ehrenzeichen, zog den Hut und verbeugte sich hierhin und dorthin, offenkundig von dem Willkommen bewegt.
Kydd beobachtete, wie er sich immer wieder umwandte, um alle Menschen anzusehen. Einmal glaubte er, den Blick des Admirals auf sich gezogen zu haben, und fragte sich, ob er winken sollte, aber Onslow schien ihn nicht wirklich zu erkennen.
Der Lärm erstarb, und der Admiral trat auf dem Balkon vor. Er zog ein Blatt Papier aus seiner Jacke, zögerte, steckte das Blatt wieder in die Tasche und richtete sich zu voller Größe auf. »Mylord Bürgermeister und Mylady – Bürger von Guildford«, begann er, »ich danke Ihnen für Ihre großartige und aufrechte Dankschrift nach der Schlacht von Camperdown. Aber ich möchte Ihnen sehr deutlich sagen: Kein Admiral gewinnt Schlachten allein, sondern es sind die Seeleute. Und ich kann heute abend nicht hier stehen, ohne diese vor Ihnen allen zu belobigen! Dort drüben an Backbord! Ja, diese beiden Männer! Seien Sie so freundlich und zeigen Sie sich! Dies sind zwei von den wahren Siegern von Camperdown!«
»Thomas – los!« quiekte Cecilia, als offensichtlich wurde, wen der Admiral gemeint hatte.
Die Menge machte ihnen Platz. Onslow wartete auf sie und schüttelte ihnen dann herzlich die Hand.
»Es ist schön, Sie beide hier zu sehen«, sagte er, während er aufmerksam ihre neuen Uniformen betrachtete. »Zeigen wir uns zusammen der Menge, und dann gewähren Sie mir bei dem Empfang die Ehre Ihrer Anwesenheit.«
Zu dritt traten sie unter dem Jubel der Menge gemeinsam auf den Balkon, während Kydd unbeholfen grüßte und Renzi sich verbeugte. Kydds Blick suchte Cecilia. Sie rief ihm etwas zu und winkte stürmisch, und sein Herz schwoll vor Stolz.
»Eine großartige Wahl«, sagte Renzi, während er seine Jacke ablegte und in Weste und Hose stehen blieb. »Anscheinend werden wir die Reparatur der Tenacious in aller Gemütlichkeit abwarten können.« Er ließ sich in einen sehr hochlehnigen Sessel sinken.
Kydd rieb sich vor dem Feuer die Hände. Der Vermieter war gegangen, und sie hatten die Villenhälfte unterhalb des Schlosses für einen vernünftigen Preis von ihm bekommen. Offensichtlich hatte der Besitzer verfügt, Offiziere im Dienste Seiner Majestät im Falle einer Vermietung mit patriotischem Pflichtgefühl zu bevorzugen. So konnten sie sich auch angenehmerweise mit dem Nachbarwohnsitz die Dienste einer Haushaltshilfe teilen, was – da dieser von einer alten Dame bewohnt wurde – kein Problem sein sollte.
Kydd sah sich zunehmend zufriedener, wenn auch ein wenig ängstlich um. Die Räume waren nicht groß, aber doch größer als alles, worin er bisher gelebt hatte. Man hatte ihm beigebracht, daß das Herz eines Heimes immer die Küche war, doch hier nahm anscheinend dieser vornehme Raum deren Platz ein.
Die Wände waren hell salbeifarben, vor den breiten, großzügigen Schiebefenstern hingen Musselin-Vorhänge mit Blumenmuster, und robuste, grobe Teppiche statt der üblichen Wachstücher lagen unter seinen Füßen. Die Möbel waren beruhigend altmodisch und robust. Kydd wandte sich wieder dem Feuer mit seiner einfachen, aber exakt proportionierten Marmorumrandung und dem Sims zu und verspürte unbändige Freude.
»Zwei oder drei Monate, vermutest du?« fragte er im Gedanken an die gravierenden Schäden, welche die Tenacious erlitten hatte.
»Ich glaube schon.« Renzi saß mit geschlossenen Augen entspannt da.
»Nicholas, die Sonne ist zwar noch nicht untergegangen, aber ich möchte auf unser Geschick anstoßen!«
Renzi öffnete die Augen halbwegs. »Einverstanden. Du wirst feststellen, daß ich bereitwillig anerkenne, daß genau diese Geschicke, die darüber entscheiden, ob man an einer abscheulichen Krankheit stirbt oder ...«
»Halt ein, Bruder!« Kydd lachte. »Ich werde etwas auftreiben, was wir ...«
»Das glaube ich nicht.«
»Warum ...«
»Läute einfach nach dem Diener.«
»Ja, Nicholas«, sagte Kydd demütig. Er fand die abgenutzte, aber glänzend polierte Silberglocke und betätigte sie zögernd.
»Sir?« Ein Diener, in Blau gekleidet und mit einer einfachen Perücke auf dem Kopf, erschien.
Renzi richtete sich auf. »Wenn Sie meinen grauen Koffer aufschließen, finden Sie eine Flasche Cognac. Bitte öffnen Sie sie für uns.«
»Gewiß, Sir«, sagte der Mann mit einer knappen Verbeugung und zog sich zurück.
Kydd setzte eine unbesorgte Miene auf und wärmte seinen Hintern, bis der Diener mit einem vergoldeten Tablett zurückkehrte.
»À votre santé«, sagte Renzi.
»À wottre sondé«, wiederholte Kydd unbeholfen. Der Brandy brannte sich in seinen leeren Magen.
Renzi erhob sich und hob Kydd sein Glas entgegen. »Auf unser gegenwärtiges Geschick. Möge dies eine sich erfüllende Weissagung für unsere Zukunft sein.«
»Ja, und mögen wir es niemals für nötig erachten, unsere Vergangenheit zu verleugnen«, erwiderte Kydd. »Nicholas! Mein wahrer Freund!« Er warf Renzi einen Seitenblick zu, und als er erkannte, daß dieser artig zuhörte, fuhr er hastig fort: »Ich habe nachgedacht – es macht dir doch nichts aus, wenn ich offen spreche?«
»Mein lieber Kamerad! Ansonsten würde ich mich verraten fühlen.«
»Nun, Nicholas, dies alles ist mehr, als ich jemals erhoffen konnte, etwas, was nur geschehen kann, wenn ... wenn das Schicksal vermutlich von Anfang an irgendwo festgeschrieben ist. Also ergreife ich diese Chance mit beiden Händen! Ich werde mein stürmischstes, seetüchtigstes, verdammtes Bestes versuchen, das werde ich!«
Renzi nickte. »Natürlich, Bruder.«
»Daher habe ich mich zu Folgendem entschlossen«, Kydd nahm einen Schluck Brandy, »ich habe erlebt, wie dein muschelrückiger Offizier durch die Klüse nach achtern kam, ein echter, schmucker Sohn Neptuns. Man sieht ihn bei der Wache auf dem Achterdeck, und das Herz geht einem auf. Aber, Nicholas, ich will nicht so ein Aufsteiger werden. Sie bleiben ihr ganzes Leben lang Leutnants, gewiß großartige Messekameraden, aber, wie soll ich sagen – mit schlichten Umgangsformen. Die anderen Offiziere gehen gemeinsam an Land, während sie isoliert an Bord bleiben und sich mit der Flasche anfreunden.« Er betrachtete das Glas in seinen Händen. »Ich möchte das Leben eines anerkannten Offiziers und Gentleman der Krone führen, Nicholas, und ich frage dich, was ich tun kann, um einer von ihnen zu werden.«
Renzi setzte ein schiefes Grinsen auf. »Wenn dir das wichtig ist, Tom – du solltest aber wissen, daß es keine Schande ist, nichts als ein geborener Gentlemen zu sein ...«
»Wenn du bitte ...«
»Ah, alles zu seiner Zeit, Kamerad. Das erfordert erhebliches Nachdenken ...«
Es war in Ordnung für Kydd, diese Frage an Renzi zu richten, obwohl dessen Vorhaltungen vollkommen vernünftig waren, denn im Grunde war die Aufgabe nahezu unmöglich zu lösen. Renzi betrachtete heimlich Kydds Statur: Anstatt fein gestalteter, geschmeidiger Würde sah er kräftige Schultern und schmale Hüften. Anstelle einer vornehmen, schlanken Wölbung des Beins verriet Kydds Kniehose eine ausgeprägte Muskulatur, seine Miene wirkte eher herzhaft bodenständig und offen als elegant, kühl und elegisch, und seine gute Laune war nicht den gesellschaftlichen Gepflogenheiten angemessen. Aber er war zweifellos intelligent. Renzi hatte Proben seiner Aufgewecktheit immer wieder miterlebt. Kydd würde Höflichkeit und Konventionen zu schätzen lernen müssen – nicht seine stärkste Gabe. Und dann Kydds Sprache! Renzi wand sich bei dem Gedanken, wie man sich hinter seinem Rücken über ihn lustig machen würde. Der wahrscheinliche Verlauf der Dinge war, daß Kydd sich danach wieder in die Behaglichkeit rauhen Seebärentums zurückzog und somit von der vornehmen Gesellschaft ausgeschlossen blieb. Doch er war sein Freund und konnte ihm die Bitte nicht abschlagen.
»Mr. Kydd, wie ich dich jetzt nennen muß, hier ist mein Vorschlag.« Er sah ihn fest an. »Solltest du diesen Weg wählen, dann muß ich dich davor warnen, daß es ein mühsamer Weg wird. Es gibt viele Möglichkeiten zu straucheln. Bist du bereit, hart am Wind zu segeln?«
»Das bin ich.«
»Und es gibt, eh, Umstände, die du ohne Hinterfragen akzeptieren mußt, auch wenn sie, oberflächlich betrachtet, weder vernünftig noch erklärbar sind. Verpflichtest du dich, deren Notwendigkeit einfach von mir anzunehmen?«
Kydd zögerte. »Ja.«
»Sehr gut. Ich werde dich bei deinem ehrenvollen Bestreben bestmöglich unterstützen, und wenn du diesen Kurs beibehältst ... denn du könntest in der Tat irgendwann abbrechen wollen ...«
»Niemals!«
»... dann erkläre ich mich im Gegenzug einverstanden, dir bei deinem Aufstieg in die bessere Gesellschaft beizustehen.«
Kydd errötete. »Ich werde dich vor deinen Freunden nicht blamieren, falls du das befürchtest.«
»Das habe ich nicht gemeint, aber fangen wir an.« Er griff nach dem Cognac und füllte Kydds Glas nach. »Alles hat seinen Anfang, und als erstes muß dir klar sein, daß ein Gentleman durch sein äußeres Erscheinungsbild definiert wird. Höflichkeit und die einer Lady gegenüber angemessenen Liebenswürdigkeiten sind auf diesem Parkett wesentlich wichtiger als dein Mut hoch oben auf der Rah oder echte Seemannschaft. Es ist unfair, aber so ist die Welt. Und was die Liebenswürdigkeiten betrifft, so haben wir ...«
Kydd lernte beharrlich. Er war sich bewußt, daß Renzis Unterweisung nur eine Einführung war und ihm enorme Herausforderungen an Einsicht und Verständnis bevorstanden, die sich weit von allem unterschieden, was ihm bisher im Leben begegnet war. Die Unterweisungen zogen sich in die Länge, und als Renzi zum Thema »der richtige Gebrauch von Euphemismen« kam, kapitulierte Kydd. Beide hörten den Klopfer an der Vordertür.
»Ich werde öffnen«, sagte Kydd und erhob sich.
»Das wirst du nicht!«
Renzis Worte geboten ihm Einhalt, und er sank wieder in seinen Sessel.
Der Diener trat mit einem Silbertablett in den behandschuhten Händen ein und ging zu Renzi. »Sind Sie zu Hause, Sir?«
Renzi nahm eine Karte hoch. »Für diese junge Lady bin ich zu Hause, danke.«
»Sehr wohl, Sir.«
Als der Diener ging, sprang Renzi auf. »Anbrassen, Tom – es ist deine Schwester.«
Cecilia betrat das Wohnzimmer und sah sich schnell um.
»Eh, willkommen, Cec«, sagte Kydd und versuchte vergebens, sich seiner Morgenlektionen über Liebenswürdigkeit zu erinnern.
Sie grüßte Renzi mit knappem Nicken. »Mutter sagt – so ein Dummerchen –, daß man Männern in punkto Häuslichkeit nichts zutrauen kann. Wie beleidigend für euch!«
»Ich muß mich entschuldigen, Miß Kydd, daß wir nicht auf Besuch eingerichtet sind. Ich hoffe, Sie verstehen das.«
»Nicholas?« sagte Cecilia verwirrt, aber dann klärte sich ihre Miene. »Natürlich – du beachtest um Thomas' willen die Förmlichkeiten.« Sie sah ihren Bruder liebevoll an.
Kydd errötete zutiefst.
Cecilia ignorierte ihn, trat zu einem Kerzenständer und schnupperte leicht an der nächstgelegenen Kerze. »Nun, es geht mich nichts an, aber ich muß feststellen, daß Bienenwachskerzen, wenn ihr nicht außerordentlich reich seid, traurigerweise als Extravaganz gelten müssen. Talg wäre ausreichend – es sei denn, ihr habt Besuch.« Sie trat zum Fenster und schloß, auf Wirkung bedacht, die Fensterläden. »Ihr werdet merken, wie lebenswichtig es ist, Möbel vor der Sonne zu schützen.«
»Wir kommen schon zurecht«, knurrte Kydd. »Ich wäre dir dankbar, wenn du deine Haushaltstipps für dich behieltest.«
»Thomas! Ich bin nur aus Sorge gekommen um eure ...«
»Cec, Nicholas bringt mir gerade das angemessene Verhalten eines Gentleman bei. Bitte laß uns damit weitermachen.«
»Also wirklich!«
»Liebe Miß Kydd, es ist außerordentlich freundlich von Ihnen, sich nach unserem Befinden zu erkundigen«, sagte Renzi, »jedoch steht es wahrscheinlich eher einem Mann zu, einem anderen Mann den Anstand eines Gentleman zu vermitteln.«
Cecilia zögerte. »Das mag sein, Mr. Renzi, aber ich bin noch aus einem anderen Grund hier. Ihr habt anscheinend vergessen, daß eine Navy-Uniform nicht allen Anlässen der feinen Gesellschaft angemessen ist. Ich bin also gekommen, um meine Dienste beim Besuch eines Schneiders anzubieten.«
Cecilia war beim Schneider nicht von ihren Vorstellungen abzubringen und brachte Kydds Vorlieben rasch zu Fall. Eine gelbe Weste war, wenn auch zweifellos bezaubernd, anscheinend unverbesserlich gewöhnlich: dunkelgrün, zweireihig, war eher geeignet. Im Falle der goldenen Paspeln an den Taschen gab sie nach. Eine lederfarbene Hose, ein rostroter Hut und ein bon de Paris mit unauffälligem Goldschnurbesatz wären äußerst ton – unsicher war sie sich nur wegen der Spitze.
»Und was kostet das alles?« Kydd hatte in der Karibik gutes Prisengeld erhalten, und nach Camperdown würde es noch mehr werden, aber dies alles würde entsetzlich viel Geld verschlingen.
Cecilia eilte unerbittlich voran. Ein dunkelblauer Gehrock war unentbehrlich, im neuen Stil mit Cutaway-Schößen; die geteilt endeten, damit sie beim Reiten elegant fielen, was Kydd unsinnig schien, da er eher die Wärme eines geschlossenen Uniformrocks gewohnt war. Ein Schwung Leinenhemden folgte, und es wurde Stoff für ein Halstuch erstanden, bei dem Cecilia darauf beharrte, nur sie könne es auswählen. Kydd protestierte gegen Pantalons, lange Hosen, die man in die Stiefel stecken konnte. Kniehosen waren es, worin er gesehen werden wollte, damit niemand ihn irrtümlicherweise für einen »verdammten Makkaroni« halten könnte.
Der Schneider, der sich über diese Kundschaft freute, die erst seit so kurzer Zeit im öffentlichen Interesse stand, versprach, so bald wie möglich zu liefern. Dann wurde Kydd zum Stiefelmacher geleitet und schließlich in die Räumlichkeiten von Henry Tidmarsh, dem Strumpfwaren-, Hut- und Handschuhmacher, wo er einen feschen, hellgrauen Hut mit Krempe und Silberschnalle für sich fand.
Während Kydd Hüte aufprobierte, trat Renzi zu Cecilia. »Eine gewaltige Verwandlung«, murmelte er.
»Ja, Nicholas«, stimmte Cecilia ihm leise zu, »aber ich fürchte, er wird als Stutzer angesehen werden, wenn seine Manieren seiner Kleidung nicht entsprechen.« Sie legte ihm ihre Hand auf seinen Arm. »Lieber Nicholas, ich weiß, du versuchst dein Bestes, aber Thomas kann sehr halsstarrig sein. Bitte hab Geduld mit ihm.«
»Gewiß. Aber der schwerste Brocken wird zweifellos seine Artikulation werden. Seine Sprache desavouiert ihn augenblicklich.«
Cecilia berührte erneut seinen Arm. »Kann ich vielleicht irgend etwas tun?«
Renzis Gedanken hatten eine vollkommen andere Richtung genommen. Cecilia war nicht mehr das raffinierte kleine Mädchen, das er von früher kannte. Sie war jetzt eine begehrenswerte, selbstbeherrschte Frau, die jedes gesellschaftliche Ereignis schmückte. »Eh, darüber könnten wir möglicherweise gemeinsam beraten, wenn du einmal Zeit haben solltest.« Er spürte, wie er bei diesen Worten errötete.
»Aber, Nicholas!« rief Cecilia lebhaft. »Wenn ich dich nicht besser kennen würde, müßte ich dir Aufdringlichkeit unterstellen.« Sie lächelte ihm kurz zu und wandte ihre Aufmerksamkeit dann dem Geschmack ihres Bruders bei Hüten zu.
Obwohl es Kydd jetzt zustand, konnte er sich doch nicht für die Perücken begeistern, die zu fertigen er während seiner Lehre gelernt hatte: Der cornet, der royal bird, der long bob – sogar der fesche cardogan puff waren nicht mehr modern. Er beschloß, sein Haar nur mit einem einfachen, schwarzen Band im Nacken zusammenzubinden. Haarpuder wurde besteuert, so daß jedermann Verständnis haben würde, wenn er das Haar natürlich trug.
Der Schneider lieferte seine Arbeit, wie versprochen, nur drei Tage später, und Kydd stand vor dem großen Schlafzimmerspiegel und betrachtete sich voller Zweifel. Ein großzügiger Zuschnitt verhinderte bei der Weste jegliche, durch Muskelspiel entstehende Falten, aber die lederfarbene Hose saß ungebührlich eng. Doch wie dem auch sei, wenn er in der Öffentlichkeit auftreten müßte, wäre dies kein schlechter Anfang, dachte er. Er betrachtete anerkennend die weißen Strümpfe und die Schnallenschuhe und drehte sich einmal um sich selbst.
»Ich bin froh, dich guter Laune zu sehen, Bruder«, erklang es hinter ihm.
»Ja, was sein muß ...«, scherzte Kydd und richtete eine Manschette. »Bist du bereit, Nicholas?«
»Ah!« Renzi drohte mit einem Finger.
»Was? Oh! Ich wollte sagen: Sind Sie bereit, Mr. Renzi?«
»Wir sollten uns in die große Welt aufmachen.«
Renzi trug Braun, alles in Dunkelbraun, Hose, Jacke und sogar Weste in dieser Farbe, nur durch den cremefarbenen Faltenwurf seines Halstuchs und die Strümpfe gemildert. Zudem trug er, in der Art eines Romantikers, einen breitkrempigen Hut, den er schräg aufgesetzt hatte. Kydd benutzte zum ersten Mal einen Spazierstock aus Ebenholz, der sich, als sie die Chapel Street entlanggingen, unhandlich anfühlte, ob er ihn nun bei jedem Schritt auf dem Boden aufsetzte oder umherwirbelte. Er hatte gegen das Gefühl anzukämpfen, ein Hochstapler zu sein, aber nachdem ihm zum zweitenmal ein Passant respektvoll den Weg freigemacht hatte, fühlte er sich schon wohler. Sie gingen in der Hauptstraße unter der großen Glocke vorbei – der Büttel vor dem Rathaus grüßte mit einer Hand am Hut –, bogen in eine Seitenstraße ein und traten durch einen schäbigen Eingang.
»Darf ich dir M'sieur Jupon vorstellen? Er wurde als dein Tanzlehrer engagiert.«
Ein kleiner, aber scharfsichtiger Mann verbeugte sich vollkommen übertrieben vor Kydd, richtete sich dann wieder auf und sah ihn herausfordernd an.
»Eh, freut mich, Sie kennenzulernen«, stotterte Kydd und versuchte eine krampfhafte Verbeugung.
Jupon und Renzi wechselten Blicke.
»M'sieur Jupon wird dir schickliche Bewegung und Höflichkeit beibringen, und du wirst eine Stunde pro Tag hierherkommen, bis du die Grundlagen beherrschst.«
»Ah, Mr. Kydd, bedenken Sie, Sie befinden sich jetzt nicht an Bord Ihres Schiffes, Sir. Versuchen Sie, ein wenig Anmut in Ihre Bewegungen zu bringen.«
Die Stimme des weiblichen Reitlehrers war über das gesamte Rund hinweg mühelos vernehmbar. Sie könnte durchaus vom Achterdeck aus befehlen, die Fockrah herunter zu lassen, dachte Kydd.
Das Pferd hatte Kydds Unerfahrenheit natürlich sofort gespürt, schlug mit dem Schwanz, spielte mit der Trense und rollte erwartungsvoll die Augen, während Kydd sich bemühte aufzusteigen und deshalb mit einem Fuß im Steigbügel im Kreis umherwankte.
Renzi stieg ab und kam zu ihm. Er überprüfte den Sattelgurt und zog am Steigbügel. »Ah, der Stallbursche hat sich einen Spaß mit dir als Anfänger erlaubt. So geht das nicht. Wir werden sie lockern – so.« Als die Steigbügel etwas niedriger hingen, wurde das Pferd unter Renzis Hand ruhiger. Er gab dem Tier einen vertraulichen Klaps auf die Kruppe. »Hör zu, hier kommt ein Tipp: Stell dich mit dem Gesicht zum Pferd, streck den rechten Arm aus und berühre mit den Fingerspitzen die Aufnahme des Steigbügelriemens. Mit der linken Hand ergreifst du den Steigbügel und ziehst ihn an den Körper, bis der Riemen gestreckt ist. Wenn der Steigbügel die Achselhöhle berührt, ist die Länge richtig.«
Kydd schwang sich nervös in den Sattel und fand sich jäh in großer Höhe wieder. Das Pferd schnaubte und warf den Kopf auf. Er spürte, daß es abwartete, um schreckliche Rache zu nehmen.
»Also scheinen wir uns entschlossen zu haben, endlich zu reiten.« Der sarkastische Ruf drang über das Rund zu ihm. »Wir beginnen mit Schrittempo.«
Das Pferd trottete brav im Kreis, und Kydds Zuversicht wuchs.
»Den Rücken gerade, Mr. Kydd!«
Er zwang seine Wirbelsäule in aufrechte Haltung und vollendete einen weiteren Kreis.
»Jehosaphat Moses! Halten Sie den Rücken geschmeidig, Mr. Kydd. Sie sollten sich mit dem Pferd wiegen, Sir!«
Die flotte Bewegung im Trab gefiel Kydd besser, aber das Pferd wieherte unwillig wegen der festen Zügel, so daß Kydd sie ein wenig lockerte.
Ein Tor zu einem Feld wurde geöffnet, und Renzi verfiel in kurzen Galopp. Kydd folgte ihm, spürte das Donnern der Hufe und hörte das große Tier unter sich schnauben. Es war amüsant, und er überließ sich entspannt dem Geschehen. Das Pferd schien das zu spüren und reagierte mit schnelleren Bewegungen.
»Gut gemacht, Mr. Kydd!« hörte er. »Mit leichter Hand versammelt‹, wie wir sagen.«
Als er sich umschaute, sah er, wie die Frau eine große Taschenuhr hervorzog. »Zu mir!« forderte sie ungeduldig.
Kydd spürte, wie das Pferd auf seine Signale mit Knien und Zügeln reagierte, und wollte die Morgenlektion plötzlich nicht mehr beenden. Er drückte die Knie instinktiv in die gerundeten Seiten des Tieres. Das Pferd reagierte nach kurzem Zögern und brach in Galopp aus. Kydd handelte wie in der Takelung instinktiv, in geduckter Haltung wie ein Toppgast, der sich vorbeugt, um ein killendes Segel zu beschlagen. Das Pferd jagte am Feldrain entlang, und Kydd, der nun ziemlich aufgeregt war, nahm aus den Augenwinkeln Menschen wahr, die ihn anstarrten, während er vorüberpreschte. Der Wind fuhr ihm durchs Haar, und das Donnern der Hufe und die rhythmischen Bewegungen des Tieres beanspruchten alle seine Sinne. Ein knorriger Holzzaun kam in Sicht. Als sie darauf zu rasten, erwog Kydd als Ausweichmanöver eine Notwende nach Backbord.
Weit hinter ihm klang schwach ein Brüllen: »Die Zügel! Die Zügel!«
Aber es war bereits zu spät. Das Pferd lief auf das Hindernis zu. Eine kurze Muskelanspannung folgte, ein Sprung, und dann schien einen Herzschlag lang alles ruhig, bevor das wuchtige Tier ruckartig wieder aufkam.
Kydd blieb an Bord, während das Pferd durch unbestimmbares, winterbraunes Farnkraut in die jenseitigen Wälder raste. Es zögerte mitten im Schritt und wich dann auf einen Waldpfad aus, während sich Kydd tief duckte, um den peitschenden Ästen zu entgehen. Er hörte Hufschläge, die unsynchron mit seinen eigenen erklangen, sowie ferne Rufe, und vermutete, daß Renzi ihm folgte, wagte es aber nicht, sich umzusehen. Er schoß an einem gaffenden Wilderer vorbei und erreichte dann einen festeren Weg, der den Pfad kreuzte.
Das Pferd rutschte aus, als es eine scharfe Biegung nahm, und der Schlamm behinderte es nun, so daß der Galopp weniger wild ausfiel. Das Tier keuchte schwer, während es in Trab verfiel.
Dann holte Renzi sie ein und griff nach den Zügeln. »Wie geht es dir, Bruder?«
Kydd grinste ihn breit an. »Das war aufregend, Nicholas, ich kann mir nicht helfen«, sagte er atemlos, das Gesicht vor Anstrengung gerötet.
Renzi unterdrückte ein Grinsen. »Und wie ist es um die Schicklichkeit bestellt, Sir?«
»Oh? Ja, ja, eine großartige Erfahrung, Sir.«
Sie ritten eine Zeitlang gemeinsam weiter. Der Weg wurde breiter, als vor ihnen ein kleines Cottage in Sicht kam.
»Steig ab, alter Junge, und frage nach dem Rückweg«, schlug Renzi vor.
Kydd beugte sich sachte vor, um ein Bein über den Sattel zu schwingen, aber dann stürzte er schlagartig rückwärts in den schwarzen Winterschlamm, einen Fuß noch immer in einem Steigbügel.
Das Pferd stampfte und rollte mit den Augen, während Kydd kleinlaut aufstand und den Gartenweg zur Tür hinabstapfte.
Ein gebeugter, alter Mann mit wachsamen, hellen Augen öffnete ihm. Bevor Kydd etwas sagen konnte, grinste er. »Ah, Master Kydd, glaube ich? Thomas Kydd?«
»Ja, da haben Sie recht«, erwiderte Kydd. »Das heißt, Sie sind mir gegenüber im Vorteil, Sir.
Der Mann tat enttäuscht.
Dann klärte sich Kydds Miene: »Natürlich! Pastor Deane!« Es schien sehr lange her, seit er als Junge mit dem alten Mann und seinem Hund gern auf Entenjagd zum See gegangen war. »Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Sir«, sagte en
Der Pastor sah zu Renzi, der noch immer auf seinem Pferd saß.
»Oh, Sir, dies ist Mr. Renzi, mein spezieller Freund. Mr. Renzi, dies ist Reverend Deane.«
Renzi neigte den Kopf. »Es ist mir eine Ehre, Sir. Verzeihen Sie unser Eindringen, aber wir suchen einen vorteilhafteren Weg zu unserer manège zurück.«
Deanes Gesicht legte sich in vergnügte Falten. »Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie hereinkommen und eine Tasse Tee annehmen, während Thomas mir erzählt, wo er so lange gewesen ist.«
Sie ließen also die Pferde außerhalb des Gartenzaunes grasen und betraten das Haus des Pastors.
Deane betrachtete Kydd genau und genoß die knappe Schilderung seiner gewaltsamen Dienstverpflichtung und der folgenden Abenteuer eindeutig. »Also bist du jetzt Offizier?«
Kydd grinste wie ein Junge. »Leutnant Kydd!« sagte er stolz.
»Dann bist du nach Ansicht der Welt nun ein Gentleman. Nicht wahr?«
Es schien angemessen, sich nur schweigend zu verbeugen.
Deane betrachtete Kydd lange Zeit nachdenklich. »Unterbrich mich, wenn ich unverschämt erscheine«, sagte er, »aber ich würde mich dieses Augenblicks später mit Bedauern erinnern, wenn ich dir nicht meine Gedanken zu deiner Stellung mitteilen würde.«
»Es kann mir nur helfen, Mr. Deane.« Er konnte nicht umhin, Renzi rasch einen triumphierenden Blick zuzuwerfen – er hatte sich immerhin dieser höflichen Formulierung erinnert –, aber Renzi runzelte nur die Stirn. Kydd wandte seine ganze Aufmerksamkeit ergeben wieder dem alten Mann zu.
»Mir scheint, als läge das Wesen eines Gentleman in dessen guter Erziehung, in seiner untadeligen Höflichkeit allen gegenüber, einschließlich seiner Diener. ›Umgangsformen machen den Menschen aus‹, wie die Bibel uns lehrt. Äußerliche Umgangsformen spiegeln innere Werte wieder.«
Renzi nickte zögernd. »Der ehrenwerte Locke ist in diesem Punkt unerbittlich.«
»Es ist für junge Menschen nie einfach, sich bürgerliche Tugenden anzueignen«, fuhr der Pastor fort. »›Quo semel est imbuta recens, servabit oderem testa diu‹, lautete Horaz' Ansicht, und daher solltest du begreifen ...«
Kydd regte sich in seinem Sessel unruhig. »Wenn dir der Galgen droht, is' das mehr, als ein Mensch ertragen kann.«
Cecilia gab vor, ihn nicht zu hören.
Kydd sah sie gereizt an. »Ich wollte sagen: Wieviel hiervon wird mir auf See nützlich sein?«
»Das ist schon besser«, sagte Cecilia gesetzt, legte aber ihr Buch hin. »Da ich mir sicher bin, daß die übrigen Offiziere höflich und gut erzogen sind, mußt du mit ihnen mithalten.«
Kydd schnaubte.
Renzi seufzte. »Du mußt ohne Zweifel noch drei Themen des Gentleman's Magazine verinnerlichen«, sagte er anklagend.
»Und einen Spectator«, stimmte Cecilia mit ein. »Wie willst du eine Lady bei Tisch unterhalten, ohne oberflächliche Konversation betreiben zu können?« Sie sah Renzi mit gespielter Verzweiflung an und strahlte dann. »Mr. Renzi, haben Sie unsere Burg gesehen? Die reinste Ruine, das versichere ich Ihnen, aber wirklich alt. Wir müssen Mama überzeugen, mit uns zu kommen – sie kennt die Geschichte des Bauwerks.«
»Ich bin völlig erschöpft«, sagte Mrs. Kydd, während sie sich auf einer Holzbank niederließ, von der aus die Überreste des Burgfrieds zu sehen waren. »Ihr beide könnt euch sehr gut auch ohne mich umsehen.«
Cecilia stimmte zu, und Renzi führte sie am Arm den steinigen Pfad entlang, der um den Burgwall verlief. Die Wintersonne hatte nur wenig Kraft, betonte aber die hellen Farben zwischen dem Grau und Braun.
»Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber Thomas hat bei der Teegesellschaft nicht sehr geglänzt«, begann er. Er war sich ihrer Berührung beunruhigend bewußt – es war viele Jahre her, seit er sich zuletzt vornehmer, weiblicher Gesellschaft erfreut hatte. Cecilia war eine Schönheit.
»Ja – der törichte Junge, sitzt da wie eine ausgestopfte Gans, während die Ladies sich über ihn lustig machen. Ich verzweifle allmählich, Nicholas, ich verzweifle wirklich.«
Renzi half Cecilia an einem gefährlichen Felsen vorbei. Sie sah ihn rasch dankbar an und senkte dann den Blick, ergriff aber seinen Arm fester.
»Miß Kydd ...«, begann Renzi mit belegter Stimme und hielt dann inne. War es anständig – war es ehrenhaft – sich ihrer Zuneigung zu versichern, wenn er sich über seine Gefühle für sie absolut selbst nicht im klaren war?
»Ja, Nicholas?« fragte sie und sah lächelnd zu ihm auf.
Er riß sich zusammen. »Ich habe ... deine Mutter hat mir anvertraut, daß du in deiner Stellung bei Lady Stanhope höchstes Vertrauen errungen hast.«
»Ich hatte großes Glück«, erwiderte sie ernst. Dann brach sich ein Lächeln Bahn. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele der hohen Herren des Landes ich gesehen habe. Lady Stanhope verlangt, daß ich sie zu allen großen Abendgesellschaften begleite, und das geschieht gewiß nur, um einen Ehemann für mich zu suchen.«
»Und ...«
»Sei kein Narr, Nicholas. Ich bin mir meines Glück in dieser Hinsicht gewiß bewußt, aber ich bin nicht bereit, das alles nur für die Langweiligkeit eines häuslichen Daseins aufzugeben.« Sie warf den Kopf auf, und ihre Augen funkelten. Nach wenigen weiteren Schritten drehte sie sich mit besorgter Miene zu Renzi um. »Thomas – er ...«
Er wußte, was sie bedrückte: Ihr Bruder würde sich zunächst lächerlich machen und später gemieden werden, wenn er sich in Gesellschaft nicht besser behauptete. »Die Zeit wird knapp, wie ich zugeben muß. Sollten wir nicht darauf drängen, daß er bald formeller auftritt?«
Cecilia biß sich auf die Lippen und traf dann eine Entscheidung. »Eine Abendgesellschaft! Nun, warte ... In Guildford haben wir natürlich die Wahl. Jede Gastgeberin würde sich darum reißen, zwei Helden von Camperdown zu bewirten, aber ich habe eher das Gefühl, daß Thomas sich dem Auge der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht allzu gerne stellen möchte.« Sie dachte einen Moment nach und sagte dann: »Ich weiß, ich werde mit Mrs. Crawford reden und sie darauf hinweisen, daß Thomas nach einer solch schrecklichen Schlacht an nichts mehr Gefallen hätte als an einer kleinen, vertrauten Zusammenkunft. Ich treffe sie am Donnerstag und werde dann mit ihr sprechen.«
»Großartig«, erwiderte Renzi. Das war in der Tat eine geeignete Gelegenheit für Kydd, um seine Schüchternheit in hochgestellter Gesellschaft zu überwinden. Er lächelte Cecilia anerkennend zu.
»Nicholas«, fuhr sie wie beiläufig fort, »ich habe noch etwas vergessen zu fragen. Es ist nur meine ungehörige Neugier, aber du hast nie deine Familie erwähnt.« Sie blieb stehen, um einen außergewöhnlich knorrigen, kleinen Baum zu betrachten.
»Meine Familie? Nun ... vielleicht sollte ich sagen, daß es sich einfach um eine alteingesessene Familie mit Landbesitz in Wiltshire handelt, die ich nicht so häufig besucht habe, wie ich es hätte tun können.«
Kydd saß regungslos am leeren Tisch und hörte zu, während Cecilia erklärte und warnte, wobei seine Miene verbiestert, aber beherrscht war.
»Nein, Thomas, so geht es einfach nicht. Wir treten nicht wie eine Herde Ziegen auf, die zur Fütterung kommt. Zunächst nehmen die Damen ihre Plätze ein, und zwar an einem Ende des Tisches. Nachdem sie Platz genommen haben, folgen die Gentlemen – aber, merk dir das, in strenger Ordnung, und bei Tisch werden sie in derselben Abfolge plaziert.« Cecilias Blick zuckte einmal zu Renzi und kehrte dann zu Kydd zurück.
Kydds Gesicht wurde starrer, aber er schwieg.
»Nun, Mrs. Crawford speist stets à la française, wie du weißt, Thomas, und gestattet eine freie Platzwahl, so daß ein Mann unter Umständen neben einer Dame sitzen kann, obwohl manche das für den englischen Geschmack zu gewagt finden, und dabei ...«
Renzis Mitgefühl war allzu offensichtlich. »Ich glaube eher, daß Tom ein Mann des Wagnisses und der Tat ist, meine Liebe. Diese Gezwungenheit muß für jemanden wie ihn eine unangenehme Tortur sein.«
»Dennoch wird er Umgangsformen brauchen, wo immer er sich auch aufhalten mag«, sagte Cecilia kühl. »Ein Gentleman vergißt sein gutes Benehmen nur wegen der Gefahren des Augenblicks nicht. Und nun paß bitte auf, Thomas.«
***
»Miß Cecilia Kydd, Mr. Thomas Kydd und Mr. Nicholas Renzi!« schmetterte der Lakai.
Das Geplauder erstarb. Es war allgemein bekannt, daß die beiden soeben eingetroffenen Gäste die legendäre Oktoberschlacht vor der holländischen Küste miterlebt hatten, und es hieß, sie hätten den heutigen Abend gewählt, um ihren Platz in der feinen Gesellschaft einzunehmen. Es gab viele seltsame Gerüchte über diese Offiziere, aber die Einzelheiten würden zweifellos vor Ablauf des Abends geklärt.
Eine Woge entschlossener Damen näherte sich, allen voran die Gastgeberin, und eifrige gegenseitige Vorstellungen erfolgten.
»Sehr erfreut«, sagte Mr. Kydd und verbeugte sich höflich, wenn auch recht eigenwillig vor der erfreuten Mrs. Crawford.
»Sagen Sie Bescheid, wenn es Sie zu sehr anstrengt«, sagte sie, während sie seine breiten Schultern betrachtete. »Sie werden feststellen, daß wir äußerstes Mitgefühl für Ihre Zeit der Prüfung hegen.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen, liebe Mrs. Crawford«, erwiderte der schmucke Seeoffizier würdevoll.
Sie wandte sich zögernd dem anderen Gentleman zu, einem empfindsam wirkenden, eher ernsten Mann, und begrüßte ihn pflichtgemäß zurückhaltend.
Dann ließen sich alle unter dem goldfarbenen Glanz von Kronleuchter und Kristall zum Essen nieder und zollten dem ersten Gang höflichen Beifall.
»Darf ich Ihnen ein Stück dieses prächtigen Spanferkels reichen, Miß Tuffs?« fragte Mr. Kydd höflich.
Die junge Lady zu seiner Linken, durch die Tatsache fast überwältigt, daß einer der Hauptgäste sie beachtete, konnte nur stotternd ihren Dank äußern und war dann etwas beunruhigt über die daraus resultierende Menge an gebratenem Spanferkel, die beinahe ihren gesamten Teller einnahm.
»Sir, dieses schmackhafte Wildbret erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Dürfte ich ...«, der rotgesichtige Gentleman zur Rechten durfte nicht abgewiesen werden und häufte eine zufriedenstellende Menge auf Mr. Kydds Teller.