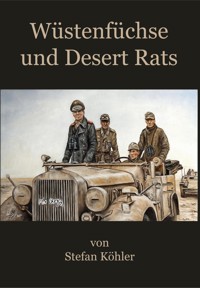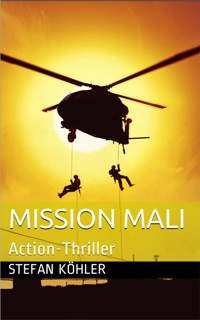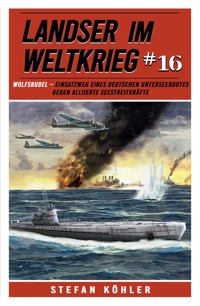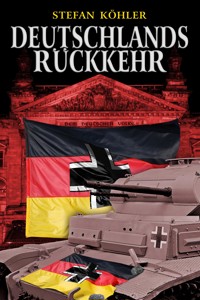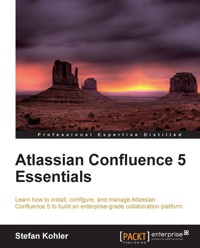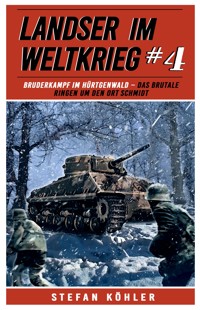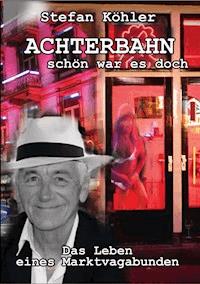7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach seinem Bestseller „Einsatzbericht – Im Fadenkreuz“ legt er erneut einen mitreißenden U-Boot-Roman vor, der den Krieg zur See in all seiner Grausamkeit darstellt.
Klappentext: Anfang 1942: Die deutsche U-Boot-Waffe befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, doch mit den USA hat ein neuer Kriegsgegner das Schlachtfeld betreten. In dieser Gemengelage erhält Kapitänleutnant Wegener, Kommandant von U 139, einen brisanten Auftrag: Zusammen mit drei weiteren U-Booten soll er in die Karibik aufbrechen, um dort die US-amerikanische Handelsschifffahrt zu stören. Doch bereits das Auslaufen aus dem Kriegshafen in Brest gereicht zum Ritt auf der Rasierklinge. Britische U-Jagd-Gruppen liegen auf der Lauer, allseits bereit, jedes deutsche U-Boot mit Wasserbomben auf den Grund des Atlantiks zu schicken. Der Durchbruch ins offene Meer gelingt Kaleu Wegener, aber er und seine Mannschaft stehen erst am Anfang einer lebensgefährlichen Reise.
Alliierte Kriegsschiffe und Flugzeuge sind dabei nicht die einzige Gefahr für die Besatzung von U 139. Einer der Neuzugänge der Mannschaft vergiftet zusehends die Atmosphäre an Bord. 7.000 Kilometer von der Heimat entfernt, fordert er Kaleu Wegener heraus, während sich die Alliierten längst an die Fersen von U 139 geheftet haben. Die folgenden Ereignisse fordern dem erfahrenen U-Boot-Kommandanten alles ab.
„Auf Feindfahrt mit U 139“ ist ein spannungsgeladener und erschütternder Roman, der den Krieg zur See auf realistische Weise nachzeichnet. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht vermochten die deutschen U-Boote jährlich mehr als 8 Millionen Bruttoregistertonnen Schiffsraum zu versenken. Den Preis dafür zahlten die deutschen U-Boot-Fahrer. Von der Propaganda gefeiert, kehrten viele von ihnen nicht von ihren gefahrvollen Feindfahrten zurück.
Detaillierte Illustrationen von Markus Preger unterstützen die Geschichte und liefern Ihnen ein realitätsnahes Bild von den Geschehnissen.
Welches Schicksal erwartet U 139?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefan Köhler
Auf Feindfahrt mit U 139
WELTKRIEGS-THRILLER ÜBER EIN DEUTSCHES U-BOOT IM EINSATZ
EK-2 Militär
Mit Illustrationen von Markus Preger
Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr!
Tragen Sie sich in den Newsletter von EK-2 Militär ein, um über aktuelle Angebote und Neuerscheinungen informiert zu werden und an exklusiven Leser-Aktionen teilzunehmen.
Link zum Newsletter:
https://ek2-publishing.aweb.page
Über unsere Homepage:
www.ek2-publishing.com
Klick auf Newsletter rechts oben
Via Google-Suche: EK-2 Verlag
Als besonderes Dankeschön erhalten Sie kostenlos das E-Book »Die Weltenkrieg Saga« von Tom Zola.
Klappentext: Der deutsche UN-Soldat Rick Marten kämpft in dieser rasant geschriebenen Fortsetzung zu H.G. Wells »Krieg der Welten« an vorderster Front gegen die Marsianer, als diese rund 120 Jahre nach ihrer gescheiterten Invasion erneut nach der Erde greifen.
Deutsche Panzertechnik trifft marsianischen Zorn in diesem fesselnden Action-Spektakel!
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Jill & Moni
von
EK-2 Publishing
Die Besatzungen der deutschen U-Boote kämpften in ihren engen Stahlröhren unter sehr primitiven und äußerst harten Bedingungen. Die Mehrzahl der deutschen U-Boot-Fahrer verlor dabei ihr Leben. Dieser Roman ist ihrem Andenken gewidmet.
»Das Einzige, das mich mit Sorge, Angst und Schrecken erfüllt, sind die deutschen U-Boote – und der Kampfgeist ihrer Besatzungen.«
Winston Churchill.
Vorwort
So, wie die Menschen schon in der Antike vom Fliegen träumten, sehnten sich Konstrukteure und Strategen danach, ein Schiff zu entwerfen, dass den Feind von unterhalb der Wasseroberfläche aus angreifen kann. Bereits in der Antike haben Römer, Griechen und Perser Taucher eingesetzt, die mit Tierhäuten als Luftspeicher ausgestattet waren. Im Jahre 460 v. Chr. soll der Grieche Scyllias mit Hilfe eines umgedrehten Kessels getaucht sein. All diese Ideen beflügelten die Fantasie der Menschen und sorgten dafür, dass die Technik stetig weiterentwickelt wurde.
Eine frühe technische Zeichnung für ein Tauchboot stammt von dem italienischen Arzt und Erfinder Guido da Vigevano, und datiert auf das 14. Jahrhundert. 1620 absolvierte das erste manövrierbare Unterwasserfahrzeug der Menschheitsgeschichte eine Fahrt durch die Themse – es handelte sich um ein mit Leder überzogenes Holzruderboot, erbaut vom niederländischen Erfinder Cornelius Jacobszoon Drebbel. 1776 konstruierte der Amerikaner David Bushnell die Turtle (Schildkröte), die als erstes richtiges U-Boot der Welt gilt. Hergestellt aus Eisen und Eichenholz, verfügte die Turtle über zwei Schrauben, die allerdings von Hand angetrieben werden mussten.
Robert Fulton aus den USA entwarf 1801 die Nautilus, einen an eine Zigarre erinnernden Entwurf, der ebenfalls mit Handkurbelantrieb ausgestattet war. Eine Neuerung waren allerdings die Ruder zur Tiefen- und Seitensteuerung sowie ein Druckluftsystem zur Atemluftversorgung der Besatzung.
Die Nautilus erregte sogar die Aufmerksamkeit Napoleons, war jedoch für militärische Einsätze zu langsam.
Erst mit dem Siegeszug der Elektrizität, speziell Batterien und Elektromotoren, wurde es technisch möglich, einen von Muskelkraft unabhängigen Antrieb für Unterwasserfahrzeuge zu entwickeln.
Der bayrische Artillerieoffizier Wilhelm Bauer ließ 1850 in Kiel das erste in Deutschland gebaute U-Boot zu Wasser, den Brandtaucher. Bei Fahrversuchen am 1. Februar 1851 kam es jedoch zu einem Unfall, und das Boot sank bis in eine Tiefe von sieben Meter. Die dreiköpfige Besatzung, darunter Wilhelm Bauer, wartete, bis der Innendruck im volllaufenden Boot mit dem Außendruck übereinstimmte, und erreichte so wieder die Oberfläche.
Während des amerikanischen Bürgerkrieges wurden mehrere U-Boote gebaut, unter anderem die H. L. Hunley (auch CSS Hunley), die am 17. Februar 1864 die USS Housatonic versenkte. Das U-Boot und seine achtköpfige Besatzung gingen dabei verloren, aber zum ersten Mal in der Geschichte hatte ein Tauchboot ein Überwasserschiff zerstört.
Der technische Fortschritt der nächsten Jahrzehnte und die damit einhergehende Industrialisierung brachten neue Herstellungsverfahren und wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch der Entwicklung von U-Booten zugutekamen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen sich die Seestreitkräfte der verschiedensten Nationen für die U-Bootwaffe zu interessieren. Die Hunley hatte schließlich bewiesen, dass Überwasserschiffe durch U-Boote versenkt werden konnten.
Dies geschah auch in Deutschland. 1897 baute Howaldt in Kiel das Versuchs-U-Boot, was sich jedoch als Fehlschlag erwies und 1902 verschrottet wurde. Doch dieser Versuch zeigte neue Wege auf und noch im gleichen Jahr wurde ein 200 Tonnen schweres Experimental-U-Boot namens Forelle konstruiert, welches sich als kriegstauglich erwies. Drei weitere Boote dieser Klasse wurden für Russland hergestellt, und nun wurde auch in Deutschland über den militärischen Einsatz von U-Booten nachgedacht. 1904 beauftrage das Reichsmarineamt den Marineingenieur Gustav Berling damit, ein U-Boot für den Seekrieg zu entwickeln. 1905 wurde dann mit dem Bau begonnen, und nach mehreren Testfahrten wurde schließlich am 14. Dezember 1906 das erste militärische U-Boot der Kaiserlichen Deutschen Marine, die U 1, in Dienst gestellt.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 erfolgte auch der erste große Kampfeinsatz der U-Boote. Diese griffen feindliche Handelsschiffe an, jedoch fast immer an der Oberfläche und mit der Bordkanone; getaucht wurde nur, um einer Verfolgung durch Feindkräfte zu entgehen. Größere Tauchtiefen waren deshalb nur von geringer Bedeutung. Zudem erfuhren die U-Boote innerhalb der Kaiserlichen Marine nur wenig Beachtung; die Admiralität zog die großen und eindrucksvollen Schlachtschiffe vor. Dies änderte sich erst am 22. September 1914, als es SM U 9 gelang, vor der niederländischen Küste einen Verband aus drei Panzerkreuzern, bestehend aus der HMS Aboukir, der HMS Cressy und der HMS Hoge, zu versenken. Dieser erstaunliche Erfolg machte die deutschen U-Boot-Fahrer praktisch über Nacht zu Helden und ermöglichte einen raschen Ausbau der U-Bootwaffe.
Doch auch die Erfolge der deutschen U-Boote konnte den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen – der Krieg endete am 11. November 1918 mit dem Waffenstillstand von Compiégne.
Das Kriegsende wirkte sich auf die Weiterentwicklung der U-Boote aus, denn aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrages waren den deutschen Streitkräften nun die Herstellung oder der Besitz von Unterseebooten untersagt. Das schloss ein generelles Verbot von Entwicklung und Export von Tauchbooten in andere Länder ein. Alle U-Boote der Kaiserlichen Marine mussten an die Siegermächte abgegeben oder verschrottet werden. Die Siegermächte ihrerseits sahen nach dem Krieg keine Notwendigkeit mehr für den Besitz einer offensiven U-Bootwaffe.
Bis 1918 war Deutschland in Sachen Konstruktion und Bau von Unterseebooten weltweit führend gewesen. Die Werften und auch die Marine waren also sehr interessiert daran, dieses gesammelte Wissen zu erhalten. Bereits zu Beginn der 1920er-Jahre initiierte Deutschland streng geheime Projekte mit Argentinien, Italien und Schweden zum Bau von U-Booten, die aber alle nicht zur Ausführung gelangten. Einige Jahre später konnten dann endlich Verträge mit den Niederlanden und Finnland zur Herstellung von einigen U-Booten abgeschlossen werden.
Ende 1932 begann die Reichsmarine schließlich mit den Planungen für den Aufbau moderner Seestreitkräfte, die eine schlagkräftige U-Bootwaffe beinhalteten. Diese Pläne wurden mehrfach angepasst und wieder verworfen. Nachdem Adolf Hitler an die Macht gelangt war, befahl er, die Pläne umzusetzen, allerdings in einem legalen Rahmen: dem deutsch-britischen Flottenabkommen vom 18. Juni 1935. Die Reichsmarine wurde in Kriegsmarine umbenannt und der Aufbau der neuen Flotte begann.
Bei Kriegsausbruch im September 1939 standen Deutschland nur 57 U-Boote zur Verfügung, von denen 39 im Atlantik eingesetzt werden konnten. Etwa 20 Boote fuhren Einsätze, ein weiteres Drittel befand sich zur Überholung oder Neuausrüstung in den Werften, der Rest im An- oder Abmarsch zum Einsatzgebiet. Diese Faustregel, dass sich nur ein knappes Drittel der verfügbaren Kräfte im Einsatz befindet, hat übrigens auch heute noch Bestand. Die Bundeswehr kann demnach rund ein Drittel U-Boot in den Einsatz entsenden. Kleiner Scherz.
Im weiteren Verlauf des Krieges konnte die Produktion von U-Booten in den Werften erheblich gesteigert werden, und immer neue Einheiten erreichten die Seekriegsgebiete.
Nach dem erfolgreichen Westfeldzug begann das Deutsche Reich 1940 damit, an der Küste der Biskaya weitere Stützpunkte für die »Grauen Wölfe« zu errichten. In Brest, Lorient, St-Nazaire und La Rochelle entstanden – mit Hilfe von Zwangsarbeitern – die berühmt-berüchtigten U-Bootbunker. Von dort liefen die Boote aus, um Jagd auf alliierte Schiffe zu machen. Und der U-Bootkrieg würgte Großbritanniens Lebensadern zu seinen Kolonien auch fast gänzlich ab. Von Kriegsbeginn an bis Ende des Jahres 1941 schickten die »Grauen Wölfe« 13,7 Millionen Tonnen Schiffsraum auf den Meeresgrund. 13,7 Millionen Tonnen, das entsprach der Hälfte der britischen Handelsflotte! Und nur zehn Prozent dieser Verluste ließen sich durch Neubauten ersetzen. Großbritannien befand sich in einer ernsten Krise. Jeder auf der Insel lebender Brite konnte sich glücklich schätzen, wenn er sonntags sein Frühstücksei auf den Tisch bekam, denn wie alles andere waren auch Eier streng rationiert.
Doch dann änderte sich die Lage. Vier Tage nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, am 11. Dezember 1941, erklärte Hitler den Vereinigten Staaten den Krieg. Bisher war der Kampf zwischen der US Navy und den »Grauen Wölfen« im Stillen erfolgt; US-amerikanische Kriegsschiffe eskortierten alliierte Konvois bis Island, ohne dass die deutschen U-Boote die Erlaubnis erhielten, jene US-Schiffe anzugreifen. Dennoch kam es in dieser frühen Phase der Atlantik-Schlacht immer wieder zu Kampfhandlungen, die von beiden Seiten zumeist unter den Teppich gekehrt wurden. Nach der Kriegserklärung fiel diese Zurückhaltung jedoch weg.
Admiral Karl Dönitz, der Befehlshaber der deutschen U-Boote (BdU), sah seine Chance gekommen: mit nur sechs Booten startete er das Unternehmen »Paukenschlag«, die erste Angriffswelle gegen die Handelsschifffahrt an der US-Ostküste. Die Boote benötigten zwei Wochen, um ihr Einsatzgebiet zu erreichen, und begannen am 14. Januar 1942 ihre Angriffe. Als sie sich am 6. Februar wieder zurückzogen, hatten sie 23 Schiffe mit zusammengezählt 150.505 BRT vernichtet. Das Oberkommando wollte diesen großen Anfangserfolg natürlich ausnutzen und, wenn möglich, wiederholen …
Anfang März 1942
Kriegshafen Brest, besetzter Teil Frankreichs
Kapitänleutnant Hans-Jörg Wegener blies die Wangen auf. »Da hat sich der Flottillenchef aber äußerst fein niedergelassen.«
»Würde ich auch sagen, Herr Kaleu«, stimmte ihm Oberleutnant Wolfgang Engelmann zu. Der IWO und sein Kommandant waren zum Chef der Flottille befohlen worden, der mit seinem Stab eine edel eingerichtete Villa oberhalb des Hafens bezogen hatte. Sollte die luxuriöse Einrichtung der Villa ihre Besucher beeindrucken, so verfehlte sie ihre Wirkung bei den U-Bootleuten. Die empfanden diese pompöse Zurschaustellung von Luxus nach einer sechs Wochen dauernden Fahrt in ihrer engen Eisenröhre, umgeben vom penetranten Dieselgeruch und den Ausdünstungen der Männer, und auf Schritt und Tritt verfolgt vom lauernden Tod, geradezu als obszön.
»Leben wie Gott in Frankreich, IWO«, sagte der Kaleu mit leichter Verbitterung. »Die scheinen das hier wahrlich als Lebensmaxime verinnerlicht zu haben.«
»Ist ja auch nicht weiter schwer, wenn man wie der Flottillenchef sicher auf einem Druckposten an Land sitzt«, hieb Engelmann prompt in die gleiche Kerbe. »Wir in unserer Stahlröhre hingegen…«
»Psst!«, unterbrach Wegener seinen Ersten Wachoffizier, denn eine Ordonnanz in weißer Jacke näherte sich den beiden Offizieren.
»Guten Morgen, die Herren. Wenn der Herr Kaleu und der Herr Oberleutnant bitte ihre Mäntel hier ablegen möchten«, sagte die Ordonnanz ihr Sprüchlein auf, was in den Ohren der U-Bootfahrer reichlich gestelzt klang.
Engelmann runzelte die Stirn, doch Wegener zuckte nur mit den Schultern und legte Mantel und Mütze ab. An seinem Hals wurde das Ritterkreuz sichtbar und auf seiner Uniformjacke hingen neben dem U-Bootkriegsabzeichen auch das EK I und das EK II. Sein IWO war bis auf das Ritterkreuz mit den gleichen Orden und Ehrenzeichen behangen.
Die Ordonnanz schien von den Auszeichnungen nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Sie reichte die Mäntel und Mützen an ein wie durch Zauberhand erschienenes Hausmädchen im schwarzen Kleid mit weißer Schürze weiter und deutete dann auf die breite Treppe. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen, meine Herren.«
Die Ordonnanz stieg die Treppe hinauf, die beiden Offiziere trotteten ihm folgsam hinterher.
»Möchte mal wissen, wo die vom Stab dieses Hausmädchen aufgetan haben«, raunte Engelmann seinem Kommandanten ins Ohr. »Die war nicht nur bildhübsch, die hatte auch ordentlich Holz vor der Hütte.«
Wegener hätte um ein Haar laut aufgelacht. »Selbstbeherrschung, IWO«, flüsterte er dann ebenso leise zurück. »Selbstbeherrschung.«
Engelmann grinste nur schalkhaft und hob bedauernd die Schultern an.
Als sie den oberen Absatz der Treppe erreicht hatten, streifte der Blick des Kommandanten einige Ölgemälde. Von Kunst verstand Wegener nicht viel, aber ihm war klar, dass diese Gemälde sehr alt und wertvoll sein mussten. Einige Statuen und Marmorsäulen rundeten das noble Ambiente ab.
Die Ordonnanz führte sie zu einer großen Doppeltür, klopfte an und öffnete. »Kapitänleutnant Wegener und Oberleutnant Engelmann«, kündigte sie an.
Als Wegener und Engelmann den Raum betraten, erwartete sie eine kleine Überraschung, denn neben dem Chef der Flottille, Korvettenkapitän Werner Busch, und seinem Adjutanten, Oberleutnant Armin Herzfeldt, waren noch sechs weitere Offiziere anwesend. Oberleutnant Günther Kreienbaum und sein IWO, Leutnant Klaus Fuhrmann, von U 136, Oberleutnant Thomas Petersen, der Kommandant von U 142, und dessen Erster Wachoffizier, Leutnant Wilhelm Kesselbach sowie Oberleutnant Alexander Hoth und Leutnant Frank Linkmann von U 147. Wegener kannte die anderen Kommandanten, zwei waren in seiner Kadettenklasse gewesen und alle waren mehr oder weniger eng miteinander befreundet.
»Ah, da sind Sie ja, meine Herren«, begrüßte sie Korvettenkapitän Busch, als sich der Kreis der Offiziere um ihn ein wenig gelichtet hatte. Der Flottillenchef löste sich aus der Gruppe, um Wegener und Engelmann per Handschlag zu begrüßen. »Die wievielte Feindfahrt war das jetzt bei Ihnen auf U 139 noch gleich, Herr Wegener?«
»Die fünfte, Herr Korvettenkapitän«, antwortete Wegener.
»Beeindruckend. Nun, da wir jetzt vollzählig sind, nehmen Sie doch bitte Platz.« Busch wies auf den großen Konferenztisch, auf dem bereits mehrere Kaffeekannen und Tassen bereitstanden. Der Kartenständer neben dem Tisch war noch abgedeckt und am Kopfende lagen mehrere dünne Kladden.
»Scheint ja ´ne große Nummer zu sein, die der Chef mit uns geplant hat«, meinte Engelmann, als er neben seinem Kommandanten Platz nahm.
»Wir werden es wohl gleich erfahren, IWO.«
Korvettenkapitän Busch lächelte die versammelten Offiziere an. »Wie Sie vermutlich bereits erraten haben, steht eine größere Operation an. Zunächst jedoch möchte ich ein wenig ausholen.« Er zog seine Papiere zurate. »Ich darf annehmen, dass Sie alle mit dem Wehrmachtsbericht für den Januar vertraut sind. 106 alliierte Schiffe mit 419.907 Bruttoregistertonnen wurden von unseren U-Booten versenkt, davon allein 23 Schiffe mit 150.505 BRT während der Operation ›Paukenschlag‹ gegen die US-amerikanische Ostküste.«
Busch machte eine kleine Kunstpause, um diese Worte wirken zu lassen. »Das Oberkommando möchte an diesen Erfolg anknüpfen und deshalb erneut U-Boote an die US-Küste entsenden. Sie, meine Herren, zählen zu unseren erfahrensten Offizieren, und sind Teil dieses Auftrags.«
Der Flottillenchef gab dem wartenden Maat ein Handzeichen, der daraufhin das Tuch von der Karte entfernte. Zu sehen war die gesamte Ostküste des nordamerikanischen Kontinents von Nova Scotia bis Florida; ein vergrößerter Ausschnitt auf der rechten Seite zeigte die Karibik von der Südspitze Floridas bis Venezuela.
»Wie Sie unschwer erkennen können, ist ihr potenzielles Einsatzgebiet viel zu groß, um es mit nur vier Typ IX-Booten abzudecken«, nahm Busch den Faden wieder auf. »Unsere Operation wird sich deshalb in mehrere Teile aufsplitten. Herr Herzfeld, übernehmen Sie bitte.«
Oberleutnant Herzfeld erhob sich und trat vor den Kartenständer. Er benutzte ein Holzlineal als Zeigestock und ließ es von Florida aus nach Süden gleiten. »Die militärische Situation hat sich unseren Informationen zufolge seit Januar nicht grundlegend verändert. Unsere Boote haben zu diesem Zeitpunkt nur Einzelfahrer angetroffen, jedoch keine gesicherten Geleitzüge. Soweit wir wissen, gibt es drei Hauptschifffahrtsrouten. Die östliche Route verläuft von der Mündung des Orinoko an der Küste Venezuelas ausgehend östlich um Barbados herum, bevor sie auf die US-Küste trifft. Die beiden anderen Routen liegen weiter westlich. Schiffe, die von Maracaibo her auslaufen, nehmen meist die westliche Route, die zwischen Kuba und Haiti vorbeiführt; die andere, von Caracas ausgehend, verläuft zwischen Haiti und Puerto Rico, ehe sie sich wieder der US-Küste zuwendet. Vor einigen Wochen war es noch so, dass die Schiffe aller Routen die Inselgruppe der Bahamas östlich passiert haben, aber das kann sich inzwischen geändert haben. Zudem ist nach der Operation ›Paukenschlag‹ davon auszugehen, dass die Amerikaner und Briten ihre Präsenz in der Karibik erheblich verstärkt haben. Rechnen Sie also mit der Anwesenheit von U-Boot-Jägern und Aufklärungsflugzeugen in diesem Gebiet.«
Herzfeld sah den Flottillenchef an. »Möchten Sie den nächsten Teil wieder übernehmen, Herr Korvettenkapitän?«
»Ja. Ich danke Ihnen, Herr Herzfeld.« Busch öffnete die vor ihm liegende Kladde. »Sowohl die Briten als auch die Amerikaner sind sich der Wichtigkeit dieses Gebiets bewusst und bauen deshalb ihre Stützpunkte in der Karibik weiter aus. Nach den uns vorliegenden Informationen schließt das die Errichtung von sogenannten Radarstationen ein, wie die Alliierten die eigenen Funkmessgeräte nennen. Ihr Part bei dieser Operation wird es sein, den alliierten Nachschub zu stören und so viel Schaden wie möglich anzurichten. Herr Herzfeld, verteilen Sie doch bitte die Papiere.«
Während Oberleutnant Herzfeld damit begann, die Kladden an die Offiziere auszugeben, fuhr Busch fort: »Herr Wegener wird als ranghöchster Offizier den gesamten Einsatz leiten, meine Herren. Sie kennen einander ja schon und deshalb wird es in dieser Hinsicht ja wohl keine Probleme geben. Oder, meine Herren?«
»Natürlich nicht, Herr Korvettenkapitän«, sagte Oberleutnant Kreienbaum stellvertretend für alle. »Wir haben schon mehrere Einsätze zusammen durchgeführt.«
Wegener nickte dem Kommandanten von U 136 zu. »Danke für Ihr Vertrauen, Herr Kreienbaum.«
Busch lächelte hintergründig. »Ach, wenn doch nur alle Besprechungen so harmonisch verliefen.«
Leises Gelächter hallte durch den Raum, während der Flottillenchef feixte. »Lachen Sie nicht, meine Herren! Lachen Sie nicht! Sie machen sich ja kein Bild davon, wie es manchmal hier bei uns im Stab zugeht, wenn ich es mit dem Leiter der Werft oder dem Nachschuboffizier zu tun bekomme.«
Dann wurde das Gesicht des Korvettenkapitäns wieder ernst. »In den vor Ihnen liegenden Ordnern finden Sie alle weiteren Informationen, die unser B-Dienst über alliierte Flottenbewegungen vor der französischen Küste, im Atlantik und in der Karibik zusammentragen konnte. Dies ist aber nur der vorläufige Entwurf der Operation. Ich wollte zuerst mit Ihnen darüber sprechen, meine Herren, und mir anhören, was Sie dazu beizutragen haben.«
Mit dieser einfachen Geste hatte der Flottillenchef bei seinen Offizieren sofort ein Stein im Brett und auch Wegener und Engelmann vergaßen ihren anfänglichen Unmut ob des zur Schau gestellten Prunks der Luxusvilla. Buschs Vorstoß sprach nicht nur für den Zusammenhalt der Flottille, sondern zeugte auch von Menschenführung. Der Flottillenchef wusste, dass in den schriftlichen Berichten nicht immer alle notwendigen Informationen enthalten waren, und verließ sich bei der Planung im hohen Maße auf die praktischen Erfahrungen seiner Offiziere.
Zudem war der vorbereitete Entwurf derart gestaltet, dass nur noch die Koordination zwischen den vier beteiligten U-Booten zu regeln blieb. Der kniffligste Teil des gesamten Unternehmens war jedoch vorerst das Auslaufen aus Brest.
»Ein großer Vorteil für uns ist, dass wir dem alliierten Radar nicht mehr wehrlos ausgeliefert sind«, sagte Oberleutnant Petersen, der Kommandant von U 142. »Unser Funkmessbeobachtungsgerät zeigt uns sofort an, ob und aus welcher Richtung wir geortet worden sind. Diesen Vorteil sollten wir beim Auslaufen nutzen.«
»Sehe ich genauso. Laut B-Dienst liegen jede Nacht vor der Küste der Bretagne mindestens drei, wahrscheinlich sogar sechs U-Jäger und lauern auf unsere Boote, die den Hafen verlassen oder anlaufen wollen«, sagte Hoth von U 147. »Vier unserer Boote gegen zwei Gruppen aus je drei Fregatten oder Korvetten der Tommys, das klingt doch gar nicht schlecht.«
»Sollte es dennoch knapp werden, legen wir ihnen einen Bold vor die Nase und verschwinden«, führte Oberleutnant Petersen weiter aus. »Wenn sie einen von uns trotzdem an den Kanthaken nehmen sollten, dann muss eben einer der anderen den Tommys einen Aal auf den Pelz brennen.«
»Wir werden Ihr Auslaufen wie üblich mit den Küstenbatterien abstimmen, damit die Ihnen, falls nötig, Feuerschutz geben können.« Oberleutnant Herzfeld tippte mit dem Finger auf die vor ihm liegende Seekarte der Biskaya. »Solange Sie sich in Reichweite der Küstenbatterien befinden, ist ein Angriff eher unwahrscheinlich, aber danach dürfte es spannend werden.«
»Ich nehme doch stark an, dass Sie angesichts der herrschenden Lage auf die große Verabschiedung verzichten möchten, meine Herren?«, sagte Busch.
»Natürlich, Herr Korvettenkapitän«, gab Wegener sofort zurück.
»Gut, dann wäre auch das geregelt.« Busch sah in die Runde. »Gibt es sonst noch etwas, dass ich für Sie tun kann, meine Herren?«
»Übernahme von Treibstoff und Munition?«, fragte Kreienbaum nach.
»Erfolgt wie üblich im Arsenal«, antwortete Herzfeld wie aus der Pistole geschossen. »Sie werden mit dem Treibstoff ein wenig haushalten müssen, aber auf dem Rückmarsch vom Operationsgebiet werden Sie auf hoher See betankt.«
»Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen.« Kreienbaum schien zufrieden zu sein.
»Wir benötigen noch einen Ersatzmann für unseren IIWO«, warf Wegener ein. »Leutnant Schneider liegt mit einem Blinddarmdurchbruch im Lazarett und fällt vorerst aus.«
»Hmm, ja«, brummte Busch nachdenklich. »Einen Ersatzmann für Ihren Leutnant Rolf Schneider. Wir sind zwar ein wenig knapp an Leuten, aber ich denke, da haben wir doch jemanden für Sie. Herr Herzfeld?«
Der Oberleutnant zog sein Notizbuch hinzu. »Leutnant Siegfried Pauli wäre verfügbar. Er hat drei Feindfahrten auf U 69 hinter sich und wegen eines Luftangriffs in der Heimat den Abfahrtstermin seines Bootes verpasst. Seine Beurteilungen sind gut.«
Wegener und Engelmann wechselten einen kurzen Blick. »Versuchen wir´s mit Herrn Pauli.«
»Sehr schön, meine Herren. Wenn sonst nichts mehr anliegt, kehren Sie an Bord ihrer Boote zurück und bereiten alles vor. Morgen erfolgt noch eine kurze Besprechung und am Abend können Sie dann mit der Flut auslaufen. Ich danke ihnen.«
*
Wegener, Engelmann und die anderen Offiziere wurden verabschiedet und holten ihre Mützen und Mäntel, bevor sie zum Hafenbecken schlenderten.
»Hans!«, rief Hoth und der Kommandant von U 139 drehte sich um.
»Was gibt´s denn, Alex?«
Hoth und Linkmann schlossen zu Wegener und Engelmann auf.
»Ich wollte dir nur eine freundschaftliche Warnung zukommen lassen.« Der Kommandant deutete auf seinen IWO. »Lindemann hatte schon mit Pauli zu tun und …«
Was auch immer Hoth noch sagen wollte, es ging im Heulen der Luftschutzsirene unter.
»Fliegeralarm!«, brüllte Kreienbaum. »Wir müssen in die Bunker!«
Die Männer nahmen die Beine in die Hand und rannten auf den nächstgelegenen Luftschutzbunker zu. Aber sie waren zu langsam; tief über die graue See hinweg, rasten Flugzeuge heran. Zuerst die kleineren Jagdflugzeuge, dahinter die größeren Bomber. Die Jäger nahmen sofort die Küstenstellungen unter Beschuss, während die leichte Flak der Deutschen ihr stakkatoartiges Feuer eröffnete.
»Die wollen die Flak niederhalten, damit die Bomber freie Bahn haben!«, schrie Petersen über das Dröhnen der Triebwerke und das Hämmern der Flugabwehrgeschütze hinweg. »Oh, verdammt! Der hat´s auf uns abgesehen! Volle Deckung!«
Die Männer warfen sich aufs Pflaster.
Ein Hagel aus MG-Geschossen hämmerte hernieder, riss Löcher in den Boden und ließ einen Regen von Stein- und Metallsplittern nach allen Seiten fetzen. Dann heulte die feindliche Maschine über sie hinweg.
Wegener hob automatisch den Kopf und nahm die britische Kokarde unter den Flügeln des Jägers wahr, den er als Hurricane erkannte. Über dem Hafenbecken standen die Sprengwölkchen der Flak in der Luft und versuchten, den Wellington-Bombern den Weg zu verlegen. Doch die Tommys ließen sich davon nicht beirren und klinkten ihre Bomben aus.
»In den Hauseingang! Los doch!«, trieb Engelmann seinen Kommandanten an, ergriff ihn am Arm und zerrte ihn auf die Füße. Zusammen drängten sich die Männer in den Eingang des Hauses, als auch schon die Bomben unten am Hafen explodierten. Der Boden schien unter ihren Füßen ins Wanken geraten zu sein, Mörtel und Staub zogen durch die Luft. Die Fenster im Stockwerk über ihnen gingen zu Bruch und Glassplitter fielen zu ihren Füßen auf den Boden und zerplatzten in tausend Bruchstücke.
»Danke, IWO«, sagte Wegener zu Engelmann. »Das war knapp.«
»Gern geschehen«, grinste der Oberleutnant. »Sie hätten das Gleiche für mich getan.«
Eine Wellington zog über das Hafengebiet hinweg. Der Bordschütze im Bug bestrich die ganze Umgebung mit Feuer aus seinen Maschinengewehren, um die Flak niederzuhalten. Faustgroße Löcher erschienen im Putz des Hauses, in dessen Eingang die Offiziere Schutz gesucht hatten.
Engelmanns Gesicht verschwand in einer Blutwolke, die Wegener über und über besudelte, und der Getroffene brach zusammen. Der ganze Kopf war von einem Geschoss zerschmettert worden, graue Hirnmasse ergoss sich aus dem aufgebrochenen Schädel auf das Pflaster.
Wegener war der Tod nicht fremd, aber als ihm bewusst wurde, dass ihm Blut und Hirn seines IWO im Gesicht klebten, revoltierte sein Magen und er musste sich übergeben.
»Gottverdammt!«, fluchte Hoth. »Hans! Bist du in Ordnung? Bist du getroffen?« Der Kommandant von U 147 wischte Wegener mit einem Taschentuch über die Augen. »Hans? Kannst du mich hören?«
»Ich höre dich, Alex«, krächzte Wegener. Er wollte immer noch nicht glauben, dass Engelmann tot vor ihm lag.
Die Detonationswellen weiterer Bombenexplosionen warfen sie zu Boden. Dichter Staub brachte die Männer zum Husten. Benommen kauerten sie auf dem Pflaster. Dann verschwand das Dröhnen der Flugzeugtriebwerke allmählich und auch das Hämmern der Flak verstummte.
Die Offiziere erhoben sich steif.
»Grundgütiger Gott!«, entfuhr es Kreienbaum. »Das sieht ja aus, als ob die halbe Stadt in Flammen steht!«
Dichter, schwarzer Rauch hing über Brest. Zahlreiche Häuser brannten hell, und aus geborstenen Gasleitungen stiegen grelle Flammenzungen in den Himmel. Einige Franzosen torkelten orientierungslos wie Betrunkene durch die Straßen, während andere versuchten, die sich rasch ausbreitenden Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehr und die Garnisonstruppen beteiligten sich nach und nach bei den Rettungsarbeiten.
Im Wasser des Hafenbeckens trieben die Trümmer einer abgeschossenen Wellington. Die Briten hatten zwar große Schäden an der Stadt angerichtet, die Kaianlagen jedoch zum größten Teil verfehlt. Eine Wasserleitung war zerbombt worden und ließ eine Springflut auf dem Kai entstehen, aber das Arsenal und die Bunker waren intakt geblieben.
*
Am nächsten Morgen trieben immer noch dichte Rauchwolken durch Brest, einige der brennenden Gebäude hatte man noch nicht löschen können, andere glommen weiter vor sich hin.
»Tut mir sehr leid um Oberleutnant Engelmann«, sagte Korvettenkapitän Busch bedauernd. »Er war ein guter Mann.«
»Er war der beste IWO, den man sich wünschen konnte«, stieß Wegener erbittert hervor. »Er war längst reif für sein eigenes Kommando. Nach dieser Fahrt wollte ich Ihnen eine entsprechende Empfehlung für Engelmann zukommen lassen.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen im Büro des Flottillenchefs, dann war das leise Räuspern von Oberleutnant Herzfeld zu vernehmen. »Wir sind uns alle der schwierigen Situation bewusst, in der Sie sich befinden, Herr Kaleu, aber Ihr Auftrag… Sie verstehen sicher.«
Wegener wollte den Adjutanten im ersten Augenblick wütend anblaffen, doch dann war sein Zorn von einer Sekunde zur nächsten verschwunden. Der Mann machte schließlich nur seine Arbeit.
»Ja. Ja, ich verstehe schon.«
Der Kommandant rieb sich über sein Gesicht. Obwohl er Blut und Hirnmasse längst abgewaschen hatte, glaubte er immer noch etwas auf seiner Haut zu spüren. »Ich nehme nicht an, dass Sie irgendwo noch einen IWO gebunkert haben?«
»Bedauerlicherweise ist kein weiteres Personal verfügbar«, sagte Herzfeld, sichtbar erleichtert darüber, dass Wegener Verständnis zeigte. »Aber Leutnant Pauli könnte als ihr IWO einsteigen.«
»Und wen nehme ich dann als IIWO?«, wollte Wegener wissen.
»Da könnte ich dir vielleicht aushelfen«, meldete sich Kreienbaum zu Wort. »Ich habe da einen wirklich hellen Fähnrich an Bord, der zwei Fahrten als Wachoffiziersschüler mit uns absolviert hat. Er ist sozusagen als dritter Wachoffizier mitgefahren, und hat sich als eine echte Bereicherung für die Mannschaft erwiesen. Der Bootsmann und die Unteroffiziere mussten ihm zwar noch ein wenig zur Hand gehen, aber sonst habe ich keinerlei Bedenken. Ich habe ihn für das EK I empfohlen, nachdem er einen Briten abgeschossen hat, der uns am Ende unserer letzten Fahrt auf die Hörner nehmen wollte. Wenn du es mit ihm versuchen willst, kannst du ihn haben.«
Wegener nickte ihm zu. »Danke. Ich will es versuchen.«
Busch schien ebenfalls von der Lösung angetan. »Gut. Ich bedaure wirklich, Herr Wegener, aber leider bleibt uns keine Zeit, eine bessere Lösung zu finden. In sieben Stunden kentert die Flut und Sie müssen auslaufen.«
»Ich verstehe, Herr Korvettenkapitän.«
Der einzige Lichtblick für den Kommandanten war die eingespielte Mannschaft von U 139. Wegener ging sofort in seine Kammer, legte die Bordbekleidung an und suchte dann die Offiziersmesse auf. Dort wurde er schon erwartet.
Oberbootsmann Horst Brandes legte seinem Kommandanten die nötigen Unterlagen vor. »Die Übernahme mit Lebensmitteln und Munition ist bereits abgeschlossen, Herr Kaleu.«
»Danke, Brandes. Was ist mit dem Treibstoff und dem Wasser?«
Leutnant Reinhold Stollenberg, der LI, konnte auf seine Notizen verzichten. »Alle Tanks sind bis zum Anschlag gefüllt, Herr Kaleu. Wir sind frontklar.«
Der Bootsmann und der Leitende Ingenieur hatten dafür gesorgt, dass die Übernahme von Treibstoff, Wasser, Lebensmitteln für sechs Wochen und Munition in den U-Bootbunker reibungslos verlaufen war. Wie gesagt, Wegener verfügte über eine eingespielte Mannschaft.
»Danke, meine Herren. Und unsere Ersatzleute?«
»Leutnant Pauli soll jeden Moment eintreffen, und der Fähnrich, den uns Oberleutnant Kreienbaum überlassen hat, ist bereits auf dem Weg«, berichtete Brandes.
Wegener richtete den Blick auf seinen LI. »Sie haben doch stets so gute Quellen, Herr Stollenberg. Haben Sie irgendetwas über unsere neuen Offiziere in Erfahrung bringen können?«
Die Wangen des LI röteten sich leicht. »Gute Quellen, Herr Kaleu? Nun, ich kenne da in der Tat einige Marinehelferinnen beim Stab, aber das will ja nichts heißen, oder?«
Brandes schmunzelte. Der LI war dem ganzen Boot als Casanova bekannt, der nun wirklich nichts anbrennen ließ.
»Haben Sie oder haben Sie nicht?«, bohrte der Kommandant nach.
Das Eintreffen eines Läufers bewahrte den LI vor einer peinlichen Antwort. »Verzeihung, Herr Kaleu. Unsere Ersatzleute sind eingetroffen.«
»Wie gerufen. Schicken Sie sie gleich zu uns in die Messe. Da können wir ihnen umgehend etwas auf den Zahn fühlen.«
»Jawohl, Herr Kaleu.«
Wegener widmete sich wieder den Unterlagen und sah erst auf, als es am Schott neben der O-Messe klopfte.
»Leutnant zur See Siegfried Pauli, als IWO zur besonderen Verwendung auf U 139 kommandiert, meldet sich wie befohlen an Bord, Herr Kaleu«, schnarrte der dunkelhaarige Offizier, der vor Wegener stand. Er schien fast einen Kopf kleiner zu sein als der Kommandant. Nun klappte Pauli die Hacken zusammen und grüßte zackig.
Sowohl Wegener als auch Stollenberg und Brandes sahen sich mit leichter Verwunderung an. Auf U 139 legte man gewiss keinen großen Wert auf übertriebene militärische Umgangsformen, aber ihr neuer IWO meldete sich hier zum Dienst wie ein kleiner Seekadett. Im Gegensatz zu allen anderen Anwesenden trug er eine blaue Marineuniform, auf dem sich neben dem U-Bootkriegsabzeichen auch noch das goldene Mitglieds- und das ebenfalls goldene Leistungsabzeichen der Hitlerjugend befanden.
Ach du lieber Himmel, fuhr es Wegener durch den Kopf. Ein ehemaliger HJ-Führer, der meint, seine HJ-Auszeichnungen zur Schau stellen zu müssen! Hoffentlich war das nicht auch einer von diesen Hundertprozentigen, denn dann konnte es noch eine heitere Reise werden.
»Ähm, willkommen an Bord von U 139, Herr Pauli.« Wegener reichte dem Leutnant die Hand und war schier erschrocken über den schlaffen Händedruck. Es fühlte sich an, als hätte Pauli ihm einen toten Hering in die Hand gelegt.
»Danke, Herr Kaleu«, schnarrte Pauli wieder. »Sie können voll und ganz auf mich zählen.«
»Na, dann bin ich ja beruhigt«, konnte sich Stollenberg einen Kommentar nicht verkneifen.
»Wie meinen?«, fragte Pauli und wandte sich dem LI zu.
»Ich sagte: Willkommen an Bord.«
»Danke, Leutnant.«
Wegener sah den zweiten Mann an, der ruhig neben Pauli stand und das Spektakel mit einem leicht amüsierten Zug um die Lippen verfolgt hatte.
»Fähnrich zur See Joachim Dahlen, von U 136 an Bord von U 139 kommandiert, Herr Kaleu«, stellte er sich vor und grüßte lässig. Der Fähnrich trug sein Lederpäckchen und die Schirmmütze. Zudem wirkte er, als wäre er einem Rekrutierungsplakat der Waffen-SS entsprungen: groß, blond, muskulös, mit blauen Augen, welche die Anwesenden aufmerksam musterten.
»Auch für Sie gilt: Willkommen an Bord.«
»Danke, Herr Kaleu.« Dahlens Händedruck war kräftig, und er sah seinem neuen Kommandanten dabei prüfend in die Augen. »Oberleutnant Kreienbaum hat mir viel über Sie erzählt. Ich hoffe, ich werde Ihren Anforderungen gerecht.«
»Da bin ich sicher, Fähnrich.« Das stimmte sogar. Kreienbaum war ein gnadenloser Ausbilder, der seine Leute schliff, bis sie kaum noch kriechen konnten, aber er erzielte damit auch hervorragende Ergebnisse.
»Nehmen Sie doch Platz. Sie werden noch Gelegenheit haben, sich mit U 139 vertraut zu machen, aber zunächst möchten wir gerne wissen, welche Funktionen Sie bisher ausüben durften. Herr Pauli, ich sehe, Sie tragen das U-Bootkriegsabzeichen. Das verrät, dass Sie bereits Fronterfahrung gesammelt haben.«
»Jawohl, Herr Kaleu.« Das Schnarren schien ein fester Bestandteil von Paulis Stimme zu sein, denn er behielt es konsequent bei. Er hockte sich nun ganz steif auf seinen Platz. »Das ist zutreffend. Ich bin als IIWO an Bord von U 69 gefahren; die Aufgaben eines Wachoffiziers sind mir also bestens vertraut.«
Wegener, der LI und der Bootsmann horchten auf.
»U 69 ist doch aber ein VII C-Boot, oder?«, hakte Stollenberg nach. »Haben Sie denn gar keine Erfahrung mit unseren IX B-Booten?«
»Meine Erfahrung ist mehr als ausreichend, um meinen Pflichten wie gewünscht nachzukommen«, versetzte Pauli und musterte die kahle Jacke von Fähnrich Dahlen abschätzend. »Ich denke, andere Personen geben da wohl mehr Anlass zur Sorge.«
Das klang nicht nur arrogant, sondern sträflich dumm für Wegener. Vielleicht nahm der Kaleu das aber auch nur so wahr, weil er wegen der HJ-Auszeichnungen etwas voreingenommen war. Auf jeden Fall aber passte ihm das Verhalten von Pauli nicht.
»Ist das so?«, fragte er und ließ ein wenig Kühle in seine Stimme einfließen. »Nun, ich weiß von Oberleutnant Kreienbaum, dass Fähnrich Dahlen auf zwei Feindfahrten als Dritter Wachoffizier Dienst an Bord von U 136 getan hat, Herr Pauli. So unerfahren kann er dann ja wohl nicht mehr sein, oder?«
Paulis Augen flackerten irritiert, als er hektische Blicke zwischen den Anwesenden hin und her schickte. Die Äußerung des Kommandanten hatte ihn auf dem falschen Fuß erwischt. »Mhm, das wollte ich damit ja auch gar nicht zum Ausdruck bringen, Herr Kaleu. Das war nur ganz allgemein gehalten.«
»So, so. Um es klar zu sagen, Kompetenzgerangel oder Komplikationen zwischen meinen Offizieren kann ich weder gebrauchen noch tolerieren. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, meine Herren! Damit Sie sich mit den Abläufen an Bord von U 139 vertraut machen können, wird Herr Stollenberg Sie herumführen. Aber ziehen Sie sich zuvor noch ihr Bordpäckchen an, Herr Pauli, das ist bestimmt zweckmäßiger.«
»Jawohl, Herr Kaleu«, schnarrte der Leutnant und beeilte sich aufzustehen. Pauli und Stollenberg verschwanden hinter dem Vorhang, der die Offiziersmesse vom Gang abtrennte.
Das war kein guter Anfang, dachte Wegener und sah Dahlen an, der scheinbar ungerührt auf der Backskiste saß. »Viel mehr weiß ich auch nicht über Sie, Herr Dahlen. Welche Funktionen hatten Sie zuvor?«
»Ich war Geschützführer einer 3,7 cm-Flak an Bord der Georg Thiele, zumindest bis Narvik, Herr Kaleu.«
Wegener sah den Fähnrich forschend an. Im Kampf um Narvik waren die deutschen Zerstörerverbände schwer gerupft worden, alle zehn eingesetzten Schiffe waren in den Kämpfen verlorengegangen. Die überlebenden Besatzungsmitglieder der gesunkenen Zerstörer hatten als Infanteristen gegen die alliierten Truppen kämpfen müssen und dabei hohe Verluste erlitten.
»Nun lassen Sie sich mal nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, Herr Dahlen«, sagte Wegener und vollführte mit der rechten Hand eine auffordernde Bewegung. »Kriegsauszeichnungen?«
Der Fähnrich zuckte gelassen mit den Schultern. »Zerstörerkriegsabzeichen, Narvik-Schild, EK II und das Verwundetenabzeichen. Unter Oberleutnant Kreienbaum das U-Bootkriegsabzeichen und das EK I.«
»Als Sie den Tommy abgeschossen haben?«, vergewisserte sich Wegener.
»Jawohl, Herr Kaleu. Ich war zufällig gerade dabei, die 3,7 zu überprüfen, als der Tommy überraschend aus den Wolken auftauchte. Es blieb keine Zeit, um mit dem Richtschützen den Platz zu tauschen, also schoss ich selbst.«
Das klingt doch vielversprechend, befand der Kommandant. »Mir scheint es so, als hätten Sie nicht verlernt, mit der 3,7 umzugehen. Herr Brandes wird Sie durch unser Boot führen. Sie sind ja mit dem Typ IX schon vertraut.«
Der Fähnrich quittierte die kleine Spitze gegen Pauli mit einem schmalen Lächeln. »Danke, Herr Kaleu.«
Der Bootsmann und der Fähnrich machten ihre Runde durch U 139. Die Boote des Typen IX B waren die größeren Geschwister der VII C-Boote und verfügten über gute Seeeigenschaften. Sie waren echte Ozeanboote und konnten auch noch im Südatlantik oder sogar im Indischen Ozean eingesetzt werden. Im Bug befand sich der vordere Torpedoraum mit seinen vier Rohren im Kaliber 53,3 cm mit den dazugehörigen Torpedos. Unter den Bodenplatten verborgen, lag der Stauraum für die Reservetorpedos. Zusätzlich gab es auf jeder Seite des Raumes Kojen, die eingeklappt werden konnten, um mehr Platz zu schaffen. Die zwölf Kojen waren der Schlafplatz von 24 Seeleuten, die hier abwechselnd im Schichtbetrieb ihre Schlafstatt fanden.
Hinter dem ersten Schott lag die Hauptunterkunft, ganz vorne war der Raum für die Unteroffiziere. An der Backbordseite lag das vordere Klo und zwei Reihen mit Kojen, auf der gegenüberliegenden Seite waren drei Reihen Kojen aufgebaut.
Dann folgte der Offiziersbereich, der Raum für sechs Männer bot. Nach dem nächsten Schott stand man vor der Kabine des Kommandanten, den Offiziersunterkünften, dem Sonarraum und der Funkkabine. Herzstück von U 139 war die Zentrale, hier befanden sich die Steuereinrichtungen des Bootes, die Taucharmaturen, der Navigationstisch, die Ballaststeuerung und das Periskop. Eine Leiter führte hinauf in den Kommandoturm, dort oben waren auch die Kommandobrücke und die Haupteinstiegsluke. Direkt hinter der Zentrale lag der große Maschinenraum mit seinen massiven Diesel- und Elektromotoren.
Die letzte Abteilung bildete der achtere Torpedoraum mit seinen zwei Rohren. Dort waren auch das zweite Klo sowie Unterkünfte für 16 Mann untergebracht.
Mit den insgesamt sechs Torpedorohren, einer 10,5 cm-Deckkanone vor dem Turm, einer 3,7 cm-Flak auf dem Achterdeck und zwei 2 cm-Flak im Wintergarten, war U 139 gut bewaffnet. Aber auch das neue GHG, das Gruppenhorchgerät, war beeindruckend. 24 Sensoren standen dem Sonargast zur Verfügung, um Richtung und Entfernung einer Schallquelle zu erkennen. Außerdem hatte man bei U 139 und den anderen Booten das neue Funkmessbeobachtungsgerät (FuMB) eingebaut, mit dem feindliche Radarstrahlung geortet werden konnte.
Oberbootsmann Brandes registrierte mit einem zufriedenen Lächeln, dass Fähnrich Dahlen die Gelegenheit nutzte, um sich mit den Männern bekannt zu machen. Natürlich war es bei einer Mannschaft von 48 Mann unmöglich, sich gleich alle Namen und Funktionen zu merken, aber die wichtigsten Besatzungsmitglieder prägte sich der Fähnrich schon mal ein: Obersteuermann Wahl und Navigationsgast Wisbar, mit denen er in der Zentrale eng zusammenarbeiten würde; das waren die Sonargasten Felmy und Lüttke, die Funkgasten Brandstetter und Mahler sowie die Maate Timmler und Schütter, die beiden Torpedomixer im Bug- beziehungsweise Heckraum, sowie Obermaat Jahnen, den Stellvertreter des LI im Maschinenraum. Dann waren da noch Maat Räbiger, der Geschützführer der 10,5 cm-Deckkanone, und natürlich der Obergefreite Ott, der Smutje, der den neuen IIWO gleich mit reichlich Kaffee versorgte.
*
Der Flottillenchef hatte die Kommandanten mit einem herzlichen »Gute Jagd und fette Beute« verabschiedet, der offizielle Bahnhof war aus naheliegenden Gründen entfallen. Alle vier Boote lagen seeklar an der Pier und warteten auf den Befehl zum Auslaufen. Kapitänleutnant Wegener befand sich mit seinem neuen IIWO auf dem Brückenturm und sah auf das Leinenkommando auf Deck hinunter. Leutnant Pauli tat Dienst in der Zentrale.
Dann wollen wir doch mal sehen, wie es um unseren IIWO bestellt ist, dachte sich Wegener. »Herr Dahlen, geben Sie Befehl zum Ablegen!«
»Jawohl, Herr Kaleu. Ablegen.«
Obwohl es dunkel war und regnete, konnte Wegener sehen, wie der Fähnrich lässig salutierte. Es herrschten alles andere als gute Bedingungen für einen Neuling, aber der Kaleu wollte eben wissen, was der IIWO auf dem Kasten hatte.
»Leinenkommando Achtung! Alle Trossen bis auf die vordere und achtere Spring lösen!«
Die Trossen wurden gelöst und klatschten ins Hafenwasser; die Mannschaft am Kai holte sie schnell ein.
»Achtere Spring lösen! Ruder Backbord zehn, Backbord-E-Maschine kleine Fahrt voraus!«
Wegener bemerkte, dass der IIWO in die vordere Spring einfuhr, damit das Heck vom Kai loskam. Den Rest würde dann das ablaufende Wasser der Ebbe besorgen. So geschah es auch. Wegener erkannte darin die Handschrift seines Freundes Kreienbaum. Der hatte eine besondere Vorliebe für solche eleganten Manöver.
»Vordere Spring lösen! Beide E-Maschinen kleine Fahrt voraus!«
Die letzte Spring wurde losgeworfen und eingeholt. Die Leinenmannschaft verstaute rasch alles und kletterte geschwind unter Deck.
»Boot ist frei und hält Kurs auf die Fahrrinne, Herr Kaleu«, meldete Dahlen.
»Nicht schlecht, Herr Dahlen.« Wegener war zufrieden mit seinem IIWO.
Vom Ebbstrom mitgezogen, fuhr U 139 mit den E-Maschinen leise und unbemerkt aus dem großen Bunker hinaus in die Bucht des Hafens. Die anderen drei U-Boote verließen ihre Liegeplätze ebenso heimlich. Das war leider notwendig, denn trotz des regnerischen Wetters gab es genügend Franzosen, die den Hafen mit Argusaugen beobachteten und jede Bewegung sofort an die Briten durchstachen.
Langsam näherte sich U 139 dem Blinklicht der Boje, die im dicht fallenden Regen nur sehr schwer auszumachen war. Hier begann die Fahrrinne, die aus dem Kriegshafen hinausführte. Wegener sah nach achtern; das nachfolgende Boot war nur als grauer Schemen auszumachen; die beiden anderen sah er überhaupt nicht.
»Wenn wir einander schon nicht sehen können, dann sehen uns die Franzosen erst recht nicht«, merkte Wegener an.
»Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Kaleu«, sagte der IIWO abgelenkt, während er angestrengt über den Bug ins Dunkel spähte. Zur Linken wie zur Rechten rückte die die Küstenlinie näher an das Boot heran. Aus Brest heraus gab es nur eine Ausfahrt, und die bildete praktisch einen engen Schlauch zwischen dem Kriegshafen und der offenen See. In regelmäßigen Abständen waren Bojen mit schwachen Blinklichtern positioniert worden, um die Navigation bei Nacht oder schlechter Sicht zu erleichtern. An diesen Bojen mussten sie sich regelrecht entlangtasten, um den Weg zum Atlantik zu finden. Da Ebbe herrschte, entstand in der engen Durchfahrt ein starker Sog, der dem Boot einige zusätzliche Knoten bescherte.
Nach 30 Minuten erreichten sie die Ausfahrt des Schlauches; vor ihnen öffnete sich der weite Atlantik. Oben auf den Klippen ragten die Rohre der Marineartillerie in die Finsternis hinaus. Solange sie sich in ihrem Schutz befanden, würden die Briten nichts versuchen, aber wenn sie erst einmal außer Reichweite der deutschen Geschütze waren, ging es los. Natürlich nur, wenn sich dort draußen wirklich gegnerische Einheiten herumdrückten.
»Blinklicht ein Dez Steuerbord voraus«, meldete der Ausguck. Ein Dez stand für 10 Grad.
»Die letzte Boje«, sagte Dahlen angespannt. »Gleich werden wir wissen, ob die Tommys da sind.«
»Nur die Ruhe, IIWO.« Wegener schob sich seine alte speckig-weiße Kommandantenmütze in den Nacken. »Die Tommys kochen auch nur mit Wasser. Und bei diesem Sauwetter können die ebenso wenig sehen wie wir.«
Der IIWO sah zu ihm hinüber, sagte aber klugerweise nichts. Dahlen ließ er auf die Diesel umkuppeln.
Sie passierten die Ausfahrt; im Süden lag Camaret-sur-Mer, im Norden der Leuchtturm von Phare de Saint Mathieu. Diese Seegebiet vor der bretonischen Küste war der für die deutschen U-Boote gefährlichste Abschnitt jeder Fahrt, egal, ob sie nun nach Brest hinein oder aus dem Hafen heraus wollten, denn hier lagen die britischen U-Jagd-Gruppen auf der Lauer. Die schwachen deutschen Seestreitkräfte in diesem Bereich brauchten die Tommys nicht zu fürchten; von dem einen oder anderen Vorposten- oder Schnellboot mal abgesehen, war die Kriegsmarine kaum präsent. Bis zum Februar war das anders gewesen, da hatten die Dickschiffe Scharnhorst, Gneisenau und Prinz Eugen noch in Brest gelegen.
Den Briten war die Gefahr, die diese schweren Einheiten für ihre Handelsschifffahrt darstellten, natürlich bewusst, und so versuchten sie alles, um die Dickschiffe zu versenken. Die sich ständig wiederholenden Luftangriffe der Briten beschädigten die Schiffe und hätten sie früher oder später endgültig ausgeschaltet. Da sich die militärische Lage durch den ausgebrochenen Krieg mit der Sowjetunion erheblich wandelte, befahl Adolf Hitler, die schweren Einheiten der Kriegsmarine nach Norwegen zu verlegen. Sie sollten die alliierten Konvois auf dem Weg nach Murmansk angreifen. In einem kühnen Unternehmen brachen die drei Dickschiffe durch den Kanal in die Heimat durch – praktisch vor den Nasen der Tommys. Die Briten waren darüber sehr erbost und rächten sich nun an den deutschen U-Booten vor der bretonischen Küste für die erlittene Schmach. Die »Grauen Wölfe« waren seitdem jedenfalls mehr oder weniger auf sich gestellt.
Obwohl Wegener es sich nicht anmerken ließ, so wurde auch er zunehmend nervös und lauschte gespannt auf die Meldungen der Wassertiefe aus der Zentrale. Zum Trimmen des Bootes reichte die Tiefe zwar aus, aber nicht, um dem britischen Ortungsgerät ASDIC zu entgehen. Da kam endlich die erlösende Meldung, auf die Wegener gewartet hatte: »Zentrale an Brücke: Wassertiefe liegt nun zwo-null-null Meter.«
»Brücke an Zentrale: Verstanden«, sagte der IIWO. »Beide Dieselmaschinen Stopp! Auf die E-Maschinen umkuppeln! Alle Mann auf Tauchstation!«
Die Ausgucke und die Bedienungsmannschaften der leichten Flak verschwanden blitzschnell durch das Turmluk im Druckkörper.
»Brücke an Horchraum: Irgendwelche Meldungen?«
Maat Felmy war der diensttuende Sonargast und bemühte sich nun, nachdem die lärmenden Dieselmaschinen verstummt waren, etwas mit seinem GHG aufzufangen. »Horchraum an Brücke: Melde schwaches Schraubengeräusch in drei-fünf-fünf. Kontakt fährt vermutlich Schleichfahrt. Entfernung etwa fünf bis sechs Seemeilen.«
»Alarmtauchen!«
Wegener rutschte die Leiterholme hinunter in die Zentrale, der IIWO schlug die Luke zu und verriegelte den Vortreiber. »Turmluk ist dicht!«
Dann sauste auch er die Leiter hinab und knallte mit den Stiefeln auf das Deck.
»Fluuuten!«, befahl der Kommandant. »Auf 40 Meter gehen!«
Seewasser rauschte in die Tauchzellen, verdrängte die Luft. Der Bug neigte sich nach vorne und das Boot schoss in die Tiefe.
»30 Meter, gehen durch«, sang der LI heraus. »Erbitte Erlaubnis zum Trimmen, Herr Kaleu.«
»Stopp Tiefe! Auf 40 Meter einpendeln! Dann mal los, Herr Stollenberg.«
Der LI und seine Mannschaft waren gut aufeinander eingespielt, da saß jeder Handgriff. Rasch vollzogen sie jeden einzelnen Punkt des Trimmprogramms.
Wegener trat an den Kartentisch. Obersteuermann Wahl hatte den Kontakt bereits eingezeichnet.
»Wir sollten den Burschen da lieber ausweichen. Nach dem Trimmen ist der neue Kurs zwo-vier-null.«
Der LI und seine Leute waren mit dem Trimmen, also dem Gewichtsausgleich, der das Boot auf ebenen Kiel brachte, so weit durch, dass Stollenberg melden konnte: »Trimmen abgeschlossen, Herr Kaleu.«
»Respekt, Herr Stollenberg. Das muss ein neuer Rekord sein.«
Der leitende Ingenieur grinste. »Wir haben im Bunker so weit wie möglich vorgearbeitet und die technischen Einrichtungen gründlich durchgeprüft. Jetzt müssen wir nur noch die Stopfbuchsen kontrollieren.«
Stopfbuchsen, das waren die zahlreichen Außenbordverschlüsse; sie stellten die schwache Stelle eines jeden U-Bootes dar. Drang Wasser durch sie in den inneren Bootskörper vor, war das ein echtes Problem, dass sogar zum Untergang führen konnte.
Der Kommandant nickte. »Auf neue Tiefe gehen: eins-fünf-null Meter. Das sollte reichen, oder, LI?«
»Auf jeden Fall, Herr Kaleu.«
U 139 ging tiefer herunter. Der enorme Wasserdruck verursachte ein Knirschen und Knacken, als sich der Druckkörper des Bootes an die Belastungen anpasste, denen er in größerer Tiefe ausgesetzt war. Obwohl man es mit bloßem Auge nicht wahrnehmen konnte, verbog sich der Stahl des Bootes um Bruchteile eines Millimeters. Aber Metall konnte in diesem geringen Bereich arbeiten, die auf dem Stahl aufgetragene Farbe konnte es jedoch nicht. Folglich platzte der erneuerte Innenanstrich des Druckkörpers teilweise ab und rieselte in feinen Partikeln auf die Männer nieder. Mancher wischte die Farbteilchen unbeachtet ab, denn alle Blicke in der Zentrale klebten am Tiefenmesser. Die Boote vom Typ IX waren für eine Tauchtiefe von 90 bis 100 Meter konstruiert worden. Man hatte angenommen, dies würde ausreichen, um feindlichen Wasserbomben und dem britischen Ortungsgerät ASDIC zu entgehen. Diese Annahme war von der Realität des modernen Seekrieges längst überholt worden. Das verbesserte ASDIC zwang die deutschen U-Boote, in immer größere Tauchtiefen vorzudringen, um sich der Ortung zu entziehen. Das vergrößerte natürlich auch die Gefahr, denn ein Leck in dieser Wassertiefe konnte das Ende bedeuten. Andererseits war der Salzgehalt in diesen Tiefen so hoch, dass die Suchstrahlen des ASDIC-Gerätes zurückgeworfen wurden und dem Gegner Kontakte vermittelten, wo gar keine waren.
Die Besatzung von U 139 ging das Tauchprogramm durch; Wegener ließ bis auf 200 Meter Tiefe tauchen, um wirklich sicher gehen zu können, dass alle Stopfbuchsen dicht waren.
Der LI war mit dem Ergebnis zufrieden. »Keine Lecks, Herr Kaleu. Wir sind klar.«
»Danke, Herr Stollenberg. Anblasen! Auf Sehrohrtiefe gehen! Ich möchte einen raschen Rundblick nehmen.«
Die Besatzung atmete leise auf. Aus verständlichen Gründen hatten die Männer stets ein mulmiges Gefühl in diesen großen Wassertiefen; hier unten konnte der Druckkörper zerquetscht werden wie eine leere Konservendose. Das Boot schwebte sanft aus der dunklen Tiefe empor.
»80 Meter, gehen durch«, sang der LI aus, den Tiefenmesser fest im Blick.
»Horchraum, was macht der Kontakt?«, fragte Wegener nach.
»Keine Kontakte, Herr Kaleu«, machte der Sonargast sofort Meldung, musste sich dann jedoch verbessern: »Belege das! Kontakt in zwo-neun-fünf. Sehr schwach.«
Der Kommandant reagierte sofort. »Stopp Tiefe! Auf 70 Meter einpendeln! Absolute Ruhe im Boot! Auf Schleichfahrt umkuppeln!«
»Boot hält 70 Meter Tiefe!«
»Ich höre mir unseren Kunden mal selbst an«, sagte Wegener und ging hinüber zur Horchkammer. Felmy reichte dem Kaleu einen Kopfhörer. »Ein ganz seltsamer Kontakt, Herr Kaleu. Ich denke, das ist möglicherweise eine Lenzpumpe, die mit minimaler Kraft läuft.«
»Eine Lenzpumpe?«, vergewisserte sich Wegener. »Eines der anderen Boote vielleicht?«
Der Kaleu brauchte einen Moment, um sich in der Geräuschkulisse unter Wasser zu orientieren, denn dort war es niemals wirklich still. Die verschiedensten Meeresbewohner und Naturphänomene wie etwa Strudel waren eine Quelle stetigen Lärms. Wegener schloss kurz beide Augen, um sich besser konzentrieren zu können, und nahm dann das Geräusch wahr, das Felmy so irritierte.
»Ja«, sagte er leise. »Das könnte wirklich eine Lenzpumpe sein, die mit minimaler Leistung läuft. Frage Peilung?«
»Immer noch zwo-neun-fünf, Herr Kaleu. Jetzt eindeutig als Oberflächenkontakt erkennbar.«
»Danke, Felmy.«
Wegener verließ die Horchkammer und kehrte in die Zentrale zurück. »Es hilft alles nichts, ich muss wissen, wer oder was da oben ist. Anblasen! Auf Sehrohrtiefe gehen! Aber bitte schön mit Gefühl, LI, ja?«
»Ihr habt den Kommandanten gehört«, sagte Stollenberg grinsend. »Also bitte gefühlvoll auf Sehrohrtiefe gehen.«
Sämtliche Männer in der Zentrale schmunzelten, als sie den LI das Wort so betont sagen hörten.
Die Druckluft presste das Wasser aus den Tauchzellen und U 139 stieg weiter auf. Der LI und seine Mannschaft gingen sehr behutsam zu Werke; so dauerte es zwar seine Zeit, bis sie Sehrohrtiefe erreichten, aber sie verhinderten damit, dass das Boot wie ein Korken an die Wasseroberfläche schoss.
»Boot hat Sehrohrtiefe erreicht«, meldete Stollenberg dann.
»Danke, LI. Dann wollen wir mal sehen, wer da herumschippert. Sehrohr ausfahren!«
Das Gehäuse fuhr nach oben und die Optik durchbrach die Wasseroberfläche. Wegener packte die Griffe und presste die Stirn an die dafür vorgesehene Gummiwulst. Er nahm einen schnellen Rundblick durch das Luftzielrohr, aber es war noch zu dunkel für Flugzeuge. Der Kaleu wechselte auf das Seezielrohr und suchte die Kimm ab. Das fahle Licht des Mondes, das durch die aufgerissene Wolkendecke schien, erleichterte ihm die Suche etwas.
»Horchraum, haben Sie den Kontakt nach wie vor in zwo-neun-fünf?«, hakte Wegener nach.
»Zentrale: Bestätige Kontakt in zwo-neun-fünf.«
»Eine Korvette«, berichtete Wegener. Im Mondlicht waren ganz deutlich die Konturen eins kleinen Kriegsschiffs auszumachen, das dem U-Boot einladend seine Steuerbordseite präsentierte. »Liegt gestoppt da wie auf dem Schießstand.«
Der Kaleu drehte das Sehrohr weiter. »Aha, da sind noch zwei! Habe ich´s doch geahnt. Die alte Masche: Der erste spielt den Köder und die beiden anderen warten nur darauf, dass einer von uns darauf hereinfällt. Aber heute Nacht habt ihr die schlechteren Karten, Gentlemen. Rohr Eins bis Sechs klar zum Unterwasserschuss!«
Unter diesen Umständen war die Zielansprache ein Leichtes; der Zentralmaat gab die Werte in den Vorhalterechner ein, der das Ergebnis in die Lenksysteme der G7-Torpedos einspielte.
»Rohre Eins bis Sechs sind klar!«, meldete Dahlen, der schon die Stoppuhr in der Hand hielt. Als IIWO war er für die Waffensysteme verantwortlich.
Jetzt musste es schnell gehen.
»Achtung! Rohr Eins… los! Rohr Zwo… los!«
Die beiden Aale rauschten aus den Rohren; der Kommandant ging auf Nummer sicher und schoss eine Dublette, weil die Entfernungen bei Nacht nur schwer einzuschätzen waren. Ein Torpedo würde mit Sicherheit sein Ziel treffen.
»Rohr Eins und Zwo sind los.« Dahlen startete die Stoppuhr.
Der LI und seine Tauchmannschaft reagierten schnell und fingen das Boot ab; es war immerhin gerade um drei Tonnen leichter geworden und besaß dadurch mehr Auftrieb.
Wegener beobachtete die Korvette und zählte im Stillen die Sekunden mit. Ob die Besatzung ahnte, dass der Tod unaufhaltsam auf sie zuraste?
Die Einschläge der beiden Torpedos hallten wie ein wilder Donnerschlag durch die See. An der Steuerbordseite der Korvette stiegen zwei gewaltige Wassersäulen in den Himmel. Langsam fiel der aufgeworfene Wasservorhang wieder in sich zusammen und gab den Blick auf das Ziel frei – ihr ganzer Bug war bis vor die Brücke abgerissen und Seewasser flutete ins Innere.
»Treffer!«
Jubel brandete auf.
»Ruhe im Boot, Männer!«, befahl Wegener und drehte das Sehrohr zu den beiden anderen Briten-Korvetten.
»Ist denn das die Möglichkeit?«, wunderte sich der Kommandant. »Die anderen Korvetten liegen immer noch gestoppt im Wasser! Ja, pennen die etwa?«
In diesem Moment stob eine weitere Wassersäule am Heck der linken Korvette in die Höhe.
»Treffer auf der zweiten Korvette, da ist einer unserer Kameraden zum Schuss gekommen!«
Wegener konnte sehen, wie brennendes Treiböl aus den aufgerissenen Tanks des Kriegsschiffes in die See strömte und die ganze Szenerie hell erleuchtete.
»Horchraum: Was erzählen die Fische?«
»Ich höre die Schotten brechen, Herr Kaleu! Die beiden sind erledigt!«
Wegener zögerte. Schoss er auf die verbliebene Korvette, gab es für die Besatzungen der getroffenen Schiffe wohl kaum eine Überlebenschance. Als Seemann war es ihm zutiefst zuwider, die Briten – die offenkundig völlig unerfahren waren – einfach so ihrem Schicksal zu überlassen. Anderseits würden sie selbst wohl nicht zögern, ein deutsches U-Boot gnadenlos zu den Fischen zu schicken.
»Horchraum an Zentral: neue Kontakte in null-eins-null. Drei Einheiten, vermutlich Fregatten oder Zerstörer. Entfernung zehn bis zwölf Seemeilen.«
Die Briten hatten also über Funk Hilfe herbeigerufen. Das war es dann für die letzte Korvette, denn in spätestens 30 Minuten würde der neue Verband hier eintreffen und die Treibjagd auf die Deutschen beginnen.
»Rohr Drei und Vier… Achtung! Rohr Drei… los! Rohr Vier… los!«
Ein spürbarer Ruck ging durch das Boot.
»Rohre Drei und Vier sind los!«, meldete Dahlen.
Wegener hörte kaum hin. »Sehrohr einfahren! Wieder auf Kurs zwo-vier-null gehen! Tauchtiefe eins-null-null Meter! Beide E-Maschinen äußerste Kraft voraus!«
»Sehrohr einfahren, Kurs zwo-vier-null, Tiefe eins-null-null«, echote Pauli.
Dahlen behielt den Zeiger der Stoppuhr im Auge. »Jeden Moment…«
Ein lautes Wummern hallte durch das Boot und Jubel ertönte.
»Das war´s für die dritte Korvette!«
Dann erschütterte ein gewaltiger Stoß U 139; jeder suchte nach einem Halt. Mächtige Druckwellen beutelten das Boot; das Licht flackerte.
»Schadensmeldungen an Zentrale!«, rief Wegener über den infernalischen Lärm hinweg, doch dann war das Getöse auch schon wieder vorbei.
»Was zum Henker war das denn?«, wunderte sich Pauli.
»Das muss das Munitionsmagazin gewesen sein«, meinte Dahlen. »Und dann noch die scharfen Wasserbomben am Heck… die Korvette ist wahrscheinlich komplett in die Luft geflogen.«
Leutnant Pauli sah den Kommandanten bewundernd an und schüttelte ihm begeistert die Hand. »Ich gratuliere, Herr Kaleu! Zwei Feinde weniger, um die sich das Reich Sorgen machen muss!«
»Ah, lassen Sie mal, IWO«, wehrte Wegener ab, dem das Gehabe von Pauli unangenehm war. »Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Zuerst müssen wir die zweite U-Jagdgruppe loswerden, die gerade mit Volldampf angerauscht kommt.«
»Da bringen unsere sieben Knoten doch nichts«, merkte Stollenberg an. »Das kostet uns nur die Batterieladung. Sollten wir nicht lieber auftauchen und Fersengeld geben?«
Pauli fuhr zum LI herum. »Sie kritisieren die Befehle des Kommandanten?«, wollte er empört wissen.
Stollenberg schwoll sichtbar der Kamm, deshalb ging Wegener rasch dazwischen: »Der LI hat völlig recht. 18 Knoten bringen jetzt mehr. Ein guter Kommandant hört auf die Ratschläge seiner erfahrenen Offiziere. Anblasen und Auftauchen! Beide Dieselmaschinen volle Kraft voraus! Die Brückenwache in den Turm!«
Mit voller Kraft davonzulaufen war tatsächlich die beste Möglichkeit. Die Briten mussten ja zunächst einmal ihre Kameraden aus dem Wasser fischen, was bei Dunkelheit gar nicht so einfach war. Erst dann konnten sie Jagd auf die Deutschen machen. Zudem bestand die Möglichkeit, dass sie glauben könnten, ein einlaufendes U-Boot hätte die Korvetten mit seinen letzten Aalen erledigt. Vielleicht suchten sie zuerst nahe der Küste, wo sie sich mit der Marineartillerie herumschlagen mussten; in der Zwischenzeit konnten die U-Boote entkommen.
Der Turm durchbrach die Wasseroberfläche und die Brückenmannschaft zog auf. Hinter ihnen erleuchtete das brennende Wrack der Korvette die Nacht. Sie hatte einen schweren Wassereinbruch, stand lichterloh in Flammen und doch hielt sie sich immer noch tapfer an der Oberfläche. In den Magazinen entzündete sich knatternd Munition, wirbelte funkensprühend davon und zog dabei helle Streifen durch die Dunkelheit.
Die Brückenwache sah es mit gemischten Gefühlen, während unter ihren Füßen das Deck im Takt der hämmernden Dieselmaschinen vibrierte.
»Keine Rettungsboote im Wasser, nur Flöße und Schwimmer«, stellte Dahlen mit Blick durch sein Nachtglas fest. »Das waren wohl wirklich noch blutige Anfänger. Die andere Korvette ist bereits gesunken und von der dritten ist keine Spur mehr vorhanden. Hundert Mann pro Schiff, einfach so weg. Das ist fürchterlich.«
»Ihr Mitleid ist hier fehl am Platz, Fähnrich«, rügte ihn Pauli. »Die Tommys bombardieren unsere Heimat fast jede Nacht und ermorden dabei wehrlose Frauen und Kinder. Die haben nur bekommen, was sie verdienen.«
»Das hätten genauso gut wir sein können«, erinnerte ihn Dahlen und deutete auf die brennenden Überreste der Korvette. »Das sind Seeleute wie wir.«
»Süß und ehrenvoll ist´s, fürs Vaterland zu sterben«, zitierte Pauli.
»Ja, dergleichen haben sie uns in der Hitlerjugend auch erzählt. Narvik hat mich endgültig von solchen Heldengeschichten kuriert.«
»Was erlauben Sie sich?«, polterte der Leutnant los. »Sie… Sie…«
»Geschenkt, Herr Leutnant. Das habe ich alles schon gehört.«
Pauli bedachte den Fähnrich mit einem giftigen Blick, als er den Kommandanten bemerkte, der unbemerkt auf den Turm geklettert war.
»Sie können in der Zentrale übernehmen, IWO.«
»Jawohl, Herr Kaleu,« sagte Pauli, schickte einen letzten Blick zu Dahlen und verschwand dann durch das Turmluk.
»Alles in Ordnung. IIWO?«
»Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Herrn HJ-Führer«, antwortete Dahlen. Dann wurde dem Fähnrich klar, was er gesagt hatte, und er drehte den Kopf zu Wegener. »Bitte um Verzeihung, Herr Kaleu.«
»Wieso denn, IIWO?«, fragte Wegener und klopfte ihm auf die Schulter. »Wir sind alle Seeleute und natürlich lässt einen so ein Anblick nicht kalt.«
Der Alte hat einen Teil der Unterhaltung mitangehört, ging es Dahlen durch den Kopf.
Wegener sah sich um und aktivierte den Befehlsübermittler: »Brücke an Funkraum: Haben Sie Kontakt zur zweiten Jagdgruppe?«
»Funkraum an Brücke«, meldete sich Funkgast Kleinschmidt. »Kein FuMB-Kontakt.«
»Die fahren ohne Radar?«, fragte sich Dahlen verwundert. »Das ist aber ungewöhnlich.«
»Vielleicht haben die Tommys noch nicht alle ihrer Schiffe mit Radar ausgestattet«, meinte der Kaleu. »Freuen wir uns darüber, solange wir es können.«
Die Briten begannen mit den Bergungsmaßnahmen und zogen ihre Kameraden aus dem Wasser. Als sie die Rettungsaktion beendet hatten, drehten sie in Richtung Küste ab. Vermutlich gingen sie tatsächlich davon aus, dass das deutsche Boot in den Hafen einlaufen wollte.
*
Die brennende Korvette flog etwas später in die Luft, wie eine hochschießende Feuersäule weit hinter U 139 verkündete. Wegeners Boot nutzte die Verschnaufpause und raste mit Höchstfahrt in den Atlantik hinaus.
»Drei Korvetten versenkt«, meinte Obergefreiter Kubelsky, der Backbordausguck verhalten zu seinem Nebenmann. »Da werden die Tommys aber schon aufgebracht und auf Rache aus sein. Das nehmen die nicht so einfach hin.«
»Glaube ich auch nicht, die werden uns jagen«, stimmte ihm der Gefreite Franke zu, der an Steuerbord Ausschau hielt.
»Was soll das dumme Gerede, Obergefreiter?«, ranzte Pauli, der den Wortwechsel mitbekommen hatte. »Wir haben zwei der verdammten Briten erledigt, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Das ist eine hervorragende Leistung! Der Führer wird mit Sicherheit stolz auf uns sein!«
Kubelsky und Franke wechselten rasch einen verstohlenen Blick. Franke rollte mit den Augen, dann sagte der Obergefreite: »Jawohl, Herr Leutnant.«
Der Kommandant tauchte im Turmluk auf und stieg auf die Brücke. »Wachablösung, Herr Pauli.«
Der IWO salutierte zackig. »Jawohl, Wachablösung, Herr Kaleu!«
Wegener winkte lässig mit der Hand ab. »Etwas entspannter, IWO. Immerhin sind wir im Einsatz und nicht in der Kadettenschule.«
»Jawohl, Herr Kaleu!«
Der Wachwechsel vollzog sich rasch, die abgelösten Männer verschwanden unter Deck. Die neue Wache hob bereits die Gläser an die Augen. In einer halben Stunde würde das Dunkel der Nacht langsam dem Licht des neuen Tages weichen.
»Es wird bald hell«, stellte der Kommandant entsprechend fest. »Irgendetwas von den anderen Booten zu sehen?«
»Keine Kontakte, Herr Kaleu«, kam die Meldung.
»Hm.«
Der IIWO sah auf seine Armbanduhr. »Darf ich eine Horchrunde vorschlagen, Herr Kaleu?«
»Es ist Ihre Wache, Herr Dahlen.«
Der IIWO hob die Stimme: »Dieselmaschine Stopp! Horchrunde! Brücke an Horchraum: Was erzählen die Fische?«
Dieses Mal hatte Maat Lüttke Dienst. »Schraubengeräusch in eins-vier-null! Sehr weit entfernt und sehr schwach. Entfernung etwa… zwölf bis 14 Seemeilen.«
»Brücke an Funkraum: irgendwelche FuMB-Kontakte?«
»Keine… belege das! Kontakt in eins-vier-zwo! Peilung konstant! Scheint näher zu kommen!«, rasselte Funkgast Voß seine Meldung hervor.