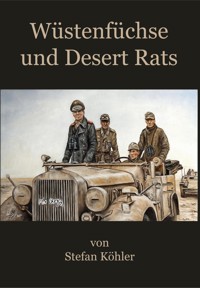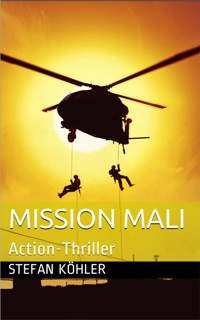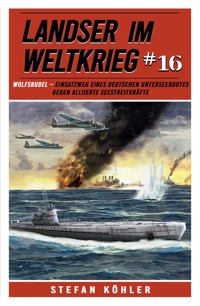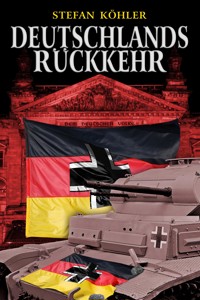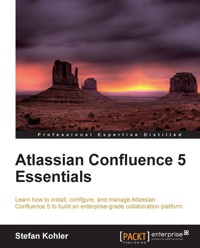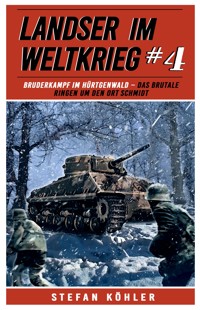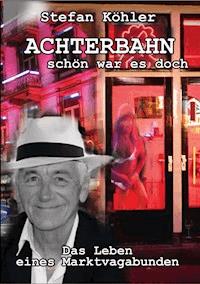6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lassen Sie sich von Kultautor Stefan Köhler in seinen Bann ziehen und begleiten Sie den Kampfpiloten der Luftwaffe, Daniel Friedrichs, der im geteilten Deutschland der 1960er Jahre den wohl gefährlichsten Kampfjet der Welt fliegt: Die F 104 Starfighter, auch "Witwenmacher" genannt. KLAPPENTEXT: Ein Traum wird wahr für Oberleutnant Daniel Friedrichs, als er Kampfpilot des hochmodernen Abfangjägers „F-104G Starfighter“ wird. Voller Entschlossenheit patrouillieren Daniel und seine Kammeraden entlang der innerdeutschen Grenze und drängen Flugzeuge des Warschauer Pakts ab, die sich im westdeutschen Luftraum herumdrücken. Doch schon bald geschieht das Unvermeidliche: Es kommt zu Ausfällen, Abstürzen und tragischen Todesfällen. Auch die Witwe eines verstorbenen Starfighter-Piloten gibt Friedrichs zu denken, wodurch der junge Pilot schlussendlich an seinem Dienstherrn zu zweifeln beginnt. Kurz darauf muss Friedrichs eine folgenschwere Entscheidung treffen … Bereits 2019 erschien die erste Auflage dieses spannungsgeladenen Militär-Thrillers, der den nervenzerfetzenden Alltag der Starfighter-Piloten gekonnt einfängt. Nun meldet sich Stefan Köhler, Experte für Militär und Bundeswehr, mit dieser Neuauflage zurück, die ein komplett neues, verbessertes und überraschendes Alternativende seiner tragischen Geschichte enthält. Der Autor behandelt die Starfighter-Affäre der Bundeswehr, die zwischen 1960 und 1984 mehr als 100 deutsche Piloten das Leben kostete. Der Lockheed F-104 Starfighter war bei seiner Einführung ein hochmodernes Kampfflugzeug, das seine Piloten begeisterte. Politische Fehlentscheidungen und eine desolate Versorgungslage aber sorgten für das vielzitierte Starfighter-Desaster. Was erwartet den jungen Piloten auf seinen waghalsigen Einsätzen? Wem kann er noch trauen und wie wird er sich entscheiden? Finden Sie es heraus und sichern Sie sich ihr persönliches Exemplar von „Sternenjäger“!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefan Köhler
Sternenjäger
Ein Militär-Actionthriller über die Starfighter der Bundeswehr
EK-2 Militär
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Moni & Jill von EK-2 Publishing
Dieses Buch ist den umgekommen Starfighter-Piloten der Luftwaffe, ihren Familien und Freunden gewidmet.
Vorgeschichte
Die junge Bundesluftwaffe stand vom Zeitpunkt ihrer Gründung an vor gewaltigen Herausforderungen. In den zehn Jahren seit Kriegsende hatte sich die Technik rasant weiterentwickelt und sowohl das politische als auch das militärische Umfeld wandelte sich. Aus der Sowjetunion, zuvor Teil der Siegermächte über das Dritte Reich, war praktisch übergangslos ein Feind geworden.
Für die Bundesluftwaffe ergaben sich, als Bestandteil des NATO-Bündnisses, zwei schwerpunktmäßige Aufgaben, namentlich die Luftverteidigung und der taktische Luftangriff. Diese Vorgaben bestimmten die Ausrüstung und die Zusammenstellung der Einsatzverbände.
Als am 2. Januar 1956 die ersten Rekruten der Bundeswehr ihren Dienst antraten, fehlte es der Luftwaffe an allem: an Infrastruktur, an Material, an englischer Sprachkenntnis und ganz besonders an Erfahrung. Dennoch, man entwickelte in Bonn ehrgeizige Pläne: 20 Geschwader sollten bis April 1960 aufgestellt werden.
Zur Erstausstattung der Luftwaffe zählten zum größten Teil veraltete Flugzeugmuster, die nur als Übergangslösung angesehen wurden. Dennoch konnten die neu aufgestellten Einsatzverbände schon sehr bald in die NATO integriert werden. Trotz aller Mängel und Schwierigkeiten waren bis zum Ende des Jahres 1960 zwei Lufttransportgeschwader sowie fünf Jagdbomber-, zwei Aufklärungs- und drei Jagdverbände einsatzbereit. Die Allwetter- und Nachtkampffähigkeit der vorhandenen Flugzeugmuster war allerdings unzureichend. Ein Ersatz musste her und das dringend.
Die Luftwaffe suchte bereits ab 1957 nach einem modernen Abfangjäger, der den Canadair Sabre und den F-86K ersetzen sollte. Laut Vorgabe musste dieser Abfangjäger mit einer sehr kurzen Startbahn auskommen und eine Geschwindigkeit von Mach 2 erreichen, um hochfliegende sowjetische Bomber bekämpfen zu können – allerdings existierte ein solches Flugzeug Ende der 1950er-Jahre nicht.
1958 kam es zu einem ersten Vergleichsfliegen der damals verfügbaren Modelle, der französischen Dassault Mirage III sowie zwei aus den Vereinigten Staaten stammenden Jägern, der Grumman F11F »Tiger« und der Lockheed F-104A »Starfighter«.
Doch dann übernahm die Politik. Für Bundeskanzler Konrad Adenauer spielte die Erlangung der weitgehenden Souveränität der Bundesrepublik eine wichtige Rolle, die noch immer durch das Besatzungsstatut stark eingeschränkt war. Aus diesem Grund galt für Bonn die nukleare Teilhabe als unverzichtbar, alleine schon, um ein Mitspracherecht an der atomaren Einsatzplanung zu erhalten. Der damalige Verteilungsminister Franz-Josef Strauß verkündete, dass der Starfighter als neues fliegendes Waffensystem für die Luftwaffe ausgewählt worden sei – obwohl die zu beschaffende Version nur auf dem Reißbrett existierte. Auch sollte die Maschine nun in verschiedenen Rollen eingesetzt werden: als Abfangjäger, als Jagdbomber (mit nuklearer Bewaffnung), als Aufklärer, Trainer und als Kampfflieger zur Seezielbekämpfung.
Und es schien auch alles für die »Hundertvier« zu sprechen: sie bot eine erstaunliche Höchstgeschwindigkeit von 1.220 Knoten (rund 2.300 km/h), sie erklomm im Steigflug eine Höhe von 82.020 Fuß (etwa 25 km) in vier Minuten und 26,03 Sekunden, und erreichte eine maximale Flughöhe von 103.390 Fuß (unglaubliche 31,5 km). Sie war das erste Flugzeug, das gleichzeitig die Rekorde für Geschwindigkeit, Höhe und Steigrate hielt.
Der Starfighter sollte die veralteten Abfangjäger CL-13 und F-86K Sabre sowie die Aufklärer und Jagdbomber F-84F/RF-84F bei der Luftwaffe ablösen und zudem noch bei der Bundesmarine als Ersatz für die Sea Hawk dienen. Weitere NATO-Staaten schlossen sich der deutschen Wahl an.
Für einen Stückpreis von etwa sechs Millionen Deutsche Mark sollten über 900 Flugzeuge bei Luftwaffe und Bundesmarine in Dienst gestellt werden ...
Die folgende Geschichte spielt in den 1960er-Jahren ...
Flugplatz Nörvenich
Oberleutnant Daniel Friedrichs freute sich auf den bevorstehenden Flug, auch wenn er sich immer noch nicht so recht an das Leben in Deutschland gewöhnt hatte. Die vergangenen Monate hatte Friedrichs in Arizona verbracht, genauer auf der Luke Air Force Base. Dort hatte er gelernt, den F-104G Starfighter zu fliegen. Die Rückkehr nach Deutschland war eine ernüchternde Sache gewesen. Es war unverkennbar, wie stark die Luftwaffe in allen Bereichen improvisieren musste. Da war das Leben in den zugigen Baracken neben dem Flugfeld noch das kleinste Übel.
Innerlich verglich Friedrichs noch immer alles mit Arizona. Dort war der Flugbetrieb straff durchorganisiert gewesen, ebenso die theoretische Unterweisung. In den riesigen Tieffluggebieten von Arizona hatten die Piloten bei schönstem Wetter ihren Maschinen »die Sporen« geben können. Wieder in der Heimat angekommen, machte vor allem das Wetter den frisch ausgebildeten Starfighter-Piloten das Leben schwer. Der Wind, der Nebel, die tiefhängenden Wolken und vor allem die Temperaturen beeinträchtigten Mensch und Maschine. So setzte sich die hohe Luftfeuchtigkeit in den elektronischen Geräten fest, was immer wieder zu unberechenbaren Fehlfunktionen führte. Unterstellmöglichkeiten für die Flugzeuge waren so gut wie gar nicht vorhanden, die Maschinen standen bei Wind und Wetter draußen im Freien. Teilweise konnte das Jagdbombergeschwader 31, das erst im April von Generalleutnant Josef Kammhuber seinen Traditionsnamen »Boelcke« verliehen bekommen hatte, nur drei oder vier Maschinen als klar melden. Die Techniker waren wegen ihrer noch mangelhaften Ausbildung, fehlender Ausrüstung und zu wenig Personal einfach nicht in der Lage, mehr Vögel flugklar zu halten. Damit geriet die weitere Ausbildung in den fliegenden Staffeln natürlich immer weiter in Verzug. Die Luftwaffenführung tat ihr Möglichstes, um zum Beispiel die dringend erforderlichen baulichen Veränderungen auf dem Flugplatz in Angriff zu nehmen, aber Anweisungen und Befehle halfen wenig, wenn das erforderliche Material nicht verfügbar war. Es bedurfte mehr Zeit, um das von der NATO geforderte Niveau zu erreichen. Die Mängel führten beim Stammpersonal natürlich zu Unzufriedenheit. Einige Piloten hatten die Luftwaffe bereits wieder verlassen, um ihr Glück in der zivilen Fliegerei zu suchen.
Friedrichs sah das ein wenig anders. Ihm war klar, dass die neue Bundeswehr als Ganzes und besonders die Luftwaffe vor großen Herausforderungen stand. Man stampfte nicht einfach so mir nichts, dir nichts eine neue Armee aus dem Boden. Es hatte ja zehn Jahre lang überhaupt keine deutsche Luftfahrt gegeben. Und wenn man genauer hinsah, waren die ersten Verbesserungen auch schon auszumachen. Überall wurde gebaut: Unterkünfte für die Besatzungen und das Bodenpersonal, neue Abstellflächen und Rollbahnen, eine verlängerte Start- und Landebahn – im Grunde war der ganze Flugplatz eine einzige Baustelle.
»Na, Daniel«, sagte Staffelkapitän Roland Henke unvermittelt. »So in Gedanken?«
Der Oberleutnant zuckte halb zusammen. »Ein wenig, Herr Hauptmann.«
Henke lächelte. »Bereit, in den Himmel aufzusteigen?«
»Aber immer, Herr Hauptmann!«
»Dann wollen wir mal.«
So einfach gestaltete sich die Sache jedoch nicht. Die Schwierigkeiten begannen bereits, als Henke die Flugunterlagen aus dem Schrank nehmen wollte.
»Verflixt und zugenäht«, schimpfte der Hauptmann, während er sich an der Schranktür abmühte. »Das gibt es doch nicht!«
Die Tür klemmte, warum auch immer. Erst, als ihr ein Gefreiter mit einer Brechstange zu Leibe rückte, kapitulierte sie und Henke konnte die Flugunterlagen an sich nehmen.
»Das fängt ja gut an«, kommentierte der Staffelkapitän launisch.
Nach der Vorbesprechung begaben sich Friedrichs und Henke zur Einsatzplanung, wo ihnen der Einsatzoffizier zwei Flugzeuge zuwies. Von dort aus ging es weiter zum Flugausrüster, der die Fallschirme in Verwahrung hatte. Zwar waren drei Rettungsschirme vorrätig, aber nur einer davon durfte benutzt werden, da die beiden anderen zur routinemäßigen Überprüfung anstanden. Per Telefon versuchte der Flugausrüster nun, seinen Vorgesetzten zu erreichen. Nach fünf Minuten nahm dann endlich ein gelangweilt klingender Soldat den Hörer vom Telefon.
Hauptmann Henke schnappte sich den Hörer und faltete den armen Mannschaftsdienstgrad prompt zusammen: »Was ist denn das für ein Kasperleverein hier? Wir brauchen die Fallschirme! Wir sind für einen Flug angemeldet!«
Am anderen Ende der Leitung übernahm der Chef der Flugausrüster das Gespräch. Er erklärte dem zornigen Hauptmann, dass freigegeben Fallschirme erst gegen Mittag verfügbar seien würden.
Der Staffelkapitän legte bedächtig den Hörer auf. »Scheint so, als müssen wir noch ein wenig warten. Machen wir das Beste draus und gehen einen Kaffee trinken.«
Henke führte den Oberleutnant in den Bereitschaftsraum zurück. Er reichte Friedrichs eine Tasse mit Kaffee und sie setzten sich an einen freien Tisch.
»Nicht mal genug Fallschirme haben wir«, grummelte Henke in seinen Kaffeebecher hinein. »Unglaublich, das Ganze.«
»Ach, das wird schon, Herr Hauptmann«, gab sich Friedrichs optimistisch.
»Hey, du krummer Kerl«, rief jemand plötzlich herüber. Friedrichs reckte den Kopf und erkannte einen breit feixenden Oberleutnant Bernd Koenig, der Hauptmann Henke nun mit einem angedeuteten Salut grüßte. Friedrichs kannte den Burschen schon vom Gymnasium her, die beiden hatten danach gemeinsam die Ausbildung zum Kampfpiloten durchlaufen. Sie waren über die Jahre Freunde geworden, verbrachten auch privat Zeit miteinander, oft zu viert mit seiner Frau und Friedrichs aktuellen Lebensabschnittsgefährtin. In den letzten Monaten waren die Treffen seltener geworden, Bernd und seine Frau Gerda hatten seit der Geburt ihrer Zwillinge alle Hände voll zu tun.
»Dass du mir ja nicht die Tauben verschreckst da oben!«, frotzelte Koenig, der immer für einen lockeren Spruch zu haben war.
»Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen!«, knurrte Hauptmann Henke lachend. »Sie sind wirklich ungeheuerlich, Koenig!«
»Immer gerne, Herr Hauptmann.« Koenig schlappte davon.
Fast zwei Stunden später klingelte das Telefon. Einer der anderen Piloten nahm den Hörer ab und meldete Henke, dass die Fallschirme verfügbar seien.
»Na sehen Sie, Herr Hauptmann«, grinste Friedrichs fröhlich. »Was lange währt, wird endlich gut!«
»Abwarten, Daniel. Immer abwarten«, dämpfte Henke die Begeisterung des jüngeren Fliegers.
Beim Flugausrüster erhielten sie ihre Fallschirme. Vor jeder Nutzung musste zunächst das kleine Heft in der Seitentasche der Schirmhülle kontrolliert werden. Die Piloten hatten das aktuelle Inspektionsdatum und den dazugehörigen Stempel zu prüfen und in einer Klappe des Flugausrüsters gegenzuzeichnen. Es waren die gleichen Fallschirme, die schon auf der F-84F verwendet worden waren. Um die Schirme im Notfall überhaupt nutzen zu können, mussten die Piloten Sporen über ihre Fliegerstiefel schnallen. Diese wurden dann unten am Schleudersitz eingerastet, um die Füße fest an den Sitz zu ziehen, sollte der Schleudersitz ausgelöst werden. Beladen mit ihren Fallschirmen und den Flugtaschen schritten Oberleutnant Friedrichs und Hauptmann Henke nach draußen.
Wie durch ein Wunder war sogar ein Kleinbus verfügbar, der sie zum Flugfeld fuhr. Dabei waren Fahrzeuge wie der DKW-Kleinbus Mangelware. Der DKW war aus Sicherheitsgründen mit einer rot-weiß-karierten Flagge ausgestattet, die munter im Fahrtwind flatterte. Der Fahrer setzte die beiden Flieger schließlich ab und brauste mit einem Winken davon.
Henke und Friedrichs bewegten sich auf die beiden ihnen zugewiesenen Maschinen zu. Ihre Sporen klickten, jedes Mal, wenn sie den Beton berührten.
Der verantwortliche Oberfeldwebel kam ihnen nervös entgegen.
»Guten Tag, Herr Hauptmann. Herr Oberleutnant.«
»Guten Tag. Was ist kaputt?«, fragte Henke direkt.
Oberfeldwebel Seidel wand sich unbehaglich. »Gar nichts, Herr Hauptmann. Aber die Flugzeugwarte sind noch beim Essen. Ich erwarte sie jeden Moment zurück.«
»Dann machen wir schon mal die Kontrolle. Ich möchte nicht noch mehr Zeit verlieren«, entschied Henke.
»Jawohl, Herr Hauptmann.«
Allein der Vergleich der teilweise noch geheimen Leistungsdaten der F-104G mit den Daten der veralteten F-84F »Thunderstreak« versetzte Friedrichs immer wieder in Erstaunen. Das Abfluggewicht des Starfighters war geringer als das der F-84F und gleichzeitig entwickelte das J79-Triebwerk mehr als doppelt so viel Schub. Dies bedeutete eine sehr hohe Steigleistung, eine bessere Beschleunigung und eine hohe Geschwindigkeit. Die Vorderkanten der extrem dünnen und kurzen Tragflächen waren scharf wie Schwertklingen und mussten am Boden mit einer Abdeckung versehen werden. Mancher Pilot und Techniker hatte sich während der Vorflugkontrolle daran verletzt, denn bei der Inspektion wurden die Abdeckungen entfernt. Die Tragfläche selbst war kaum größer als der Esstisch im Wohnzimmer von Friedrichs Großeltern. Ohne Zusatztanks an den Flügelspitzen betrug die Spannweite nur 6,68 Meter. Beim alten Thunderstreak-Jagdbomber waren es noch 10,25 Meter gewesen. Der Starfighter, auch liebevoll »Gustav« genannt, war also mehr so etwas wie eine bemannte Rakete. Von vorne gesehen war sein Profil extrem schmal, was bedeutete, dass die Maschinen im Anflug weder optisch noch mit technischen Hilfsmitteln gut auszumachen war. Im Ernstfall würde das ihre Chancen erheblich verbessern. Im Konturenflug verhielt sich der Starfighter sehr stabil, ein zusätzliches Plus für dieses Waffensystem, wie Friedrichs fand.
Inzwischen waren auch die Flugzeugwarte eingetrudelt und beeilten sich, die Vorflugkontrolle abzuwickeln. Es gab erfreulicherweise keine technischen Beanstandungen. Die Piloten trugen ihre Namen ins Bordbuch ein.
»Also, dann wollen wir mal!«, rief Henke zu Friedrichs rüber, dieses Mal mit einem Grinsen im Gesicht. Auch der Hauptmann war der Faszination für den Lockheed-Jet letztlich erlegen.
Friedrichs hob den Daumen und ging dann zum Bug seines Starfighters mit der auflackierten Nummer DA 113.
Na hoffentlich ist das kein böses Omen, dachte er sich halb im Scherz. Er war, im Gegensatz zu manchem Kameraden, zwar nicht abergläubisch, aber man konnte ja nie wissen.
Von der Thunderstreak her war er es gewohnt, von links in die Kanzel zu steigen. Beim Starfighter war das anders. Hier öffnete sich das Kabinendach nach links, weshalb der Pilot von der rechten Seite her einsteigen musste. Der Starfighter war eben ein extravagantes Fluggerät. Friedrichs kletterte die Leiter hinauf und legte den lästigen Fallschirm in die Sitzwanne des C2-Schleudersitzes. Obwohl dieser eine Rettung auch bei niedrigen Höhen und Geschwindigkeiten ermöglichte, kam Friedrichs der Sitz wie ein schlechtes Gesellenstück vor. Bei Starts oder Landungen, den kritischsten Momenten eines Fluges, war der C2 komplett nutzlos … es durfte also ja nichts passieren. Und kam es zum Ausstieg, wirbelte der Sitz oftmals so umher, dass er in den Fallschirm geriet oder gleich den Piloten traf. Friedrichs hoffte, nie mit diesem Ding aussteigen zu müssen.
Mit Hilfe des Technikers schnallte er sich in den Sitz und ließ die Sporen einrasten.
Oberfeldwebel Seidel klopfte Friedrichs auf die Schulter und zeigte ihm die aus dem Schleudersitz gezogenen Sicherheitsstifte. Damit war der Sitz aktiviert und konnte im Notfall ausgelöst werden.
Daraufhin ging Friedrichs die kurze Prüfliste vor dem Anlassen des Triebwerks durch und kontrollierte das Funkgerät.
»Panther Zwo an Panther Eins«, rief Friedrichs seinen Staffelkapitän an. »Hören Sie mich?«
»Panther Eins an Zwo. Höre Sie klar und deutlich.«
»Verstanden.«
»Und ich glaube, ich muss ihrem Kumpel Koenig noch mal ordentlich den Kopf waschen«, brummte Henke im Funkkreis. »Panther Eins out.«
Das ließ Friedrichs unkommentiert, stattdessen gab er dem Techniker das Zeichen zum Anlassen des Triebwerks. Als die kleine Turbine im Bodenaggregat Luft in den Starter zu leiten begann, ertönte ein lautes Zischen, das jeden, der den Startvorgang nicht kannte, zuerst einmal erschreckte. Kurz darauf reagierte die Drehzahlanzeige, der Zeiger bewegte sich langsam. Bei etwa 15 Prozent Leistung wurde die Abgastemperatur angezeigt und stieg dann sehr schnell auf 600 Grad an. Als die Mindestdrehzahl erreicht war, erklang das typische Jaulen der J79-Turbine. Das Triebwerk verbrannte nun etwa zwölf Liter Treibstoff pro Minute.
Friedrichs beobachtete aufmerksam seine Instrumente. Als sich die Treibwerkswerte stabilisiert hatten, gab er der Bodenmannschaft das Zeichen zum Trennen des Druckluftschlauchs und der Außenbordversorgung. Es dauerte weitere fünf Minuten, um in der Parkposition die Steuerung zu überprüfen, dann zeigte der Techniker endlich an, dass alles klar sei.
Seidel beendete seinen Rundgang um die Maschine, trat neben die Kanzel und zeigte Friedrichs die Sicherungsstifte des Fahrwerks. Nun konnte der Pilot es in der Luft einfahren. Am Boden musste es dagegen natürlich gesichert sein, damit sich keine Unfälle ereigneten.
Friedrichs hob beide Daumen und neigte sie nach außen – das Zeichen, die Bremsklötze von den Rädern zu entfernen. Seidel wiederholte das Zeichen und signalisierte dann Bereitschaft.
»Kontrollturm, Panther Zwo, erbitte Freigabe, zur Startbahn zu rollen«, rief Friedrichs über Funk.
Eine Sekunde später war auch Hauptmann Henke zu vernehmen: »Kontrollturm, Panther Eins, erbitte Freigabe, zur Startbahn zu rollen.«
Der Mann im Kontrollturm schien schon auf ihren Ruf gewartet zu haben. »Panther Eins, Panther Zwo, sie haben Freigabe.«
Friedrichs löste die Bremsen, gab geringfügig mehr Schub und schon rollte sein Starfighter aus seiner Parkposition. Links vor ihm befand sich die DA 117 von Hauptmann Henke, die ebenfalls anruckte. Der Oberleutnant achtete auf genug Abstand zu seinem Rottenführer und folgte ihm dann auf den Rollweg. Die Bugradsteuerung war ein echter Fortschritt und erleichterte die Handhabung am Boden enorm. In der alten Thunderstreak musste der Pilot mit den Bremsen steuern, was nicht immer optimal funktionierte, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Friedrichs folgte der Maschine des Hauptmanns auf die Startbahn und konnte seine Gustav ohne Probleme neben dem anderen Starfighter zum Stehen bringen.
Beide Piloten schlossen nun ihre Cockpithauben und verriegelten sie mit dem dafür vorgesehenen Hebel.
Nun stand ein Probelauf des Triebwerks an. Friedrichs stellte beide Füße fest auf die Bremsen in den Seitenruderpedalen und erhöhte die Leistung der Turbine auf die erlaubten 85 Prozent. Mehr Schub durfte nicht gegeben werden – das Triebwerk war so leistungsstark, dass es passieren konnte, dass sich die Reifen auf der Felge des Fahrwerks drehten, wenn man den Hebel zu weit nach vorne drückte.
Blieben bei 85 Prozent Schub alle Anzeigen im grünen Bereich, musste der Leistungshebel wieder in den Mindestbereich zurückgezogen werden. Friedrichs spürte, wie sich die Nase seiner F-104G beim Triebwerkstest kräftig nach unten drückte – die Maschine schien den Start kaum noch abwarten zu können. Der Oberleutnant sah nur grüne Anzeigen und reduzierte den Schub wieder.
In der anderen Kanzel zeigte ihm Hauptmann Henke den erhobenen Daumen. Friedrichs erwiderte die Geste.
»Kontrollturm, Panther Eins, klar zum Start«, meldete Henke über Funk.
»Kontrollturm, Panther Zwo, klar zum Start.«
Der Oberleutnant sah durch die vordere Cockpitscheibe die Startbahn hinab.
Gleich würde es losgehen!
»Panther Eins und Zwo, Start freigegeben. Guten Flug!«
Friedrichs erhöhte die Leistung wieder auf 85 Prozent und überprüfte noch einmal alle Anzeigen. Hinter seiner Sauerstoffmaske grinste der Oberleutnant wie ein Honigkuchenpferd. Die J79-Turbine gab ein schrilles Geräusch von sich. Mit der linken Hand schob Friedrichs den Leistungshebel in den maximalen Nachbrennerbereich. Sein Helm wurde gegen die Kopfstütze gepresst und er fühlte die einsetzende Beschleunigung, als hätte ihn ein Pferd in den Hintern getreten. Schon zeigte der Fahrtenmesser 100 Knoten an, also 185 Stundenkilometer. Die Geschwindigkeit steigerte sich enorm schnell. Bei 290 km/h hob Friedrichs die Nase seines Kampfjets an und bei 350 km/h zog er etwas stärker am Steuerknüppel, um abzuheben. Jetzt ging es um Sekunden. Das Fahrwerk musste eingefahren werden, bevor eine Geschwindigkeit von 420 Stundenkilometer erreicht war, sonst bestand die Gefahr, dass es blockierte oder dass die Abdeckungen vom Fahrtwind weggerissen wurden. Der Starfighter erforderte nun einmal eine sehr rasche Handhabung. Im Vergleich dazu war die Steuerung einer Thunderstreaks ein Kindergeburtstag gewesen.
Nachdem das Fahrwerk eingefahren war, zog Friedrichs den Leistungshebel aus der Nachbrennerstellung zurück und orientierte sich an der Maschine des Hauptmanns. Es lag in der Verantwortung eines Flügelmanns, immer die richtige Position an der Seite seines Rottenführers zu halten.
Jetzt, wo sich sein Starfighter in seinem Element bewegte, reagierte er wie ein Vollblut auf jeden sanften Druck des Steuerknüppels. Für Friedrichs war es immer noch ein Wunder, dass sich dieses Rohr mit den kurzen Stummelflügeln so elegant durch die Lüfte steuern ließ.
Laut Flugplan sollten sie zunächst nach Osten und dann an der innerdeutschen Grenze entlang bis zur Ostsee fliegen, dort kehrtmachen und nach Nörvenich zurückkehren. Dabei mussten die Piloten natürlich höllisch aufpassen, nicht in den ostdeutschen Luftraum zu geraten.
Oberleutnant Friedrichs blickte nach rechts. Die DDR. Für viele auch die Ostzone. Im Ernstfall würden er und seine Kameraden jenseits der innerdeutschen Grenze, die sich wie eine Narbe durch seine Heimat zog, verschiedene Ziele anfliegen und angreifen. Der normale Westbürger hatte keine Ahnung, wo sich die Militärflugplätze von Laage oder Finsterwalde befanden. Für Friedrichs waren diese Orte mit Zielmarkierungen versehene Eintragungen auf seiner Fliegerkarte. Er kannte überhaupt nur wenige Leute, die im Osten Verwandte hatten. Die DDR war für ihn ein unbekanntes Land, fern und fremd wie die Sowjetunion.
»Panther Eins an Panther Zwo, drehen wir etwas nach Backbord ab«, ertönte Henkes Stimme über Funk. »Nicht, dass die Genossen da drüben noch nervös werden.«
»Panther Zwo an Panther Eins, verstanden.«
Die Vorsicht war nicht unbegründet – die Sowjets nahmen westliche Luftraumverletzer für gewöhnlich sofort unter Beschuss. Jeder, der unvorsichtigerweise die Grenze überflog oder einen der drei Luftkorridore nach Berlin verließ, hatte sofort Abfangjäger am Heck. Eine ganze Reihe von Zwischenfällen belegte die sowjetische Nervosität sehr gut. Die Spionageflugzeuge, die von den Amerikanern und Briten immer wieder losgeschickt wurden, um die rote Luftabwehr zu foppen, waren natürlich eher weniger hilfreich, wenn es darum ging, die Spannungen zwischen den Blöcken abzubauen.
Die Küste geriet in Sicht.
»Zeit umzudrehen.«
Ein Blick auf die Treibstoffanzeige bestätigte es, die Tanks waren zur Hälfte leer. Dabei befanden sie sich erst etwas über eine Stunde in der Luft. Die beiden F-104 gingen wieder auf Südkurs. Es war ein schöner Tag zum Fliegen, kaum eine Wolke bedeckte den Himmel. Der Rückflug verlief ohne Zwischenfälle.
»Nörvenich, Flug Panther mit zwei F-104 meldet sich zurück. Erbitten Landeerlaubnis«, rief Henke den Kontrollturm an.
»Flug Panther, Landeerlaubnis erteilt.« Der Mann im Tower rasselte noch die örtlichen Wetterdaten herunter.
Bei etwa 700 Stundenkilometern fuhr Friedrichs die Landeklappen in halber Stellung aus und folgte seinem Rottenführer nach unten. Er begann den Landeanflug bei etwa 600 Stundenkilometern. Er stellte die Klappen auf Landestellung ein. Das Fahrwerk an Henkes Maschine fuhr heraus. Friedrichs betätigte den Hebel, um es seinem Hauptmann gleichzutun. Drei grüne Lichter bestätigten, dass das Fahrwerk eingerastet war. Mit 425 Stundenkilometern näherten sich die beiden Maschinen der Landebahn. Sachte verringerten die Piloten die Geschwindigkeit bis auf 225 km/h. Die Räder des Hauptfahrwerks berührten mit einem Quietschen den Boden, eine blaue Wolke bildete sich. Nachdem auch das Bugrad aufgesetzt hatte, betätigte Friedrichs den Hebel für den Bremsschirm. Als Flügelmann musste er diesen als erster auslösen. Rechts voraus entfaltete sich nun der Bremsschirm von Henke. Mit mäßigem Wind von vorne reduzierte er die Geschwindigkeit rasch auf unter 100 Stundenkilometer. Dank der Bugradsteuerung hatte der Oberleutnant keine Probleme, seinen Starfighter auf der linken Seite der Piste zu halten. In der Thunderstreak, wo er nur mit den Bremsen des Hauptfahrwerks hatte steuern können, war dies immer ein sehr kritischer Moment gewesen, ganz besonders bei Seitenwind. Im Starfighter war das Rollen am Boden und das Einparken auf der Abstellfläche hingegen ein Kinderspiel. Friedrichs folgte zunächst Henkes Maschine und dann den Signalen des Einweisers, der ihn auf seine vorgesehene Parkposition lotste.
Das Abstellen des Triebwerks und die folgenden Überprüfungen waren unkompliziert und relativ schnell überstanden.
Friedrichs atmete tief durch, entriegelte die Kanzel und klappte die Haube nach links.
Einer der Warte hakte die Leiter ein und Oberfeldwebel Seidel kam zum Cockpit herauf.
»Alles in Ordnung, Herr Oberleutnant?«
»Keine Beanstandungen.«
Seidel freute sich. Dass alles glattgelaufen war, kam dieser Tage selten genug vor. Der Oberfeldwebel steckte die Sicherungsstifte wieder in den Schleudersitz, um ihn zu entschärfen.
Der Pilot öffnete die Sitzgurte, konnte sich mit schweren Fallschirmpaket auf dem Rücken jedoch kaum selbst nach oben stemmen. Der Wart musste mit zugreifen. Friedrichs klinkte die Sporen aus, machte einen großen Schritt über den Kabinenrahmen hinweg und kletterte mühsam die Leiter runter. Mit dem Gewusel an Gurten und dem schweren Paket auf dem Rücken musste er aufpassen, nirgendwo hängen zu bleiben.
Unten angekommen befreite sich Friedrichs vom Fallschirm und schnallte auch gleich die Sporen ab. Diese waren aus Aluminium gefertigt und konnten beim Gehen auf dem Betonboden sehr leicht beschädigt werden. Er blieb noch einen Moment vor seiner Gustav stehen und betrachtete sie eingehend. Das erhitzte Metall knackte und die Maschine strahlte nach dem Flug eine ungeheure Wärme ab.
»Alles in Ordnung, Daniel?«, fragte Hauptmann Henke.
»Alles bestens, Herr Hauptmann.«
»Dann liefern wir mal die Ausrüstung ab und gehen zur Nachbesprechung.«
Henke und Friedrichs lieferten die Helme und Fallschirme beim Flugausrüster ab – gegen Unterschrift, wie immer – und schritten dann zum Einsatzbüro, damit die Flugdaten in ein spezielles Formular eingetragen werden konnten. Die Flugnachbesprechung dauerte knapp eine halbe Stunde.
»Gehen Sie noch mit ins Kasino?«, fragte Hauptmann Henke anschließend.
»Natürlich.«
Jede Staffel unterhielt eine eigene Pilotenküche; dort befand sich der soziale Mittelpunkt der Pilotengemeinde, wo man zusammensitzen und bei einem Bier zum Dienstschluss den Tag noch einmal Revue passieren lassen konnte. Mittags gab dort auch die Verpflegung. Die Küchenchefs hießen Tante Marie und Onkel Jürgen. Letzterer war im Krieg selbst Pilot gewesen und war neben seinen leckeren Schnitzeln auch für seine guten Ratschläge in allen Lebenslagen bekannt. Die meisten der anwesenden Piloten hatten ein Bier vor sich stehen oder eine Zigarette in der Hand. Die Stimmung war gut.
»Setzen wir uns da vorne hin, da sind Kurt und Otto«, schlug Henke vor und Friedrichs folgte ihm zum Tisch mit besagten Kameraden.
»Ah, Hauptmann Henke, unser unerschrockener Staffelchef, und sein Flügelmann sind zurück«, begrüßte sie Oberleutnant Otto Gemersheim fröhlich.
Leutnant Kurt Staake nickte knapp. »Chef. Daniel.«
»Was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen, Kurt?«, wollte Henke wissen.
»Ach, wir waren uns nur etwas uneins«, meinte Gemersheim. »Kurt ist der Ansicht, dass die geplante Flugvorführung in zwei Wochen keine gute Idee ist.«
In zwei Wochen war auf dem Flugplatz Nörvenich der erste öffentliche Auftritt des Starfighters geplant. Zum Jahrestag der Aufstellung des Jagdbombergeschwaders 31 Boelcke und der abgeschlossenen Umrüstung des Verbandes auf den Starfighter hatte der Inspekteur der Luftwaffe alles eingeladen, was Rang und Namen hatte. Vertreter aus der Politik, der Wirtschaft und dem Militär sollten den neuen Wundervogel bestaunen dürfen. General Kammhuber wollte persönlich vor Ort sein.
Es gab jedoch auch Stimmen, die eindringlich vor einer solchen Flugshow warnten. Einer der schärfsten Kritiker war der Leiter des Arbeitsstabs F-104 im Verteidigungsministerium in Bonn, Oberst Günther Rall. Scheinbar war nun auch Staake auf diesen Zug aufgesprungen.
»Ich sage, diese Vorführung ist der pure Wahnsinn«, ließ sich Staake vernehmen. »Mit diesem Vogel kann man doch keinen Kunstflug betreiben, dass sieht doch jeder, der sich die Gustav auch nur ansieht!«
Henke nahm einen Schluck von seinem Bier. »Warum genau?«
Staake beugte sich vor und hielt beide Zeigefinger einige Zentimeter auseinander. »Die Tragflächen sind nun einmal verdammt klein, weshalb die Flächenbelastung sehr hoch ist. Laut Handbuch liegt sie bei 514 kg pro Quadratmeter und das bei normalem Startgewicht. Das immense Gewicht, das auf den Flächen lastet, frisst beim Kurven viel Geschwindigkeit. Deshalb ist die Manövrierfähigkeit unserer Mühlen ja auch eingeschränkt. Und wenn man zu langsam wird, gerät man ins Trudeln, und das mag die Gustav überhaupt nicht.«
Während seiner Umschulung in Arizona hatten er und sein Fluglehrer einen Schubverlust im Triebwerk erlitten. Dabei musste Staake die Erfahrung machen, dass sich die kurzen Stummelflügel des Starfighters so überhaupt nicht für den Gleitflug eigneten. Er und sein Fluglehrer hatten letztlich mit dem Schleudersitz aussteigen müssen. Staake wusste also, wovon er sprach.
»Dagegen kann ich nichts sagen«, meinte Henke. »Aber glauben Sie wirklich, man hätte den Flugtag angesetzt, ohne sich über solche Dinge ernsthafte Gedanken zu machen?«
»Ich glaube, im Moment sind alle so besoffen vor Freude darüber, dass wir die 104 in Dienst gestellt haben, dass da keiner auch nur einen Gedanken dran verschwendet hat.«
Der Einwand war nicht ganz unbegründet, wie Friedrichs fand. Die Begeisterung der Piloten und der höheren Chargen in Luftwaffe und Politik für den Starfighter waren allgemein bekannt.
»Na, na, Kinder, hier wird nicht gestritten«, ging Onkel Jürgen dazwischen. Der hatte sich dem Tisch unbemerkt genähert, um die leeren Gläser einzusammeln. »Ihr kennt die Regeln.«
In Jürgens Kasino gab es feste Regeln, die jeder, unabhängig von seinem Dienstrang, zu befolgen hatte. Eine dieser Regeln lautete, dass man zwar diskutieren, aber nicht streiten durfte.
»Tut mir leid, Jürgen«, sagte Staake angemessen zerknirscht. »Ich halte das nur für keine gute Idee.«
»Mag sein.« Jürgen wischte mit einem Lappen über den Tisch, obwohl dieser wie immer makellos sauber war. »Nach dem, was ich von euch so gehört habe, scheint der Starfighter genauso launisch zu sein wie seinerzeit die 109. Ein hervorragendes Jagdflugzeug, aber wenn man seine Grenzen überschreitet, ist sie ein launisches Biest.«
Für einen Moment hatte Friedrichs das Bild eines zwanzigjährigen Jürgens vor Augen, der sich in der Kanzel seiner Messerschmitt 109 hunderten amerikanischer Bomber entgegenstellte. Er blinzelte und das Bild verschwand wieder.
»Nun, wir werden es erleben«, meinte Henke. »In zwei Wochen sind wir klüger.«
Zwei Wochen später
Die Begeisterung um den Starfighter hatte auch die Idee einer deutschen Kunstflugstaffel entstehen lassen. Andere Länder unterhielten schon lange solche Teams, wie etwa die Thunderbirds der US-Luftwaffe, die Blue Angels der amerikanischen Marineflieger oder die Patrouille de France der Franzosen, um nur einige zu nennen. Die deutsche Luftwaffe verfügte mit der F-104 über das modernste Fluggerät der NATO, da wollte man nicht hintenanstehen. Im Frühjahr hatte der Inspekteur der Luftwaffe seine Genehmigung zur Aufstellung des Kunstflugteams mit dem Namen Starfighters gegeben. Seitdem übten die dafür vorgesehenen Piloten fast täglich ihre Flugmanöver. An diesem Mittwoch sollte die Premiere stattfinden. Die geplanten Flugmanöver würden die Formation, bestehend aus vier Starfightern, über die Grenzen des Flugplatzes hinaustragen, sodass sie für das Publikum zeitweise nicht mehr zu sehen, sondern nur noch zu hören sein würden. Die Zuschauer würden Ferngläser benötigen, um den Manövern überhaupt folgen zu können. Aber davon hatte man ausreichend organisiert, auch die Tribünen für die Zuschauer waren vor der großen Wartungshalle bereits aufgebaut worden und die Soldaten in Nörvenich übten das Marschieren und Antreten.
Oberleutnant Friedrichs und einige seiner Kameraden befanden sich an diesem Nachmittag im Schulungsraum. Auf dem Lehrplan stand Triebwerkskunde, es unterrichtete Major Möller. Sie besprachen die Notverfahren, die bei einem Ausfall der J79 unbedingt einzuhalten waren. Bald war zu hören, wie die Triebwerke von mehreren Starfightern angelassen wurden, und durch die Fenster konnten die Piloten sehen, wie die vier Maschinen des Kunstflugteams zur Startbahn rollten.
Oberleutnant Gemersheim hob die Hand.
»Herr Major, können wir uns nicht die Generalprobe der Starfighters ansehen?«
Dies war ganz im Sinne der anderen Flieger und auch der Major war nicht abgeneigt. Er klappte das Handbuch zu. »In Ordnung. Gehen wir raus.«
Die Gruppe verließ den Raum und ging hinüber zum Wartungshangar. Neben der Tribüne stehend warteten sie darauf, dass die Maschinen endlich starteten.
Einzig Leutnant Staake war nicht begeistert. »Die Wolken hängen ziemlich tief. Nicht gerade ideal.«
»Ach wo, die stehen bei etwa 3.000 Fuß und die Sicht darunter ist gut«, meinte Gemersheim.
Pünktlich um 15:00 Uhr zündete das Kunstflugteam seine Nachbrenner und rollte in Zweierformation los. Als es die Höhe der Tribüne passierte, befanden sich die Starfighter bereits in der Luft. Die Doppelsitzer wurden sonst für die Pilotenausbildung verwendet. Unter lautem Grollen der Triebwerke und dem Jubel der wenigen Zuschauer flitzten die vier Maschinen in den Himmel hinauf. Vorne weg der Führungsflieger und an beiden Flügelspitzen und am Heck die drei anderen Flügelmänner.
Captain John Shoemaker war der Formationsführer. Der erfahrene Fluglehrer gehörte zur US-Luftwaffe und bildete zusammen mit den deutschen Lehrern die neuen Piloten aus.
An seinen beiden Flügeln hingen Friedrichs' alter Freund, Oberleutnant Bernd Koenig, sowie Oberleutnant Harald Graf. Wolfgang Vogt bildete das Schlusslicht der Diamantformation. In der hinteren Position, als sogenannter »Slotman«, blickte er dabei nahezu direkt in das Triebwerk des Führungspiloten und musste stets darauf achten, dass er nicht den Abgasstrahl geriet.
Nach etwa zehn Minuten kamen die vier Flugzeuge in Diamantformation aus westlicher Richtung über den Flugplatz gerauscht.
»Wahnsinn! Das sieht aus, als wären sie alle aneinander gekettet!«, rief einer der Piloten begeistert.
Auf Höhe der Tribüne zündeten alle vier Maschinen ihre Nachbrenner. Den Zuschauern lief es kalt über den Rücken, ehe sie erneut in Hochrufe ausbrachen. Einige hielten sich wegen des infernalischen Lärms die Ohren zu.
Am Ende des Flugplatzes schwenkte die Formation nach links aus, um in einer hochgezogenen Rechtskurve wieder zur Landebahn zurückzukehren. Es war 15:12 Uhr, als die vier silberglänzenden Flugzeuge in die dicke Wolkenschicht eintauchten und aus dem Blickfeld der Beobachter verschwanden.
»Gleich kommt der nächste Überflug«, freute sich Gemersheim.
Einige Minuten vergingen.
»Nanu? Wo bleiben die denn?«, wunderte sich einer der Piloten.
Ein Grollen rollte über den Flugplatz. Die Piloten sahen sich erschrocken an. Das waren keine Triebwerksgeräusche! Unruhe kam auf.
»Seht doch! Da!«, rief einer und deutete mit dem Finger nach Osten.
Die entsetzten Blicke folgten dem Fingerzeig. Schwarze Rauchwolken stiegen etwa fünf Kilometer östlich des Flugplatzes auf. Die Situation drehte Friedrichs den Magen um. Seine Knie begannen zu schlottern, als stünden sie unter Strom.
Alarmsirenen heulten los und der in Bereitschaft gehaltene Rettungshubschrauber stieg auf.
»Gott, das darf doch nicht wahr sein«, stammelte Gemersheim fassungslos.
»Alles wieder in den Schulungsraum!«, wies der Major die geschockten Piloten an.
Es war 15 Uhr 20.
Wie betäubt schlurften die Piloten zurück zum Staffelgebäude und versammelten sich im Aufenthaltsraum. Manch einer hatte Schwierigkeiten, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Mit zitternden Fingern steckten sich einige eine Zigarette an, andere umklammerten ihren Kaffeebecher, als ob dieser ihnen Halt geben könnten.
Wenig später erfuhr die geschockte Gruppe, dass der Flug des Teams Starfighters in der knapp fünf Kilometer entfernten Braunkohlegrube bei Knappsack ein schreckliches Ende gefunden hatte. Keiner der vier Flugzeugführer hatte das Unglück überlebt.
Die Erkenntnis, gute Freunde verloren zu haben, lastete schwer auf den Piloten.
Wie hatte es dazu kommen können? Es musste eine Erklärung für dieses Desaster geben.
Die bedrückende Stille im Raum wurde durch das Eintreten des Kommandeurs jäh unterbrochen. Auch er war auffällig blass.
»Meine Herren.« Die Stimme des Kommandeurs klang irgendwie fremd in Friedrichs Ohren. »Ich bedaure sehr, aber durch die ständigen Anrufe der höheren Dienststellen, der Presse und der Politik bin ich im Moment unabkömmlich. Wer von ihnen mag den Fliegerarzt zur Absturzstelle begleiten?«
Die Piloten zogen den Kopf ein und hofften, dieser bittere Kelch möge an ihnen vorübergehen. Nach kurzem Zögern entschied sich Friedrichs die Hand zu heben. Er wollte nicht einfach herumsitzen und Däumchen drehen. Nicht zuletzt war er es den verunglückten Kameraden schuldig. Er war wie die meisten anderen von der Idee einer Kunstflugstaffel begeistert gewesen und hatte das Vorhaben nach Kräften unterstützt.
»In Ordnung, Friedrichs«, sagte der Kommandeur. »Sonst noch jemand?«
»Hier.« Hauptmann Henke hob die Hand.
»Gut. Der Fliegerarzt wartet draußen auf sie. Ich wünschte wirklich, ich müsste Sie nicht an meiner Stelle dorthin schicken.«
Friedrichs sah in den Augen des Kommandeurs, dass das nicht der Wahrheit entsprach.
Die Absturzstelle zu finden war leicht. Die Rauchsäule stand immer noch über der Braunkohlegrube und die blinkenden Blaulichter der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei wiesen die Richtung. Am Rand der Grube hatten sich bereits zahlreiche Gaffer eingefunden. Die beiden Piloten und der Fliegerarzt, Doktor Groote, mussten sich förmlich an ihnen vorbeidrängen.
»Verdammt noch mal«, sagte Hauptmann Henke leise.
Friedrichs trat neben ihn und sah in die Grube hinunter. Silberne Metallteile und drei nahe beieinander liegende Löcher markierten die Absturzstellen der Formation. Etwa 300 Meter weiter befand sich die Absturzstelle der vierten Maschine.
»Scheint so, als wären Shoemaker, Koenig und Graf in einem sehr steilen Winkel heruntergekommen«, schätzte Henke die Lage ein. »Lediglich Vogt hat als Slotman das Unglück kommen sehen und wohl noch versucht, die Mühle abzufangen. Deshalb liegt seine Absturzstelle etwas weiter weg.«
Der Hauptmann schüttelte ungläubig den Kopf. »Das hätte niemals passieren dürfen.«
Friedrichs stieß einen Grunzlaut aus, erwiderte jedoch nichts. Er betrachtete die Spur aus Trümmerteilen und die Furche, die Koenigs Maschine in den morastigen Boden gerissen hatte. Das grausige Bild des Unglücksorts hatte sich unauslöschlich in sein Hirn gebrannt. Was mochte Wolfgang wohl in seinen letzten Sekunden durch den Kopf gegangen sein, als er erkannte, dass er es nicht schaffen würde?
»Wir müssen unbedingt herausfinden, was hier schiefgelaufen ist«, sagte Hauptmann Henke und schreckte Friedrichs aus seinen Gedanken auf.
»Ja«, gab der Oberleutnant knapp zurück.
Doktor Groote gesellte sich an die Seite der beiden Piloten. »Wie wollen wir das mit den nächsten Angehörigen regeln?«
»Verzeihung?«, fragte Henke nach.
»Das ist nur ein Vorschlag, Hauptmann, mehr nicht«, sagte Groote. »Aber es würde die Dinge für alle etwas erleichtern, wenn jemand die Angehörigen aufsuchen würde, der die Toten kannte.«
»Oh.« Der Blick des Hauptmanns schien sich für einen Moment nach innen zu richten. »Ich verstehe, Doktor. Es wäre für die Angehörigen vermutlich wirklich besser, wenn jemand aus der Staffel anwesend wäre. Danke, Doktor.«
Groote nickte knapp und schritt dann auf eines der Wracks zu, um seine traurige Arbeit aufzunehmen. Feuerwehrleute hatten den Bereich abgesperrt und in Flammen stehende Trümmer gelöscht. Nun galt es, den Tod der Piloten offiziell festzustellen und die Totenscheine auszustellen.
Henke sah Groote einen Moment lang nach, dann drehte er sich zu Friedrichs um.
»Fahren wir zurück, Daniel. Hier können wir doch nichts tun.«
Einige Tage später
Die sterblichen Überreste von Bernd Koenig wurden in seine Heimatstadt zurückgebracht und am nächsten Tag im Familiengrab beigesetzt. Seine Staffelkameraden hatten den Sarg zum Grabe getragen. Freunde und Nachbarn der Witwe hatten ein Büffet im Hause der Koenigs aufgebaut, zu dem sich weitere Trauernde nach dem Gedenkgottesdienst einfanden.
Oberleutnant Daniel Friedrichs hatte sich freiwillig gemeldet, um seinem Freund Bernd auf dessen letzten Weg zu begleiten. Als er mit zwei Staffelkameraden in Uniform beim Haus der Koenigs eintraf, waren beide Straßenseiten voll von parkenden Autos. Er brauchte einige Minuten, um eine Parklücke für seinen VW Käfer zu finden.
»Ich wusste gar nicht, dass Bernd so beliebt war«, merkte Gemersheim an, als sie ausstiegen.
»Er war aktiv in der Gemeinde tätig«, wusste Staake zu berichten. »Und er hat auch irgendwas für die Kirche gemacht.«
»Das wusste ich nicht.«
Friedrichs schloss den Käfer ab. Gemeinsam gingen sie zum Haus der Familie Koenig.
Eine Menge Leute waren bereits anwesend. Die Piloten wurden eingelassen und fanden die Witwe im Wohnzimmer vor. Gerda Koenig war blass und saß benommen in einem großen Ohrensessel. Besucher kondolierten ihr und gingen dann weiter ins Esszimmer, um sich am Buffett gütlich zu tun.
Die drei Luftwaffenoffiziere reihten sich in die Schlange ein.
Während sie Gerda näherkamen, überlegte Friedrichs, was er ihr sagen sollte. Dann war er schon an der Reihe. Er erschrak, als er in ihr graues Gesicht blickte, dann verneigte er sich und ergriff ihre Hand.
»Gerda ...« Mehr brachte er zunächst nicht hervor. Er sah sie an diesem Tag zum ersten Mal, seit er zusammen mit Henke und dem Standortpfarrer die schlimme Nachricht überbracht hatte und sie vor seinen Augen zusammengesunken war.
»Ich kann nicht in Worte fassen ...«, stammelte Friedrichs. »Wenn es irgendetwas gibt, das wir für dich tun können … lass es uns wissen.«
»Vielen Dank«, antwortete Gerda Koenig tonlos.
Sie hat überhaupt nicht gehört, was ich gesagt habe, erkannte Friedrichs. Verdammt, Bernd, deine Frau hätte Besseres verdient! Friedrichs biss sich auf die Unterlippe. Was sollte nun werden, wo Gerda allein war mit den Zwillingen? Ob die Luftwaffe ihr da helfen konnte?
Friedrichs machte einer älteren Frau Platz, die sich zwischen ihn und seine beiden Kameraden gedrängt hatte, und nun Gerda Koenig innig umarmte. Der Oberleutnant begab sich in die Nähe der offenen Teerassentür. Draußen im Garten konnte er die beiden Töchter von Bernd sehen, die in der kleinen Gartenlaube auf dem Schoss zweier Frauen saßen, von denen sie umsorgt wurden. Weitere Damen umringten die wenige Monate alten Kinder, die noch nicht begreifen konnten, dass sie ohne Vater aufwachsen würden.
Eine der Damen, eine beeindruckende Schwarzhaarige, verließ die Gruppe im Garten und trat ins Wohnzimmer. Sie war modisch gekleidet, eine dunkle Strähne fiel ihr ins Gesicht. Als sie Friedrichs einen kurzen Blick zuwarf, war da so etwas wie Wiedererkennen in ihren braunen Augen. Aber noch bevor er etwas sagen konnte, wurde ihr Blick zornig.
Die ältere Dame hatte sich inzwischen von Gerda gelöst. Gemersheim und Staake erhielten so die Gelegenheit, ihr Mitgefühl zu bekunden, aber Gerda Koenig war in Gedanken ganz woanders.
»Herrgott noch mal!«, rief die Schwarzhaarige wütend aus. »Lassen Sie Gerda einfach in Frieden!«
»Verzeihung?« Gemersheim und Staake waren wegen der ihnen entgegenschlagenden Feindseligkeit völlig verwirrt.
»Gerda steht unter Beruhigungsmitteln. Sie war völlig außer sich, als sie vom Tod ihres Mannes erfahren hat! Und das Letzte, was sie jetzt gebrauchen kann, sind weitere Uniformträger um sich!«
Sie wirbelte herum und tippte dem nicht minder verdatterten Friedrichs mit dem Zeigefinger anklagend gegen die Brust. »Daniel, schaff diese Leute raus! Am besten, du verschwindest ebenfalls!«
Die Schwarzhaarige legte eine Hand auf Friedrichs Rücken und schob ihn in Richtung Tür. Mechanisch setzte der Oberleutnant einen Fuß vor den anderen. Aus einem Reflex heraus setzten sich Gemersheim und Staake ebenfalls in Bewegung. Einen Augenblick später standen sie vor der Tür, die krachend hinter ihnen ins Schloss geworfen wurde.
»Meine Güte«, brachte Gemersheim hervor. »Was hatte das denn zu bedeuten?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung«, gab Staake zurück und fasste Friedrichs scharf ins Auge. »Wer war diese Frau?«
»Was fragst du mich das?«
»Na, Sie schien dich doch zu kennen, oder nicht?«
Friedrichs hob in einer hilflos wirkenden Geste die Arme. »Ich wüsste nicht, woher die mich kennen sollte.«
Staake fixierte seinen Freund und Kameraden noch einige Sekunden lang, dann nickte er. »Gut, ich will dir das glauben. Für einen Moment dachte ich schon, sie wäre so sauer, weil sie eine deiner Ex-Freundinnen ist.«
»Auf keinen Fall«, protestierte Friedrichs heftig. »An diese Frau würde ich mich garantiert erinnern.«
»Besser wäre es auf jeden Fall für dich«, merkte Gemersheim an. »Ich glaube kaum, dass diese Drachenlady dir so was durchgehen lassen würde.«
Friedrichs wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Der Tod Koenigs wühlte ihn noch immer auf.
Staake erlöste ihn schließlich. »Ach, was soll´s? Ich könnte jetzt einen kräftigen Schluck gebrauchen. Kommt, wir suchen uns eine Theke und heben einen auf Bernd. Oder auch zwei oder drei.«
Sie stiegen in den Käfer und fuhren los.
Bei Eisenach, Grenzgebiet BRD–DDR, einige Wochen später
Kapitänleutnant Harald Winkler gähnte hinter seiner Sauerstoffmaske. Er war erschöpft. Der lange Flug hatte einen erheblichen Teil seiner Kräfte aufgezehrt. Gestartet war der Marineflieger vor langen Stunden an der südlichen Spitze der Iberischen Halbinsel. Im Rahmen einer Navigationsübung sollte Winkler von Gibraltar aus zu seinem Fliegerhorst Jaegel in Schleswig-Holstein zurückkehren. Dort befand sich der Flugplatz seiner Stammeinheit, dem Marinefliegergeschwader 1. Zuvor hatte der Pilot im Mittelmeer an einer Übung mit dem amerikanischen Flugzeugträger USS Saratoga teilgenommen.
Der Kapitänleutnant flog eine in Großbritannien hergestellte Hawker Sea Hawk Mk 101. Das einstrahlige Kampfflugzeug kam bei der Bundesmarine als Abfangjäger, Jagdbomber und Aufklärer zum Einsatz. Für den langen Flug war die Sea Hawk mit drei Zusatztank unter den Flächen ausgestattet worden. An der vierten Außenstation führte Winkler einen externen Behälter für Aufklärungsmittel mit. Doch Aufnahmen konnte der Kapitänleutnant nicht machen, ganz Deutschland lag unter einer dichten Wolkendecke.
Winkler kontrollierte seine Karte. Unter ihm musste Hessen liegen. Er betrachtete besorgt seine Instrumente. In 11.000 Meter Höhe wehte ein sehr kräftiger Westwind und der Pilot befürchtete, dass dieser Wind ihn zu weit nach Osten abgetrieben haben könnte. Winkler korrigierte seinen Kurs ein wenig nach Westen.
Doch seine Maßnahme kam zu spät, der Wind hatte ihn bei Eisenach tatsächlich über die innerdeutsche Grenze geschoben.
Die sowjetische Luftverteidigung hatte den Anflug des Eindringlings verfolgt und sofort Abfangjäger auf ihn angesetzt. MiG-21 entdeckten den Eindringling binnen Minuten und identifizierten ihn als westdeutsches Flugzeug.
»Leitstelle, hier Golf Sieben«, rief der Pilot der ersten MiG-21 die Bodenstation. »Eindringling identifiziert. Ein westdeutscher Sea Hawk-Jäger. Erbitten Anweisungen.«
»Leitstelle an Golf Sieben, bitte warten.«
Die Zeit drängte. Auf dem Radar war zu verfolgen, wie der Eindringling seinen Kurs änderte, um sich in Richtung Westen davonzustehlen.
»Leitstelle an Golf Sieben«, erklang die Stimme des Einsatzleiters über Funk. »Abschussbefehl! Ich wiederhole: Abschussbefehl!«
»Golf Sieben an Leitstelle. Bestätige.«
Die beiden MiG-21 beschleunigten und setzten sich hinter die Sea Hawk. Beide sowjetische Piloten feuerten mehrere kurze Salven aus ihren Bordkanonen auf den Eindringling ab.
Kapitänleutnant Winkler vernahm einen metallischen Schlag und spürte, wie der Rumpf seiner Maschine erzitterte. Alarmsignale schrillten durch seine Kanzel, rot leuchtende Lampen zeigten ihm einen schweren Schaden in der Hydraulik an. Winkler reduzierte den Schub und senkte die Nase der Maschine nach unten.
Die beiden sowjetischen Flieger sahen nur, wie eine weiße Wolke aus hydraulischer Flüssigkeit aus dem Rumpf der Sea Hawk austrat und wie der West-Jäger dann nach unten in die Wolkendecke glitt.
»Leitstelle, hier Golf Sieben!«, meldete sich der erste Pilot aufgeregt. »Eindringling getroffen! Er brennt und geht runter!«
»Golf Sieben, hier Leitstelle. Bestätigen Abschuss.«
Doch Harald Winkler war nicht abgestürzt – zumindest noch nicht. Mit großer Mühe gelang es ihm, die bockende Maschine unter Kontrolle zu halten.
»Mayday. Mayday. Mayday.« Über Funk erklärte der Kapitänleutnant seine Notlage.
Der Jägerleitoffizier in der Bodenstation rief per Telefon die Marinefliegertruppe an. Man kam überein, Winkler nicht nach Fritzlar, sondern nach Bremen zu leiten, wo Focke-Wulf ansässig war. Das Werk war schließlich für die Instandhaltungsarbeiten an den Sea Hawk der Bundesmarine zuständig, also erschien dieses Vorgehen sinnvoll.
Im Anflug auf Bremen musste Winkler jedoch feststellen, dass er das Fahrwerk weder hydraulisch noch elektrisch oder per Handkurbel ausfahren konnte. Sein Flugzeug war offenbar stärker beschädigt, als er zunächst angenommen hatte.
Um den zivilen Flugbetrieb in Bremen nicht durch ein auf der Landebahn havariertes Flugzeug zum Erliegen zu bringen, wurde Winkler eine Bauchlandung auf dem nahegelegenen Flugplatz Ahlhorn nahegelegt.
Der Aufseher im Kontrollturm griff zum Telefonhörer und alarmierte den gesamten Flugplatz. »Eine Sea Hawk der Marine befindet sich im Landeanflug!«
»Was macht der denn hier?«, wunderte sich sein Gesprächspartner.
»Es handelt sich um einen Notfall. Der Pilot hat die Hydraulik verloren und bekommt das Fahrwerk nicht raus!«
»Verstanden. Die Feuerwehr rückt aus.«
Die Flugplatzfeuerwehr legte einen Schaumteppich auf die Landebahn. Rettungsfahrzeuge säumten die Betonpiste. Jeder, der gerade nicht beschäftigt war, fand sich in sicherer Entfernung ein, um das Spektakel zu verfolgen.
Kapitänleutnant Winkler legte auf der eingeschäumten Bahn eine erstklassige Bauchlandung hin. Unverletzt stieg er aus der Kanzel, noch bevor die ersten Rettungskräfte seine Sea Hawk erreichten.
Gemeinsam sahen sich alle den bruchgelandeten Vogel an und machten bald große Augen – siebzehn Einschusslöcher im Rumpf legten eindeutig Zeugnis ab über den Grund für den Hydraulikausfall.
»Mensch, du wurdest beschossen!«
»Ist nicht wahr …« Winkler war fassungslos. Er war bisher von technischem Versagen ausgegangen. Die sowjetischen Abfangjäger hatte er nicht einmal bemerkt!
Die Sea Hawk wurde in einen Hangar geschleppt. Spezialisten machten sich am Aufklärungsbehälter zu schaffen und transportierten ihn noch am Abend ab.
Der Vorfall war für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen, jedoch zog er unmittelbare Konsequenzen nach sich.
Es war bekannt, dass die Sowjets und ihre Verbündeten bei Grenzverletzungen durch westliche Flugzeuge sofort scharf schossen.
Im umgekehrten Fall waren die Amerikaner und Engländer für Eindringlinge aus dem Osten zuständig, denn die Kontrolle des westdeutschen Luftraumes unterlag alliierter Aufsicht. Die NATO-Verbände geleiteten die Flugzeuge des Warschauer Pakts in der Regel bis zurück bis zur Grenze, ohne das Feuer zu eröffnen.
Grenzverletzungen wurden im Osten in schnöder Regelmäßigkeit von der Propaganda ausgeschlachtet, um vor den aggressiven Kapitalisten aus dem Westen zu warnen.
In den westlichen Medien wurden Grenzverletzungen durch den Warschauer Pakt ebenfalls als Bedrohung gewertet, auch wenn es sich oftmals schlicht um Fehler der örtlichen Radarleitstellen handelte.
Oftmals lag der Grund auch in der geringen Erfahrung der Piloten in Ost und West.
Um solchen Vorfällen in Zukunft vorzubeugen, wurde die Air Defence Identification Zone – kurz ADIZ – geschaffen. Die ADIZ und eine westlich davon eingerichtete Pufferzone lag nun wie ein 80 Kilometer breites Handtuch zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Sie reichte von der Ostsee im Norden bis zur österreichischen Grenze im Süden und erstreckte sich westlich der Zonengrenze auf bundesdeutsches Gebiet. Innerhalb der Flugüberwachungszone unterlagen die Bewegungen sämtlicher Luftfahrzeuge strikter Kontrolle und die Besatzungen waren angewiesen, ständig die Notfrequenz abzuhören. Sobald sich eine Maschine der AIDZ näherte, wurde ein Codewort gesendet, welches die Besatzung dazu aufforderte, auf Westkurs zu gehen.
Mit dieser Maßnahme war Himmel über dem geteilten Deutschland wieder ein Stück kleiner geworden.
Flugplatz Nörvenich, einen Monat später
Oberleutnant Friedrichs streifte den Fliegeranzug über, zog den Bauch ein und schloss den Reißverschluss. Dann sog er Luft ein, hielt den Atem an und bückte sich, um auch die Reißverschlüsse der Beinüberzüge zuzuziehen. Diese kleine Prozedur reichte oftmals aus, um unbedarfte Kameraden während der ersten Tage der Flugschule den Atem zu rauben. Doch man gewöhnte sich daran und es war vermutlich nicht schlimmer, als es für eine Frau sein musste, sich in ein Korsett zu zwängen.
Dieser Gedankengang brachte Friedrichs erneut zurück auf die Schwarzhaarige, die ihn bei der Trauerfeier für Bernd Koenig rausgeworfen hatte. Friedrichs hatte sich tagelang das Hirn zermartert, doch ihm war nicht eingefallen, woher die Frau ihn kennen könnte. Irgendwann hatte er es aufgegeben und sie aus seinen Überlegungen gestrichen. Jedenfalls versuchte er das. Die junge Frau hatte ihn tief beeindruckt.
Friedrichs legte die Gurte am Oberkörper an, die als Geschirr für den Fallschirm dienten. Blieb zu hoffen, dass es niemals nötig werden würde, per Schleudersitz auszusteigen …
Die Gedanken des Luftwaffenoffiziers wanderten weiter. Der Unterausschuss zum Absturz des Kunstflugteams tagte noch immer, versuchte herauszufinden, wie es zu der schrecklichen Tragödie hatte kommen können. Man ging vorläufig davon aus, dass Verbandsführer Shoemaker, vermutlich aufgrund von Desorientierung in den Wolken, die Formation in eine zu steile Abwärtsbewegung gebracht hatte. Aus dieser Bewegung heraus war ein rechtzeitiges Abfangen nicht mehr möglich gewesen. Es war müßig, weiter zu spekulieren, bevor der endgültige Abschlussbericht vorlag. Dennoch hatte man bei der Luftwaffenführung sofort reagiert und sämtliche Kunstflugvorführungen mit dem Starfighter verboten.
Der Zwischenfall vom August, bei dem eine Sea Hawk durch Kampfflugzeuge aus dem Osten beschossen worden war, hatte jedoch klar gemacht, dass die im Dienst stehenden Flugzeugmuster der Luftwaffe und Marine veraltet waren. Sie mussten so schnell wie möglich durch den modernen Starfighter ersetzt werden. Deswegen wurde die Einführung des neuen Musters auch weiter mit Hochdruck vorangetrieben.
Friedrichs sah dem mit mulmigem Gefühl entgegen. Der Tod von Bernd hatte ihn nachhaltig bestürzt.
War wirklich allein menschliches Versagen für das Unglück verantwortlich? Alle vier waren erfahrene Piloten gewesen, die ihr Handwerk verstanden.
Musste die Tauglichkeit des Starfighters grundsätzlich hinterfragt werden?
Friedrichs schüttelte diese Frage rasch ab. Er nahm seinen Helm, in dem die Sporen lagen, klemmte sich seine Flugunterlagen unter den Arm und machte sich auf den Weg zur Vorflugbesprechung. Dort traf er auf Oberleutnant Gemersheim und Leutnant Staake.
»Guten Morgen.«
»Morgen, Daniel.«
Sekunden später trafen die Leutnants Lutz Hoppe und Edgar Baensch ein. Hoppe war für den heutigen Übungsflug als vierter Mann des Schwarms eingeteilt worden war.
»Morgen zusammen.«
»Morgen, Lutz. Edgar. Und, habt ihr euch schon eingewöhnt?«, fragte Gemersheim.
Hoppe und Baensch waren mit dem letzten Schwung Piloten frisch von der Ausbildung in Arizona eingetroffen und hatten gerade einmal um die einhundert Flugstunden auf dem Starfighter abgeleistet.
»Es geht so, denke ich«, gab Hoppe zurück.
Sie alle konnten sich noch gut an die Schwierigkeiten erinnern, die sie selber mit der Umstellung gehabt hatten. Es war ein riesiger Unterschied, ob man unter dem azurblauen Himmel über die Wüste von Arizona hinwegraste, oder in Europa in einer vier Kilometer dicken Regenwolke seinen Fliegerhorst suchte, womöglich noch bei Regen und unberechenbarem Seitenwind.
Die Männer brachten die Vorflugbesprechung hinter sich und gingen zu ihren Maschinen hinaus. Leichter Nieselregen fiel aus den grauen Wolken und reduzierte die Sicht auf weniger als drei Kilometer.
»Über den Wolken wartet der Sonnenschein auf uns,« lachte Gemersheim.
Friedrichs grinste und zeigte ihm den hochgereckten Daumen. Zusammen mit dem Wart Seidel vollführte er den Rundgang um die Maschine, unterschrieb und stieg dann ins Cockpit. Gurte, Fallschirm, Sporen, alles an Ort und Stelle und angelegt beziehungsweise eingerastet. Friedrichs setzte den gepolsterten Kopfschutz auf, danach den harten Helm. Er steckte die Anschlüsse für Sauerstoffmaske und Funkgerät in die vorgesehenen Buchsen und gab Seidel ein Signal. Der Oberfeldwebel klopfte Friedrichs auf die Schulter und zeigte ihm die Sicherheitsstifte des Schleudersitzes. Sie beendeten die letzten Checks und der Oberleutnant aktivierte sein Funkgerät.
»Panther Zwo an Panther Eins. Funkcheck.«
Gemersheim, der an diesem Tag ihren Schwarm anführte, antwortete sofort: »Panther Eins an Zwo. Check.«
»Panther Drei. Funkcheck«, meldete sich auch Staake.
»Eins an Drei. Check.«
»Vier an Eins. Funkcheck.«
»Eins an Vier. Check. Auf die Abstände achten, wenn wir in Formation starten«, erinnerte sie Gemersheim.
Die J79-Triebwerke heulten auf und die vier Starfighter bewegten sich nacheinander zur Startbahn. Gemersheim und Friedrichs bildeten das erste Paar, hinter ihnen rollten Staake und Hoppe in Position.
»Pantherflug, Triebwerkstest.«
Alle vier Piloten überprüften ihr Triebwerk, erhöhten die Leistung auf 85 Prozent und sahen grüne Lampen vor sich. Doch bei Hoppe flackerte die Kontrollanzeige.
»Panther Eins. Startklar.«
Leutnant Hoppe runzelte die Stirn. Diese spezielle Lampe wies auf einen zu niedrigen Öldruck hin. Doch das konnte nicht stimmen. Hoppe hatte neben dem Wart gestanden, als dieser mit dem Messstab den Ölstand überprüft hatte.
»Panther Zwo. Startklar.«
Manchmal gab es kleinere Probleme mit den Anzeigen, eine Fehlfunktion, ein Kurzschluss im elektrischen System. Nichts Wildes also.
»Panther Drei. Startklar.«
Hoppe klopfte mit dem Knöchel gegen das Instrumentenbrett und die Lampe sprang auf grün um. Zufrieden seufzte er auf. Er hätte den Start nur ungern abgebrochen, er brauchte dringend Flugstunden.
»Panther Vier. Startklar.«
»Kontrollturm, Pantherflug ist klar zum Start«, meldete Gemersheim.
»Kontrollturm, Pantherflug, Start freigegeben. Guten Flug!«
Gemersheim erhöhte die Leistung wieder auf 85 Prozent und überprüfte noch einmal alle Anzeigen. »Pantherflug, Formationsstart.«
Auf seinen Befehl hin lösten er und Friedrichs die Bremsen und brausten unter dem Donner ihres Triebwerks über die Startbahn. Sekunden später folgten ihnen auch Staake und Hoppe.
Leutnant Hoppe beobachtete konzentriert seinen Fahrtmesser. Der Nachbrenner zündete einwandfrei. Doch nur Sekunden später verlor das J79-Triebwerk erheblich an Leistung. Erschrocken starrte Hoppe auf die Anzeigen.
Vor seiner Nase stiegen die ersten beiden Maschinen bereits in den Himmel auf und links vor ihm wurde der Vorsprung von Staake immer größer, denn der Schubverlust in seinem Triebwerk machte sich nun deutlich bemerkbar. Doch während sein Flügelmann mit 330 Stundenkilometer abhob, klebte Hoppe immer noch am Boden fest.
Es musste doch gehen!
Er zog leicht am Steuerknüppel und die Nase der F-104 hob sich. Erleichterung durchströmte Hoppe und er fuhr rasch Fahrwerk und Startklappen ein. Doch das Einfahren der Klappen reduzierte den Auftrieb der Maschine, die sich gerade so am Rande ihrer Mindestfluggeschwindigkeit bewegte.
Alarmsignale plärrten los, Warnlichter wiesen den Piloten auf seine Notlage hin. Der Starfighter hatte nicht genügend Fahrt, um sich weiterhin in der Luft zu halten. Die Nase der Maschine senkte sich und wies wieder auf den Erdboden. Hoppe versuchte, den Bug wieder nach oben zu zwingen, doch es war zu spät.
Die vollgetankte Maschine prallte auf dem Boden auf, die Außentanks wurden von den Flügelspitzen abgerissen, und dann bohrte sich die F-104 in den Erdwall hinter der Startbahn.
Flammen loderten hoch.
»Oh Scheiße!«, entfuhr es dem Mann im Kontrollturm, der den Start durch sein Fernglas beobachtet hatte. »Crash! Crash am Ende der Startbahn!«
Er hieb auf die Sendetaste seines Funkgerätes. »Pantherflug, ihre Nummer Vier ist abgestürzt!«
»Was!?!« Gemersheim konnte es kaum fassen. »Zwo, bleib bei mir!«
»Zwo, verstanden.«
Der Oberleutnant drehte um und überflog mit Friedrichs den Flugplatz.
Da! Am Ende der Startbahn: Rauch, Feuer und verstreute Metallteile.
»Verfluchte Scheiße! Hoppe!«
Rettungswagen und die Flugplatzfeuerwehr rasten mit blinkendem Blaulicht auf die Unglücksstelle zu. Doch Gemersheim wusste bereits, dass sie seinem Kameraden nicht mehr helfen konnten.
Die Stimmung im Geschwader war niedergeschlagen. Nach Dienstschluss saßen die Piloten im Kasino bei Onkel Jürgen und diskutierten bei reichlich Bier über den Absturz.
»Hoppe hatte nur rund einhundert Flugstunden auf dem Starfighter«, meinte Oberleutnant Dieter Suhr vom Nebentisch aus. »Vielleicht war es ja die mangelnde Erfahrung?«
»Wir alle haben auch nicht viel mehr Stunden aufzuweisen«, entgegnete Gemersheim. »Im Durchschnitt liegen wir bei 180.«
»Der Tower sagte, dass seine Maschine plötzlich langsamer geworden sei, als der Nachbrenner aus ging. Vielleicht ist die Schubdüse mal wieder ausgefallen«, spekulierte Staake. Damit bezog sich der Leutnant auf die verstellbare Schubdüse am Ende des Triebwerks. Wenn sich diese Düse voll öffnete, nahm die Schubleistung ab und der Nachbrenner fiel aus. Diese Problematik war ihm bestens bekannt, denn während der Ausbildung hatte sie ihm einen Ausflug im Schleudersitz beschert.
»Und ohne den Nachbrenner erreicht die F-104 die Startgeschwindigkeit nicht«, folgerte Friedrichs.
»Stimmt schon«, räumte Suhr ein. »Aber dafür gibt es doch die Notverfahren. Und die beten wir täglich runter.«
Für jeden unvorhergesehen Notfall gab es spezielle Notverfahren – die sogenannten Emergency Procedures. So auch für einen Nachbrennerausfall während des Startvorgangs. Die Emergency Procedures wurden täglich durchgesprochen. Hätte der Chef einen seiner Piloten des Nachts aufgeweckt, er würde diese Verfahren auswendig aufsagen können. In diesem Fall wäre der Startabbruch die richtige Entscheidung gewesen.
Friedrichs schüttelte den Kopf. »Wir haben nicht mit Hoppe in der Kanzel gesessen. Wir wissen nicht, warum er so und nicht anders entschieden hat.«
Und fragen konnte den jungen Leutnant niemand mehr. Schweigend schauten die Flieger in ihre Biergläser.
Hauptmann Henke betrat das Kasino, bestellte ein kühles Blondes und setzte sich zu Gemersheim, Staake und Friedrichs an den Tisch.
»Hauptmann«, begrüßten die drei Männer ihren Staffelchef.
»Jungs.« Henke nippte an seinem Bier, dass ihm Jürgen soeben serviert hatte.
»Gibt es schon etwas Neues über … den Unfall?«, fragte Staake vorsichtig.
»Nicht viel.« Henke drehte das Glas in seinen Händen. »Es scheint eindeutig, dass Hoppe den Start hätte abbrechen müssen. Pilot´s error, sagen sie.«
Wich ein Pilot während eines Notfalls von den vorgeschriebenen Verfahren ab, weil es die Umstände erforderten – oder weil er tatsächlich falsch reagierte – fiel der Fehler automatisch auf den Piloten zurück. Pilot´s error – Pilotenfehler, hieß es dann.
»Die Flüge gehen normal weiter«, verkündete Henke noch.
Friedrichs leerte sein Bierglas mit einem letzten Schluck und erhob sich. »Ich bin dann mal weg. Bis morgen.«
»Bis morgen, Daniel.«
Friedrichs ging nach draußen und steckte sich vor dem Kasino eine Zigarette in den Mund, zündete sie jedoch nicht an. Natürlich gingen die Flüge morgen Früh weiter. Denn unter Piloten gab es ein ungeschriebenes Gesetz: Nach einem Unfall musst du sofort wieder ins Flugzeug steigen. Alles andere bringt Unglück.
Etwas Laufen wird mir jetzt guttun, dachte Friedrichs bei sich und stopfte die Zigarette zurück in die Packung. Dann steckte er die Hände in die Taschen seiner Fliegerjacke und stapfte zum Quartier für ledige Offiziere rüber.
Einige Minuten später schloss er seine Stubentür auf, trat ein und schloss wieder ab. Er hängte seine Lederjacke in den Schrank und setzte sich in den Sessel neben dem Fenster. Er angelte gerade nach dem Playboy, dessen neuste Ausgabe oben auf dem kleinen Klapptisch lag, als das Telefon klingelte.
»Oberleutnant Friedrichs.«
»Daniel, hier ist Caroline Wegener.«
Wer ist das?, fragte sich Friedrichs. »Hallo, Caroline Wegener.«
»Ich möchte mich bei dir entschuldigen, weil ich so unfreundlich zu dir und deinen Kameraden gewesen bin.«
Ich habe diese reizvolle Stimme doch schon mal gehört, überlegte Friedrichs. Wer ist das? An diese Frau sollte ich mich erinnern.
»Entschuldigung, aber wie war das?«
»Ich sagte, ich will mich entschuldigen ...«, begann Caroline Wegener, ehe sie sich selbst unterbrach. »Du hast keine Ahnung, wer hier spricht, oder?«
Tja, ertappt, dachte sich Friedrichs. »Ich muss mich entschuldigen«, sagte er.
Caroline Wegener lachte und der Klang ihres Lachens gefielt ihm. »Die Drachenlady. Ich habe gehört, was dein Kamerad zu dir gesagt hat, nachdem ich euch von Bernds Totenfeier vertrieben habe.«
Das ist die atemberaubende Schwarzhaarige, die mich so merkwürdig angesehen hat!, erkannte Friedrichs aufgeregt.
»Du erinnerst dich immer noch nicht, Daniel?«, bohrte sie nach. »Ich bin Frau Wegener. Albert Wegeners Witwe.«
Friedrichs wäre vor Überraschung fast der Hörer aus der Hand gerutscht. Vor seinem geistigen Auge sah er Leutnant Albert Wegener, ein guter Kamerad seit den ersten Tagen der fliegerischen Grundausbildung. Ein stämmiger, immer fröhlicher Rheinländer, der später zu einem seiner besten Freunde geworden war. Er erinnerte er sich an die Hochzeit, es war wie im Bilderbuch gewesen. Caroline Wegener, nicht die elegante Drachenlady, sondern eine süße, junge Frau, die sich liebevoll an ihren Albert geklammert hatte. Er hatte sie da zum ersten Mal gesehen, und danach nie wieder, bis … und dann kam ihm die Erinnerung an den Unfall. Es musste jetzt drei Jahre her sein. Bei einer Tiefflugübung hatte Alberts Thunderstreak einen Vogelschwarm eingesaugt. Das Triebwerk des alten Republic-Jagdbombers hatte sich förmlich in seine Bestandteile zerlegt. Albert setzte einen Notruf ab und steuerte die Maschine über unbewohntes Gebiet. Als er endlich hätte aussteigen können, ohne Leben am Boden zu gefährden, war er bereits zu tief. Er versuchte es trotzdem mit dem Schleudersitz, aber sein Fallschirm konnte sich nicht mehr rechtzeitig öffnen.
»Oh Gott, Caroline, es tut mir leid, ich habe dich wirklich nicht erkannt«, stieß Friedrichs betroffen hervor.