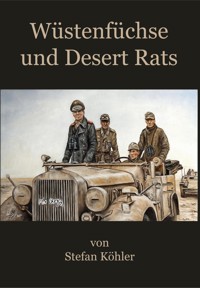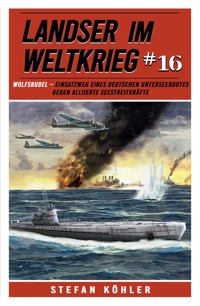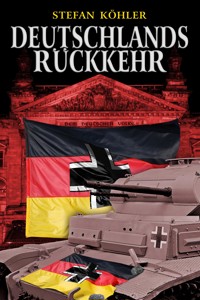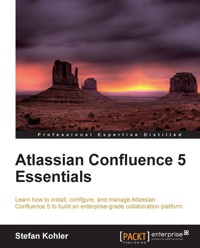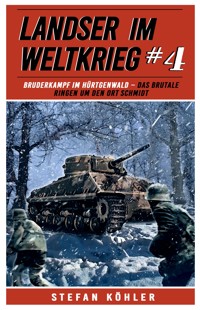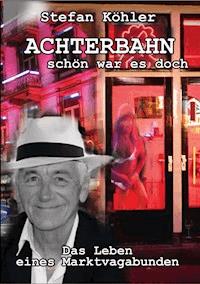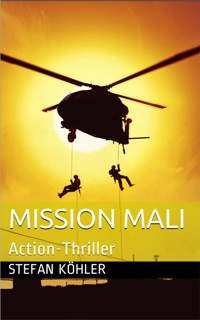
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Mali nimmt die Bundeswehr an der blutigsten UN-Mission seit dem Koreakrieg teil ... Der westafrikanische Staat Mali, einst Vorzeigedemokratie auf diesem Kontinent, stürzt nach bewaffneten Unruhen, dem Vormarsch militanter Islamisten und einem Militärputsch ins Chaos. Eine Friedensmission der Vereinten Nationen, die MINUSMA, soll dabei helfen, das Land wieder zu stabilisieren. Doch die deutschen Bundeswehrsoldaten um Feldwebel Michael Volkmann erwartet in Mali der verlustreichste Einsatz der UN seit dem Koreakrieg. Inmitten von Selbstmordanschlägen, grausigen Massakern an der Zivilbevölkerung und Überfällen auf UN-Patrouillen erfüllen Volkmann und seine Kameraden ihre Pflicht. Tag für Tag sehen sie der Gefahr ins Auge, stellen sich schützend vor die malische Bevölkerung; und ernten dafür den blanken Hass skrupelloser Terroristen. Mission Mali ist Stefan Köhlers neuster Streich. Packend, rasant geschrieben, voll von technischen und soldatischen Details, ist „Mission Mali“ eine emotionale Achterbahnfahrt quer durch diesen fast unbekannten Auslandseinsatz der Bundeswehr in Westafrika. Lassen Sie sich diesen packenden Lesegenuss nicht entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefan Köhler
Mission Mali
Action-Thriller
EK-2 Militär
Mit Illustrationen von Markus Preger
Für Mücke
Nichts bringt dich zurück, doch in unseren Herzen bist du immer bei uns.
Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr!
Tragen Sie sich in den Newsletter von EK-2 Militär ein, um über aktuelle Angebote und Neuerscheinungen informiert zu werden und an exklusiven Leser-Aktionen teilzunehmen.
Als besonderes Dankeschön erhalten Sie kostenlos das E-Book »Die Weltenkrieg Saga« von Tom Zola. Enthalten sind alle drei Teile der Trilogie.
Klappentext: Der deutsche UN-Soldat Rick Marten kämpft in dieser rasant geschriebenen Fortsetzung zu H.G. Wells »Krieg der Welten« an vorderster Front gegen die Marsianer, als diese rund 120 Jahre nach ihrer gescheiterten Invasion erneut nach der Erde greifen.
Deutsche Panzertechnik trifft marsianischen Zorn in diesem fulminanten Action-Spektakel!
Band 1 der Trilogie wurde im Jahr 2017 von André Skora aus mehr als 200 Titeln für die Midlist des Skoutz Awards im Bereich Science-Fiction ausgewählt und schließlich von den Lesern unter die letzten 3 Bücher auf die Shortlist gewählt.
»Die Miliz-Szenen lassen einen den Wüstensand zwischen den Zähnen und die Sonne auf der Stirn spüren, wobei der Waffengeruch nicht zu kurz kommt.«
André Skora über Band 1 der Weltenkrieg Saga.
Link zum Newsletter:
https://ek2-publishing.aweb.page
Über unsere Homepage:
www.ek2-publishing.com
Klick auf Newsletter rechts oben
Via Google-Suche: EK-2 Verlag
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Jill & Moni
von
EK-2 Publishing
Mission Mali
Frühjahr 2017
Dakar, Senegal
Die Heckrampe des Transportflugzeugs schloss sich, was den schier infernalischen Lärm der vier Turboprop-Triebwerke schlagartig auf ein moderates Singen reduzierte.
Oberfeldwebel Kristina Wolff nahm den Gehörschutz aus ihren Ohren, sodass er am Bändchen um ihren Kinn baumelte, und reckte den Hals. Neugierig spähte sie an den Frachtpaletten im hinteren Teil des Laderaums vorbei, um einen Blick auf die Soldaten zu erhaschen, die bei ihrem kurzen Zwischenstopp in Dakar zugestiegen waren.
Sechs Männer im Wüstenflecktarn der Bundeswehr marschierten an den Standardpaletten vorbei und wurden vom Lademeister zu den Sitzen im vorderen Teil des Frachtraums geleitet. Dort waren mehrere Sitzreihen auf die Paletten montiert worden, was es der A400M ermöglichte, gleichzeitig Truppen und Material zu transportieren.
Unter Aufsicht des Lademeisters verstauten die Neuankömmlinge ihre Ausrüstung und Seesäcke in den Frachtnetzen an der Seitenwand. Sobald sie damit fertig waren, deutete der Lademeister, ein Sergent-chef der französischen Armée de l'air, auf die wenigen freien Sitze. Fast alle waren mit weiteren Soldaten und Gepäckstücken belegt.
»Take a Seat«, sagte er geschäftsmäßig.
»Merci«, erwiderte ein deutscher Feldwebel und winkte die anderen Neuankömmlinge zu den freien Sitzen im hinteren Bereich. Er selbst schob sich an den Sitzreihen vorbei, bis er neben dem freien Platz in der ersten Reihe stand.
»Ist der Sitz noch frei, Frau Oberfeldwebel?«, erkundigte er sich höflich.
»Sicher, Feldwebel«, entgegnete Kristina.
»Danke.«
Er setzte sich neben sie und legte den Sitzgurt an. Dann wandte er ihr den Kopf zu. Seine blauen Augen betrachteten sie einen Moment lang kühl und abschätzend, bevor er seine große, kräftige Hand ausstreckte.
»Michael Volkmann«, stellte er sich vor.
»Kristina Wolff«, erwiderte sie. Sie reichten einander flüchtig die Hand.
Die Triebwerksgeräusche veränderten sich, als die Piloten die Leistung erhöhten, was eine potenzielle weitere Unterhaltung zunächst unterbrach. Das Transportflugzeug rollte an und schwenkte auf die Startbahn. Nach einem weiteren kurzen Halt, dem sogenannten Last-Chance-Stopp, erhöhten die Piloten die Leistung erneut und die Maschine rollte zügig an. Keine 30 Sekunden später hob sich der Bug in die Luft und die Passagiere wurden in
ihre Gurte gedrückt, denn sie saßen mit der Blickrichtung zum Heck. Die schwerbeladene Maschine erhob sich für ein Flugzeug dieser Größe überraschend elegant in die Luft, wobei der Triebwerkslärm mit dem Charme eines Industriebohrers auf die Passagiere einwirkte.
Rasch setzte Kristina wieder ihre Ohrstöpsel ein. Ihren Sitznachbarn schien ihre Hast zu erheitern, wenn sie das amüsierte Funkeln in seinen Augen richtig deutete. Erst jetzt erkannte sie, dass er selbst kleine, gelbe Schutzstopfen in den Ohren trug.
Einige Minuten später war die A400M auf ihrer Reiseflughöhe angekommen und die Triebwerke liefen wieder mit normaler Leistung, was den Gehörschutz überflüssig machte. Mit Erleichterung verstaute Kristina die beiden Schaumstoffdinger in der kleinen Plastikbox und steckte sie in ihre Brusttasche. Dann wandte sie sich an ihren neuen Reisegefährten. »Sind Sie in Dakar hängen geblieben?«
»Ja«, gab Volkmann etwas brummig zurück. »Nachdem man unseren Flieger aus dem Verkehr gezogen hat … Mal wieder.«
Die deutsche Luftwaffe verfügte derzeit über zehn Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M, und bei diesen hatte man einen kleinen technischen Defekt in der Klimaanlage festgestellt. Im Vergleich zu anderen Problemen mit den Maschinen war diese Störung eigentlich unbedeutend, denn sie beeinträchtigte die Einsatzbereitschaft nicht im Geringsten. Die Presse jedoch walzte die ganze Angelegenheit genüsslich zu einem Skandal erster Güte aus. Die Regierung hatte einige Tage lang über das Problem diskutiert; schließlich war Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vor die Kameras getreten, um ein allgemeines Flugverbot für die A400M anzuordnen. Deshalb waren einige Soldaten der Bundeswehr in Dakar gestrandet und mussten nun mit den französischen Maschinen nach Mali weitertransportiert werden. Die Flugzeuge der Armée de l'air befanden sich nämlich weiterhin im Einsatz, obwohl sie völlig baugleich zu den deutschen Modellen waren. Die Franzosen schienen im Einsatz eben andere Prioritäten zu setzen als die deutschen Verteidigungspolitiker, die sich von Presseberichten einmal mehr treiben ließen.
»Rund 1.000 Kilometer oder noch fast zwei Stunden bis Bamako«, sagte Kristina. »Und dann noch mal 900 Kilometer oder ein dreiviertel Stunden bis Gao.«
»Genug Zeit, um noch etwas zu schlafen«, merkte Volkmann mit einem dünnen Lächeln an und zog die Ohrstöpsel heraus. Dann kramte er einen alten, verschrammten MP3-Player aus seiner Brusttasche hervor, steckte sich dessen Ohrhörer ein und nickte ihr zu. Er ließ sich schlaff in den Sitz sinken und schloss die Augen.
Kristina beobachtete fasziniert, wie sich seine Brust schon nach wenigen Augenblicken regelmäßig hob und senkte. Verfügte der Feldwebel wirklich über die Fähigkeit, so schnell eingeschlafen? Erleichtert, aber auch ein wenig verwirrt betrachtete sie ihn. Er mochte so Anfang 30 sein, vielleicht einen Meter fünfundachtzig groß, mit kräftiger Statur, breiten Schultern und kurzem, dunkelblonden Haar. Kleine Fältchen um seine Augen verrieten ihr, dass er sich viel im Freien aufgehalten und zu oft in die Sonne geblickt hatte. Nach Hollywood-Maßstäben war er kein gutaussehender Mann, aber er verfügte über eine gewisse Anziehung.
Auf dem Flug hierher hatten die männlichen Soldaten, sowohl die Franzosen als auch die Deutschen, die ganze Zeit über versucht, sie in Gespräche zu verwickeln, wobei sie ihre wahren Absichten keineswegs verheimlicht hatten. Deshalb hatte sich Kristina auch schon auf der Höhe von Gibraltar in die erste Sitzreihe verkrümelt. Nur so hatte sie endlich Ruhe finden können. Es war schließlich nicht ihr Fehler, dass sie mit ihren 29 Jahren auf Männer reizvoll wirkte: Sie war einen Meter zweiundsiebzig groß, hatte kurzes, rotblondes Haar, den durchtrainierten Körper einer begeisterten Fußballerin und ein sympathisches Gesicht mit funkelnden grünen Augen. Sie war es gewohnt, dass die Männer sich für sie interessierten. Dass man sie hingegen gänzlich ignorierte, wie dieser Volkmann es tat, war eine neue Erfahrung für sie. Kristina schüttelte den Kopf, verdrängte den merkwürdigen Sitznachbarn aus ihren Gedanken und döste bald ein.
Gao, Mali
Auf dem weitläufigen Gelände des Flugplatzes von Gao herrschte reges Treiben. Fast ein Dutzend verschiedenste Transportflugzeuge mit den Kennzeichen und Tarnmustern fast ebenso vieler Länder stand aufgereiht auf der Betonpiste. Eine unbemannte Aufklärungsdrohne rollte gerade über die zweite Startbahn. Ein Stück weiter warteten drei Transporthubschrauber mit langsam drehenden Rotoren auf ihren Startbefehl. Neben den Helikoptern entluden mehrere Gabelstapler eine von der UNO gecharterte Antonow-Frachtmaschine der ukrainischen Volga-Dnepr Airlines. Überall zwischen den Luftfahrzeugen wuselte Militärpersonal der MINUSMA umher.
Seit 2012 tobte in Mali ein blutiger Bürgerkrieg. Dabei hatte das Land nach den ersten freien und demokratischen Wahlen im Jahre 1992 lange Zeit als Vorzeigedemokratie in Westafrika gegolten.
Im Norden Malis gründeten die Tuareg Ende 2011 eine Nationale Bewegung für die Befreiung des Azawad, kurz MNLA. Im Januar 2012 starteten sie einen Aufstand gegen die Regierung, um die Unabhängigkeit des Nordens zu erreichen. Dafür verbündeten sie sich mit diversen radikal-islamistischen Gruppierungen, darunter auch Al-Qaida. Es gelang ihnen, weite Teile im Norden des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Da die Aufständischen besser ausgerüstet waren, konnte die malische Armee dem Feldzug der Rebellen nur hilflos zusehen. Der Zusammenbruch Libyens hatte die Tuareg – und zahllose andere bewaffnete Gruppierungen der Region – mit neuen und schlagkräftigen Waffen aus Gaddafis Lagern versorgt, durch die sie den malischen Streitkräften mit ihrer veralteten Ausrüstung überlegen waren. Die Aufständischen finanzierten sich über die Handels- und Schmuggelrouten, die diesen Teil der Sahara seit Jahrhunderten durchzogen. Drogenhandel, Waffenschmuggel, Entführungen und seit neustem auch Sklaverei … Die Aufständischen taten alles, womit sich Geld verdienen ließ. Der Süden Malis wurde durch Attentate und Geiselnahmen erschüttert, während die Bevölkerung im nördlichen Rebellengebiet Raubüberfällen, Morden und Vergewaltigungen ausgesetzt war. Ferner litten die Menschen dort unter Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs. Auch das Trinkwasser war nicht mehr flächendeckend verfügbar, da die Aufständischen die entsprechende Infrastruktur zerstört hatten. Im April 2012 proklamierten die Tuareg den autonomen Staat Azawad, der international jedoch nicht anerkannt wurde.
Parallel zu den Kämpfen im Norden, fand im März 2012 in der Hauptstadt Bamako ein Putsch des Militärs statt. Als Grund gaben die malischen Militärs das zögerliche Vorgehen der Regierung gegen den Aufstand an. Ein nicht erfolgreicher Gegenputsch stürzte das Land noch weiter ins Chaos. Der Putsch legte dabei offen, worunter Mali eigentlich litt: unter einem hohlen, korrupten Staat und einer Regierung, die über viele Jahre hinweg die Demokratie nur vorgetäuscht und sich so Entwicklungsgelder in Milliardenhöhe gesichert hatte. Aber sie kümmerte sich nicht um die politischen und gesellschaftlichen Strukturen im Land, schon gar nicht im kargen Norden.
Seit Mitte 2013 hatte Mali wieder eine gewählte Regierung. Diese ersuchte Frankreich, das intensive Beziehungen zu dem nordafrikanischen Staat unterhielt, um Beistand im Kampf gegen die Aufständischen.
Die Islamisten und Tuareg-Kämpfer bewegten sich auf die Hauptstadt zu, als der Westen aufzuhorchen begann. Mali, so fürchtete man, könnte zur neuen Brutstätte für global agierende Terrorgruppen werden. Und die knapp 12.000 Mann der malischen Streitkräfte würden die Aufständischen ohne Unterstützung gewiss nicht aufhalten können.
Frankreich intervenierte 2013, um die Islamisten im Norden des Landes zurückzudrängen. Es folgte eine Friedensmission der Vereinten Nationen, eben die MINUSMA. Die Abkürzung stand für den Zungenbrecher Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali. Im Rahmen der UN-Mission waren über 13.000 Blauhelmsoldaten und 2.000 Polizisten aus mehr als 50 unterschiedlichen Nationen in Mali vertreten. Der Einsatz galt im Allgemeinen als gefährlichste und verlustreichste UN-Mission überhaupt: Zwischen den Jahren 2013 und 2017 wurden 116 Blauhelmsoldaten getötet.
Derzeit wurde die Mission von einem belgischen Kommandeur im Forces Headquarters (FHQ) in der Hauptstadt Bamako geführt.
Seit 2013 beteiligte sich auch die Bundeswehr an der Mission. Waren zunächst nur 150 Soldaten im Einsatz, so erhöhte sich ihre Anzahl bis 2017 auf rund 1.000 Männer und Frauen. Damit war die Auslandsmission in Mali aktuell die zweitgrößte der Bundeswehr – nach Afghanistan. Allein im Norden des Landes standen 875 deutsche Soldaten im Einsatz, welche im Camp Castor in Gao stationiert waren.
Gao, von 2012 bis Januar 2013 von den Kämpfern der Tuareg und Islamisten besetzt, lag im Nordosten Malis am linken Ufer des Flusses Niger. Berühmt war die Stadt für die rote Düne von Koyma, die direkt in Gao auf dem anderen Nigerufer lag und als eines der natürlichen Wahrzeichen der Stadt galt. Rund 90.000 Einwohner und zahlreiche Flüchtlinge aus dem Norden des Landes lebten in Gao, diesem wichtigen Knotenpunkt des Handels.
Die Bodenmannschaften der UN-Truppe sowie malische Arbeitskräfte bemühten sich mit nur mäßigem Erfolg, Ordnung ins Durcheinander auf dem Flugplatz zu bringen, während die französische A400M ihre Parkposition erreichte. Mit einem letzten Aufheulen verabschiedeten sich die Triebwerke in den Ruhemodus. Die Heckrampe senkte sich langsam herab und die heiße, trockene Luft aus der Sahara überfiel die Insassen. Fast sofort näherten sich Arbeiter und ein Gabelstapler, um die Frachtpaletten zu entladen, die bei ihrer Zwischenlandung in Bamako an Bord geblieben waren.
In Kristinas Sitznachbar kehrte das Leben zurück. Der Feldwebel nahm die Ohrhörer aus den Ohren und packte den MP3-Player wieder in seine Brusttasche. Dann legte er den Gurt ab, stand auf und streckte sich.
»Ausrüstung aufnehmen und dann am Heck sammeln, Leute«, wies er die fünf Soldaten an, die mit ihm in Dakar zugestiegen waren.
Auch Kristina erhob sich und strebte dem Frachtnetz entgegen, in dem ihre eigene Ausrüstung untergebracht war. Der französische Sergent-chef war ihr dabei auffällig behilflich, obwohl sie ihm schon kurz nach dem ersten Start klar gemacht hatte, dass sie nicht an seiner Aufmerksamkeit interessiert war. Wie auch immer, so gelangte sie immerhin rasch an ihre Sachen. Im Anschluss arbeitete Kristina sich zum Heck vor und marschierte forsch die Rampe hinunter.
Das grelle Sonnenlicht machte sie nahezu blind. Sie zog rasch ihre Sonnenbrille hervor und setzte sie auf. Hitze flimmerte auf dem Beton und die Luft schien förmlich zu kochen.
»Alter Gevatter, ist das heiß hier«, maulte einer der Soldaten neben ihr. »Das sind locker über 35 Grad!«
»Wenigstens ist es eine sehr trockene Hitze«, witzelte ein anderer, der an ihr vorüberging.
Kristina sah sich einen Moment lang um, nahm die neuen Eindrücke und Gerüche ihrer Umgebung in sich auf.
»Afrique, la belle afrique«, murmelte sie verträumt vor sich hin. Afrika, das schöne Afrika. Hier befand sich die Wiege der Menschheit, hier hatte sich vor Millionen von Jahren der moderne Mensch, der Homo Sapiens, entwickelt. Mit einer Fläche von 30,2 Millionen Quadratkilometer verfügte der Kontinent über etwa 22 Prozent der gesamten Landfläche des Planeten und war Heimat von mehr als 1,3 Milliarden Menschen. Zahlreiche Filme, Bücher, Mythen und Legenden hatten bei Kristina die romantische Vorstellung eines wilden, ungezähmten Kontinents geprägt. Nun war sie endlich hier, um alles mit eigenen Augen sehen zu können.
»Afrique, sanglante afrique«, sagte ihr ehemaliger Sitznachbar, der, bepackt mit Ausrüstung und Waffen, neben ihr her schritt.
»Wie meinen Sie das? Blutiges Afrika?«, wollte Kristina wissen, etwas verstimmt darüber, dass er ihre Träumerei unterbrochen hatte.
»Na, werfen Sie doch mal einen Blick auf die Landkarte«, meinte Volkmann mit einem grimmigen Zug um den Mund. »Krieg, Bürgerkrieg, ethnische Konflikte, bewaffnete Auseinandersetzungen, Aufstände oder wie auch immer man es nennen möchte. Von Nord nach Süd und von Ost nach West. Der ganze Kontinent ist praktisch eine einzige Feuer-frei-Zone.«
»Das ist eine sehr zynische Ansicht, Feldwebel«, hielt ihm Kristina tadelnd vor.
»Sicherlich ist es das«, gab er mit einem Schulterzucken zu. »Aber bedauerlicherweise ist das auch eine Tatsache. Unsere Anwesenheit ist doch das beste Beispiel dafür.«
»Es ist unsere Aufgabe, diese Zustände zu ändern, sie zu verbessern.« Kristina funkelte den Mann herausfordernd an, was jedoch durch die Sonnenbrillen, die beide trugen, erheblich in der Wirkung gemindert wurde. »Oder sehen Sie das etwa anders, Feldwebel?«
Sie sollte nie erfahren, was er antworten wollte, denn Volkmann zuckte unvermittelt zusammen und fuhr herum. Über das Turbinengeheul auf dem Flugplatz legte sich ein leises, gerade noch wahrzunehmendes Geräusch. Ein Geräusch, das einem durch Mark und Bein ging und das man niemals wieder vergaß, wenn man es erst einmal vernommen hatte.
Kristina Wolff stand zu seiner Linken, etwa zwei Meter von ihm entfernt. Vielleicht war es ein uralter Beschützerinstinkt, der ihn dazu trieb, sie an den Hüften zu packen und sie mit einem lauten Warnruf zu Boden zu reißen.
»VOLLE DECKUNG!«
Er rollte sich mit ihr über den heißen Beton, warf sich schützend über sie, als auch schon die erste Detonation das Gelände erschütterte und die Druckwelle ihnen die Luft aus der Lunge drückte.
*
Die westafrikanische Pinasse lag in einem Seitenarm des Niger. Das knapp 15 Meter lange Boot war ein typischer Anblick in diesem Teil der Welt, auch an ihrer Ladung aus Reissäcken schien nichts ungewöhnlich zu sein. Nun jedoch legten die zehn Männer an Bord dicke Bohlen über die Reisladung und befestigten sie dort. Im Handumdrehen entstand eine stabile Plattform für die beiden Bodenplatten aus Metall. Einige weitere Säcke wurden weggenommen und hölzerne Munitionskisten kamen zum Vorschein. Zwei 82-mm-Mörser sowjetischen Ursprungs wurden auf den Bohlen in Stellung gebracht. Die Waffen waren uralt, verrostet und in erbärmlichen Zustand, aber gerade deshalb hatten sie sich für sie entschieden – sie waren entbehrlich. Von ihrem Standort aus reichten die Mörser so gerade an den Flugplatz heran, auf dem sich die Blauhelme tummelten. Nacheinander wurden die Munitionskisten geleert und über Bord geworfen. Jetzt befanden sich nur noch die Granaten und die beiden BM-37-Mörser an Bord. Weitere Waffen führte die Besatzung nicht mit, von einigen Messern mal abgesehen. Aber damit würden sie bei einer Überprüfung nicht auffallen.
Auf ein Nicken des Kapitäns hin ließen die beiden Schützen die ersten Granaten jeweils in den Lauf des Mörsers gleiten. Mit dem ihnen eigenen Abschussgeräusch husteten diese die Granaten hinaus. Die beiden Schützen der Al-Qaida hatten bereits vier Geschosse in die Luft befördert, bevor die erste Explosionswolke auf dem UN-Flugplatz in den Himmel stieg. Zielen mussten sie nicht, durch die Bewegungen der Wellen sowie den Wind verteilten sich die Einschläge über ein weites Gebiet. In knapp einer halben Minute waren alle Granaten aufgebraucht. Nachdem sie ihren Zweck erfüllt hatten, warf die Besatzung die beiden Mörser und die Bodenplatten über Bord. Die dicken Bohlen wurden wieder unter die Reissäcke gelegt und die Ladung neu verteilt.
Der Kapitän startete den Motor und die Pinasse steuerte wieder auf den Niger zu. Sollte man sie stoppen und überprüfen, so befand sich nichts Verdächtiges mehr an Bord. Wenige Minuten später waren sie im Schutz von Dutzenden ähnlichen Booten untergetaucht und spurlos verschwunden.
*
Feldwebel Michael Volkmann schüttelte den Kopf, um das Dröhnen aus seinen Ohren zu vertreiben, und schnappte dabei nach Luft. Staub und der beißende Geruch von verbrannten Sprengstoffen ließen ihn husten. Immerhin bekam er dadurch seine Ohren wieder frei, vernahm schließlich das verspätete Heulen der Sirene, aber auch Hilferufe in einem Dutzend verschiedener Sprachen, die ihm unbekannt waren. Die Schmerzensschreie hingegen verstand er auch ohne Übersetzung.
Volkmann rollte sich von Oberfeldwebel Wolff hinunter, sprang auf und zog sie ebenfalls hoch. Er ignorierte ihren schwachen Protest und zerrte sie mit Gewalt hinter sich her, auf einen der vielen Splitterschutzgräben zu, die neben dem Rollfeld angelegt waren.
»In die Gräben!«, donnerte Volkmann. »Vielleicht ist der Angriff noch nicht vorbei!«
Er sprang in ein Deckungsloch, zog Kristina einfach mit sich, die sich wie eine umher geschleuderte Puppe vorkam.
»Was ist passiert?«, fragte sie benommen. Der Schlag von der Druckwelle und seine wenig feine Art, sie zu Boden zu stoßen, hatten sie auf dem falschen Fuß erwischt.
»Mörserbeschuss«, lautete die knappe Antwort des Feldwebels, der mit den Händen nun über ihre Schultern, Arme und den Rumpf strich.
»He! Was soll das?«, begehrte Kristina auf. Sie versuchte, seine Hände wegzuschlagen und zerkratzte ihm die Unterarme, doch er war stärker als sie und ignorierte ihre Bemühungen einfach.
»Sind Sie getroffen?«, stieß er besorgt hervor, während er über ihre Hüften strich und dann ihre Beine abtastete. »Hey, sehen Sie mich an! Sind Sie in Ordnung?«
So langsam ging Kristina auf, dass der Feldwebel die Gelegenheit nicht dazu ausnutzte, um sie zu betatschen, sondern dass er ihren Körper nach Verletzungen absuchte. »Oh … ich … mir tut alles weh, aber ich glaube, ich bin okay.«
Sie kam sich in diesem Moment unglaublich dumm vor.
»Ich kann auch keine Verletzungen finden«, sagte er und lehnte sich zurück. Die Sonnenbrillen hatten sie verloren, sodass Kristina in seine blauen Augen sehen konnte. Die wirkten nun überhaupt nicht mehr kühl, sondern besorgt. Sie offenbarten eine seltsame Wärme.
»Mir geht es gut«, versicherte sie ihm. »Ich war nur ein wenig durcheinander.«
»Verständlich«, meinte Volkmann kurz angebunden. Als wäre es ihm peinlich, dass er sich seine Besorgnis hatte anmerken lassen, sprang er rasch auf. Er streckte den Kopf vorsichtig aus dem Splittergraben, peilte die Lage, bevor er hinauskletterte und nach seinen Kameraden sah. Die hatten den Feuerüberfall ebenfalls unbeschadet im benachbarten Graben überstanden.
Kristina stand auf und ließ den Blick umherwandern.
Ein alter Antonow-Transporter irgendeines afrikanischen Landes stand in hellen Flammen. Sie produzierten eine dichte Rauchwolke, die langsam in den Himmel aufstieg und dort zerfaserte. Aus einer der Lagerhallen erhob sich dichter Rauch. Auf dem Vorfeld lagen die brennenden Trümmer eines französischen Hubschraubers verstreut. Helfer und Rettungstrupps eilten aus allen Richtungen herbei. Löschfahrzeuge rollten auf die Betonflächen und sprühten Schaum auf die in Flammen stehenden Luftfahrzeuge. Besatzungen rannten auf ihre Maschinen zu, um sie auf Schäden zu überprüfen, und bereiteten sich darauf vor, sie aus dem Gefahrenbereich zu schaffen.
Das Flughafengebäude war nur knapp einem Volltreffer entgangen. Im Sandsackwall vor dem Haupteingang klaffte eine große Bresche. Zwei der malischen Milizposten lagen regungslos am Boden. Ihr Blut wurde vom Sand, der aus den aufgerissenen Säcken strömte, aufgesogen.
»Sanglante afrique«, sagte Kristina traurig und mehr zu sich selbst als zu jemand anderem. »Blutiges Afrika.«
Camp Castor, Gao
Das Feldlager Camp Castor war von der niederländischen Armee errichtet worden. Am Eingang zum Kommandoposten des großen Lagers hinter den obligatorischen Splitterschutzboxen – Drahtkörbe, gefüllt mit Splitt und Steinen – wuchsen mehrere Fahnenmasten aus dem Grund, an denen die Flaggen der im Camp vertretenen Nationen im heißen Wüstenwind flatterten.
Unzählige Container und Zelte bildeten lange Reihen, in denen die Unterkünfte, Werkstätten, Vorratslager, Kantinen, Duschen und alle anderen für das Lagerleben benötigten Einrichtungen untergebracht waren. Durchzogen war das gesamte Camp von Splitterschutzboxen, die zusätzlich einen Ring um die ganze Einrichtung spannten. Jener Ring aus Splitterboxen war rundherum mit NATO-Draht, Wachtürmen und Stellungen für schwere Maschinengewehre und automatische Granatmaschinenwaffen gesichert. Darüber hinaus schützten Wachposten mit Ferngläsern, auf Masten montierte Kameras, weit reichende Radaranlagen und in der Luft kreisende Drohnen, die unaufhörlich die Umgebung absuchten, das Lager. Ferner standen innerhalb des Lagers Artillerieeinheiten auf Abruf bereit, ausgerüstet mit Granatwerfern und Haubitzen, um Angreifer zurückzuschlagen.
»Mann, ein so gut gesichertes Lager habe ich ja noch nie gesehen«, meinte ein Stabsgefreiter, als die kleine Gruppe aus den Transportpanzern kletterte.
»Das kannst du laut sagen, Jewgeni«, pflichtete ihm ein anderer Kamerad zu und erhob seine Stimme, um den einsetzenden Rotorlärm zu übertönen. »Und das musst du auch! Sieht mal, auf zwei Uhr!«
Rechter Hand stieg ein Apache-Kampfhubschrauber vom Landefeld auf. Als er dröhnend über sie hinwegdonnerte, konnten die Soldaten am Boden die Abzeichen der niederländischen Streitkräfte am langen Heckausleger erkennen. Unter den Stummelflügeln hingen Panzerabwehrlenkwaffen und Behälter mit ungelenkten Raketen. Die 30-Millimeter-Bordkanone schwenkte suchend von einer Seite zur anderen, folgte den Kopfbewegungen des Bordschützen. Der Hubschrauber vollführte eine weite Kehre um das Camp. Offenbar wollte er die Landung einer amerikanischen Transportmaschine absichern, die gerade auf das Camp herabstieß.
»Ich frage mich nur: Warum mussten wir in Gao landen, wenn wir auch hier ein Flugfeld haben?«, wunderte sich Jewgeni. »Das hätte uns den ganzen Feuerzauber erspart!«
»Ganz einfach«, antwortete sein Kumpel. »Das Flugfeld wurde letzte Nacht mit Raketen beschossen, weshalb hier niemand landen konnte, bevor die Krater aufgefüllt waren.«
Jewgeni machte ein langes Gesicht. »Ist ja ´ne ganz besch…eidene Gegend, in die sie uns geschickt haben.«
»Schluss jetzt mit dem Gemecker!«, rief sie Feldwebel Volkmann zur Ordnung. »Waffen und Ausrüstung aufnehmen!«
Volkmann schwang sich seinen Seesack mittels der Trageriemen über die Schulter. Zusätzlich nahm er seine persönliche Waffe auf, ein modifiziertes G36K mit einem unter dem Lauf montierten Granatwerfer.
»Mir folgen«, wies er seine fünf Kameraden an, allesamt Mannschaftsdienstgrade.
Schon nach wenigen Schritten glänzten ihre Gesichter vor Schweiß, denn die Außentemperaturen kratzten an der 39-Grad-Marke.
Ein Unteroffizier in Bundeswehrtarnkleidung und mit Sonnenbrille auf der Nase erwartete sie bereits: »Willkommen im Camp Castor, Kameraden. Eure Unterkünfte sind bereits vorbereitet. Feldwebel Volkmann, Sie sollen sich umgehend beim Herrn Oberstleutnant im Kommandogebäude melden.«
»Verstanden, Unteroffizier. Es wäre sehr nett, wenn sich währenddessen jemand um meine Ausrüstung kümmern könnte.«
»Das ist doch kein Problem, Herr Feldwebel. Ich bringe Ihre Sachen zu Ihrem Quartier«, bot der Unteroffizier hilfsbereit seine Dienste an. »Die Nummer Ihres Wohncontainers ist T-411.«
»Danke sehr.« Mit einem leicht amüsierten Zug um die Mundwinkel verfolgte der Feldwebel, wie der Unteroffizier den Seesack aufnahm und ihn sich mit offenkundiger Mühe auf die Schultern lud. Die fünf Mannschafter folgten ihm im Gänsemarsch zu den Wohncontainern.
Volkmann merkte sich die Richtung, ehe er sich zum Kommandogebäude aufmachte, wo er sich bei den Wachposten anmeldete. Vier niederländische MINUSMA-Soldaten standen sich vor dem Gebäude die Beine in den Bauch, was dem Feldwebel genug über die Sicherheitslage vor Ort verriet. Einer der Posten sprach in sein Funkgerät. Einige Minuten später erschien eine belgische Stabsgefreite und führte den Feldwebel ins Hauptquartier. Volkmann seufzte erleichtert auf, als er das klimatisierte Gebäude betrat. Mit der frischen Brise, die die Lüftungslamellen durch die Räume pusteten, ließ es sich gleich etwas besser aushalten.
Nach wenigen Schritten erreichten die Belgierin und er jenen Bereich, der dem deutschen Truppenkontingent zur Verfügung stand. In den Büroräumen arbeiteten einige Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Bundeswehr, saßen an Schreibtischen und Computern oder beugten sich über Lagekarten.
Ein Hauptmann verzog missbilligend das Gesicht.
»Wie sehen Sie denn aus, Herr Feldwebel?«, fragte er mit aufgebrachter Fistelstimme, stemmte dabei die Hände in die Hüften und betrachtete Volkmann prüfend.
Der Feldwebel war verschwitzt, seine Tarnkleidung verdreckt und er roch nach Rauch und den Rückständen von Explosivstoffen.
»Ich freue mich auch, Sie wiederzusehen, Hauptmann Boiger«, entgegnete Volkmann trocken.
Armin Boiger sackte der Unterkiefer herab, als er in dem verdreckten Feldwebel den ehemaligen Mannschaftsdienstgrad aus Afghanistan wiedererkannte.
»Sie?«, stieß er verblüfft hervor.
Volkmann kannte Hauptmann Boiger, damals noch den Rang des Leutnants bekleidend, aus Afghanistan. Dort war er der Laufbursche ihres Einsatzoffiziers gewesen, stets danach bestrebt, seinem Vorgesetzten zu gefallen. Boiger war knapp 1,75 Meter groß, sein Haarschopf war dunkel. Trotz Tarnanzug wirkte er eher wie ein Büroangestellter.
»Ich soll mich beim Herrn Oberstleutnant melden«, fuhr Volkmann ungerührt fort. »Darf ich meine Waffe so lange hier deponieren?«
»Aber sicher doch, Herr Feldwebel«, sagte ein Oberstabsgefreiter, der vergnügt verfolgt hatte, wie Boiger von der Ankunft des Neuankömmlings aus dem Konzept gebracht worden war.
»Danke, Kamerad. Die Waffe ist ungeladen und gesichert.«
Der Oberstabsgefreite nahm das G36K entgegen und bewunderte es erst einmal eingehend, schließlich handelte es sich bei der Waffe nicht um das Standardmodell.
»Die Waffe will ich aber wiederhaben, Kamerad«, mahnte Volkmann sanft, als er das begehrliche Glitzern in den Augen des Mannschafters wahrnahm. Der Oberstabsgefreite sah von dem G36 auf und ein leicht verlegenes Lächeln erschien auf seinem Gesicht.
»Natürlich, Herr Feldwebel. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.«
»Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen nachher die Spezifikationen geben«, bot Volkmann an.
»Sehr gern. Danke, Herr Feldwebel.«
Volkmann nickte ihm kurz zu, ging zur Tür mit dem Kommandeursschild rüber und ließ den perplexen Hauptmann Boiger einfach stehen.
Der Feldwebel klopfte an.
»Herein«, ertönte eine gedämpfte Stimme über dem Summen der Klimaanlage.
Volkmann öffnete die Tür und trat ein, um fünf Schritte vor dem Schreibtisch des Kommandeurs Haltung anzunehmen.
»Herr Oberstleutnant, Feldwebel Volkmann, melde mich wie befohlen«, sagte Volkmann das übliche Sprüchlein auf, während er die Hand an die rechte Schläfe legte.
»Stehen Sie bequem, Volkmann«, sagte der Oberstleutnant auf der anderen Seite des Schreibtischs, den Telefonhörer am linken Ohr, und deutete mit der freien Hand einen Gruß an.
Vor dem Tisch hatte ein junger Leutnant Platz genommen. Er schien so um die 20 zu sein, hatte die 1,80-Meter-Marke knapp verfehlt, hatte dichtes, schwarzes Haar, einen bleistiftdicken Schnurrbart auf der Oberlippe und dazu die sportliche Figur eines Leichttatlehen.
»Ich verstehe. Danke.« Der Oberstleutnant legte den Hörer auf. »Einen Moment noch, Feldwebel. Wir sind sofort fertig.«
Er unterschrieb eilig einige Papiere und reichte sie dem Leutnant.
»Das wäre dann alles, Leutnant Yilmaz.«
»Jawohl, Herr Oberstleutnant.«
Der junge Offizier erhob sich von seinem Stuhl und grüßte. Nachdem der Gruß vom Kommandeur erwidert worden war, nickte er dem Feldwebel freundlich zu und verließ den Raum.
»Schön, Sie wiederzusehen, Feldwebel.«
Oberstleutnant Volker Sternberg betrachtete Volkmann mit einem breiten Grinsen. Sternberg ging stramm auf die 50 zu, maß 1,88 Meter, hatte breite Schultern, eine schmale Taille und ein wettergegerbtes Gesicht. Seit ihrem letzten Zusammentreffen war Sternbergs Augenpartie um einige Falten reicher geworden und das volle, schwarze Haar war an den Schläfen nun grau meliert.
»Ich freue mich auch, Herr Oberstleutnant«, erwiderte Volkmann.
Und dann breitete der grinsende Sternberg die Arme aus und Volkmann begriff, dass jetzt von ihm erwartet wurde, sich dem Oberstleutnant zu nähern, der offensichtlich die Absicht hatte, ihn in die Arme zu schließen. Gehorsam trat er an seinen Kommandeur heran.
»Verdammt, Digger, ich freue mich wirklich, dich zu sehen«, sagte Sternberg und dann legte er die Arme um den jüngeren Mann. »Auch wenn die Leute für gewöhnlich in besserem Zustand eintreffen, um sich bei mir zu melden.«
»Ich bitte den Herrn Oberstleutnant um Verzeihung«, sagte Volkmann etwas betreten. »Aber als wir in Gao landeten, wurde der Flugplatz angegriffen …«
»Ja, davon habe ich schon gehört«, unterbrach ihn Sternberg und ließ den Feldwebel los. »Darum ging es eben am Telefon. Aber über eventuelle Verluste gibt es noch keine Nachricht.«
»Zwei der malischen Milizposten wurden getötet, fünf Mann der UN-Truppe sind verwundet worden«, berichtete Volkmann. »Dazu kommt einiger Sachschaden an Gebäuden und Fluggeräten. Es war ein blitzartiger Feuerüberfall mit Mörsern, so wie wir das schon in Afghanistan erlebt haben.«
Sternberg nickte. »Laut unseren Schlapphüten vom Nachrichtendienst sollen die Aufständischen einige Experten aus Afghanistan und dem Irak angeworben haben. Zudem erhalten die Tuareg seit Neustem auch noch Unterstützung vom Islamischen Staat.«
Die Betonung des Wortes »Experten« ließ keinen Zweifel daran, wie der Oberstleutnant dazu stand.
»War ja klar, dass die sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.«
»Sicher.« Sternberg boxte Volkmann gegen den Arm. »Aber ich habe gehört, dass du dich mal wieder als Lebensretter betätigt hast«, sagte er und lächelte. »Scheint ein richtiges Hobby von dir zu werden, wie?«
Volkmann zuckte nur mit den Schultern. »Ich mache nur mein Job.«
Sternberg schüttelte amüsiert den Kopf. »Guter Konter, Digger.«
Er deutete auf den Stuhl, der eben noch von Leutnant Yilmaz besetzt worden war.
Volkmann nahm Platz und sah den Oberstleutnant erwartungsvoll an.
Sternberg atmete tief durch und faltete die Hände auf dem Schreibtisch. »Damit kommen wir zum Grund, warum ich dich angefordert habe. Was weißt du über die Lage hier?«
»Die Lage ist, mit Verlaub gesagt, beschissen, und es wird immer schlimmer. Jede Woche gibt es zahlreiche Überfälle auf die UN-Truppen, dazu kommen noch gezielte Angriffe auf die zivile Infrastruktur im Süden und jede Menge Anschläge auf die Bevölkerung«, zählte Volkmann auf.
»Sehr schön. Damit weißt du schon mal mehr über die Lage hier als der Bendlerblock oder die Hardthöhe.«
Sternberg deutete auf die Karte an der Wand.
»Wir sitzen hier auf einem Pulverfass, das jederzeit hochgehen kann. Aber wir tun unser Bestes, um die malische Armee zu beraten, auszubilden und zu unterstützen. Dafür brauche ich dich. Ich möchte, dass du mit den Malis arbeitest und sie ausbildest.«
»Auftrag verstanden, Herr Oberstleutnant.«
»Gut. Außerdem möchte ich, dass du auf Leutnant Yilmaz aufpasst. Er ist dein neuer Zugführer und kommt frisch von der Offiziersschule. Das hier ist seine erste Verwendung.«
»Verstanden, auf den Herrn Leutnant aufpassen«, wiederholte Volkmann.
»Du kriegst das schon hin, Digger.« Sternbergs Gesichtsausdruck wurde weicher. »Jetzt mal kurz privat: Wie geht es dir?«
Volkmann rutsche für einen kleinen Moment unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. »Sie wissen ja, wie man so sagt, Herr Oberstleutnant. Für die Eltern soll es viel schlimmer sein als für den Verlobten.«
Das ist nichts weiter als dummes Gelaber, Digger, dachte Sternberg bei sich. Aber er hatte die Frage einfach stellen müssen. Leicht war es ihm nicht gefallen.
»In Ordnung, Digger. Dann bezieh mal dein Quartier. Ach ja, ihr werdet die Wohncontainer mit den Soldaten der malischen Spezialkräfte teilen.«
»Wie bitte?«, fragte Volkmann verblüfft nach. Normalerweise hatten die Soldaten einen gewissen Einfluss darauf, mit wem sie ihren Wohncontainer bezogen. Wenn man über viele Monate hinweg auf engem Raum zusammenlebte, musste man mit seinem Zimmergenossen zumindest einigermaßen gut klar kommen, um unnötige Spannungen zu vermeiden.
Sternberg hob die Hände. »Die Anweisung kommt von ganz oben, da kann man nichts machen. Also werden wir lächeln und unsere Befehle befolgen. Das nennt man auch fröhlichen Gehorsam.«
»Jawohl, Herr Oberstleutnant. Quartier beziehen und fröhlich lächeln.« Der Feldwebel ließ seine Zähne aufblitzen und verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
»Das sollte reichen«, feixte der Oberstleutnant amüsiert. »So, Digger, es hat mich gefreut, aber ich habe noch zu tun.«
Volkmann schoss in die Höhe und grüßte. »Melde mich ab, Herr Oberstleutnant.«
Sternberg hob die Hand an die Schläfe. »Wir sehen uns.«
Volkmann machte kehrt, verließ das Büro des Oberstleutnants. Draußen nahm er sein G36K wieder in Empfang und schrieb dem Oberstabsgefreiten alle Änderungen an der Waffe auf, bevor er den Container verließ. Hauptmann Boiger starrte ihm gedankenverloren nach.
*
Als Volkmann aus dem klimatisierten Stabsgebäude trat, traf ihn die Hitze wie ein Keulenschlag. Er orientierte sich noch einmal kurz am ordentlich ausgehängten Lageplan des Camps und fand die Position des Wohncontainers T-411. Schon nach wenigen Minuten Fußmarsch entdeckte er den gesuchten Container in einer langen Reihe aus Metallkästen, die alle mit eigenen Splitterschutzboxen gesicherten waren. Inzwischen strömte ihm der Schweiß aus allen Poren. Jetzt, gegen Mittag, lag die Temperatur weit jenseits der 40 Grad Celsius.
Vor dem Container mit der Aufschrift T-411 stoppte er und klopfte nach kurzem Zögern an die Tür.
»Herein!«, rief eine tiefe Stimme.
Volkmann öffnete die Tür, trat ein und lächelte. Es überraschte ihn, einen sehr großen Malier im Container stehen zu sehen, der einzig mit schwarzen Boxershorts bekleidet war.
»Überraschung, Weißbrot!«, dröhnte der Mali. Sein Englisch wies einen starken französischen Akzent auf. »Ich weiß genau, was du jetzt denkst.«
»Ach, ja?«
»Ja. Verdammt, die haben mich wirklich mit einem Schwarzen zusammengelegt, das denkst du!«
»Eigentlich denke ich, dass du der größte Afrikaner bist, den ich je gesehen habe«, erwiderte Volkmann ehrlich.
Sein Stubenkamerad war weit über zwei Meter groß und erschreckend muskulös; er wirkte mehr wie ein Gewichtheber denn wie ein Läufer. Sein vor Schweiß glänzender Schädel war vollständig rasiert, aber um Mund und Kinn zog sich ein sorgfältig gestutzter Bart.
»Na, du bist zwar nicht der größte weiße Junge, den ich je gesehen habe, aber ein Zwerg bist du auch nicht gerade«, sagte der Mali und streckte seine riesige Pranke aus. »Sergent-chef Yoro Keita.«
»Feldwebel Michael Volkmann«, stellte sich der Deutsche vor und griff zu.
Einige Sekunden lang spannten sich die Muskeln beider Männer an, wobei sie einander abschätzend taxierten. Auftritt zweier Alphamännchen.
Leicht überrascht stellte Keita fest, dass er die Hand des Deutschen nicht so einfach zusammendrücken konnte, und ließ schließlich los.
»Du bist stärker, als du aussiehst, weißer Junge.«
»Das sagen viele.« Volkmann grinste. »Ziehst du mit jedem Neuankömmling diese Nummer ab, Sergent-chef Keita?«
»Oui.« Keita lächelte breit. »Dein Vorgänger hat nicht bestanden. Der hat sich unentwegt bei mir dafür entschuldigt, dass er mein Volk so lange ausgebeutet und unterdrückt hat. Dabei seid ihr Deutschen weder in der Kolonialzeit noch im Krieg hier in Mali gewesen. Nachdem er mich eine Stunde lang mit diesem Geschwurbel genervt hat, habe ich ihn rausgeworfen.«
Volkmann lachte auf. »Ist das mit dem rauswerfen wörtlich zu verstehen?«
»Oui, Sergent-chef Volkmann«, bestätigte Keita, ehe zwei Reihen weiße Zähne seinen Bart spalteten.
»Dann werde ich mich entgegen meiner Art zurückhalten und mich bemühen, dir nicht auf den Wecker zu fallen«, meinte Volkmann, worauf es nun an Keita war, laut aufzulachen. Der Feldwebel trat zu dem mit einem Moskitonetz geschützten Feldbett, neben dem sein Seesack stand. Rasch räumte er seine Kleidung in den Metallspind ein und stellte seine Ausrüstung sowie sein Gewehr in den zweiten Spind.
»Du hast das schon öfter gemacht«, stellte Keita fest. »Wie lange dienst du bereits in der Armee?«
»Neun Jahre.« Volkmann wischte sich den Schweiß aus den Augen. Die Temperatur im Raum war extrem hoch. Kein Wunder, dass der Mali in Unterwäsche herumlief. »Ist die Klimaanlage kaputt oder was?«
»Welche Klimaanlage bitte?«
Volkmann entdeckte den Schalter für die Klimaanlage unter dem für das Licht und betätigte ihn. Zu seiner Erleichterung strömte nach einigen Augenblicken tatsächlich ein Schwall kühle und relativ trockene Luft aus den Lüftungslamellen. Dieser Luxus wurde allerdings mit einem permanenten Dröhnen erkauft.
»Ich dachte, das wäre ein zweiter Lichtschalter«, brummte Keita und genoss den kühlen Luftzug.
Volkmann drehte sich um und zog das nasse, am Körper klebende T-Shirt aus. Als er ein anderes Shirt aus dem Schrank hervorkramte, sah Keita die Narben an Brust und Bauch des Deutschen.
»Was ist dir denn da passiert, weißer Junge?«
»Ich spazierte in einen laufenden Ventilator«, erwiderte Volkmann leichthin, während er das frische T-Shirt überstreifte.
»Ja, genau so sieht das auch aus!«, brummte Keita. Der hünenhafte Mali betrachtete den Deutschen nachdenklich und mit schräggelegtem Kopf. »Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen, weißer Junge.«
»Na, das freut mich aber, Sergent-chef.«
Keita ging zum Kühlschrank, entnahm ihm zwei Dosen mit einem Fitnessgetränk und reichte eine davon an Volkmann weiter. Die beiden Männer öffneten die Dosen und stießen an.
»Willkommen in Mali, weißer Junge.«
*
Nachdem er Volkmanns Narben gesehen hatte, bestand Keita auf eine ausführliche Erklärung und erhielt diese auch. Im Gegenzug erfuhr der Feldwebel, dass der hünenhafte Sergent-chef nicht nur verheiratet war und drei Kinder hatte, sondern dass seine Familie auch der katholischen Kirche angehörte. Die beiden Soldaten unterhielten sich bis spät in die Nacht hinein und stellten dabei fest, dass sie tatsächlich gut miteinander auskamen.
Die wenigen Stunden bis zum Aufstehen vergingen wie immer viel zu schnell.
»Wach auf, weißer Junge!«, dröhnte Keita fröhlich.
Volkmann rieb sich die noch vom Schlaf verklebten Augen.
»Was ist denn los, Keita?«
»Wie wäre es, wenn unsere Teams gemeinsam einen kleinen Morgenlauf absolvieren?«
Der Sergent-chef betrachtete den Deutschen herausfordernd und Volkmann schloss daraus, dass die Testphase des Mails immer noch nicht ganz abgeschlossen war.
»Gute Idee, Keita. Warte kurz, bis ich mich angezogen habe.« Volkmann schlüpfte rasch in seine Uniform. »Wer führt die Jungs heute Morgen an?«
»Wie regelt Ihr das für gewöhnlich?«, fragte Keita neugierig.
»Na, wie echte Männer natürlich!« Volkmann grinste. »Kennst du Stein, Schere, Papier?«
Der Mali brach in brausendes Gelächter aus, nickte dann aber zustimmend. Sie hoben ihre Fäuste dreimal. Volkmann zeigte Papier, Keita Schere.
»Tja, so kann´s gehen«, kommentierte der Deutsche seine Niederlage.
Die beiden Unteroffiziere trommelten ihre zehn Kameraden aus den anliegenden Wohncontainern zusammen. Diese hatten sich am vergangenen Abend alle mehr oder weniger zusammengerauft. Offenbar hatte derjenige, der für die Stubenbelegung verantwortlich war, tatsächlich etwas richtig gemacht. Nun ja, Wunder gab es immer wieder, wie bereits Katja Ebstein sang.
Der Ehrlichkeit halber musste sich Feldwebel Volkmann jedoch eingestehen, dass seine fünf Kameraden beim Antreten sehr viel angeschlagener wirkten als die Soldaten von Sergent-chef Keita. Besonders Jewgeni machte den Eindruck, als würde er am liebsten die Innenseite seiner Augenlider betrachten statt des Camps in den Schattierungen der weichenden Dunkelheit.
»Guten Morgen, Kameraden!«, rief Volkmann.
»Guten Morgen, Herr Feldwebel!«, hallte es weit leiser zurück als üblich.
»Dies ist Sergent-chef Keita, der Gruppenführer unsere Kameraden von den Spezialkräften der malischen Armee«, stellte Volkmann den zwei-Meter-Mann vor.
»Und dieser weiße Junge hier«, sagte Keita mit breitem Grinsen, »ist Sergent-chef Volkmann von der Bundeswehr, der diese traurigen Gestalten da vorne am Hals hat.«
Seine fünf Männer lachten und auch bei den Deutschen gab es das eine oder andere Grinsen.
»Soweit noch nicht bekannt«, übernahm Volkmann wieder, »sind dies Jewgeni, Stitch, Piet, Matze und Tom.«
»Und hier haben wir Adama, Salif, Modibo, Oumar und Jean«, stellte Keita vor.
Die zehn Männer musterten sich abschätzend. Alle trugen nur Stiefel, Tarnhose und T-Shirt. Die Malis waren alle kleiner als ihr Sergent-chef und bei Weitem nicht so muskulös, wirkten jedoch ebenfalls drahtig und durchtrainiert. Die Mienen strahlten Zuversicht und Entschlossenheit aus. Sie schienen dem Typ Mensch anzugehören, der bei den Spezialkräften genau richtig aufgehoben war.
»Dann fangen wir mal an!«, kommandierte Keita.
Sie begannen mit einigen Liegestützen, die allen leichtfielen, auch wenn die ersten Schweißtropfen aus den Gesichtern der Deutschen perlten. Das Thermometer zeigte bereits über 23 Grad an, obwohl es erst halb sechs am Morgen war.
»Gruppe, links um! Im Laufschritt, mir folgen!«
Keita legte ein strammes Tempo vor, während er die Gruppe zwischen den endlosen Containerreihen entlangtraben ließ. Der Malier entschied, es nicht zu übertreiben, und beließ es für den Anfang bei einem Drei-Kilometer-Lauf durch das Camp. Die Deutschen, die das Laufen durchaus gewohnt waren, schnappten bereits nach dem ersten Kilometer nach Luft. Keita führte sie am Motorpool vorbei, wo die Fahrzeuge gewartet und auf den nächsten Einsatz vorbereitet wurden. Danach ging es am Flugfeld entlang. Dort stiegen bereits zahlreiche Maschinen und Hubschrauber zu ihren ersten Einsätzen des Tages auf. Der Schießstand war noch leer, da bog Keita links ab, führte die hechelnde Gruppe wieder in Richtung der Wohncontainer.
»Aufstellung nehmen!«, rief der Sergent-chef, als sie am Startpunkt eintrafen. »Rührt euch! Na, so schlimm was das gar nicht, oder?«
Die Gruppe war verschwitzt, die nassen T-Shirts klebten ihnen am Leib und die Beine fühlten sich an wie weichgekochte Spagetti. Der einzige Trost für die Deutschen war, dass es den malischen Kameraden nicht besser erging als ihnen.
»Na schön.« Keita grinste breit und präsentierte den anderen Männern zwei Reihen strahlend weiße Zähne. »Die Hitze macht einen völlig fertig. Vergesst nicht, die Sahara befindet sich nur wenige Kilometer nördlich von hier. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran.«
Quatsch mit Soße, dachten die Deutschen so beziehungsweise sinngemäß. Allerdings wussten sie, dass der Sergent-chef Recht hatte.
»Wir fangen jetzt ganz gemütlich an. Ihr habt eine Stunde Zeit, um euch zu erholen und etwas zu frühstücken. Schlagt euch den Wanst jedoch nicht zu voll, heute Vormittag wollen wir auf den Schießstand. Um acht treten wir hier zur Waffenausbildung an. Wegtreten.«
Die Gruppe zerstreute sich.
Keita und Volkmann betraten ihren Container.
»Ach, Scheiße, und ich dachte, ich wäre fit«, stieß der deutsche Feldwebel keuchend hervor und rieb sich die brennenden Beinmuskeln.
»Wie gesagt, das ist die Hitze.« Keita reichte ihm eine Wasserflasche, die der Deutsche sofort öffnete. Volkmann setzte die Flasche an, behielt das Wasser jedoch einige Sekunden lang im Mund, bevor er es herunterschluckte.
»Ich habe zehn T-Shirts eingepackt«, brummte Volkmann, während er das klebende Kleidungsstück auszog. »Aber wenn das so weitergeht, reichen die nur für zwei Tage.«
»Such dir eine Frau, weißer Junge!«, riet ihm Keita und lachte, während er die Hände ausbreitete. »Sie wäscht für dich, kocht für dich und bietet dir auch sonst einige Vorteile!«
Volkmann erstarrte für eine Sekunde, was Keita keineswegs entging. Der Deutsche setzte sich wieder in Bewegung, aber sein Gesicht verdunkelte sich vor Trauer.
»Kein gutes Thema, was?«, fragte der Malier.
»Wir wollten heiraten, aber sie ist vorher gestorben.«
»Tut mir leid, mein Freund«, sagte Keita betroffen.
»Ist schon gut. Es ist jetzt über zwei Jahre her«, sagte Volkmann mit einem traurigen Lächeln.
Der Malier sah jedoch, dass es keinesfalls gut war.
Der Schießplatz war großflächig angelegt, damit die Soldaten der UN-Mission in Camp Castor ihre Waffenübungen durchführen konnten. Rote Flaggen warnten vor dem Einsatz von scharfer Munition. Bis auf eine Gruppe von Männern, die aus verschiedenen afrikanischen Staaten stammten, waren die Malier und Deutschen um Keita und Volkmann jedoch allein. Sie trugen nun Tarnuniform, hatten jeweils einen Tropenhut auf dem Kopf und eine Sonnenbrille auf der Nase, um die Augen vor dem grellen Tageslicht zu schützen.
Eine große Auswahl an Waffen war auf den Tischen bereitgelegt worden. Bei den malischen Soldaten dominierten verschiedene Varianten der Kalaschnikow, Modelle aus sowjetischer, chinesischer und jugoslawischer Produktion, ferner RPK- und PKM-Maschinengewehre das Inventar. Dazu kamen Tokarew-Pistolen und alte französische Maschinenpistolen MAT-49.
Die Bundeswehrsoldaten verfügten natürlich über Waffen aus heimischer deutscher Produktion: verschiedene Modelle des G36, leichte Maschinengewehre MG4, Pistolen P8 und kompakte MP7-Maschinenpistolen.
»Achtung!«, rief eine laute Stimme.
Die Soldaten, die seit 15 Minuten an den Tischen diverse Magazine mit Patronen füllten, fuhren herum und nahmen Haltung an.
Ein malischer Capitaine, der einen weiteren Sergent-chef bei sich hatte, sowie Leutnant Yilmaz, dem wiederum ein Hauptfeldwebel folgte, näherten sich der gemischten Gruppe.
»Bonjour, Männer!«, rief der malische Hauptmann.
»Bonjour, mon Capitaine!«, schallte es zurück.
»Rührt euch, Männer. Wie ich sehe, arbeiten Sie bereits zusammen. Das ist gut, sehr gut.« Der Capitaine lächelte. Er war von hellerer Hautfarbe als die anderen malischen Soldaten der Gruppe. Sein Gesicht wies einen arabischen Einschlag auf. Er war groß, sportlich und wirkte auf den ersten Blick sympathisch.
»Für diejenigen, die mich noch nicht kennen: Ich bin Capitaine Seydou Bamba, der Zugführer der malischen Spezialkräfte«, stellte er sich vor. »Dies ist Lieutenant Mehmet Yilmaz, der Zugführer unserer deutschen Kameraden.«
»Guten Morgen«, grüßte Yilmaz.
»Guten Morgen, Herr Leutnant!«
»Sergent-chef Keita, wir würden gerne bei der Waffenausbildung zusehen«, informierte Bamba seinen Gruppenführer.
»Es wäre uns eine Ehre, mon Capitaine«, erwiderte Keita und wies einladend auf die Tische mit den Waffen und der Munition.
Der deutsche Hauptfeldwebel bewegte sich indessen auf Volkmann zu.
»Sieh mal an, wen der Wüstenwind herbeigeweht hat«, sagte er und richtete den Blick seiner dunklen Sonnenbrille auf den Feldwebel.
Volkmann fühlte sich erkennbar unbehaglich und sein Unterkiefer schob sich angespannt vor.
»Ich wusste nicht, dass du auch hier bist«, brachte er schließlich hervor.
»Sonst hast du nichts zu sagen?« Der Hauptfeldwebel nahm die Sonnenbrille ab. Seine braunen Augen musterten Volkmann eingehend. »Verdammt noch mal, Michael! Wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht! Du hast auf keinen Anruf reagiert, auf keine Mail, gar nichts!«
Volkmann schien unter den Worten des Hauptfeldwebels sichtbar zusammenzuschrumpfen.
»Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten«, sagte er schließlich mit belegter Stimme. »Jeder hatte Mitleid mit mir und hat versucht, mich zu trösten. Ich wollte nur noch weg von alldem.«
»Und da haust du einfach ab, ohne ein Wort zu sagen, was?« Markus Neubert schüttelte den Kopf. »Du warst schon immer ein sturer, verschlossener Eigenbrötler, aber damit hast du dich selbst übertroffen, du blöder Arsch. Verschwindest für fast zwei Jahre auf Auslandsmissionen, ohne deinen Freunden vorher auch nur ein Wort zu sagen!«
Volkmann rang sich zu einem schwachen Lächeln durch. »Würde es dir helfen, wenn ich dir sage, dass es mir leid tut?«
»Ja, das würde helfen, du dämlicher Schwanzlurch!«
Und damit trat Neubert noch einen Schritt näher an seinen alten Freund heran und umarmte ihn.
»Blöder Kerl, machst einfach so die Biege. Du bist wirklich unglaublich«, meinte Neubert, aber seiner Stimmelage war anzumerken, wie sehr ihm das Wiedersehen naheging.
Volkmann war froh über die Sonnenbrille, damit niemand sah, dass seine Augen feucht geworden waren.
»Lass mich mal wieder los, Markus. Die gucken alle schon so komisch.«
Neubert lachte auf, gab den jüngeren Mann aber frei.
»Du Blödmann! Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie sehr mir Sabine in den Ohren gelegen hat, damit ich herausfinde, wo du abgeblieben bist?«
»Entschuldigung, Spieß.«
Verlegen sahen sie sich an.
Leutnant Yilmaz hatte die Szene mit Interesse verfolgt.
»Sie kennen einander wohl schon.«
»Jawohl, Herr Leutnant«, bestätigte Neubert. »Wir waren zusammen dreimal in Afghanistan und sind auch privat befreundet.«
»Nun, wenn Sie dann fertig sind …«
»Natürlich, Herr Leutnant.«
Neubert boxte Volkmann gegen den Arm; es war nicht besonders sanft, aber der Feldwebel zeigte außer einem dünnen Lächeln keine Reaktion darauf.
»Darf ich vorschlagen, zunächst Feldwebel Volkmann schießen zu lassen? Er ist ein Experte mit allen möglichen Feuerwaffen und war schon in seiner Jugend im Schützenverein«, sagte Neubert zu den Offizieren.
»Nur zu, Sergent-chef Volkmann«, forderte ihn Bamba auf.
»Jawohl, mon Capitaine«, antwortete Volkmann und warf dem grinsenden Hauptfeldwebel einen vernichtenden Blick zu. Er hängte sich Ohrschützer um den Hals, schulterte sein G36K und steckte zwei Magazine mit je dreißig Schuss in seine Kampfweste.
Keita winkte dem belgischen Offizier, der die Aufsicht führte, während Volkmann an die Feuerlinie trat. Der Feldwebel setzte sich die Ohrschützer auf, zog ein Magazin aus der Weste und steckte es in den Magazinschacht, wo es mit einem vernehmbaren Klicken einrastete. Dann zog er den Spannhebel zurück und beförderte die erste Patrone aus dem Magazin ins Patronenlager.
»Klar zum Feuern«, meldete er mit lauter Stimme.
»Feuererlaubnis erteilt!«
Volkmann zog das Gewehr an die Schulter und stellte den Sicherungshebel mit dem Daumen auf »Einzelfeuer«. Sein Kopf senkte sich automatisch in die richtige Stellung, um durch das Visier schauen zu können. Er gab den ersten Schuss ab und das Gewehr schlug relativ weich gegen seine Schulter. Die 5,56 x 45-Millimeter-Kugel fuhr mitten durch den Kopf des menschlichen Umrisses auf der Zielscheibe der 100-Meter-Range. Er gab zwei weitere Schüsse ab, traf erneut und feuerte dann fünfmal in rascher Folge. Die wiederholten Schüsse schienen seine Zielgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen, denn alle acht Treffer lagen in einer schön dichten Gruppe; die Scheibe hatte nun ein Loch in der Nase, für das man drei oder vier Finger bräuchte, um es abzudecken.
Nun legte Volkmann den Sicherungshebel auf die Position »Feuerstoß« um.
Die Serien aus jeweils drei Geschossen fuhren in die Herzgegend des Ziels, nun zwar etwas breiter gestreut, aber dennoch wäre jeder einzelne Treffer tödlich gewesen. Dauerfeuer nutzte Volkmann nicht; das wäre ohnehin nur Munitionsverschwendung gewesen. Bei der Infanterie war Munition etwas, das man mitschleppen musste, da ballerte man nicht wild in der Gegend herum. Er verschoss den Rest des Magazins auf das Ziel und wurde mit Treffern belohnt, die alle genau dort saßen, wo er sie haben wollte. In der Brust der menschlichen Silhouette klaffte nun ein Loch, das man mit einer Faust abdecken müsste. Er hob den Kopf vom Visier, sicherte, zog das leere Magazin aus dem Schacht und führte eine Sicherheitsüberprüfung durch, ehe er von der Feuerlinie zurücktrat.
»Nicht übel, Sergent-chef«, bemerkte Bamba mit einem Fernglas an den Augen. »Sogar hervorragend, will ich meinen.