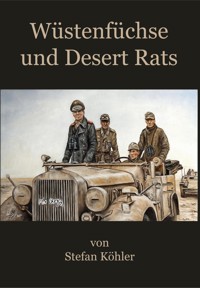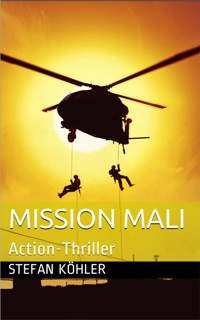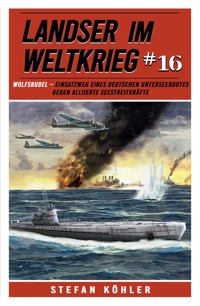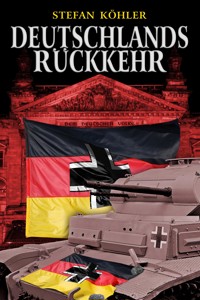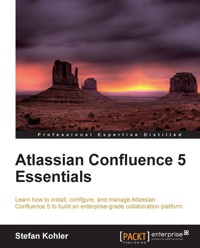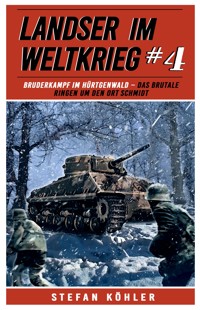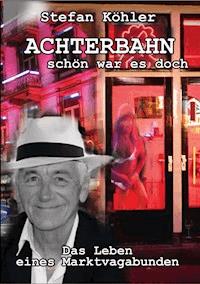7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Militär
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kaleu Wegener und seine U-Boot-Männer von U 139 sind zurück in der Nervenkitzel-Fortsetzung zu Stefan Köhlers U-Boot-Bestseller "Auf Feindfahrt mit U 139"!
Wir schreiben das Jahr 1943. Immer mehr deutsche U-Boote kehren von ihrer Feindfahrt nicht zurück, immer mehr Matrosen finden auf dem Grund der Weltmeere ihr nasses Grab.
Die hohen Verluste sorgen dafür, dass die U-Boote der alten Garde einige erfahrene Männer an neue Boote abgeben müssen. Der frischgebackene Leutnant Dahlen gelangt somit als Erster Wachoffizier an Bord von U 228.
Derweil hat die Aufklärung einen gewaltigen alliierten Geleitzug ausgemacht, der mutmaßlich Truppen nach Europa verschifft. Die Befehle der Flottille sind klar: Alle verfügbaren U-Boote laufen aus, bilden ein Wolfsrudel und heften sich an den Geleitzug, um so viele Schiffe wie möglich zu versenken.
Somit stechen auch U 139 unter Kaleu Wegener und U 228 in See. Für Leutnant Dahlen beginnt dabei ein persönlicher Spießrutenlauf an Bord von U 228: Sein Kommandant ist ein unerfahrener Napola-Absolvent, dessen blinder Fanatismus das gesamte U-Boot in große Gefahr bringt.
Und dann geraten sie schon an den Feind. Die Augen der Männer blicken an die Decke, als das unverwechselbare Stampfen des feindlichen Zerstörers erklingt. Im nächsten Augenblick erfolgt schon das unbarmherzige Ping-Ping-Ping des ASDIC-Strahls, der nach U 228 greift, um es zu orten.
Der Jäger wird zum Gejagten …
»Auf Feindfahrt Teil II – Wölfe der See« ist ein spannungsgeladener und erschütternder Roman, der den Krieg zur See auf realistische Weise nachzeichnet.
Auf dem Höhepunkt ihrer Macht vermochten die deutschen U-Boote jährlich mehr als 8 Millionen Bruttoregistertonnen Schiffsraum zu versenken. Den Preis dafür zahlten die deutschen U-Boot-Fahrer. Von der Propaganda gefeiert, kehrten viele von ihnen nicht von ihren gefahrvollen Feindfahrten zurück.
Detaillierte Illustrationen von Markus Preger unterstützen die Geschichte und liefern Ihnen ein realitätsnahes Bild von den Geschehnissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefan Köhler
Auf Feindfahrt Teil II – Wölfe der See
Zweiter Weltkrieg: Marine-Thriller über ein deutsches U-Boot im Einsatz
EK-2 Militär
Mit Illustrationen von Markus Preger
Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr!
Tragen Sie sich in den Newsletter von EK-2 Militär ein, um über aktuelle Angebote und Neuerscheinungen informiert zu werden und an exklusiven Leser-Aktionen teilzunehmen.
Als besonderes Dankeschön erhalten Sie kostenlos das E-Book »Die Weltenkrieg Saga« von Tom Zola. Enthalten sind alle drei Teile der Trilogie.
Klappentext: Der deutsche UN-Soldat Rick Marten kämpft in dieser rasant geschriebenen Fortsetzung zu H.G. Wells »Krieg der Welten« an vorderster Front gegen die Marsianer, als diese rund 120 Jahre nach ihrer gescheiterten Invasion erneut nach der Erde greifen.
Deutsche Panzertechnik trifft marsianischen Zorn in diesem fulminanten Action-Spektakel!
Band 1 der Trilogie wurde im Jahr 2017 von André Skora aus mehr als 200 Titeln für die Midlist des Skoutz Awards im Bereich Science-Fiction ausgewählt und schließlich von den Lesern unter die letzten 3 Bücher auf die Shortlist gewählt.
»Die Miliz-Szenen lassen einen den Wüstensand zwischen den Zähnen und die Sonne auf der Stirn spüren, wobei der Waffengeruch nicht zu kurz kommt.«
André Skora über Band 1 der Weltenkrieg Saga.
Link zum Newsletter:
https://ek2-publishing.aweb.page
Über unsere Homepage:
www.ek2-publishing.com
Klick auf Newsletter rechts oben
Via Google-Suche: EK-2 Verlag
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Jill & Moni
von
EK-2 Publishing
U-Boot
Ein Gedicht aus dem Ersten Weltkrieg
Vier Wochen Tag und Nacht
im Lederzeug geschlafen – gewacht,
vierzig Mann, die ein starker Geist
auf Tod und Leben zusammenschweißt,
wisst ihr, was das heißt?
Tag und Nacht und Nacht und Tag
Motorengerassel, Maschinenschlag
rastlos rasend die Kurbel kreist,
Öldunst der in Lungen und Augen beißt,
wisst ihr, was das heißt?
Wenn schäumend die Gischt das Boot umtollt
wenn es schlingert, stampft und rollt,
wenn der Sturm die See auseinanderreißt,
wenn die Kälte der Wache den Atem vereist,
wisst ihr, was das heißt?
Geleitzug, Zerstörer und Kreuzer vereint,
zum Schutze der Dampfer, denn: »Ran an den Feind!«,
der wütend Bombe auf Bombe schmeißt,
bis hell krachend ihn ein Torpedo zerreißt,
wisst ihr, was das heißt?
Und bei euch, wenn da ein Zeitungsblatt hängt:
Vierzigtausend Tonnen versenkt!
Denkt einmal nach, was es schweigend spricht,
freilich wir tun ja nur unsere Pflicht,
doch ihr ahnt es nicht, was das heißt
denn ihr wisst es nicht!
Nordatlantik
Frühsommer 1943
Das Fadenkreuz glitt langsam vor den Bug des Frachters, wanderte weiter und erfasste dann die weiteren Dampfer des Konvois, welcher sich über das graue Schimmern des Nordatlantiks nach Osten bewegte. Im Zusammenspiel mit dem ähnlich grauen und mit Wolken bedeckten Himmel hoben sich die in Tarnfarben gestrichenen Schiffsrümpfe kaum von den Wellen ab. Das war natürlich beabsichtigt, denn feindlichen U-Booten, Schiffen und Flugzeugen sollte die Erkennung erschwert werden. Das helle Weiß der Bugwellen aber durchbrach das stumpfe Grau-in-grau und wies auf die relativ hohe Geschwindigkeit des Konvois hin.
Der Mann, der durch das Sehrohr auf die Dampfer blickte, wusste den Anmut der durch die See stampfenden Schiffe durchaus zu schätzen, aber dann holte ihn die harte Realität des Krieges wieder ein.
»Sehrohr einfahren. Neuer Kurs eins-fünf-fünf«, ordnete der Kommandant an.
»Sehrohr einfahren. Neuer Kurs eins-fünf-fünf«, wiederholte der Zentralmaat.
Der Kommandant drückte die Sprechtaste der Bordsprechanlage.
»Zentrale an Bugraum: Wie ist der Zustand meiner Bugrohre?«, fragte Korvettenkapitän Hans-Jörg Wegener.
Der Kommandant des U-Bootes war schlank, hatte dunkle Haare und ein sympathisches Gesicht, aus dem die geübten Augen eines erfahrenen Jägers herausstachen. Auf seinem Haupt thronte eine speckige, weiße Mütze, deren Schirm er stets nach hinten zu drehen pflegte, bevor er durch die Optik des Sehrohrs blickte. Nun trat er einen Schritt zurück und drehte den Schirm wieder nach vorne.
Wegener fröstelte trotz des dicken Strickpullovers, den er anstelle der ausgegebenen Uniform trug. Auf U 139 herrschte wie eigentlich auf allen Einheiten der U-Boot-Waffe eine eher legere Auslegung der Bekleidungsvorschriften. In den engen, kalten, tropfenden, stinkenden und mit allerlei technischen Geräten, Nahrungsmitteln und Waffen vollgestopften Eisenröhren war militärisches Gehabe fehl am Platze. Hier draußen auf hoher See wurde den praktischen Dingen der Vorrang gegeben, und wenn der Kommandant einen dicken Strickpullover über der Seehose tragen wollte, konnte ihm das ohnehin niemand verbieten.
Ein starker Kaffee wäre jetzt genau das Richtige, aber seitdem die Kriegsmarine diese dünne, miese Plörre von Ersatzkaffee bereitstellte, musste der Kommandant auf den Konsum seines innig geliebten Kaffees verzichten. Die Ersatzbrühe schmeckte fast genauso schlimm, wie sie roch, daran konnte auch der beste Smutje nichts ändern – und Ott war der beste, den Wegener kannte.
Im ganzen Boot roch es unangenehm nach einer Mischung aus Schimmel und den ungewaschenen Körpern der Besatzung, worüber sich dann noch der allgegenwärtige Gestank des Diesels legte. An so etwas wie eine heiße Dusche oder auch nur die grundlegendste Körperreinigung war an Bord eines sich im Einsatz befindlichen U-Bootes nicht zu denken. Wegeners Bart juckte ganz fürchterlich. Die letzte Dusche und die letzte Rasur hatte er vor drei Wochen in Brest genossen …
Es knackte leise im Lautsprecher, dann erklang die Antwort aus dem im Bug gelegenen Torpedoraum: »Bugraum an Zentrale: Die Störung ist behoben, Herr Kommandant. Der IWO ist wieder auf dem Weg in die Zentrale.«
Wegener drückte auf die Sprechtaste: »Zentrale an Bugraum. Verstanden.«
Da schwang sich auch schon der Erste Wachoffizier durch das vordere Kugelschott und näherte sich dem Kommandanten.
»Technische Störung behoben, Herr Korvettenkapitän. Alle vier Bugrohre sind jetzt geladen und klar zum Schuss.«
»Um was für ein Problem handelte es sich denn, IWO?«
Leutnant Joachim Dahlen zuckte nichtssagend mit den Schultern.
»Nun, um ein gelöstes Problem, Herr Kapitän. Ich glaube kaum, dass es sich noch einmal bemerkbar machen wird.«
»Verstehe, IWO«, sagte Wegener und musterte den jungen Leutnant eindringlich mit seinen dunklen Augen. »Dann wollen wir es dabei belassen.«
Dem Korvettenkapitän ging zum wiederholten Male der Gedanke durch den Kopf, dass sein Erster Wachoffizier so aussah, als wäre er einem Rekrutierungsplakat der Waffen-SS entsprungen: Dahlen war groß, blond und hatte blaue Augen. Einzig sein struppiger Bart und seine Kleidung störten das ansonsten perfekte Bild. Der IWO trug ein schwarz-weiß kariertes Baumwollhemd über seiner Arbeitshose, dessen Ärmel er bis oberhalb der Ellbogen aufgerollte hatte, was seine muskulösen Unterarme zur Geltung brachte. Dahlen hatte vor einer Woche seinen vierundzwanzigsten Geburtstag gefeiert. Der IWO war bei den Männern sehr beliebt und für die jüngeren fast so etwas wie ein großer Bruder.
Der Kommandant vermutete, dass hinter der »technischen Störung«, wie Dahlen es formuliert hatte, in Wirklichkeit der neue Torpedomaat im Bugraum steckte. Maat Richter war ein ganz anderes Kaliber als sein Vorgänger Timmler. Der hatte seine Mannschaft fest im Griff gehabt und die Aale stets in Rekordzeit in die Rohre bekommen. Aber seit Timmler von Bord versetzt worden war, gegen seinen ausdrücklichen Wunsch und auch gegen den seines Kommandanten, mussten sie mit Richter vorliebnehmen. Der tat, was ihm möglich war, aber leider war er noch nicht erfahren genug, um den hohen Anforderungen seines neuen Kommandanten gerecht zu werden.
»Der Konvoi zackt, Herr Kapitän«, verkündete Leutnant Robert Blasius, der am Navigationstisch stand. Der Zweite Wachoffizier litt zeitlebens unter seinem Nachnamen beziehungsweise unter Mitmenschen, die darüber Witze machten. Da Blasius einfach nicht über die körperlichen Fähigkeiten verfügte, solchen Spöttern eins auf die Nase zu geben, ignorierte er sie bisweilen. Der Leutnant hatte kurzes, braunes Haar, war von durchschnittlicher Größe und wies auch sonst keine besonderen Merkmale auf. Wäre man ihm auf der Straße begegnet, so würde man sich kaum an ihn erinnern. Am liebsten vergrub sich der IIWO in irgendwelchem Papierkram; Zahlen, Listen und ähnliche Dinge schienen es ihm angetan zu haben, womöglich, weil er dann nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten musste.
»Der neue Kurs des Konvois ist jetzt eins-fünf-fünf, ganz so, wie Sie es vorhergesehen haben, Herr Kapitän. Die Geschwindigkeit beträgt nach wie vor fünfzehn Knoten.«
Wegener fühlte sich durch die unverhohlene Bewunderung in der Stimme seines IIWO peinlich berührt und sah zu Dahlen hinüber, der vergeblich gegen ein breites Grinsen ankämpfte.
Der Posten eines U-Boot-Kommandanten brachte eine gewisse Einsamkeit mit sich. Die war nun einmal notwendig, denn als Befehlshaber konnte man sich nicht mit den Männern verbrüdern, die man ins Gefecht und möglicherweise in den Tod schicken musste. Für seine Besatzung war der Kommandant nicht nur der Befehlshaber, er war – vor allem für die jüngeren Männer – auf gewisse Weise eine Vaterfigur; freundlich, wenn es angebracht war, aber ebenso streng und distanziert, wenn notwendig.
In ihrer aus einer Eisenröhre bestehenden Welt voller Handräder, Rohre, Leitungen und vielen, vielen anderen technischen Gerätschaften war der Kommandant die zentrale Figur, die dafür sorgte, dass das Zusammenwirken von Mensch und Technik funktionierte und daraus eine schlagkräftige Waffe entstand. Mit seinen dreiunddreißig Jahren war Wegener nach menschlichen Maßstäben im besten Mannesalter – in Bezug auf das Durchschnittsalter seiner Mannschaft gehörte er jedoch fast schon zum alten Eisen. Die neuen Gesichter an Bord erinnerten Wegener stets auf schmerzliche Weise daran, dass man viele seiner Männer auf andere Boote versetzt hatte, deren Mannschaften noch grün hinter den Ohren waren und die dringend einen harten Kern aus wenigstens einigen gut ausgebildeten und erfahrenen Seeleuten benötigten.
Deshalb war Wegener so sehr auf seine Offiziere angewiesen; sie waren die einzigen, mit denen er mehr oder weniger offen sprechen und sich beraten konnte. Neben seiner rechten Hand, dem IWO, traf dies vor allem auf den Leitenden Ingenieur zu, der mit vor der Brust verschränkten Armen am hinteren Kugelschott lehnte. Oberleutnant Reinhold Stollenberg, dem der nicht unbegründete Ruf anhaftete, in Brest einen wahren Harem von willigen Marinehelferinnen zu unterhalten, stieß sich vom Schott ab und trat an den Navigationstisch heran.
»Jetzt haben Sie den Kommandanten aber ganz verlegen gemacht, Herr Blasius«, sagte der LI. Er war ein gutaussehender Mann, der am liebsten in seinem Maschinenraum an seinen beiden Dieselmaschinen herumwerkelte und sie – und damit das ganze Boot – in Topform hielt. Stollenberg war jetzt neunundzwanzig und nach dem Kommandanten der drittälteste an Bord.
»So etwas wie hellseherische Fähigkeiten hat ihm noch keiner unterstellt.«
Den Titel des Ältesten an Bord verbuchte Oberbootsmann Horst Brandes für sich. Der erfahrene Unteroffizier war die seemännische Nummer Eins von U 139 und zeichnete dafür verantwortlich, die neuen Jungs auf einen Wissens- und Ausbildungsstand zu bringen, der dem Kommandanten zusagte. Brandes war mit einundvierzig Jahren fast schon der »Opa« der Mannschaft, auch wenn es niemand wagen würde, ihm das offen ins Gesicht zu sagen.
»Na, na, LI«, ermahnte Brandes den Oberleutnant. »Immer langsam mit den jungen Leutnants.«
Blasius bekam rote Ohren. Der Leutnant hatte seine Hochachtung für den Korvettenkapitän nicht so deutlich zeigen wollen, aber wie üblich war er über das Ziel hinausgeschossen. Das konnte man ihm nicht wirklich vorhalten; der Leutnant war erst einundzwanzig.
»Verzeihung, Herr Kapitän«, murmelte Blasius verlegen.
Wegener wechselte einen Blick mit Dahlen und dem LI, der sagen sollte: Waren wir auch einmal so jung? Die beiden Offiziere grinsten nur und Wegener stieß ein lautloses Seufzen aus.
»Lassen Sie sich von den anderen nicht auf den Arm nehmen, IIWO. Ich wusste, wohin der Konvoi steuern würde, weil er die letzte halbe Stunde in die andere Richtung gezackt hat. Diese Geleitzugführer sind ziemlich berechenbar, wenn man erst einmal dahintergekommen ist, wie sie ticken.«
»Jawohl, Herr Kapitän.« Blasius wechselte von Verlegenheit auf Nervosität. Dies war erst seine zweite Fahrt an Bord von U 139; zuvor hatte er die 1. Unterseebootslehrdivision in Pillau besucht. Der Leutnant hatte sich noch nicht an die harten Bedingungen des modernen Seekrieges gewöhnt, ebenso wie die anderen Neuzugänge an Bord.
Ein U-Boot war der Jäger in den Weltmeeren – und wurde dennoch selbst gejagt. Zerstörer, Fregatten und Korvetten waren ebenfalls Jäger, die den stählernen Haien unterhalb der Wasseroberfläche nachstellten und versuchten, sie zu erlegen. Hinzu kamen die feindlichen Flugzeuge, die mit Wasserbomben und Geschützen selbst aktiv die deutschen U-Boote hetzten, wann immer sich ihnen die Möglichkeit dazu bot. Auf Grönland und Island hatten die Alliierten Flugplätze errichtet und von dort aus stiegen Langstreckenbomber und Seeaufklärer auf, um die U-Boote der Kriegsmarine im Nordatlantik aufzuspüren. Hier rächte es sich wieder einmal, dass Deutschland nicht über geeignete Jäger für Langstreckeneinsätze oder gar über Flugzeugträger verfügte, die den Booten im Einsatz die so dringend benötigte Luftunterstützung hätten liefern können. Aber auch ohne Einwirkung des Feindes war das Leben eines U-Boot-Mannes nicht ohne Gefahren; durch technische oder menschliche Fehler, Unfälle und Sabotage war schon so manches Boot in arge Schwierigkeiten geraten oder gar auf den Grund des Meeres gesunken.
»Horchraum an Zentrale«, meldete sich der Sonargast Felmy aus seiner kleinen Kammer, die in etwa die Größe eines Besenschranks hatte. »Zwo Kontakte in eins-fünf-null und in eins-drei-acht. Schnelle Schrauben, könnten Zerstörer sein. Entfernung etwa fünf bis sieben Seemeilen. Sie treiben sich auf der anderen Seite des Konvois herum.«
»Zentrale an Horchraum. Verstanden«, antwortete Wegener über die Sprechanlage.
Die Briten hatten gleich bei Kriegsausbruch eine wirksame Geleitzugorganisation geschaffen, denn sie hatten ihre Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen. Schon damals war das Empire von den U-Booten der Deutschen an den Rand einer Niederlage gebracht worden. Gerüchten zufolge wäre es nur noch eine Frage von mehreren Wochen gewesen, bis England hätte kapitulieren müssen. Aber dann waren die praktisch unbegrenzten Verstärkungen aus den USA verfügbar geworden, und der Krieg war für Deutschland verloren gewesen. Ein Umstand, der heute in den Stäben der Kriegsmarine immer noch für schlaflose Nächte sorgte. Jedenfalls sicherten die Alliierten ihre Konvois mit allen Begleitschiffen, die sie auftreiben konnten: Zerstörer, Fregatten, Korvetten, sogar Kreuzer und gelegentlich ein dickes Schlachtschiff fuhren auf den Routen der Geleitzüge mit. Der neuste Trick der Briten und Amerikaner war es, kleine Geleitflugzeugträger einzusetzen. Da es für die großen Flottenträger mehr als genug andere Missionen gab, hatte man Fracht- und Tankschiffe zu leichten Trägern umgebaut. Da die Rümpfe dieser Schiffe auf zivilen Entwürfen basierten, war ihre Geschwindigkeit nicht hoch genug, um mit anderen Kriegsschiffen im Einsatz mitzuhalten, aber um die Geleitzüge vor U-Booten zu schützen, dafür waren sie bestens geeignet. Doch auch ohne diese zusätzliche Bedrohung aus der Luft verfügten die großen Geleitzüge über hinreichenden Schutz durch ihre Begleitschiffe.
Die beiden Zerstörer, die sich jenseits dieses Konvois herumtrieben, waren die sogenannten Kolonnenfeger. Sie hielten sich stets an den Flanken der drei Schiffskolonnen und achteten sowohl auf feindliche U-Boote als auch auf die Kapitäne der Frachter, die sich nicht immer an die Anweisungen des Konvoiführers hielten. Die Aufgabe der Kolonnenfeger ähnelte der eines Schäferhundes, der seine Lämmerherde bewachte.
Und die Besatzungen der Feger waren wütend.
In der letzten Nacht hatte U 139 zwei Frachter aus der Herde versenkt und einen weiteren zum Krüppel geschossen. Die Mannschaft hatte von Bord gehen müssen und dem brennenden Frachter war von einem der Zerstörer mit einem Torpedo der Todesstoß versetzt worden.
Neben U 139 jagten sieben weitere deutsche Boote den Geleitzug und griffen immer wieder an. Das verbale Geplänkel der erfahrenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften an Bord von U 139 war natürlich reine Show für die Neuen an Bord – wenn ihre Vorgesetzten und Kameraden die Lage mit Spott überspielten, konnte es ja gar nicht so schlimm sein, oder?
Die Angst war der größte Feind einer U-Boot-Besatzung. Verlor nur einer die Nerven, vermochte die Panik auf alle anderen überspringen, und das wäre dann so gut wie das Todesurteil für die gesamte Besatzung.
Brommm!
Ein dumpfes Grollen rumpelte durch die See und versetzte den Rumpf des U-Bootes vom Typ IX B in sanfte Schwingungen.
»Sieh an«, bemerkte Wegener und grinste extra breit. »Da ist einer der Kameraden am Konvoi und holt sich den nächsten Frachter. Wird Zeit, dass wir uns auch wieder ans Werk machen, Männer. Sehrohr ausfahren, LI!«
»Sehrohr ausfahren!«, wiederholte Stollenberg.
Der Spargel fuhr, von der Hydraulik angetrieben, nach oben. Wegener drehte den Schirm seiner Mütze nach hinten und nahm einen schnellen Rundblick.
»Keine Flugzeuge in der Luft auszumachen. Nun, zu dieser Stunde nicht weiter verwunderlich.«
Der Kommandant schaltete vom Luftzielfernrohr auf Seebetrieb um.
»Da haben wir ja unsere Kunden wieder. Drei schöne Kolonnen, die hintereinander her dampfen.«
Mehrere, dumpfe Schläge hallten durch das Wasser heran.
»Wasserbomben«, stellte Dahlen fest. »Die Feger haben einen der Kameraden am Wickel.«
»Ja, wir sollten die Gelegenheit nutzen, solange sie besteht«, meinte Wegener. »Rohre Eins bis Vier bewässern! Mündungsklappen öffnen!«
»Rohre Eins bis Vier bewässern, Mündungsklappen öffnen!«, gab der Erste Wachoffizier weiter.
Leutnant Blasius eilte zum Waffenrechner hinüber, um die Daten einzugeben, sobald der Kapitän sie ansagen würde.
»Dreiundzwanzig Grad relative Richtung«, sprach Wegener.
Der Leutnant gab den Wert ein und der Vorhalterechner ratterte.
»Dreiundzwanzig Grad eingestellt.«
»Entfernung 2.000 Meter.«
»2.000 Meter eingestellt«, meldete Blasius, nachdem er die Entfernung eingegeben hatte.
»Zweite Peilung: Jetzt einundzwanzig Grad relativ«, sagte Wegener die Daten für den zweiten Frachter an.
Das Rechengerät ratterte wieder.
»Einundzwanzig Grad relativ, eingestellt.«
»Entfernung 1.500 Meter.«
»Entfernung 1.500 Meter.« Der Zweite Wachoffizier wischte sich mit dem Handrücken rasch einen Schweißtropfen von der Braue, bevor er ihm ins Auge geraten konnte.
Jetzt war es so weit!
»Zentrale an Bugraum: Wir schießen Dubletten auf jedes Ziel. Alles klar zum Schuss!«
»Bugraum an Zentrale: Rohr Eins bis Vier bereit«, meldete Torpedomaat Richter.
»Achtung! Rohr Eins und Zwo … los!«
»Eins und Zwo los!«, echote Dahlen und drückte auf die Stoppuhr.
Zweimal ging ein Ruck durch den Bootskörper, als die beiden ersten Aale aus ihren Rohren ausgestoßen wurden.
Stollenberg und seine Tauchmannschaft bemühten sich rasch, das Boot in der vorgesehenen Tiefe zu halten, denn durch den Abschuss der Aale war es rund drei Tonnen leichter geworden.
»Rohr Drei und Vier … los!«
»Drei und Vier los!« Der Erste Wachoffizier betätigte die zweite Stoppuhr.
Wieder liefen die Erschütterungen durch U 139, als das nächste Paar Torpedos davon zischte.
»Vorne unten fünf«, ordnete der LI an, um den hinzugewonnenen Auftrieb zu kompensieren.
»Vorne unten fünf liegt an.«
»Recht so. Aufkommen. Tiefe halten.«
»Tiefe halten«, bestätigte Obersteuermann Wahl.
Die Torpedos mit der Bezeichnung G7e wurden ab dem Jahr 1936 für die Kriegsmarine hergestellt. Die ersten Losnummern waren noch chronisch unzuverlässig gewesen, wie sich zu Beginn des Krieges und vor allem während des Einsatzes vor Norwegen gezeigt hatte. Wütende Kommandanten kehrten Heim und berichteten von ganzen Chargen von Versagern. Einer der Kommandanten hatte im Nordmeer ein fettes Schlachtschiff der Tommys voll im Visier, aber dann versagten alle vier Torpedos des Fächers, den er auf das Dickschiff losgelassen hatte. Es war wie verhext, entweder funktionierten die vielgepriesenen Magnetzünder nicht oder die Aale liefen einfach unter dem Ziel hindurch. Als sich diese Berichte häuften und zu einer regelrechten Torpedokrise führten, musste dringend etwas unternommen werden. Also überarbeitete man den ursprünglichen Entwurf und verbesserte die Zuverlässigkeit von Zünder und Tiefensteuerung der Torpedos. Seit dem Sommer 1940 galt der G7e dann endlich als zuverlässige Waffe.
Die vier gut sieben Meter langen Torpedos wurden von ihrem Antrieb auf 30 Knoten beschleunigt, was mehr als ausreichend war, um einen Frachter zu erwischen, der nur halb so schnell fuhr. Wenn die mit Aufschlagpistolen versehenen Torpedospitzen gegen die Bordwand des Ziels trafen, wurde der Gefechtskopf von rund 280 Kilogramm Sprengstoff ausgelöst. Die dann folgende Detonation dieser gewaltigen Ladung riss ein riesiges Loch in den Schiffskörper, sodass Unmengen von Wasser eindringen konnten. Um das getroffene Schiff zu retten, musste man alle Schotts schließen und so die Leck geschlagenen Abteilungen separieren. Gelang das, hatte die Besatzung gute Chancen, ihr Schiff zu retten. Um das zu verhindern, entwickelte die deutsche Seite den Magnetzünder. Dieser löste nicht erst durch einen direkten Kontakt aus, sondern durch das Magnetfeld eines Schiffes. Schiffsrümpfe bestanden aus Metall und verfügten deshalb über ein eigenes magnetisches Feld. Die verbesserte Version des G7e konnte dieses Feld dann mit seinem Zünder erkennen und detonierte unterhalb des Schiffsrumpfes.
Die Wirkung eines Aals, der unter dem Kiel eines Ziels zündete, war verheerend. Die bei der Detonation entstehende Gasblase zerbrach den Rumpf eines Schiffes einfach. Genau das geschah nun bei den beiden Frachtschiffen, die Wegener als Ziel gewählt hatte.
Brommm! Brommm!
Zwei schnelle, laute Schläge kündeten von den Detonationen des ersten Torpedopaares; schwere Explosionen rollten durch die See und die Mannschaft von U 139 jubelte auf.
Brommm! Brommm!
Dann folgten zwei weitere Hammerschläge, die den Rumpf des U-Bootes erzittern ließen, aber das machte niemandem etwas aus, denn nun stimmte auch der letzte Mann an Bord in den Chor der lauten Jubelrufe ein.
Nur der Kapitän blieb ganz ruhig. Wegener sah durch das Periskop; Flammen loderten am Horizont in die Höhe, beleuchteten die graue Szenerie in gelben, orangenen und roten Farbtönen.
»Denen haben wir das Rückgrat gebrochen«, stellte Wegener fest und drehte seine Mütze wieder nach vorne. »Sehrohr einfahren!«
»Sehrohr einfahren!«
»Gut geschossen, Herr Kapitän«, befand Dahlen.
Die letzten Jubelrufe verstummten, als ein gewaltiges metallisches Stöhnen und Kreischen durch die See rollte. Es handelte sich nicht um menschliche Stimmen, vielmehr waren es die Geräusche der zerbrechenden und sinkenden Frachter. Die Gesichter in der Zentrale wurden mit einem Male ausdruckslos. Jedem, der zuhörte, wie ein Schiffsrumpf zerbarst, lief es dabei kalt den Rücken hinunter. Maschinen wurden aus ihren Sockeln gerissen, prallten gegen Schotts, durchschlugen sie, zerschmetterten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Es fiel den Männern von U 139 nicht schwer, sich vorzustellen, was mit den unglücklichen Besatzungsmitgliedern an Bord der waidwunden Schiffe geschah. Sie waren schließlich auch Seeleute, genau wie die Mannschaft von U 139.
»Horchraum an Zentrale!«, meldete Felmy. »Schnelle Schraube in eins-null-null! Entfernung unter drei Seemeilen! Kommt rasch näher!«
»Zentrale an Horchraum. Verstanden!« Wegener sah den LI an. »Tauchen! Auf einhundert Meter gehen!«
»Tauchen! Auf einhundert Meter gehen!«
»Steuerbord zwanzig!«
»Steuerbord zwanzig, Herr Kapitän!«
»Geben Sie alles, was die Batterien mitmachen, LI!«
»Jawohl, Herr Kapitän!«
Die Blicke der Männer hoben sich an die Decke, als von oben das unverwechselbare Pitch-Pitch-Pitch der schnell drehenden Schrauben des Zerstörers zu vernehmen war. Dann erfolgte auch schon das unbarmherzige Ping-Ping-Ping des ASDIC-Strahls, der nach dem U-Boot griff und versuchte, es fest in der Ortung zu halten.
Jetzt war der Jäger zum Gejagten geworden.
»Festhalten, Männer!«, sagte Wegener. »Gleich kommen die Wasserbomben!«
»Horchraum an Zentrale: Klatschgeräusche, Herr Kapitän!«, meldete Felmy.
Die erfahreneren Männer wussten, was nun kommen würde. Die Frischlinge schauten sich nur mit blassen, wächsernen Gesichtern um.
Wummm!
Eine erste Erschütterung lief durch U 139 und ließ jeden an Bord Halt suchen.
Wummm! Wummm!
Ebenso ängstliche wie fragende Blicke der Neuzugänge hefteten sich auf den Kommandanten.
»Da müssen wir jetzt durch, Männer«, sagte Wegener ruhig. »Beißt die Zähne zusammen!«
Wummm! Wummm! Wummm!
Immer heftiger wurden die Schläge, in immer kürzeren Abständen. Im nächsten Moment schien es so, als hätte Gott persönlich mit seiner Faust gegen den Rumpf des Bootes geschlagen. Die Männer wirbelten umher wie Würfel in einem Becher. Alles, was nicht sicher verstaut worden war, flog und polterte auf einmal wild im ganzen Boot herum. Abgeplatzte graue Lackpartikel regneten auf die Männer nieder. Lebensmittelkonserven, die überall im Boot gelagert wurden, rollten zwischen den Füßen umher und brachten die U-Boot-Männer ins Stolpern.
Wummm! Wummm! Wummm!
Drei weitere Explosionen erfassten U 139. Skalen und Schaugläser zerplatzen, dann zertrümmerte es die Glühbirnen in der Zentrale und es wurde finster. Glasstückchen fielen klirrend zu Boden.
»Wir brauchen hier sofort Licht!«, übertönte die Stimme von Wegener das unheilvolle Dröhnen des Rumpfes. »Schadensmeldungen in die Zentrale!«
Die Strahlen zweier starken Handlampen stachen durch die Zentrale und leuchteten umher.
Wummm! Wummm!
Ein Rohr an der Decke gab unter der Belastung nach und sofort sprudelte ein starker Wasserstrahl ins Innere der Zentrale.
»Das Leck abdichten!«
Der LI kam heran gesprungen, in den Händen eine metallene Klammer, die man über das Loch in dem schadhaften Rohr legen konnte. Doch der Wasserdruck war zu stark; der Oberleutnant schaffte es alleine nicht, die Klammer über das Leck zu legen.
Der Erste Wachoffizier stieg über einen am Boden liegenden Körper hinweg und packte das andere Ende der Klammer.
»Hoch damit!«, grunzte Dahlen und zusammen hoben sie die Klammer über das Leck. Eiskaltes Wasser spritzte wild umher und ertränkte die beiden Männer fast. Doch sie ließen sich davon nicht beirren, sondern schoben die Klammer in Position. Nun musste der LI sie festzurren und Dahlen dabei die Vorrichtung alleine halten lassen. Stollenberg sah, wie die Muskeln in den Unterarmen des IWO arbeiteten, aber der Leutnant ließ nicht los. Rasch zurrte der LI die Klammer fest und der eben noch so heftige Wasserstrahl verkam zu einem dünnen Rinnsal.
»Leck abgedichtet.«
»Gute Arbeit, LI. Von Ihnen auch, IWO«, sagte Wegener. »Was ist mit dem Licht?«
»Möller! Sicherungen überprüfen und die zersprungenen Glühbirnen ersetzen!«
»Jawohl, Herr Oberleutnant!«
Wummm! Wummm!
Möller drehte die Reste der zerschlagenen Glühbirne aus der Fassung und ersetzte sie durch eine neue. Sofort erhellte Licht die Zentrale, was Wegener erleichtert begrüßte.
»Sehr gut, Möller!«, lobte der Kapitän den Elektriker. »Nur weiter so!«
Er sah sich um und bemerkte einen zitternden Frischling auf dem Deck.
Der Erste Wachoffizier schüttelte den pitschnassen Kopf und Wassertropfen flogen umher. »Na, so eine kalte Dusche wirkt doch recht belebend, will ich meinen! He, Janke! Was ist mit Ihnen?«
Dahlen zog den zitternden Matrosen auf die Beine. »Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder, Herr Kapitän? Die Wasserbomben lagen doch weit ab.«
»Sehr weit, IWO«, stimmte Wegener zu. »Da hat unsere gute, alte U 139 schon weit Schlimmeres überstanden. Was meinen Sie, LI?«
»Pah!«, schnaufte Stollenberg und wischte sich das nasse Haar aus der Stirn. »Das sind doch nur ein paar zerbrochene Gläser und Glühbirnen. Keine große Sache, das lässt sich binnen Minuten beheben, Herr Kapitän.«
Wummm!
»Eben. Dann greifen wir mal in die Trickkiste, um den Tommys da oben eine lange Nase zu drehen. Heckraum: Bold ausstoßen! Ruder mittschiffs. Auf zweihundert Meter gehen.«
»Bold ausstoßen. Ruder mittschiffs. Auf zweihundert Meter gehen.«
»Zentrale an Horchraum: Wo steht der Zerstörer?«
»Horchraum an Zentrale: Zerstörer auf zwo-sieben-drei. Er dreht auf dem Teller, will offenbar zu einem zweiten Angriff anlaufen.«
»Dem werden wir die Suppe versalzen«, sagte Wegener. »Backbord zwanzig.«
»Backbord zwanzig.«
»Auf Schleichfahrt gehen. Absolute Ruhe im Boot!«
»Schleichfahrt. Ruhe im Boot.«
»So, Männer. Wir schleichen uns jetzt leise wie ein Dieb in der Nacht davon, während der Tommy da oben den Bold erfasst«, erläuterte Wegener und grinste zuversichtlich in die Runde.
Die verbesserte Version des alliierten ASDIC zwang die deutschen U-Boote, sich in immer größere Tauchtiefen zu flüchten, um dem Ortungsstrahl zu entgehen. Der Salzgehalt in großer Tiefe war so hoch, dass die Strahlen des ASDIC davon zurückgeworfen wurden. Dem Gegner wurden so Scheinkontakte vermittelt, die von einem echten U-Boot praktisch nicht zu unterscheiden waren.
Hinzu kam der Bold. Ein Bold bestand aus einem etwa zehn Zentimeter breiten Schwimmkörper, der mit einer Mischung aus grob gemahlenen Calciumhydrid befüllt war. Nachdem der Bold aus seinem Startrohr hinausbefördert worden war, löste das Meerwasser den dünnen Lacküberzug binnen weniger Sekunden auf, und es entstanden Wasserstoff-Gasblasen. Diese Gasblasen narrten den Bediener des ASDIC-Gerätes an Bord des Zerstörers zusätzlich, denn sie wurden als feindliches U-Boot angesprochen.
Ping-Ping-Ping, machte der ASDIC-Strahl, saugte sich am Bold fest und ließ ihn nicht mehr los.
»Horchraum an Zentrale: Klatschgeräusche!«
Ängstlich duckten sich die Männer in Erwartung an das, was nun wieder folgen würde.
Wummm! Wummm! Wummm!
Erschütterungen ließen den Bootskörper von U 139 schwingen, aber es war bei weitem nicht so schlimm wie beim Angriff zuvor.
»Ja, macht den Bold nur recht ordentlich zur Sau«, murmelte Dahlen leise, aber so laut, dass die meisten Männer in der Zentrale ihn verstehen konnten. »Wir spielen derweil scheues Kaninchen und schleichen uns auf leisen Sohlen davon.«
Wummm!
Nach der letzten Detonation verstummten die Maschinen des Zerstörers.
»Der sucht jetzt die Wasseroberfläche nach Trümmern und Ölflecken ab als Beweis, dass er uns versenkt hat«, führte Wegener aus. »Aber natürlich wird er nichts finden und dann den Bold mit einer weiteren Lage Wabos belegen.«
Wenig später sprangen die Maschinen des Zerstörers wieder an und er drehte mit Höchstfahrt. Dann ging er wieder mit dem Tempo herunter, um seine Wasserbomben noch dichter dort konzentrieren zu können, wo ihm sein ASDIC ein U-Boot meldete.
Wummm! Wummm! Wummm! Wummm! Wummm! Wummm!
»Junge, Junge«, meinte Stollenberg grienend. »Der muss seine Wabos im Sonderangebot erstanden haben, so verschwenderisch, wie er damit um sich wirft.«
»Soll mir nur recht sein, LI«, entgegnete Wegener. »Meinetwegen kann er seine ganzen Vorräte auf den Bold verschwenden.«
Der Zerstörer stoppte erneut und suchte hartnäckig nach einem Beweis für eine erzielte Versenkung. Der gegnerische Kommandant musste wohl ziemlich angefressen sein, dass ihm seine Beute entkommen war.
Brommm!
Da lief ein Bullern durchs Wasser – ein Torpedotreffer auf einem weiteren Frachter.
Der Kommandant des Zerstörers ließ eine letzte Wasserbombe abwerfen und lief dann mit höchster Fahrt wieder davon, um zum Geleitzug aufzuschließen.
»Horchraum an Zentrale: Zerstörer peilt nun in null-drei-sieben. Entfernung drei Seemeilen und vergrößert sich.«
»Zentrale an Horchraum: Verstanden.«
»Wahrscheinlich hat der Geleitzugführer dem Zerstörerkommandanten den Kopf gewaschen und ihm befohlen, die vergebliche Jagd auf sein Geisterecho einzustellen und zum Konvoi zurückzukommen«, spekulierte Dahlen.
»Eine berechtigte Vermutung, IWO«, stimmte Wegener zu und setzte erneut ein verwegenes Grinsen auf. »Diese Geleitzugführer werden immer ganz schrecklich nervös, wenn ihre Feger sich zu weit von ihren Schützlingen entfernen.«
Leises Lachen der Veteranen lief durch die Zentrale; die Neuzugänge lächelten eher verhalten.
»Lassen Sie die restlichen Schäden beseitigen, LI. Bringen Sie unsere gute U 139 wieder in Topform für die Heimfahrt.«
»Jawohl, Herr Kapitän.«
Die Anspannung fiel von ihm ab und Wegener fühlte sich mit einem Male schrecklich erschöpft.
»Ich bin so lange in meiner Kammer. IWO, Sie übernehmen.«
»Der IWO übernimmt«, kündigte Dahlen an, während der Kapitän mit steifen Knochen durch den Kugelschott stieg und in seine Kammer ging.
*
Einige Stunden später machte Dahlen seine Runde durch das Boot. Im Bugraum überprüfte Maat Richter die letzten beiden Aale, über die er noch verfügte. Er blickte auf, als er den IWO näherkommen sah. »Herr Leutnant.«
»Richter«, sagte Dahlen. »Alles in Ordnung mit den Torpedos?«
»Jawohl, Herr Leutnant. Alles in Ordnung. Wir verladen sie gleich in Rohr Eins und Drei.«
»Sehr gut, Richter. Machen Sie weiter so.«
Der IWO hatte sich schon halb umgedreht, als ihn die Stimme des Maates verharren ließ.
»Herr Leutnant …?«
»Was ist denn noch, Richter?«
»Ich …«, begann der Maat, sah sich unsicher um und sagte dann: »Ich wollte mich noch bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mir vor dem Angriff ausgeholfen haben. Ich wusste einfach nicht, wie ich diese verflixte Ladevorrichtung wieder ans Laufen bekomme …«
»Macht nichts, Richter. Jetzt wissen Sie es doch.«
»Jawohl, Herr Leutnant. Das wird nicht noch mal vorkommen.«
Dahlen klopfte dem Maat auf die Schulter. »Das weiß ich doch. Halten Sie sich das nächste Mal an Ihre Leute. Die sind erfahren und wissen einige Dinge, die keiner von uns je gelernt hat.«
»Danke, Herr Leutnant.«
Der IWO lächelte dem Maat aufmunternd zu und verließ den Bugraum. Dahinter, in Richtung des Hecks, lag die Hauptunterkunft. Vorne befand sich der Raum für die Unteroffiziere. An der Backbordseite lag das vordere Klo, wo sich wie immer eine Schlange mit Wartenden gebildet hatte.
»Was ist denn hier los? Gibts hier was umsonst?«, fragte Dahlen verschmitzt grinsend.
»Schön wärs, Herr Leutnant«, stöhnte Kubelsky, einer der Ausgucke. »Der Neumann ist seit zehn Minuten da drin und kommt nicht raus!«
»Na, geben wir ihm noch zwei Minuten, Kubelsky. Wenn er dann immer noch nicht draußen ist, schnappt ihn euch und schießt ihn aus einem der Torpedorohre.«
Die wartenden Männer brachen in Gelächter aus.
»Wird gemacht, Herr Leutnant!«
Zwischen den beiden Reihen mit Kojen saßen einige Unteroffiziere zusammen und spielten wie üblich Skat.
»Macht einfach weiter, Männer, ich bin nur auf der Durchreise«, sagte Dahlen, als der Erste von ihnen aufsprang.
»Herr Leutnant!«, rief Obersteuermann Wahl. »Wenn wir in Brest sind, dann kommen Sie doch auch zu meiner Hochzeit, oder?«
»Das lasse ich mir doch nicht entgehen, Wahl.«
»Danke, Herr Leutnant!«
Einer seiner Unteroffizierskameraden grinste breit. »Die Hochzeit findet gerade noch rechtzeitig statt, wenn Sie verstehen, wie ich das meine, Herr Leutnant. Unser guter Wahl hier hat die Ware sozusagen getestet, bevor er sich zur Hochzeit entschieden hat, und jetzt ist die Zeit ein dringender Faktor geworden.«
Der Obersteuermann bedachte seinen Kameraden mit einem finsteren Blick. »Pass auf, was du sagst!«
»Na, na, Obersteuermann. Immer mit der Ruhe. Und was das Testen der Ware angeht: Ich würde auch nicht die Katze im Sack kaufen«, meinte Dahlen und kniff dem Unteroffizier ein Auge.
Wahl lächelte, dann lachte er und seine Kameraden fielen mit ein.
»Bis später, Männer«, verabschiedete sich der IWO und stieg durch den nächsten Schott. Er sah in der Zentrale vorbei, wo Leutnant Blasius das Kommando innehatte, blickte auf die Seekarte am Navigationstisch und suchte dann die Offiziersunterkünfte hinter dem nächsten Schott auf. Er stand vor der Kammer des Kommandanten und klopfte gegen den Rahmen.
»Der IWO«, kündigte er sich an.
»Kommen Sie rein, Dahlen.«
Der IWO zog den Vorhang beiseite und betrat die kleine Kammer.
Wegener hatte eine knappe Stunde geschlafen. Wirklich erholt war er nicht, aber der Posten eines Kommandanten war eben derart gestaltet, dass man sich immer im Dienst befand. Wegener klappte das Logbuch zu und deutete auf die Backskiste. »Setzen Sie sich.«
»Danke, Herr Kapitän.«
Dahlen pflanzte sich auf die kleine Bank und sah den Kommandanten an. »Die letzten Schäden sind behoben. Das Boot ist voll einsatzbereit. Kurs null-acht-sieben liegt an, unsere Geschwindigkeit beträgt zwölf Knoten. In Anbetracht unseres Treibstoffvorrats hält der LI das derzeit für die beste Marschgeschwindigkeit.«
»Sehr schön, IWO.« Der Korvettenkapitän lehnte sich gegen die Rückwand. »Das war heute aber verdammt knapp, was?«
»Ja.« Dahlen rieb sich mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand über den Nasenrücken. »Ich habe uns schon auf einer Wolke sitzen und an einer Harfe zupfen sehen. Aber es ist wohl noch nicht an der Zeit.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr.« Wegener bedachte seinen IWO mit einem prüfenden Blick, dann nickte er. »Gute Arbeit heute, Joachim.«
»Danke, Herr Kapitän. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben.«
»Ah, keine Schmeicheleien, bitte!«, wehrte Wegener mit erhobenen Händen ab, aber er lachte dabei.
»Ich meine das ernst, Herr Kapitän. Es gibt niemanden, mit dem ich sonst auf Feindfahrt gehen wollen würde.«
»An den Gedanken müssen Sie sich schon mal gewöhnen, IWO.«
»Herr Kapitän?«, fragte Dahlen verwirrt.
»Ich habe Sie beim Stab der Flottille für ein eigenes Kommando vorgeschlagen«, eröffnete Wegener seinem IWO.
»Ein eigenes Kommando?«, wiederholte Dahlen unbehaglich und kratzte seinen Kinnbart. »Ich weiß nicht so recht, Herr Kapitän … ob ich dafür schon bereit bin?«
»Oh, das war keine Entscheidung, die ich einfach so übers Knie gebrochen habe. Sie werden erst die entsprechenden Kommandantenlehrgänge absolvieren müssen, bevor Sie ein eigenes Boot erhalten. Das wird mindesten sechs Monate oder so dauern. Aber danach werden Sie Ihr eigenes Kommando haben.«
Dahlen kaute einen Moment auf seiner Unterlippe herum, bevor er sagte: »Ich … weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, Herr Kapitän. Ich bin zufrieden hier an Bord.«
»Und ich habe Sie gerne hier bei mir. Sie waren auf zwei Fahrten mein IIWO und auf drei weiteren mein IWO. Es wird langsam Zeit, dass Sie Ihren Weg weitergehen.«
Der Kapitän boxte seinem Ersten Wachoffizier gegen den linken Oberarm.
»Sie machen das schon. Außerdem ist es ja noch nicht so weit. Sie werden wohl oder übel noch ein- oder zweimal mit mir auf Fahrt gehen müssen.«
»Danke, Herr Kapitän.« Dahlen lächelte seinen Kommandanten dankbar an. »Ich lasse die Männer dann mal unsere Siegeswimpel anfertigen.«
»Sechs versenkte Frachter, dass kann sich schon sehen lassen«, stimmte Wegener zu.
»Und eine Barkasse«, erinnerte ihn Dahlen.
»Ja, und eine Barkasse«, bestätigte Wegener mit einem Auflachen. Beim Auslaufen hatte U 139 unter der Führung von Leutnant Blasius eine Motorbarkasse gerammt und dadurch versenkt. Es war nicht die Schuld des Zweiten Wachoffiziers gewesen; der Steuermann der Barkasse hatte gepennt. Aber es war nun einmal ihre erste Versenkung auf dieser Fahrt gewesen. »Die wollen wir doch nicht vergessen, oder?«
Dahlen grinste wie ein Honigkuchenpferd. »Bestimmt nicht, Herr Kapitän. 0,5 Tonnen sind 0,5 Tonnen auf unserem Konto. Der IIWO war zwar zu Tode verlegen, hat jedoch darauf bestanden, es in die Liste versenkter Tonnage aufzunehmen.«
»Ah, das reicht jetzt! Raus mit Ihnen!«
»Jawohl, Herr Kapitän.« Dahlen sprang auf, grüßte übertrieben zackig und verschwand.
Mit einem Lächeln blickte Wegener ihm nach und schüttelte den Kopf, bevor er sich wieder dem Logbuch zuwandte.
Zwei Wochen später
Kriegshafen Brest, besetzter Teil Frankreichs
»Herr Korvettenkapitän«, sagte das Hausmädchen und nahm den Mantel mit einem Nicken von Wegener entgegen. Dann reichte ihr Stollenberg seinen Mantel und sie nickte auch ihm zu.
»Herr Oberleutnant.«
Als Letzter legte Dahlen seinen Mantel ab und hielt ihn dem Hausmädchen im schwarzen Kleid mit weißer Schürze hin.
»Herr Leutnant«, schnurrte die schwarzhaarige, junge Frau und schenkte dem gutaussehenden Offizier einen einladenden Blick.
Ein Räuspern der Ordonnanz rief sie zur Ordnung und das Hausmädchen lief im Gesicht rot an. Rasch verschwand sie im hinteren Teil des Empfangsraumes.
»Meine Herren«, sagte die Ordonanz in ihrer weißen Affenjacke. »Der Fregattenkapitän erwartet Sie schon.«
»Gehen Sie voran«, erwiderte Wegener.
Die drei Offiziere folgten der Ordonanz die Treppe hinauf. Die luxuriös ausgestattete Villa lag oberhalb des Kriegshafens von Brest auf den Hügeln und bot einen sehr guten Ausblick auf den Hafen und die Stadt. Es war nicht das erste Mal, dass die Männer von U 139 hierhin eingeladen worden waren.
»Na, da soll mich doch dieser und jener«, sagte Stollenberg leise zu seinen Begleitern. »Sie machen sich, Joachim. Die junge Dame schien sehr an Ihnen interessiert zu sein.«
»Das sind nur die Orden«, wehrte der Erste Wachoffizier verlegen ab.
Alle drei Offiziere trugen das Ritterkreuz am Hals, im Fall von Wegener kam noch das Eichenlaub hinzu. Unter den weiteren sichtbaren Orden waren das U-Boot-Kampfabzeichen, das EK I und das EK II. Der Erste Wachoffizier trug zudem noch das Zerstörer-Kampfabzeichen, den Narvik-Schild in Gold am Ärmel und das Verwundetenabzeichen auf seiner Jacke.
»Es wird Blasius noch leidtun, dass er an Bord geblieben ist«, sagte Wegener, um dem IWO aus seiner Verlegenheit heraus zu helfen. »Er wird hier so einiges verpassen.«
Der Zweite Wachoffizier hatte dringende Dienstpflichten vorgeschoben, um an Bord bleiben zu können. Seit U 139 vor zwei Tagen im Bunker festgemacht hatte, wurden alle an Bord von den zahlreichen Aufgaben in Anspruch genommen. Die noch auf dem Boot befindliche Munition, also die beiden verbliebenen Torpedos, sowie die Vorräte für die 10,5-cm-Deckskanone und die Maschinenwaffen der 3,7- und der 2-cm-Flak mussten am Arsenalkai abgegeben werden. Im Anschluss musste das Boot an den Ausrüstungskai verlegt werden, damit die Ingenieure der Werft es in Augenschein nehmen und erste Abschätzungen darüber liefern konnten, wie lange es in der Werft bleiben würde. U 139 war durch den harten Kriegsalltag sehr mitgenommen worden, dass wusste niemand so gut wie die Männer, die mit ihr auf See gewesen waren. Ganze dreizehn Feindfahrten hatte ihr Boot nun glücklich überstanden und war dabei im Schnitt jedes Mal 35 Tage lang im Einsatz gewesen. Laut Auskunft des Chef-Ingenieurs der Werft würden mindestens vier bis fünf Wochen nötig sein, um U 139 auf den neusten Stand der Technik aufzurüsten und alle Geräte an Bord zu überholen. Die Mannschaft würde also einen ausgedehnten Urlaub genießen können, bevor sie wieder auf See hinausmusste. Der IIWO hatte angekündigt, sich um die Urlaubslisten zu kümmern, und die Einladung zum Umtrunk beim Flottillenchef dankend abgelehnt.
»So eine hochkarätige Zusammenkunft ist nichts für mich, Herr Kapitän«, hatte Blasius zum Abschied gesagt und sich wieder in seinem Papierkram vergraben.
Ihre Einfahrt in den engen Kanal, der Brest mit dem Atlantik verband, war noch einmal eine nervenzehrende Angelegenheit geworden. Wie üblich lagen vor der Küste die U-Jagdgruppen der Briten auf der Lauer und warteten auf ein- oder auslaufende deutsche U-Boote. U 139 erschien als drittes Boot des Wolfsrudels vor Brest und konnte sich unbemerkt hineinschleichen. Zwei andere Besatzungen aus der Flottille hatten nicht so viel Glück; sie wurden in Sichtweite zur Küste versenkt. Es gab keine Überlebenden. Ein weiteres Boot war bereits beim Angriff auf den Konvoi vernichtet worden, wobei die Alliierten den aufgefangenen Funkmeldungen nach wohl eine Handvoll Männer aus der See geborgen hatten.
Die Ordonanz führte die drei Offiziere in den ersten Stock hinauf. Wie schon bei ihren Besuchen zuvor zogen die alten Ölgemälde an den Wänden und die Statuen und Säulen aus weißem Marmor, die in den Ecken standen, die Blicke der U-Boot-Leute auf sich. Nach der qualvollen Enge in ihrer nach Diesel und Schweiß stinkenden Stahlröhre wirkte die zur Schau gestellte Einrichtung mit all ihrem Luxus doch sehr befremdlich auf sie.
Dahlen rieb sich mit dem rechten Handrücken am Kinn, das nach der frischen Rasur nun noch schlimmer juckte als der zuvor getragene Bart.
»Ich frage mich ja immer wieder, wie die hohen Herren beim Stabe es wohl in dieser Hölle aushalten können.«
»Mit jeder Menge Alkohol«, behauptete Stollenberg grinsend. »Und reichlich Marinehelferinnen.«
»Ich dachte, Marinehelferinnen wären Ihr Fachgebiet, LI«, stichelte Wegener.
»Höre ich da etwa Neid heraus, Herr Kapitän?«, gab Stollenberg fröhlich zurück. »Ich habe keine liebe Ehefrau bei mir Daheim sitzen, also kann ich sozusagen wie eine Biene von Blume zu Blume schweben und vom angebotenen Nektar kosten.«
Dahlen gab ein Geräusch von sich, das verdächtig nach einem erstickten Lachen klang, und hob rasch die linke Hand vor das Gesicht. Aber seine blauen Augen funkelten belustigt.
»Und Sie spielen mal nicht die Unschuld vom Lande, mein lieber Joachim«, fuhr Stollenberg fort. »Ich habe die Nummer mit dem Hausmädchen von eben noch nicht vergessen.«
»Schluss jetzt, LI«, rügte Wegener, aber bei ihm war ein amüsierter Tonfall in der Stimme nicht zu überhören. »Ein wenig ernsthafter, bitte.«
»Wenn es denn unbedingt sein muss, Herr Kapitän.«
»Es muss leider, LI.«
Die Ordonanz bedachte die Offiziere mit einem missbilligenden Blick, um den Herrschaften zu verdeutlichen, dass ein solches Verhalten in diesen heiligen Mauern unangebracht war, und wandte sich dann einer großen Doppeltür zu. Der Mann klopfte an, wartete kurz und öffnete dann die Tür.
»Korvettenkapitän Wegener, Oberleutnant Stollenberg und Leutnant Dahlen von U 139«, kündigte die Ordonanz an.
»Mein lieber Wegener!«, rief der Flottillenchef aus. »Schön, Sie wieder wohlbehalten hier bei uns in Brest begrüßen zu können!«
Fregattenkapitän Werner Busch trat heran und reichte Wegener die Hand. Busch war Mitte fünfzig, hatte kurz geschnittenes, graues Haar und präsentierte sich als ein dynamischer, vor Energie sprühender Mensch.
Nachdem er die Hand des Kommandanten mehrmals auf und ab geschwenkt hatte, wechselte Busch zu Stollenberg und ließ dem LI die gleiche Behandlung zukommen.
»Oberleutnant Stollenberg!«
»Herr Fregattenkapitän.«
»Und Leutnant Dahlen!«, sagte Busch und versuchte in seinem Überschwang, die große Hand des IWO zu zerdrücken, was ihm jedoch nicht gelingen wollte.
»Herr Fregattenkapitän«, sagte der Leutnant.
»Nicht so schüchtern, mein guter Dahlen«, riet ihm Busch. »Wir hier beim Stab haben Sie und Ihre Leistungen immer genau im Auge. Wir erwarten noch so einiges von Ihnen.«
Da der Leutnant nicht genau wusste, wie er auf diese Bemerkung reagieren sollte, schwieg er einfach. Als sich der Fregattenkapitän wieder den anderen versammelten Offizieren zuwandte, tauschten die drei Männer von U 139 einen kurzen Blick. Wegener zuckte andeutungsweise mit den Schultern; er vermochte die Äußerung des Flottillenchefs auch nicht zu deuten.
»Der Alte hat meine Empfehlung für Sie gesehen und befürwortet«, sagte Wegener leise. »Hat wohl damit zu tun.«
Stollenberg gab ein undefinierbares Brummen von sich.
»Kommen Sie, meine Herren! Kommen Sie!«, lud Busch sie ein. »Die Bar ist eröffnet!«
Diese Aufforderung musste der Fregattenkapitän nicht wiederholen. Die drei Offiziere holten sich an der Bar die Getränke ihrer Wahl und mischten sich unter ihre Offizierskameraden.
»Hans! Schön dich zu sehen«, wurde Wegener von Kapitänleutnant Günther Kreienbaum begrüßt, dem Kommandanten von U 136, einem Schwesterboot ihres eigenen Typ IX B. »Der gute Reinhold ist auch da. Und der Joachim. Na, wie macht sich mein ehemaliger Fähnrich?«
»Sehr gut, Günther«, erwiderte Wegener und schüttelte Kreienbaum die Hand. »Einen besseren IWO kann ich mir nicht wünschen.«
Vor etwas mehr als einem Jahr war Dahlen noch ein kleiner Fähnrich und Wachoffiziersschüler gewesen, als er von U 136 zu Wegeners Boot kommandiert worden war. Ihre erste Fahrt führte sie in die Karibik, wo sie die alliierten Schifffahrtsrouten stören sollten. Der Einsatz war ein großer Erfolg, wenngleich sie bei ihrer Rückkehr nach Brest eines der beteiligten Boote verloren.
Kreienbaum richtete den Blick auf Dahlen. »Dann sieh mal zu, dass du deinen IWO auch behalten kannst.«
»Was soll das denn nun heißen?«, fragte Wegener. »Hast du schon wieder irgendetwas gehört?«
Kapitänleutnant Kreienbaum war innerhalb der Kriegsmarine so gut vernetzt, dass ihm die neusten Gerüchte sozusagen immer brühwarm zugetragen wurden. Wenn es jemanden gab, der bereits über die anstehenden Befehle der Flottille im Bilde war, dann der Kommandant von U 136.
»Ich höre ständig etwas«, erwiderte Kreienbaum. »Das ist ja das Problem. Mir kommt so viel zu Ohren, dass ich oftmals gar nicht weiß, wie das alles zu deuten ist.«
»Und was hast du in diesem speziellen Fall gehört?«, bohrte Wegener nach. »Was ist mit meinem Ersten Wachoffizier?«
»Es scheint so, als würdest du deinen IWO abgeben müssen und dafür einen frischen Ersatzmann bekommen«, raunte Kreienbaum ihm zu.
Obwohl Wegener die Versetzung von Dahlen selbst angeregt hatte, verspürte er so etwas wie einen leichten Stich in der Brust. Sein IWO und er waren nicht nur einfache Bordkameraden, sie waren im Laufe der vergangenen Monate echte Freunde geworden. Dahlen war seine rechte Hand an Bord, seine Stütze, auf die er sich immer verlassen konnte.
Wegener lächelte wehmütig. »Nun, wenn die Flottille Dahlen so schnell auf den Kommandantenlehrgang schicken möchte, sollte ich mich dem nicht in den Weg stellen.«
Kreienbaum schüttelte den Kopf. »Sie schicken ihn nicht auf den Lehrgang.«
»Wie bitte?«
»Sie kommandieren ihn auf ein anderes Boot.«
Der Kommandant von U 139 schob ärgerlich den Unterkiefer vor. »Der Flottillenchef persönlich hat mir zugesagt, dass er den Lehrgang für Dahlen befürwortet.«
»Korvettenkapitän Wegener?«, machte sich ein Oberleutnant bemerkbar, der völlig unbemerkt an die Offiziere herangetreten war. Er war groß und gebräunt; er stellte somit einen Gegensatz zu den bleichen U-Boot-Leuten dar. »Leutnant Dahlen?«
Der Oberleutnant trug die Abzeichen eines Adjutanten, aber da Wegener wusste, dass Oberleutnant Herzfeld der Adjutant des Flottillenchefs war, konnte er den Mann nicht einordnen.
»Ja?«
»Herr Fregattenkapitän Busch bittet Sie, Herr Korvettenkapitän, und Ihren Ersten Wachoffizier zu sich«, teilte ihm der Oberleutnant mit.
»Dann wollen wir den Chef mal nicht warten lassen«, sagte Wegener und winkte Stollenberg und Dahlen zu sich heran. Der Kapitän reichte dem LI sein Glas. »Halten Sie das bitte für mich, ja?«
Der IWO stellte sein Getränk einfach auf einem Beistelltischchen ab und folgte dem Korvettenkapitän und dem Oberleutnant. Ganz behaglich fühlte er sich nicht, denn ihm schwante bereits Ungemach.
Der Adjutant führte sie in eine Ecke des Raumes, wo Fregattenkapitän Busch mit einigen anderen Offizieren vor einer an der Wand befestigten Seekarte stand. Dahlen erkannte Orkney, die Färöer-Inseln, die Shetlandinseln und Island. Hinzu kam die endlose Weite des Atlantiks, dann Grönland und Nordamerika. Zahlreiche bekannte Routen der Geleitzüge waren auf der Karte eingetragen.
»Herr Fregattenkapitän, Korvettenkapitän Wegener und Leutnant Dahlen!«
Der Oberleutnant stand so stramm, dass er dabei beinahe vibrierte. Bei den U-Boot-Fahrern, die traditionell eher leger daherkamen, löste dieses Verhalten kaum unterdrückte Belustigung aus.
»Danke, Herr Pätzold. Meine Herren, wenn Sie uns entschuldigen möchten?«
Die anderen Offiziere verließen die Ecke und auf ein Winken des Fregattenkapitäns hin verdeckte der Oberleutnant die Karte mit einem Tuch.
»Ich danke Ihnen, Herr Pätzold«, sagte Busch zu dem Oberleutnant. »Warum leisten Sie nicht den anderen Herren Gesellschaft, während wir in Ruhe die Dinge durchgehen, die es zu besprechen gilt?«
»Jawohl, Herr Fregattenkapitän!«, erwiderte Pätzold steif und machte sich davon.
Der Flottillenchef schenkte den beiden Offizieren vor ihm ein warmes Lächeln. »Das ist mein neuer Adjutant, Oberleutnant Werner Pätzold.«
»Ich dachte, Oberleutnant Herzfeld wäre Ihr Adjutant, Herr Fregattenkapitän«, sagte Wegener.
»Oberleutnant Herzfeld wurde versetzt. Jetzt ist Herr Pätzold mein Adjutant. Er kam hier mit den Empfehlungen der höchsten Stellen an, meine Herren. Er hat sehr gute Verbindungen in die Partei. Ich möchte Sie inständig bitten, dass bei ihren Gesprächen mit ihm zu berücksichtigen.«
»Ich denke, ich verstehe, Herr Fregattenkapitän«, meinte Wegener bedächtig und zögerte ein wenig, bevor er nachfragte: »Könnte die Neubesetzung des Postens Ihres Adjutanten womöglich mit der Episode um Leutnant Pauli zu tun haben?«
»Die Möglichkeit besteht«, gab Busch unumwunden zu. »Wie Sie sicher erinnern, war Herr Pauli der Sohn eines Gauleiters. Als Herr Herzfeld überraschend versetzt wurde, trat der Vater von Herrn Pauli an mich heran und bat darum, Oberleutnant Pätzold als mein Adjutant zu akzeptieren. Der Vater von Herrn Pätzold ist wohl ein alter Weggenosse von Herrn Pauli, wenn Sie verstehen. Ich sah mich nicht in der Position, der Verwendung zu widersprechen.«
»Oberleutnant Herzfeld hat also nicht selbst um Versetzung gebeten?«, fragte Wegener nach.
»Nein, aber ich bin sicher, seine neue Position in der Marineschule von Mürwik wird ihm zusagen.«
Wenn Wegener das alles richtig auslegte, hatte der Flottillenchef seinen Offizieren durch die Blume zu verstehen gegeben, dass ihm dieser Pätzold von höchster Stelle in den Pelz gesetzt worden war, um ihn im Auge zu behalten.
Auf ihrer Amerika-Fahrt war Leutnant Pauli Wegeners Erster Wachoffizier gewesen. Pauli versagte letztlich im Gefecht und verlor bei mehreren Gelegenheiten die Nerven. Während eines Kampfes mit einem amerikanischen Konvoi wurde er dann schwer verwundet und erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Sein Vater, der Gauleiter, hatte auf einer posthumen Auszeichnung bestanden und natürlich auch darauf, dass über das Versagen seines Sohnes Stillschweigen bewahrt wurde. Busch hatte dem zähneknirschend zustimmen müssen, aber offenbar reichte das den hohen Tieren innerhalb der Partei nicht, und so hatten sie einen Spitzel im Stab der Flottille untergebracht.
»Hat die bevorstehende Versetzung von Herrn Dahlen auch mit dieser leidigen Angelegenheit zu tun?«, wollte Wegener wissen.
»Oh, nein, da kann ich Sie beruhigen«, versicherte Busch rasch. »Diese Versetzung hat ganz andere Gründe.«
»Darf ich diese Gründe erfahren, Herr Fregattenkapitän?«
»Nun, die Sache ist eigentlich ganz simpel«, führte Busch aus und unterbrach sich kurz, um an seinem Cognac zu nippen. »Wie Sie sicherlich wissen, stoßen monatlich neue Boote zu unserer Flotte. So viele, dass wir inzwischen ernste Schwierigkeiten haben, dafür genügend ausgebildete Besatzungen aufzutreiben. Einige dieser neuen U-Boote samt unerfahrenen Mannschaften sind unserer Flottille zugeteilt worden, um die erlittenen Verluste auszugleichen. Um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen: U 228 verfügt über eine noch grüne Besatzung und einen Kommandanten, der gerade erst seinen Lehrgang abgeschlossen hat. Ich muss nun versuchen, wenigstens einen kleinen, harten Kern aus erfahrenen Leuten für dieses Boot zusammenzustellen, um es ruhigen Gewissens in den Einsatz schicken zu können. Herr Dahlen wird als neuer Erster Wachoffizier auf U 228 wechseln. Ich möchte Sie bitten, noch fünf weitere Männer abzustellen, die mit ihm gehen.«
»Meinen IWO und noch fünf Männer?«, fuhr Wegener alarmiert auf. »Herr Fregattenkapitän, ich kann die besonderen Umstände, die herrschen, ja sehr gut nachvollziehen. Aber Sie werden doch gewiss einsehen, dass ich nicht mit gleich zwei völlig unerfahrenen Wachoffizieren in See stechen kann! Und die anderen Neuzugänge an Bord müssen auch erst noch richtig eingearbeitet werden. Wie soll ich unter diesen Umständen …«
Abwehrend hob Busch die linke Hand und der Korvettenkapitän verstummte. »Ich weiß genau, was Sie jetzt sagen wollen, Herr Wegener. Die Anweisung, die Besatzungsmitglieder der Boote untereinander zu tauschen, kommt vom FdU-West, und ich darf Ihnen versichern, dass ich dagegen ernste Bedenken angemeldet habe. Leider wurde mein Protest nicht zur Kenntnis genommen. Und es trifft nicht nur Sie. Kapitänleutnant Kreienbaum muss ebenfalls fünf Mann für U 228 abstellen. Dieses Bäumchen-wechsel-dich-Spiel betrifft jeden der mir unterstellten Kommandanten.«
Der Flottillenchef ließ seine Worte für einen Augenblick wirken, bevor er fortfuhr: »Der FdU-West hat durch die Aufklärung mehrere Hinweise darauf erhalten, dass gegen Ende nächsten Monats mit einem sehr großen HX-Geleitzug zu rechnen ist, der eine äußerst wichtige Ladung nach England transportieren soll. Was bedeutet, in sechs Wochen muss jedes verfügbare Boot draußen im Atlantik im Einsatz sein, um diesen Geleitzug abzufangen. Der Führer persönlich hat den Plan des FdU-West genehmigt, im Übrigen gegen den Rat von Admiral Dönitz.«
Also schlug wieder einmal die Politik zu. Der FdU-West, auch bekannt als Konteradmiral Eberhard Graßhoff, verfügte über beste Verbindungen zur Politik und zur Parteispitze. Die Gerüchteküche sah den Konteradmiral bereits als Nachfolger von Admiral Dönitz als BdU – als Befehlshaber der U-Boote. Karl Dönitz war erst am 30. Januar 1943 zum Großadmiral befördert worden und hatte das Amt des Oberbefehlshabers der deutschen Kriegsmarine übernommen. Seiner Ernennung war eine schwere Konfrontation Erich Raeders mit Hitler vorausgegangen, die dann zur Ablösung Raeders als OB geführt hatte. Dönitz behielt jedoch zugleich den Posten als Befehlshaber der U-Boote. Und wenn man den Gerüchten glauben durfte, hatte es Graßhoff auf ebendiesen Posten abgesehen, eine zugleich verantwortungsvolle wie auch prestigeträchtige Kommandostelle.
»Im Nachgang der Affäre um Leutnant Pauli haben wir doch schon unsere Erfahrungen mit dieser Art von Politik gemacht«, sagte Busch. »Ich kann Sie nur um Ihr Verständnis und um Ihre Mitarbeit ersuchen, meine Herren.«
Diese Eigenschaft des Fregattenkapitäns wurde von den ihm unterstellten Offizieren überaus geschätzt: Er bezog sie in seine Entscheidungsfindung mit ein, beriet sich mit ihnen und hörte sich ihre Meinungen an. Denn der Flottillenchef wusste, dass in den Akten und Dokumenten nicht alle Informationen zu finden waren, die er benötigte – Eine einfache Tatsache, die bei manch anderem am grünen Tisch gerne in Vergessenheit geriet. Und der Fregattenkapitän hätte auch einfach den nötigen Befehl erteilen können, stattdessen bat er um Verständnis und Unterstützung.
Wegener und sein Erster Wachoffizier wechselten einen kurzen Blick.
»Ich denke, ich verstehe, Herr Fregattenkapitän«, meinte Wegener. »Es gefällt mir zwar nicht, aber ich verstehe.«
»Darauf hatte ich gehofft«, erwiderte der Flottillenchef, dessen Erleichterung aus seiner Stimme sehr deutlich herauszuhören war. »Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, meine Herren. So finster die Zeiten auch sein mögen, wir Offiziere müssen zusammenhalten.«
»Verzeihung, Herr Fregattenkapitän«, schaltete sich Dahlen erstmals in das Gespräch ein, der es bisher vorgezogen hatte, stumm zuzuhören. »Aber ist der Kommandant von U 228 auch anwesend? Ich würde ihn gerne kennenlernen«
»Nein, Oberleutnant Klinger befindet sich derzeit im Heimaturlaub. Und wo ich gerade dabei bin, ich bedaure sehr, Sie um Ihren wohlverdienten Urlaub bringen zu müssen, Leutnant Dahlen.«
»Nun ja, es ist, wie es eben ist, Herr Fregattenkapitän. Ich glaube aber, der Herr Oberleutnant ist mir nicht bekannt.«
»Wie bereits erwähnt, hat Oberleutnant Moritz Klinger gerade erst einen Kommandantenlehrgang abgeschlossen«, erläuterte Busch. »Derzeit verbringt er seinen Urlaub in der Heimat und wird im Laufe der kommenden Woche offiziell das Kommando über U 228 übernehmen. Ihnen bleiben also ein paar Tage, um sich mit dem Boot und der Mannschaft vertraut zu machen. Sie treten morgen Ihren Dienst auf Ihren neuen Boot an. Leutnant Bernd Glaser, der Zweite Wachoffizier, wird Sie einweisen.«
Dahlen nickte. »Danke, Herr Fregattenkapitän.«
Busch klopfte dem Leutnant jovial gegen den Oberarm. »Nichts zu danken, Leutnant Dahlen. Sie werden das schon hinbekommen.«
Dann wurde der Flottillenchef wieder ernst. »Die geplante Aktion gegen den HX-Konvoi wird kein Zuckerschlecken werden, meine Herren. Wir versuchen, mehr als ein Dutzend Boote für den Angriff zusammenzuführen. Die Eskorten werden sehr stark und die feindliche Luftüberwachung sehr dicht sein. Seien Sie auf alles gefasst.«
Die sogenannten HX-Geleitzüge waren die wichtigsten des britischen Empire. HX stand für den ursprünglichen Startpunkt im kanadischen Halifax, wo sich Schiffe aus den verschiedensten Häfen aus Nord-, Mittel- und Südamerika versammelten. Von dort ging es im Geleitzug nach Liverpool. Seit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im Dezember 1941 starteten diese HX-Geleitzüge auch von New York aus. Im ersten Halbjahr 1943 operierten mehrere deutsche Wolfsrudel aus einem Dutzend U-Booten gegen diese Geleite. Es gelang der Kriegsmarine, einige Erfolge zu erzielen, allerdings stiegen dabei auch die Verluste so sehr an, dass die Angriffe auf die HX-Route schließlich für einige Wochen ausgesetzt werden mussten.
»Unbestätigten Meldungen zufolge sollen sich auch zwei oder drei Geleitflugzeugträger unter den Eskorten des Konvois befinden«, fügte Busch an.
»Zwei oder drei kleine Träger?«, wiederholte Wegener. »Was zur Hölle hat der Konvoi denn bloß geladen?«
»Truppen«, mutmaßte Dahlen. »Nur Truppen rechtfertigen eine so starke Eskorte.«
»So sehen wir beim Stab das auch«, stimmte Busch zu. »In Berlin befürchtet man immer noch eine Invasion in Norwegen, nachdem nun Nordafrika gefallen ist.«
Der Feldzug in Nordafrika hatte am 13. Mai 1943 mit der Kapitulation der Achsentruppen sein Ende gefunden, ein herber Rückschlag für die Kriegsanstrengungen des Reiches und auch für die Moral der Bevölkerung.
»Stimmen die Gerüchte, dass an der Ostfront eine große Operation geplant ist, um dort wieder die Initiative zu erlangen?«, wollte Wegener wissen.
»Sie wissen, dass ich zu solchen Dingen nichts sagen kann«, wehrte Busch ab.
»Natürlich nicht, Herr Fregattenkapitän«, lenkte Wegener ein. »Verzeihen Sie.«
Busch vollführte eine abwehrende Handbewegung. »Ihnen ist vergeben, wenn Ihr Erster Wachoffizier für mich einen neuen Cognac besorgt. Mein Glas scheint ein Loch zu haben.«
In Dahlens Gesicht blitzte ein Grinsen auf. »Ist mir ein Vergnügen, Herr Fregattenkapitän.«
Er nahm das leere Glas des Flottillenchefs entgegen und ging zur Bar, um Nachschub zu besorgen.
»Ihr Erster Wachoffizier ist ein guter Mann«, meinte Busch zu Wegener und fügte humorvoll an: »Und das sage ich nicht nur, weil er mir einen neuen Cognac holt.«
»Das ist er«, bestätigte der Kommandant von U 139 und lächelte etwas wehmütig. »Ich lasse ihn nur sehr ungern ziehen.«
»Wie war das noch mal mit den Küken, die irgendwann das schützende Netz verlassen müssen, um selbstständig zu fliegen?«, sinnierte Busch. »Wenn dieser Einsatz vorbei ist, schicken wir Dahlen auf den Kommandantenlehrgang. Und in einem halben Jahr, vielleicht sogar etwas früher, wird er sein eigenes Boot haben.«
»Ja.« Wegener schien noch etwas sagen zu wollen, aber dann kehrte sein Erster Wachoffizier mit zwei Cognac-Gläsern zurück.
»Einen Cognac für den Herrn Fregattenkapitän und einen für den Herrn Korvettenkapitän«, sagte Dahlen und reichte die Gläser weiter.
»Sie haben sich selbst vergessen«, rügte Wegener, der dankend sein Glas entgegennahm.
»Leider, Herr Kommandant, habe ich nur zwei Hände.« Dahlen schlug die Hacken zusammen und verneigte sich vor den beiden Offizieren. »Und wenn Sie mich nun entschuldigen würden, meine Herren? Ich habe noch Pläne für heute Abend.«
»Aha?«, horchte Wegener auf. »Ich hoffe doch, es ist eine heiße Verabredung, IWO?«
»Obersteuermann Wahl heiratet heute Abend«, rief Dahlen seinem Kommandanten ins Gedächtnis.
»Fast die gesamte Mannschaft wird dort sein. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um mich offiziell zu verabschieden, bevor ich dann morgen auf U 228 wechsle.«
»Eine gute Idee.« Wegener lächelte. »Vielleicht sehe ich später selbst noch vorbei. Wo finden die Festivitäten denn statt?«
»Im Club Rose Rouge – wo sonst?«
*
Der Klub Rose Rouge lag nahe dem Hafen und war das Stammlokal der Besatzung von U 139 in Brest. Wer nun eine verrauchte Spelunke voll mit betrunkenen Matrosen, leichten Mädchen und lauter Musik erwartete, lag völlig falsch. Solche Lokale gab es freilich auch und das nicht zu knapp, aber dieser Klub war anders.
Der Klub Rote Rose wurde von Madame Sophie Girard geführt, einer Französin unbestimmbaren Alters. Die meisten Männer schätzten die Madame auf Mitte bis Ende dreißig, obwohl es einige tollkühne gab, die es wagten, ihr Alter jenseits der vierzig anzusiedeln. Genaueres wusste jedoch niemand und es wagte auch niemand, bei Madame Girard nachzufragen. Fest stand nur, dass in ihrem Lokal sehr strenge Regeln galten, was den Alkoholgenuss und den Umgang mit den hübschen jungen Damen anging, von denen mehr als ein gutes Dutzend im Rose Rouge arbeitete.
Oftmals besuchten auch Krankenschwestern oder Marinehelferinnen das Lokal, wohl wissend, dass die Madame ein wachsames Auge auf sie werfen würde. Sollte sich einer der Matrosen trotz aller Ermahnungen dazu hinreißen lassen, ein Mädchen oder eine der Besucherinnen zu belästigen, kamen Youssef und Hassan zum Einsatz. Die beiden Zwillingsbrüder stammten aus Französisch-Marokko, waren gut zwei Meter groß und gebaut wie Ringer auf einem Jahrmarkt. Natürlich waren sie keine einfachen Rausschmeißer, derartige Bezeichnungen behagten Madame Girard überhaupt nicht; vielmehr waren sie die Wächter des Klubs – die Gardien.
Als Dahlen sich dem Klub näherte, trug der Westwind die Klänge von der französischen Version des Liedes Lilli Marleen