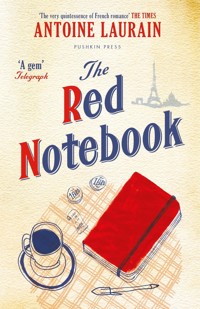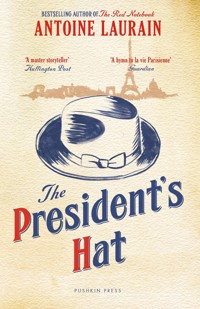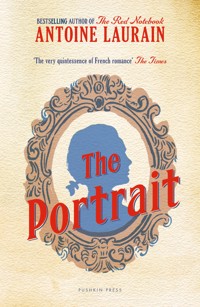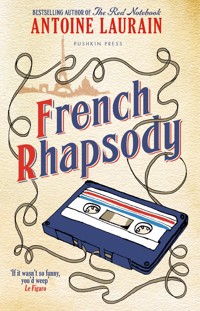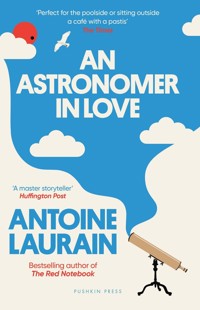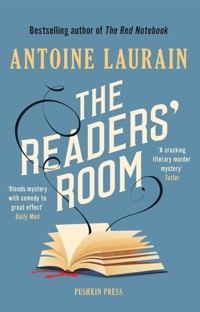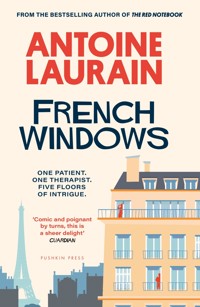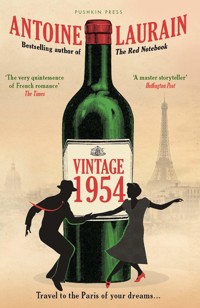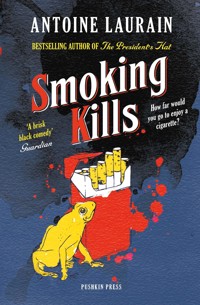18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Pariser Psychoanalytiker Docteur Faber hat eine eigenwillige Patientin: Die Fotografin Nathalia steckt seit ihrem letzten Foto in einer tiefen Krise. Tag für Tag blickt sie auf ihre geschäftigen Nachbarn und fragt sich: Wie meistern die ihr Leben bloß? Statt über sich selbst zu sprechen, erzählt sie dem Arzt lieber deren Geschichten. Sie alle handeln davon, wie Not uns erfinderisch machen und ein Sprungbrett in ein besseres Leben sein kann, vor allem, wenn wir nicht alleine sind. Erzählend hält Nathalia den Schlüssel zur Heilung eigentlich längst in der Hand. Spät beginnt der Arzt zu ahnen, warum sie wirklich zu ihm kommt und warum ihre Krise vielleicht mit seiner eigenen zusammenhängt … Mit funkelnder Fabulierfreude und großem Herz erzählt Antoine Laurain in seinem neuen Roman davon, wie herrlich erfinderisch uns verzwickte Situationen machen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Antoine Laurain
Auf gefährlich sanfte Art
Roman
Katrin Segerer
»Wer wären wir, wenn wir kein Mitgefühl für jene aufbringen könnten, die nicht wir selbst sind und die nicht zu uns gehören? Wer wären wir, wenn wir uns selbst nicht – wenigstens zeitweise – vergessen könnten? Wer wären wir, wenn wir nicht lernen könnten? Wenn wir nicht verzeihen könnten? Wenn wir nicht etwas anderes werden könnten, als wir sind?«
Susan Sontag
Auszug aus der Dankesrede bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2003
Aus dem unebenen Pflaster ragt ein großer Baum. Niemand weiß genau, um welche Art es sich handelt. Einige Bewohner tendieren zu einer Vogelkirsche, andere zu einer Eiche, auch wenn noch keine einzige Eichel daran gewachsen ist. Ehe man den Baum erreicht, muss man durch die bogenförmige Eingangstür, durch die früher die Pferdewagen fuhren. Links führt eine Treppe aus hellem Stein mit einem schwarzen, filigran gedrehten Geländer aus Schmiedeeisen zu den oberen Stockwerken gen Süden hinauf, rechts eine aus Holz zu den Wohnungen, die nach Norden hinausgehen. Zu den Wohnungen auf der Westseite gelangt man ebenfalls über eine Holztreppe, ein Stück weiter. Und die Treppe zur Ostseite liegt am anderen Ende des Innenhofs, immerfort im Dunkeln. Eingangsbereich, Treppen, Decken – alles müsste dringend neu gestrichen werden, aber hier scheint niemand sonderlich erpicht auf Gerüste und Farbausdünstungen.
Hinter den schmalen Fenstern, die den Hof säumen, sieht man Schatten vorüberhuschen. Eines geht zu, ein anderes öffnet sich einen Spaltbreit und lässt ein paar Alltagsgeräusche heraus: ein Lied, eine Nachrichtensendung, das Rauschen einer Dusche oder das Klingeln eines Handys.
Nachdem die schwere Eingangstür ins Schloss gefallen ist, steht man kurz im Halbdunkel, sucht tastend nach dem Lichtschalter, dessen Leuchtdiode schon vor langem durchgebrannt ist. Gelbes Licht dringt durch das schmutzige Milchglas und flutet Wände und Pflaster. Man läuft auf den Baum zu, holt klimpernd seine Schlüssel heraus und erklimmt die Treppe, aus Stein oder Holz.
Dann ist man zu Hause. Man schenkt sich einen Aperitif ein und tritt, fast unwillkürlich, ans Fenster.
Sie setzt sich auf die Couch, legt sich vorsichtig hin. Sie dürfte um die dreißig sein. Ihre blasse Haut betont das tiefe Schwarz ihrer Haare, die ihr bis über die Schultern reichen. Ihre Augen sind blau, meine ich. Für Augenfarben hatte ich noch nie einen Blick. Erst kürzlich hat meine Frau mich darauf hingewiesen, dass mein bester Freund dunkelblaue Augen hat, was ziemlich selten sei. Ich kenne ihn seit dreiunddreißig Jahren, aber hätte mich jemand nach seiner Augenfarbe gefragt, hätte ich geantwortet: »Braun?«
Äußerliche Details dieser Art entgehen mir oft. Ich betrachte jeden Menschen als Ganzes. Nathalia Guitry würde ich so beschreiben: junge Frau um die dreißig, hübsch, brünett, helle Augen. Fertig.
Sie schweigt schon seit ungefähr einer Minute. Ich warte für gewöhnlich, bis mein Gegenüber zu sprechen beginnt, aber diesmal passiert das nicht, und die Zeit vergeht. Selbstredend kann man auch die gesamte Sitzung so verstreichen lassen, nichts verpflichtet einen, das Schweigen zu brechen. Im Gegenteil, es kann bereits als Einleitung betrachtet werden. Schweigen sagt sehr viel.
Nathalia Guitry war noch nie hier. Dies ist ihre erste Sitzung. Ich könnte sie fragen, woher sie meine Adresse hat, aber das erscheint mir immer belanglos. Zur Antwort bekäme ich bloß den Namen eines Freundes, der ebenfalls von mir behandelt wird oder wurde, oder vielleicht den Namen einer Hausärztin. Doch die Erwähnung anderer stört meiner Meinung nach nur die Kontaktaufnahme. In diesem Raum sollte es nur zwei Personen geben: Patient oder Patientin und mich. Das ist bereits mehr als genug.
Es ist Winter, und draußen graupelt es. Wie üblich habe ich die roten Vorhänge zugezogen. Das Wetter beeinflusst die Stimmung: Sonne, Schnee, Regen, Wind, Kälte und Hitze haben Auswirkungen auf den Gemütszustand und unser Empfinden. Hier drinnen ist alles neutral. Das muss es auch sein. Meine Praxis ist als eine Art geografischer Anti-Ort konzipiert. Stadt, Land, Smartphone, Facebook- oder Instagram-Account, all das sollen meine Patientinnen und Patienten vergessen. Mein Büro – ich nenne es gerne »Büro«, das vermittelt ein Gefühl von Arbeit, auf das ich Wert lege –, mein Büro ist überall. Wie ein Floß, das von Kontinent zu Kontinent, von Neurose zu Psychose, von Melancholie zu Manie, von Traum zu Wahn treibt. Mein Büro ist ein Feuerschiff, das Signale aussendet. Man begegnet ihm niemals zufällig, nein, man sucht es, wenn auch unwissentlich. Und ich bin der Kapitän dieses Schiffs.
»Doktor Faber …?«
»Ich höre Ihnen zu«, sage ich zwischen zwei fünfzig Meter hohen Wellen. Oft lässt die Verbindung zu wünschen übrig, diverse Störgeräusche funken dazwischen: Stille, Anspannung, Angst, Versprecher. Doch das Büro schwimmt weiter, trotzt jeder Witterung. Ruhig und unsinkbar.
»Ich komme mir vor wie in einem U-Boot, Sie wissen schon, diese riesigen Dinger, die still und heimlich unter kilometerlangen Eisdecken fahren.«
Als ein Patient mir das anvertraute, musste ich lächeln. Eigentlich hätte ich auf die Heimlichkeit oder das Eis als Symbol der Beklemmung eingehen sollen, aber die Vorstellung von schwarzem Metall, das geräuschlos unter gefrorenem Wasser dahingleitet, war so bestechend, dass ich nur erwiderte: »Ja, genau so ist es auch ein wenig.«
Er war zufrieden, besänftigt, und das ist doch die Hauptsache.
Da sie weder von sich erzählt noch über das Wetter redet noch verrät, wer sie hergeschickt hat, werde ich anfangen, öfter mal was Neues.
»Sie heißen Guitry, sind Sie mit Sacha Guitry verwandt?«
Sie lächelt, sehr gut. Das Lächeln hat einen bitteren Zug, aber immerhin.
»Nein …«, antwortet sie. »Sacha Guitry hatte auch gar keine Kinder.«
Wieder Stille, ich muss verhindern, dass sie sich breitmacht. Eigentlich würde ich gern weiter über Guitry sprechen, mit dem Thema scheint sie sich auszukennen. Womöglich ist Guitry gar nicht ihr echter Name, ich überprüfe nie die Personalien meiner Patientinnen und Patienten. Die sind nicht von Bedeutung. Ich folge einigen Grundsätzen der traditionellen Psychoanalyse, wie zum Beispiel der Barzahlung. Kein Scheck, keine Karte – nichts, was Rückschlüsse auf die Person zuließe. Wie jeder im Gesundheitswesen habe auch ich garantiert schon Behandlungsscheine ausgefüllt, die nie bei der Krankenkasse eingereicht wurden. Ebenso greife ich gelegentlich ein paar Basiselemente aus der traditionellen Analyse auf, wie Fehlleistungen, Versprecher und andere unbewusste Handlungen. Sie werden nur selten relevant, aber sie sind da, wie in einem alten Werkzeugkasten ganz unten im Schrank. Immer noch brauchbar, gelegentlich vielleicht sogar sehr nützlich.
»Wie kann ich Ihnen helfen, Nathalia?«
»Ich denke, ich habe mein Leben verpfuscht.«
Den Satz habe ich in diesen vier Wänden schon oft gehört. Es gibt zahlreiche Varianten: Ich habe mein Leben verpfuscht ist endgültig und verheißt viel, sehr viel Arbeit. Aus Ich glaube, ich habe mein Leben verpfuscht sprechen noch Zweifel, es ist etwas weniger schlimm als die erste Aussage. In Mein Leben ist verpfuscht hingegen fehlt das »ich«, das Leben ist etwas Abgespaltenes. Wie ein Haustier, das man schon seit Kindestagen hat und mit dem man unzufrieden ist. Man lebt mit einem Foxterrier und stellt irgendwann fest, dass man eigentlich Bengalkatzen mag.
Bei Nathalia Guitry, die gar nicht darauf reagiert hat, dass ich sie mit Vornamen angesprochen habe statt mit Mademoiselle oder gänzlich unpersönlich, ist vor allem das Verb denken interessant.
»Weshalb denken Sie das?«
»Ich mache überhaupt nichts. Beruflich läuft es auch miserabel.«
»Was arbeiten Sie?«
Sie zögert ein paar Sekunden zu lange, ehe sie antwortet.
»Ich bin Fotografin.« Sie lächelt widerwillig.
»Warum lächeln Sie?«
»Ich bin eine Fotografin, die nichts fotografiert.«
»Erklären Sie mir das.«
In genau diesem Moment beginnt die Analyse. Dieser so banal wirkende Satz ist die erste echte Kontaktaufnahme zu meinem Gegenüber.
Erklären Sie es mir. Nun sprechen wir über sie oder ihn, das jeweilige Problem oder zumindest das, was die Person dafür hält. Falls es nicht nur eine Nebelkerze ist, die Schwerwiegenderes verschleiert.
»Ich habe keine Aufträge mehr«, sagt sie.
»Und warum, glauben Sie, ist das so?«
»Ich habe mein Talent verloren.«
Die ernüchterte Romantik dieses Satzes entgeht mir nicht. Der endgültige Tonfall wiederum ruft nach noch mehr Wachsamkeit als gewöhnlich.
Ich versuche es mit einem schlichten, aber unentbehrlichen: »Sie haben die Lust am Fotografieren verloren?«
»Ja.«
»Warum?«
»Wenn man seinen Beruf nicht ausüben kann, verliert man nach und nach das Interesse, und die Lust schwindet.«
Ich will diesen Satz gerade analysieren, die Schwachstelle aufspüren, da fährt sie schon fort.
»Das ist wie bei einem Schauspieler – wenn er nicht spielen kann, stirbt etwas in ihm.«
Schwachstelle gefunden. Antwort:
»Dieser Satz stammt nicht von Ihnen.«
»Stimmt, er stammt von einem berühmten Schauspieler, den ich vor ein paar Jahren fotografiert habe.«
»Also haben Sie Ihren Beruf früher einmal ausgeübt.«
»Ja.«
»Und nun haben Sie eine Flaute, und das fühlt sich unerträglich an?«
Sie antwortet nicht. Eigentlich hätte ich mit einem weiteren »Ja« gerechnet, diese Bestätigung scheint Nathalia gerne zu verwenden, was für einen entschlossenen Charakter spricht, vielleicht überbordend, aber unendlich lebendig. Auf meiner Couch lagen schon so einige, die nur Ich weiß nicht … Vielleicht … Mhm … Pfff …Hm … nuschelten. Ein paar Sekunden verstreichen, während ich Nathalia grob einer Kategorie zuzuordnen versuche. Fürs Erste würde ich schätzen: melancholische Depression.
»Erinnern Sie sich noch an Ihr letztes Foto?«
»Ja.«
»Was war darauf?«
»Ein Mord.«
Nathalia ist wieder weg. Ich habe die Sitzung direkt nach diesen Worten beendet. Man darf sich nie auf das Spiel der Patientinnen und Patienten einlassen. Hier drinnen ist das Leben nicht so wie da draußen. Da draußen reagieren die Leute verblüfft auf eine derartige Geschichte, es hagelt Fragen, die Aufmerksamkeit konzentriert sich, das Adrenalin steigt. Hier drinnen nicht. Hier ist es anders. Nachdem sie aufgestanden war und gezahlt hatte, haben wir Handynummern ausgetauscht. Das halte ich immer so. So können die Patientinnen und Patienten mich im Notfall erreichen und umgekehrt. Es ist eine Verbindung, von der wir Gebrauch machen – oder eben nicht.
Meine Akte wird wie folgt aussehen:
Vorname: Nathalia.
Nachname: Guitry.
Grund des Besuchs: Hat einen Mord fotografiert.
Symptome: Antriebsarmut.
Diagnose: Melancholische Depression.
In einer weiteren Spalte notiere ich immer, was mir nach der ersten Sitzung durch den Kopf schießt. Diesmal schreibe ich: Fantasie, Wahrheit, Lügensucht.
Wir haben keinen Folgetermin vereinbart, wenn sie einen möchte, muss sie mich kontaktieren.
Sie legt sich genauso sanft hin wie beim ersten Mal.
Am liebsten würde ich auf ihr letztes Foto zurückkommen, aber bei Nathalia muss ich, glaube ich, einen anderen Ansatz wählen. Dennoch, Mord … Die meisten meiner Patientinnen und Patienten reden sich hier recht banale Neurosen von der Seele: berufliche Probleme, komplizierte Scheidung, Minderwertigkeitskomplex. Die moderne Welt bringt sie aus dem Gleichgewicht – Coronakrise, internationale Spannungen, deren Auswirkungen auf ihre Ersparnisse sie tagtäglich sehen. Stress. Noch mehr Stress durch Kinder, die urplötzlich von bezaubernden kleinen Blondschöpfen zu rebellischen Teenagern heranwachsen. Oder der Klassiker: Ödipuskomplex.
Davon habe ich zwei: Lemont und Robotti. Man müsste fast einmal eine Gruppentherapie anberaumen, ein Wochenende auf dem Land, damit die beiden sich kennenlernen. Sie bilden, was meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen seit neustem twin complex nennen: zwei Menschen mit ähnlichen Problemen, die diese während der Therapie auch ähnlich zum Ausdruck bringen. Lemont und Robotti wurden beide in ihrer Kindheit von überbordenden Müttern erstickt und schleudern mir ihr Trauma mit nur leichten Abwandlungen entgegen. Und ich höre zu, versuche sie bei ihrem Erkenntnisprozess zu leiten. Das ist schwierig, manchmal sogar ermüdend, und es kommt äußerst selten vor, dass eine hübsche junge Frau auf meiner Couch Platz nimmt, nur um mir von einer künstlerischen Blockade zu erzählen. Mord. Keine künstlerische Blockade, Mord.
»Sie haben von Ihrem Beruf berichtet, nicht aber von Ihrem Privatleben«, sage ich. Diesen Weg beschreite ich nicht gern, aber er ist unumgänglich. Manche meiner Patientinnen und Patienten geraten in einen regelrechten Redezwang. Anders Nathalia. Sie antwortet nur:
»Ja.«
»Möchten Sie mir etwas darüber erzählen?«, hake ich nach und ernte bloß angenehmes Schweigen. Ich weiß nicht, ob mein Geist bereit gewesen wäre für Dutzende Kindheitserinnerungen, eine widerwärtiger als die andere. In der Regel sind Psychoanalysen eher unspannend. Hin und wieder allerdings sticht ein Patient oder eine Patientin hervor, ist begabt, intelligent, antwortet knapp – man erkennt sie sofort.
Manche bezeichnen das als Assistenz, weil das Gegenüber bei der Arbeit assistieren wird, statt teilnahmslos auf der Couch zu liegen und darauf zu hoffen, dass ein Wunder geschieht.
Fragen, auf die langes Schweigen folgt – so etwas gibt es eigentlich nur hier drinnen. Fragt man da draußen jemanden etwas und erhält keine Antwort, setzt das Unheimliche ein. Hier drinnen ist nichts unheimlich. Alles ist heimelig, sicher, normal. Also warte ich.
»Ich schaffe es nicht zu leben.«
»Das heißt?«
»Ich schaue anderen beim Leben zu und frage mich: Wie machen die das?«
»Und wie machen sie es?«
»Keine Ahnung.«
»Ist Ihr Fotoapparat eine Art Schutzbarriere zwischen Ihnen und der Welt?«
»Ein bisschen, ja.«
»Und weil Sie nicht mehr fotografieren, ist die Barriere nicht mehr da, und Sie fühlen sich schutzlos.«
»Vielleicht.«
»Was tun Sie den ganzen Tag?«
»Nichts.«
Ich warte darauf, dass sie weiterspricht. Aus Erfahrung weiß ich, wie viele Aktivitäten das Wort nichts nach sich ziehen kann. Als mein Patient Guichard auf die Frage nach seinen Mittwochnachmittagen nichts antwortete, folgte eine detaillierte Aufzählung aller möglichen und vorstellbaren Sadomasopraktiken sowie in der Szene bekannten einschlägigen Clubs, verbotenen Adressen und weiblichen Vornamen mit vorangestelltem »Herrin«. Nichts bedeutete für Guichard, sich von Herrin Caroline in einer hübschen kleinen Wohnung im sechzehnten Arrondissement anketten und bis aufs Blut auspeitschen zu lassen. Niemals wäre ihm in den Sinn gekommen, dass dieses nichts uns vielleicht die Arbeit erleichtern könnte. Je randständiger, desto naiver.
»Ich schlafe und will nie wieder aufwachen.«
»Denken Sie über Suizid nach?«
»Nein.«
»Sind Sie sich da sicher?«
»Ja, ich will mich nicht umbringen.«
Meine Patientinnen und Patienten lügen oft. Aber Nathalia sagt die Wahrheit, zumindest möchte ich das glauben. Erführe ich morgen von ihrem Tod durch eine Überdosis Barbiturate, wäre ich wirklich überrascht.
»Und wenn Sie nicht schlafen?«, frage ich.
»Schreibe ich Tagebuch.«
»Sie schreiben gerne?«
»Ja.«
»Und wenn Sie nicht schreiben …«
»Gehe ich spazieren.«
»Wo?«
»In meiner Wohnung. Ich beobachte die Leute von gegenüber. Auf der Nordseite.«
»Sie beobachten Ihre Nachbarn?«
»Ja. Eine Berufskrankheit, ich habe das Gefühl, nur ein Auge zu sein.«
Sie hat eine Perversion entwickelt – Voyeurismus – und durch ihren Beruf verklärt: Als Fotografin kann Nathalia ja gar keine krankhafte Spannerin sein. Das Beäugen ist für sie lediglich eine Fortführung ihrer Arbeit. Echte Voyeure dagegen haben nie eine Verbindung zu visuellen Berufen. Als reine Liebhaber geben sie ihr letztes Hemd für Teleobjektive, Nachtsichtbrillen und Laserentfernungsmesser. Sie verstecken sich in ihren Autos und »sind ganz Auge«, wie sie sagen. Manchmal wagen sie sich auch in die Sauna oder an den FKK-Strand und lassen ihre fast schon militärische Ausrüstung im Kofferraum zurück. Es handelt sich in der Regel um sanfte, sensible, schüchterne Menschen, die mit ihren Augen trotzdem die zwielichtigsten Szenen verschlingen. Man kann sie leicht erkennen: Sie werden nicht gern berührt. Vor Körperkontakt schrecken sie zurück wie eine Auster vor Zitronensaft. Ich weiß das, deshalb gebe ich ihnen nie die Hand. Dafür sind sie mir dankbar.
»Ein Auge, das sieht, aber nicht lebt?«
»Ja.«
»Wie viele Stockwerke hat diese Nordseite?«
»Fünf.«
»Und was sehen Sie in diesen fünf Stockwerken?«
»Geschichten, Leben. Das Leben.«
Lauern statt leben. Nathalia versteckt sich hinter ihren Augen, kauert sich in deren Höhlen zusammen wie ein Tier, hält Winterschlaf in der Tränenflüssigkeit gleich dem Fötus im Fruchtwasser, zurück an den Anfang. Sie ist ein schwierigerer Fall als zunächst angenommen. Melancholische Depression aufgrund beruflicher Orientierungslosigkeit ist nicht unüblich. Das betrifft Künstlerinnen genauso wie Führungskräfte, die ihnen unverständliche Umstrukturierungspläne nicht verwinden. Normalerweise versuche ich, bei diesen Menschen wieder Interesse für das Leben zu wecken, indem ich ihnen etwas zu tun gebe. Schon das winzigste bisschen hilft. Die entlassene Führungskraft zum Beispiel bitte ich um Aktientipps. Dabei achte ich immer darauf, dass meine kleine Aufgabe – die den Patientinnen und Patienten manchmal Übermenschliches abverlangt – im jeweiligen Kompetenzbereich liegt. Bei Nathalia wird das gar nicht so leicht, sie fotografiert nicht mehr und verlässt ihre Wohnung nicht.
»Ich möchte Sie um etwas bitten, Nathalia.«
»Ja?«
»Suchen Sie sich irgendetwas zu tun.«
»Ich will nicht fotografieren«, erwidert sie sofort.
»Das müssen Sie auch nicht.«
Wieder tritt Schweigen ein. Ich sehe nur ihre glänzenden schwarzen Haare und ihre schlanken Hände, die auf dem Rock liegen. So kommen wir nicht weiter. Das gesprochene Wort hat seine Grenzen, »manchmal muss man vom Kurs abweichen«, sagte schon Malevinsky, mein Lehrmeister. Und will man vom Sprechen abweichen, wechselt man zur anderen Form der Bekenntnis: dem Schreiben. »Das geschriebene Wort ist gedacht, also ist es Denken, ob es nun aus dem Mund oder der Feder strömt, es ist Existenz, der erste Körper dient nur als Träger für den zweiten, und das ist derjenige, der uns interessiert: das Unsichtbare.« Wieder Malevinsky. Schreiben tut man im Stillen, für sich allein, beide Zustände scheinen Nathalia nicht fremd zu sein. Also versuche ich es.
»Sie beobachten die fünf Stockwerke auf der Nordseite. Mein Vorschlag wäre: Wir beide wechseln die Strategie. Wir kommunizieren ab jetzt anders. Lassen Sie es mich erklären: Zu jeder Sitzung bringen Sie mir einen kurzen Text mit über das Leben in einem der Stockwerke. Ob es sich um eine wahre Geschichte oder eine erfundene handelt, ist dabei unwichtig. Wir arbeiten uns von Stockwerk zu Stockwerk vor, Erdgeschoss, erster Stock, zweiter, dritter … bis zum fünften. Was meinen Sie?«
»Beim fünften hören wir auf?«
»Beim fünften werden wir schon ein gutes Stück vorangekommen sein«, sage ich.
»Und Sie glauben, dass ich Ihnen durch diese Geschichten etwas über mich verrate?«
Sie hat das Prozedere bereits durchschaut, wirkt aber wachsam. Also muss ich ihre letzten Wälle niederreißen, die des Bewusstseins, das das Ich zu schützen meint und es doch nur erstickt.
»Ich würde diese Übung gerne ausprobieren.«
»Okay, aber ich bringe Ihnen die Texte nicht mit«, erwidert sie. »Ich schicke sie per Post. Ich ertrage es nicht, wenn jemand das, was ich geschrieben habe, in meiner Gegenwart liest.«
»Einverstanden.«
Während sie bezahlt, erkläre ich ihr noch, dass sie während unserer Sitzungen ruhig rauchen könne.
»Woher wissen Sie, dass ich rauche?«, fragt sie.
»Das riecht man an Ihrer Kleidung«, antworte ich mit einem verschwörerischen Lächeln.
Nathalia richtet ihre blauen Augen auf mich und schaut mich fest an. Ich weiß nicht, ob in ihrem Blick eine Frage liegt oder eher ein Vorwurf. Ich sehe nur, dass sie mich sieht. So deutlich sehen Patientinnen und Patienten mich nur selten, oft meiden sie sogar meinen Blick.
Der erste Brief kam heute Morgen, am 16. Januar, in einem markenlosen Umschlag aus Kraftpapier mit meinem aufgedruckten Namen. Ich war überrascht, dass Nathalia nicht mit der Hand geschrieben hatte, ich hätte gerne ihre Schrift analysiert. Unbeholfen? Sinnlich? Zögerlich? Energisch? Sind ihre Ms und Ns spitz oder rund? Ihre is von Punkten oder kleinen runden Planeten gekrönt?
Ich werde es nicht erfahren. Fünfzehn Seiten über das Erdgeschoss. Computergeschrieben und zusammengetackert. Der Umschlag weckte beim Frühstück direkt die Neugier meiner Frau, sie wollte den Text unbedingt lesen. Auf meine Erklärung hin, dass es sich um eine therapeutische Übung handele und nicht um einen Kriminalroman, war sie enttäuscht und warf mir Humorlosigkeit vor; früher wäre ich lustiger gewesen.
Früher? Dieses Wort verwenden meine Patientinnen und Patienten auch oft. Sie tragen es vor sich her wie ein Amulett: Früher war ich ganz anders, früher war alles gut, hätten Sie mich bloß früher kennengelernt. Bis zu welchem Zeitpunkt reicht dieses sagenumwobene Früher zurück? Gibt es einen Moment in unserem Leben, wo alles schlicht, einfach und sorgenfrei ist? Nein, natürlich nicht. Die Vergangenheit wird immer in einem besseren Licht neu erfunden, durch die Erinnerungen gefiltert, bis aller Schmutz herausgesiebt ist und nur noch ein paar Goldkörner übrig bleiben, die heller glänzen, als sie es je waren. Ich für meinen Teil weiß nicht einmal so recht, worauf meine Frau anspielt. Habe ich irgendwann einmal vor Humor nur so gestrotzt und beim Aperitif mit einem Glas Portwein in der Hand reihenweise lustige Anekdoten über meine Patientinnen und Patienten zum Besten gegeben?
An diesen Mann kann ich mich nicht erinnern.
Jetzt sitze ich auf meinem Schreibtischstuhl und greife nach der halbmondförmigen Lesebrille, die ich seit ein paar Jahren brauche und regelmäßig verlege. Nathalia kommt in einer Stunde, ich will mich dreißig Minuten lang der Lektüre widmen, vielleicht Anmerkungen machen. Ich öffne die Kappe des Cross-Füllfederhalters vom Verband der New Yorker Psychoanalytikerinnen und -analytiker, der prunkvoll graviert ist: To J. Faber from the Analyst Guild Of N.Y. C.
Ich muss gestehen, dass ich diese Übung zum ersten Mal bemühe. Bisher habe ich nur gelegentlich Niederschriften von Träumen oder Familienerinnerungen erbeten. Normalerweise beginnen diese Texte mit: Meine Großmutter war eine wunderbare Frau … oder Gestern Nacht bin ich nackt durch die Straßen gelaufen.
Diesmal ist es anders: