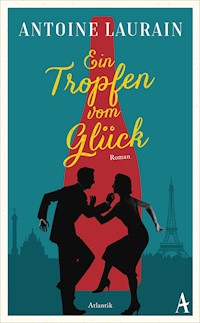10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Antoine Laurain, wie wir ihn lieben: voller Charme und Esprit und immer für eine Überraschung gut. Schon seit Jahren ist François Heurtevent Bürgermeister von Perisac, die Leute mögen ihn, seine Wiederwahl gilt als sicher. Doch dann geschieht das Unglaubliche, und ein windiger Konkurrent setzt sich gegen ihn durch. Niedergeschlagen räumt François sein Rathaus, da fällt es ihm in die Hände: sein Klassenfoto, dreißig Jahre alt, darauf lauter junge Gestalten, vor denen die Zukunft wie ein zauberhaftes Geheimnis zu liegen scheint. Kurzerhand beschließt François – schließlich hat er jetzt Zeit –, die Kameraden von früher aufzuspüren. Ob Pfarrer, Friseurin oder Pornoregisseur – bei seinen Begegnungen wird François klar, auf welch unterschiedliche Weise sich das Glück im Leben darstellen kann. Doch wird er selbst es wiederfinden, jetzt, wo sich die Hinweise auf einen Wahlbetrug verdichten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Ähnliche
Antoine Laurain
Glücklicher als gedacht
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Atlantik
Meine Vergangenheit ist drei Viertel meiner Gegenwart.
Ich träume mehr, als ich lebe, und ich träume rückwärts.
Jules Renard
(Tagebuch, 23. März 1901)
EPROM: Erasable programmable read-only memory
(Löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher)
Vor wenigen Minuten hatte der Champagner noch auf dem Buffet gestanden. Wie von Zauberhand war er nun verschwunden. Am anderen Ende des Saales knallte ein Korken, und alle Blicke suchten empört den Übeltäter.
»Was soll das denn?«, murmelte Julien Bailler.
Der junge Mann, der das Geräusch ausgelöst hatte, zuckte mit den Schultern und schenkte sich ein Glas ein, er hatte halt Durst.
Ich hatte keinen Durst. Ich kannte das Endergebnis seit einer Dreiviertelstunde. Ein Mitglied der Parteigruppe hatte mir um siebzehn Uhr dreißig mit tonloser Stimme mitgeteilt, dass das Wahlergebnis entgegen allen Erwartungen sehr eng ausfallen werde. Da wusste ich es schon. Mein Freund Armand von der Firma hatte mich zehn Minuten zuvor angerufen. Seit einer Stunde stagnierten die für mich abgegebenen Stimmen. Ich kam nicht wieder hoch.
»Sie sagen, es sei ein Phänomen von Röhren.«
»Was für Röhren? Backröhren?«
»Kommunizierende Röhren. Die eine füllt sich, und die andere hört auf, sich zu füllen … die andere bist du.«
»Was soll denn dieser Röhrenschwachsinn?«
»Sie sagen, das sei selten, komme aber vor.«
Eine Stunde und sechzehn Minuten später bestätigte der Parteisekretär Armands Röhrengeschichte: »François …«
»Wird’s nichts?«
»Nein. Alphandon hat es geschafft, keine Ahnung wie, aber er hat gewonnen.«
»Für alle überraschend verliert François Heurtevent die Bürgermeisterwahlen in Perisac«, verkündeten die nationalen Fernsehnachrichten. Dabei hatten mich alle Umfragen und Prognosen als Gewinner gesehen. Diese Wahlen zu verlieren war nahezu undenkbar gewesen.
»Das ist nicht schlimm, Schatz«, sagte meine Frau leise in meinen Nacken, ganz dicht hinter mir, wie eine tröstende Muse.
Worte, die man Kindern sagt, wenn sie gerade einen Wettkampf im Mickymaus-Club verloren haben.
»Doch, das ist schlimm.« Ich hätte gern mit düsterer, männlicher Stimme geantwortet, die keinen Widerspruch duldet. Aber der Satz war kaum zu hören. Ich kam nicht von den Champagnerflaschen los, die gerade verschwunden waren. Dann wanderten meine Augen zu einem gerahmten Poster an der Wand, das für Fahrradausflüge in der Region warb. Darauf sah man Jungen und Mädchen, die mit strahlendem Lächeln über unsere schönen Straßen radelten. In der zum Wahlkampfbüro verwandelten Geschäftsstelle der Partei waren sie die Einzigen, die lächelten. Das von der Sonne ausgebleichte Foto war mir vertraut, es hing bestimmt schon zwanzig Jahre da. Seit der zweiten Amtszeit von Mitterrand. Auch die schien schon Lichtjahre entfernt. Inzwischen hätte man es mal ersetzen können. Ein neues aufhängen. Irgendetwas in der Stadt war eingeschlafen. Zu dem, was die Journalisten Alltagstrott nennen, wenn sie nichts Berichtenswertes mehr finden, gehörte auch ich, ja seit zwei Monaten war ich geradezu seine Verkörperung. Jetzt hatte ich die Rechnung. Die Radfahrer auf dem Foto waren um die zwanzig. Jetzt mussten sie also vierzig sein, verheiratet und mit Kindern, die selbst schon Räder hatten …
›Wenn Derk das sehen würde‹, war der einzige Satz in meinem Kopf, den ich beinahe ausgesprochen hätte.
»Der Unterschied beträgt nur zweihundertzwei Stimmen«, tröstete mich Beauvin und legte mir die Hand auf die Schulter.
Ich drehte mich um und sah ihn ausdruckslos an. Ohne Zorn, ohne Verzweiflung. Ich betrachtete den Kulturdezernenten genauso, wie ich das Fahrradposter betrachtet hatte. Wie ich einen Hummer im Aquarium des Fischhändlers angestarrt hätte. Merkwürdigerweise signalisierten meine Papillen Appetit auf gegrillten Hummer. Er verschwand sofort wieder, sicher die unbewusste Erinnerung an eins von Sylvies neusten Gerichten, gegrillter Hummer mit Süßholzrinde an einer Soße aus roten Pflaumen mit Eischnee.
»Möchtest du etwas essen?«, fragte mich der Dritte auf der Liste und reichte mir eine Schale mit Keksen.
Ich nahm einen und kaute darauf herum.
»Schmeckt ja widerlich, wer hat die gekauft?«
»Äh … Wir. Das ist unser Kampagnenbuffet.«
»Das erklärt alles«, antwortete ich, legte den halben Keks auf den Teller zurück und wandte mich ab.
Ein Kameramann packte seine Ausrüstung ein, der Saal leerte sich rasch. Das Wort Exodus kam mir in den Sinn. Auf den Fernsehbildschirmen, die in allen vier Ecken aufgestellt waren, sah man das gegnerische Lager feiern. Hübsche Mädchen jubelten vor den Kameras der Regionalsender mit Champagnerflaschen in den Händen. Wie 1998 nach dem Endspiel der Weltmeisterschaft. Das erinnerte mich daran, dass ich bald die Fotos von mir mit Berühmtheiten von den Wänden meines Büros abhängen würde, unter anderen das mit Zidane. Ich sah darauf besonders blöd aus, aber den Bürgern hatte die Nähe ihres Bürgermeisters zum großen Zizou gefallen. Wer bietet mehr? Damals niemand. Tausendmal wurde ich auf der Straße gefragt, ob Zidane nett sei. Das beschäftigte sie am meisten: ob er nett sei.
Zurück im Rathaus, allein auf der Terrasse, hörte ich Knaller und Gehupe in der Nacht. Den Gesang angetrunkener Wahlkämpfer. Mich überkam die romantische Vision, wie das Rathaus ganz allmählich unterging und ich auf dem höchsten Punkt der Brücke darauf wartete, dass mich die Fluten verschlangen. Das war der Moment für großartige Sätze. Aber mir fiel nichts ein. Zweiundsechzigtausenddreihundertacht Bürger, zweihundertzwei Stimmen Abstand. Ich fragte mich, wo unter den Lichtern in den Häusern diese zweihundertzwei Stimmen waren.
»Zum Wohl, Herr Bürgermeister!« Ein junger Mann prostete mir vom Platz aus mit einer Dose in der Hand zu. Ein Anhänger, der mich trösten wollte, oder ein Unterstützer des gegnerischen Lagers, der mich verarschte? Ich hatte keine Ahnung und grüßte ihn mit einer sparsamen Geste, wie der Papst auf dem Petersplatz. Da gab es nur den kleinen Unterschied, dass der Papst sich im Vatikan einer jubelnden Menge gegenübersah. Der Platz war leer, nur ein grauer Hund überquerte ihn, um an einer Laterne das Bein zu heben. Das war das Bild, das mir von diesem Wahlabend bleiben würde. Sicher ein Hund des gegnerischen Lagers, der zu viel Champagner getrunken hatte und sich vor meinem Fenster erleichterte.
»Die Küche von La Musarde ist offen, komm, wir gehen essen«, sagte Sylvie, die mir gefolgt war. »Es gibt Hummer mit Süßholzwurzel.«
In dem Moment erhielt ich eine SMS von meiner Tochter. »Echt Scheiße«, schrieb sie mit der Frische ihrer achtzehn Jahre. Ich, der ständig ihr Vokabular kritisierte, konnte ihr ausnahmsweise nichts vorwerfen, sie hatte die beste Zusammenfassung des Abends formuliert.
Hat die letzten Wahlen um das Bürgermeisteramt von Perisac verloren. Gleich am nächsten Tag hatte ich diesen Satz in meiner Biographie bei Wikipedia ergänzt.
Heurtevent, François (französischer Politiker), geboren 1961. Sohn von Pierre Heurtevent, Zahnchirurg, und der Boulevardschauspielerin Marie Dava-Heurtevent. War mit dreiundzwanzig Jahren Mitglied der Anwaltskammer von Paris, schlug jedoch keine Anwaltslaufbahn ein, sondern begann seine politische Karriere an der Seite von André Dercours. Stand als dessen persönlicher Sekretär und später parlamentarischer Referent auf Platz zwei der Liste, mit der Dercours die Kommunalwahlen 1989 gewann, und wurde sein erster Stellvertreter als Bürgermeister von Perisac. Nach Dercours’ Tod während seiner Amtszeit wurde Heurtevent vom Gemeinderat zum Bürgermeister ernannt und gewann die nächste Wahl im ersten Wahlgang mit einundsechzig Prozent der Stimmen. Heurtevent ist kein typischer Politiker, kein Absolvent der ENA, stammt nicht aus dem Dunstkreis der Macht. Sein Netzwerk geht weit über die Grenzen seiner Partei hinaus. Er wurde als Bürgermeister zweimal wiedergewählt und bewarb sich erfolgreich um ein Abgeordnetenmandat, das er aber bei den letzten Parlamentswahlen knapp verlor. Sein Charisma macht ihn zu einem bekannten Vertreter seiner Partei. François Heurtevent ist mit der berühmten Sterneköchin Sylvie Desbruyères verheiratet.
Hat die letzten Wahlen um das Bürgermeisteramt von Perisac verloren.
→ Link: Website Stadt Perisac.
→ Link: Website La Musarde***
→ Link: Website seiner Partei.
Nach dieser absolut masochistischen Handlung lief ich durch meine Stadt. Ohne bestimmtes Ziel. Wie früher, wie ganz am Anfang. Als ich so allein durch die sonnigen Straßen wanderte, hatte ich das seltsame Gefühl, in der Zeit zurückzugehen. In der Altstadt besuchte ich einige Händler, die mir mit betroffener Miene versicherten, sie könnten meine Niederlage nicht begreifen. Der Chef einer neuen Weinbar ließ mich zwei auserlesene Weine verkosten. Er erwähnte die Wahlergebnisse nicht, wir plauderten über die Gerbsäure des Weins, die Preise und das Wetter.
Vor dem Gymnasium Paul Valéry kam ich an unseren Wahlplakaten auf den zusammenklappbaren Metallständern vorbei, die man bald entfernen würde. Sie waren mit dicken Ketten verbunden, die an Motorradschlösser erinnerten. Die Kandidatin des Front National war wütend zerfetzt worden, jemand hatte kleine Hakenkreuze auf den blauen Hintergrund des Plakats gezeichnet. Nur der Kopf von Bernard Farnou, dem Kandidaten der Grünen, war unberührt, er hatte so wenig Stimmen erhalten, dass er bei den Einwohnern keinerlei Hass ausgelöst hatte. Ich bereute, kein Bündnis mit ihm eingegangen zu sein. Er war ein sympathischer Mann, pensionierter Biologielehrer, ein wenig überfordert von den Zielen seiner Partei. Wir hatten uns wegen einer kommunalen Mülldeponie entzweit, die, zugegeben, nicht gerade den Normen entsprach, aber es gab keinen anderen Standort. Streit über nicht recycelbare Abfälle und die Mülltrennung hatten unser Zusammengehen verhindert. Dem kommunistischen Kandidaten hatte jemand »Schwuchtel« auf die Stirn geschrieben, obwohl er meines Wissens nicht auf Männer stand. Ein gebildeterer Gegner hatte mit rotem Filzstift ergänzt: »Lass dich bei Putin wählen«. Die Liste der Revolutionären Kommunisten war zerrissen und flatterte im Wind, ich strich sie mit der flachen Hand glatt. Pierre-Marie Alphandon, mein Nachfolger, war auch bekritzelt worden, aber der Schmierfink hatte nur noch wenig Tinte in seinem Kuli gehabt, denn das Gesicht war verschont geblieben. Dafür hatte ein Spaßvogel mit schwarzem Filzstift einen Regenwurm gemalt, der ihm aus dem Ohr kroch. Ebenfalls mit schwarzem Filzstift hatte dieselbe Hand mein Porträt mit einem Schnurrbart à la Salvador Dalí und einem schwarzen Zahn versehen. Ich trat zurück, um mich zu betrachten, der Schnurrbart war nicht ohne Chic, der Zahn gefiel mir weniger. Erst bei näherem Hinsehen bemerkte ich, dass der Mann mit dem Kuli ohne Tinte eine Korrektur meines Slogans vorgenommen hatte: Aus »Eine Zukunft mit Heurtevent« hatte er »Keine Zukunft …« gemacht. Eine kleine, aber wirksame Infamie.
Ein paar Jahre zuvor hatte ein Fotograf aus der Stadt eine Förderung bei der Kulturabteilung beantragt, um seine Fotoserie zerrissener und durch anonyme Hände verunstalteter Wahlkampfplakate herauszugeben. Ich fand die Idee lustig, aber der Gemeinderat war mir nicht gefolgt. Die Fotos zeigten so ziemlich alles, was sich an den Eingängen der Wahlbüros aufspüren ließ, entzückende Wörter wie »Schwanzlutscher«, »Kackvogel« oder »Schlitzohr« fanden sich neben anderen, weit poetischeren Kreationen. Seine Entschlossenheit, alles in seine Sammlung aufzunehmen, hatte die Publikation verhindert.
»Herr Bürgermeister!«
Ich drehte mich um und stand vor eben jenem Fotografen. Wie hieß er noch? Es gab eine Eselsbrücke, um sich seinen Namen zu merken … Guillaume Lux, das war es. Wie der Fernsehmoderator Guy Lux.
»Guten Tag, Guillaume«, sagte ich.
Er schien sich zu freuen, dass ich mir seinen Vornamen gemerkt hatte. Nachdem er einige Fotos von den letzten verunstalteten Plakaten gemacht hatte, unterhielten wir uns. Ich wunderte mich, dass er meins nicht fotografierte, war das ein Ausdruck von Takt, weil ich neben ihm stand? Aber er hatte es schon in der vorherigen Woche aufgenommen, und das Plakat hatte sich seitdem nicht verändert, wie er mir erklärte. Er bot in seinem kleinen Laden Hochzeitsfotos, Passbilder und Aufnahmen von Familienfeiern an. Das musste auf Dauer langweilig sein. Wir gingen ein Stück zusammen, und bevor wir uns trennten, fragte er schüchtern, ob er ein Foto von mir machen dürfe.
»Kein Plakat, Sie selbst. Ein Porträt auf der Straße.«
Gerne erfüllte ich ihm diesen Wunsch.
Er machte mich darauf aufmerksam, dass ich keine Krawatte umgebunden hatte, erst da fiel mir auf, dass ich dieses Symbol seit der Niederlage nicht mehr trug. Ich lehnte mich in offenem himmelblauen Hemd und grauer Jacke an die Mauer des Gymnasium, sah ihn an und versuchte, ein Lächeln anzudeuten. Ein leichter Wind zerzauste meine Haare, mein Lächeln erlosch, er drückte zweimal auf den Auslöser seiner Leica. Dann beugte er sich vor und machte ein drittes Foto.
»Danke«, sagte er sehr respektvoll. »Sie haben sich verändert.«
»Wirklich?«, fragte ich.
»Ja«, antwortete er ernst. »Da ist etwas in Ihren Augen …«
Dann verschwand er, ohne zu versprechen, dass er mir die Bilder schicken würde.
Der Amtsantritt von Pierre-Marie Alphandon war der Schlussakkord dieses Schwebezustands. Ich hatte die Übergabe der Macht auf sechzehn Uhr verschoben, um ausschlafen zu können. Natürlich hatte ich eine kleine Ansprache verfasst. Dabei hatte ich genug qualifiziertes Personal, das mir meine Reden schrieb, aber für diesen Anlass übernahm ich das selbst. Beim nochmaligen Durchlesen gefiel sie mir ziemlich gut. Die Lokalzeitung veröffentlichte sie im Wortlaut, mit einem Foto von mir beim Verlesen meiner Prosa. Vielleicht hätte ich mich öfter persönlich um bestimmte Aspekte meiner Kommunikation kümmern sollen. Mein Wahlkampfleiter, Franck Charmatan, und sein für den Kontakt mit den Medien zuständiger Stellvertreter waren gleich nach der verlorenen Wahl verschwunden. Ihren Slogan »Eine Zukunft mit Heurtevent« hatten sie mitgenommen. Ich hatte eingewandt, dass ich schlecht die Zukunft verkörpern könne, da ich schon die Gegenwart darstellte. Mit Kurven und Tabellen bewiesen mir die beiden Schwachköpfe das Gegenteil: »Die Verschmelzung Gegenwart-Zukunft, Sie verkörpern die Dialektik des Dialogs«, hatte mir Charmatan erklärt.
Man brauchte nur einen Buchstaben seines Namens austauschen, um zu wissen, was er war.
Nachdem ich meine kleine Ansprache unter Applaus beendet hatte, musste ich in drückender Stille die Hand meines Nachfolgers drücken, ich wünschte ihm viel Glück und dachte das Gegenteil. Die Kameras der Lokalpresse verewigten diesen schmerzlichen Moment auf ihren Speicherchips. Ich war nicht besonders betroffen, darüber war ich schon hinweg, eigentlich spürte ich nur unendliche Müdigkeit und Rückenschmerzen, dagegen hatten auch die beiden Paracetamol nicht geholfen, die ich am Morgen geschluckt hatte. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die mich seit fünfzehn Jahren begleitet hatten, würden in den kommenden Wochen gefeuert werden. Ich war niemand mehr außer François Heurtevent, achtundvierzig Jahre, braunes Haar, an den Schläfen etwas grau, ein Meter fünfundachtzig, von nun an ein ganz normaler Bürger.
Ein Monat war vergangen. Die Sonne schien durch die Vorhänge des Schlafzimmers, es war ungefähr elf Uhr, vielleicht auch schon zwölf. Meine Frau stand weiterhin um sechs auf, um ins La Musarde zu gehen. Für mich war das Aufstehen zum schwierigsten Akt überhaupt geworden, der mir neuerdings eine mehrstündige mentale Vorbereitung abverlangte. Zwischen neun und halb zwölf spielte ich flüchtig mit dem Gedanken und versank wieder im Halbschlaf, die Nase ins Kissen gebohrt, wie eine komatöse Katze auf einem Heizkörper. Während dieser leeren Stunden im stillen Haus kam nur Archipattes ab und zu vorbei, um meinen Schlaf zu kontrollieren. Der Familienkater war Frühaufsteher, er schlief erst ab dreizehn Uhr und wachte gegen zwanzig Uhr zu den Fernsehnachrichten auf.
So wurden meine Vormittage unter der Bettdecke nur kurzzeitig durch das Trommeln der Krallen am Bettrahmen unterbrochen. Kleine Angelhaken, die sich gleich darauf mit Wut und Genuss in den Lakenstoff bohrten. Ich brauchte nur unter dem Kopfkissen hervor »Archipattes!« zu schimpfen, dann hörte er sofort auf; nach ein paar Sekunden Stille folgten ein wilder Galopp und das Rutschen von Krallen in der Diele. Dann war Stille, und Morpheus nahm mich bis mittags erneut in seine Arme.
Archipattes war zwölf Jahre zuvor durch das Fenster meines Büros im Rathaus gekommen. Ich hatte eine Besprechung mit der Kulturabteilung, um unseren Salon du Livre vorzubereiten: »Ein Buch, viele Autoren, eine Region«. Als ich in mein luxuriöses, mit Deckenleisten verziertes Büro ganz im Stil Napoleons des Dritten zurückkam, stand der Kater mitten auf meinem Schreibtisch auf dem Dossier über die Aktionen des Gewerkschaftsbundes. Er sah mich näher kommen, ohne mit der Wimper zu zucken, und als ich vor ihm stand, lächelte er mich mit gelangweilter Miene an. Hätte man in dem Moment ein Foto gemacht, hätte man denken können, der Bürgermeister von Perisac sei ein Kater. Nur Sempé konnte solche absurden Situationen in einer Zeichnung einfangen. Am selben Abend brachte ich die Raubkatze nach Hause, und meine damals sechsjährige Tochter Amélie taufte sie Archipattes.
Man kann durchaus sagen, dass mein neuer Tagesrhythmus meine Umgebung beunruhigte. Missbilligend beobachtete meine Frau, wie ich immer länger schlief. Zunächst waren alle voller Verständnis für den kleinen Durchhänger und rieten mir, mich zu erholen, »Abstand zu nehmen«. Sylvie machte mir sogar eine heiße Zitrone, so eine Fürsorge hatte es seit den ersten Jahren unserer Ehe nicht mehr gegeben. Ungefähr nach der dritten Woche wurde es suspekt. Dass sich François Heurtevent, führender Kopf seiner Partei und ehemaliger Bürgermeister einer Stadt mit mehr als zweiundsechzigtausend Einwohnern, wie sein Kater benahm, war auf die Dauer offenbar schwer hinnehmbar.
Eines Morgens klingelte das Telefon auf dem Nachttisch. Schlaftrunken nahm ich den Hörer ab und knurrte ein »Hallo«.
»Heurtevent?«
»Am Apparat.«
Veillergant, PR-Chef meiner Partei, klang aufgeregt. Der Parteivorstand plane ein großes Meeting mit dem Vorsitzenden in Paris, auf dem Messegelände an der Porte de Versailles. Neben den Gewinnern seien auch alle Bürgermeister eingeladen, die die Wahlen verloren hätten. Man wolle die Reihen wieder schließen, sich um die Führung scharen und eine klare Linie für die Zukunft festlegen. Meine Teilnahme sei unerlässlich. Er wiederholte das letzte Wort und ergänzte es um Schlagwörter wie Strategie, Zweck, Ziel und Kampf.
»Wir müssen uns aufraffen!«, schloss er.
Aufraffen? Ich schlug das Wort im Wörterbuch nach: »aufraffen (V., refl.) sich – mühsam, mit Überwindung aufstehen, sich erheben; sich zusammennehmen, sich zusammenreißen, mühsam Haltung annehmen.«
Genau darüber stand: »aufquellen: (V., i. 192; ist) quellen, durch Aufnahme von Flüssigkeit anschwellen.«
In der Politik sind die Höhen sehr hoch und die Tiefen sehr tief.« Dieser Satz von André Dercours, an dessen Seite ich fünfundzwanzig Jahre zuvor meine Karriere begonnen hatte, ging mir oft durch den Kopf. Bisher hatte ich nur die Höhen kennengelernt. Die Tiefen sollten sich tatsächlich als sehr tief erweisen, dennoch würde ich in diesen tiefen Wassern, dort, wo selbst Fische nicht mehr wie Fische aussehen, für einen Augenblick das Licht finden.
André Dercours, genannt »Derk«, war Abgeordneter und Bürgermeister, Senator, kurzzeitig Minister, dann wieder Abgeordneter, Senator, und noch einmal kurzzeitig Minister gewesen. Eine Persönlichkeit des politischen Lebens der siebziger und achtziger Jahre, ein alter Fuchs, kahl wie eine Billardkugel und schlau wie ein Affe. Ich habe mich oft gefragt, was aus mir geworden wäre, wenn ich ihn nicht getroffen hätte. Wahrscheinlich gar nichts, jedenfalls nicht der, der ich bin. Männer wie André Dercours wird es nie mehr geben. Ich lernte ihn über meinen Vater kennen, der sein Zahnarzt war. Zwischen Karies und Füllungen entwickelte sich eine Art Freundschaft zwischen den beiden. Unsere Geschäftsbeziehung, wie Derk es nannte, begann im Jahr nach meiner Anwaltsprüfung. Ich hatte ohne Begeisterung Jura studiert. Im Gegensatz zu meinen Kommilitonen hatte ich keinen Ehrgeiz. Die Sache der anderen, die Sache des Volkes begeisterte mich nicht, ich wollte lieber meine eigene vertreten, und dabei half mir niemand.
»Deine Mutter hat erzählt, dass dir der Anwaltsberuf nicht gefällt«, sagte André Dercours eines Tages zu mir. »Das ist dein gutes Recht. Aber Spaß beiseite, das Leben hat dir weder eine Künstlerseele noch den Verstand eines Wissenschaftlers geschenkt, mein Junge, deswegen habe ich eine einfache Frage: Reizt dich die Politik? Anders gesagt, möchtest du für mich arbeiten?«
Ich glaube, dass es ihm mit seinen siebzig Jahren sehr gefiel, einen dreiundzwanzigjährigen Sekretär zu haben. Der Begriff »Assistent« war damals noch nicht üblich. Ohnehin hätte Derk ihn nicht verstanden. Er hätte für ihn einen unangenehmen Beiklang gehabt. »Ich brauch doch keinen Krankenpfleger« hätte er gesagt und dabei auf seinem Gebiss herumgekaut. Ein unerträglicher Tick, den er in den letzten Jahren entwickelt hatte, wobei er so weit ging, das corpus delicti auf seinen Schreibtisch zu legen und sogar Gäste zu empfangen, während seine Zähne gut sichtbar in der Stifteschale lagen. Der Gast hielt das Schweigen des Meisters für gründliches Nachdenken, bis sein Blick auf das Gebiss fiel, woraus er schloss, dass das Fehlen von Worten nicht undurchdringlichen Gedanken, sondern dem temporären Verzicht auf Schneide- und Backenzähne geschuldet war. Ich musste allerdings feststellen, dass Politiker eine sehr begrenzte Beobachtungsgabe haben, nur wenige entdeckten das Gebiss auf dem Schreibtisch. Jacques Chirac allerdings fiel nicht darauf rein. Wenn er uns besuchte, ließ er sich immer schwungvoll auf den Louis-XV-Stuhl fallen, um sich dann mit dem Problem konfrontiert zu sehen, wo er seine Beine unterbringen sollte, die eher zu einem amerikanischen Schauspieler der fünfziger Jahre passten. Wenn die Beine irgendwie verstaut waren, rief er: »Setz deinen Kiefer ein, bevor ich mit dir spreche, sonst verstehe ich dich nicht, alte Tarantel!«
Damals mochte ich Chirac. Viele von uns mochten ihn, links wie rechts hatte er ein überraschendes Kapital an Sympathie. Nur die Franzosen mochten ihn nicht. Als er 1988 von Mitterrand mit vierundfünfzig Prozent geschlagen wurde, war das eine schallende Ohrfeige. Derk, der sich sein Leben lang zwischen links und rechts durchgeschlängelt und wie ein Wetterhahn im Wind gedreht hatte, sagte ihm seine baldige Wahl voraus: »Du wirst sehen, du schaffst es noch. Wahrscheinlich beim nächsten Mal. Du schaffst es, du bist wie das niedliche Mädchen, das man ganz nett findet, aber mit dem man nicht unbedingt die Nacht verbringen möchte. Irgendwann kommt ein Abend, wo man sich einsam fühlt, man bumst mit ihr, und es ist eine Offenbarung. Du wirst die Offenbarung für Frankreich, sobald es Lust hat, mit dir zu bumsen. Auf die Nacht musst du geduldig warten.«
»Was redest du für einen Unsinn! Ich glaube, es ist mir doch lieber, wenn deine Zähne in der Stiftschale liegen«, war die Antwort des künftigen Präsidenten der fünften Republik.
Aber Derk behielt recht.
Besuche von Mitterrand waren hingegen echt verwirrend. Die beiden sprachen nie über Politik, nur über alte Bücher, die sie einander mit der Koketterie von Pornoautoren zeigten. Ich brachte ihnen den Kaffee. »François, mein Sekretär«, sagte Derk und wies auf mich. »Bonjour, Namensvetter«, begrüßte mich Mitterrand mit der kleinen Grimasse, für deren Imitation Thierry Le Luron berühmt war. Manchmal sah ich zu, wie sie sich ihre Bücher zeigten, wie Kinder ihre Spielsachen. Alte Kinder, sehr alte Kinder. In solchen Momenten packte mich der Schwindel: Was tat ich da mit diesen Greisen aus einer anderen Zeit, die sich dank einem Pakt, den auch Faust nicht abgelehnt hätte, an die Macht klammerten? Wenn ich so weitermachte, würde sich nie etwas ändern, sie würden völlig senil werden, und ich würde immer da sein, um ihnen den Kaffee zu servieren. Beängstigend.
Der eine hatte ein Dossier über jeden, der in Paris Rang und Namen hatte, der andere herrschte über die Atomwaffen. Und dann schwatzten sie über alte, ledergebundene Ausgaben, und ich machte den Kaffee mit gutem Évian in einer Kupfermaschine aus Zeiten Daladiers. Internet, Mobiltelefon und Plasmabildschirme waren im Kommen, aber die Regierenden lebten in einer anderen Welt, der versunkenen Welt der Menschen von früher, die mit dem Ende des 20. Jahrhunderts endgültig verschwinden würde.
Ich ließ sie über ihre Sammlerstücke plaudern und sah aus dem Fenster auf die getarnten Autos der Leibwächter des Präsidenten. Die Personenschützer mit ihren Ohrstöpseln und dem toten Blick hinter dunklen Brillen überwachten die Straße in aller Diskretion. Es war wie ein Ballett, nichts entging ihnen, weder die Frau mit dem Kinderwagen noch der Mann mit dem Baguette, das Paar, das die Straße überquerte, oder der junge Mann mit Inlineskatern. Auch ich nicht, hinter den Fensterscheiben von Derks Büro. Einer der Leibwächter sah zu mir nach oben, er erkannte wohl hinter der Scheibe eine bekannte Gestalt, die den Vorhang beiseiteschob. »Das ist der Junge bei dem Alten«, sagte er vielleicht in sein winziges Mikrophon. Übersetzt: »Das ist François Heurtevent bei André Dercours.« Sie wussten alles. In diesen Kreisen wissen alle alles über alle. Das waren die Dossiers. Das war Derks Stärke. Er hatte sie seit mehr als fünfzig Jahren gesammelt. Um mich zum Lachen zu bringen, besorgte er meine Akte aus dem Innenministerium. Sie hatten mich überwacht!
Weil ich für ihn arbeitete, hatten sie Erkundigungen eingezogen.
Von der Personenbeschreibung in meinem Personalausweis bis hin zu meinen intimsten Gewohnheiten war alles drin. Meine Stammkneipe, das Mädchen, mit dem ich mein Leben teilte, und das andere, mit dem ich ein paar Nächte teilte, die ich in meinem vollen Tagesablauf unterbrachte, wovon das erste Mädchen natürlich nichts wusste. Sie wussten es. Welches Bier ich trank und welche Zeitung ich las. Ich vermute bis heute, dass sie seinerzeit sogar in meine Wohnung eingedrungen sind und alles haarklein untersucht haben, um so gut informiert zu sein.
»Dossiers, mein Junge! Man muss Dossiers anlegen. Eines Tages, in einem Jahr, in zwanzig Jahren, werden sie dir nützen.«
Mit den Dossiers kann man Druck auf den Gegner ausüben und dadurch seine Haut retten. Je mehr man hat, desto mehr Joker hat man. Die Dossiers teilen sich in zwei Kategorien: Sex und Geld. Das Sexualleben: alle denkbaren Abweichungen, Geliebte oder Liebhaber. Das Geld: alle denkbaren Bestechungen, Korruption, Veruntreuungen. Außer Sex und Geld gibt es nichts. Höchstens noch die alten Bücher.
»Dieser handschriftliche Brief von Zola ist ein Meisterstück der Literatur des 19. Jahrhunderts, der Schlüssel zu seinem Werk.«
Ich höre noch die Stimme des Präsidenten, die vor lauter Begeisterung ganz schrill wurde, und Derk, der antwortete: »Ja. Ich hänge sehr daran.«
Heute gehört dieser Brief mir.
Ich möchte, dass du zu Dr. Houdard gehst.«
»Er ist ein Idiot.«
»Wie? Houdard ist ein Idiot? Er hat dich gerettet, als du deinen Infarkt hattest.«
»Du übertreibst immer, es war bloß eine Herzrhythmusstörung, die von selbst wieder weggegangen ist. Der Kerl langweilt mich, er erzählt mir von Tennis, und Tennis ist mir schnuppe, ich spiele kein Tennis.«
»Selbst schuld, du solltest es ausprobieren, das würde dir sicher guttun.«
»Um mit Doktor Houdard zu spielen?«, antwortete ich grinsend.
»Warum nicht?«
»Ich geh nicht zu ihm, außerdem bin ich gar nicht krank.«
»Du bist nicht krank? Sieh dich doch an! Amélie, findest du, dass dein Vater in einem normalen Zustand ist?«
Amélie war übers Wochenende nach Hause gekommen, sie machte eine abwehrende Geste, um zu zeigen, dass wir sie beim Nachdenken störten und sie sich zu diesem Thema ohnehin nicht äußern wolle.
»Was soll das?«, rief meine Frau. »Du machst es dir zu einfach, beteilige dich gefälligst an unserem Gespräch! Sag schon! Ist dein Vater in einem normalen Zustand?«
Der kleine Familienaperitif drohte, eine schlechte Wendung zu nehmen. Mir gefiel nicht, wie Sylvie Amélie in unser Leben einbezog, darüber hatten wir uns schon oft gestritten. Sie fand, auch wenn Amélie ihr erstes Studienjahr an der Kunsthochschule in Paris absolviere, müsse sie am Familienleben teilnehmen und ihre Meinung dazu äußern. Selbstverständlich sollte diese Meinung mit Sylvies übereinstimmen. Ich fand, dass jedes Alter seine eigenen Sorgen hat und die häusliche Atmosphäre in Perisac weit weg von der Rive Gauche und ihren neuen Freunden war.
»Er ist auf einem schlechten Trip, das ist normal, er hat die Wahl verloren und kann nichts mit seiner Zeit anfangen.«
»Das ist normal«, wiederholte meine Frau und nickte niedergeschlagen. »Bestätige ihn nur darin. Diese Vater-Tochter-Solidarität ist wirklich super.«
Amélie warf ihrer Mutter einen finsteren Blick zu. Sie schien nicht recht zu verstehen, von welcher Solidarität sie redete. Während der Pubertät war unsere Beziehung immer schlechter geworden. Eine kleine, banale Frage von mir, eine genuschelte Antwort von ihr. Eine Art Nebel hatte sich seit ihrem dreizehnten Geburtstag über unser Verhältnis gelegt. Lange Zeit war ich nicht sicher gewesen, ob die Sonne diese klimatische und hormonelle Trübung eines Tages wieder aufhellen würde. Seit ihrem Abitur und dem Umzug nach Paris war unsere Beziehung wieder herzlicher geworden. Aber das gleich als Vater-Tochter-Solidarität zu deuten …
Meine Frau verließ wortlos das Zimmer, um das Abendessen aufzuwärmen. Bestimmt ein neues Experiment von La Musarde.
»Sie nervt! Wie hältst du das bloß aus?«, fragte mich Amélie.
Das war keine Frage, mehr ein laut geäußerter Gedanke.
»Sprich nicht so über deine Mutter«, antwortete ich wenig überzeugend und fügte hinzu, sie sei nicht immer so gewesen, womit ich Amélie eher recht gab.
»Das muss lange her sein«, maulte sie.
Sie hatte nicht unrecht. Es war fast zwanzig Jahre her. Das war zugleich lange und kurz. Trotzdem kam es mir vor, als wäre ich ihr erst gestern auf dem Marktplatz von Perisac begegnet.
»Und für das hübsche blonde Fräulein? Was darf es sein?«
»Zwei Lammkoteletts bitte.«
1989. Der Wahlkampf in Perisac hatte gerade begonnen, Derk stellte sich als Parteiloser mit einem sehr persönlichen Programm zur Wahl, das ihm von Links bis Rechts viel Spielraum ließ. Ein großer Teil der älteren Wähler, die inzwischen tot sind, erkannte in ihm den erfahrenen Mann, der den Krieg erlebt hatte und wusste, wovon er sprach. Und er sprach gut. Derk war kein Jungspund mehr, aber ihm kam Mitterrands Dynamik zugute; der Präsident war zwar auch schon alt, aber das hatte seine triumphale Wiederwahl nicht verhindert.
Mit geistvollen Sprüchen von Sacha Guitry, Zitaten von General de Gaulle und Anleihen bei Mendès France oder Léon Blum fand Derk bei den meisten Leuten Anklang. Der amtierende Sozialist hatte sich durch diverse Skandale ins Abseits manövriert, und der Kandidat des RPR war zu jung. André Dercours wickelte alle um den Finger, die jungen Leute gewann er dank des Zweiten auf seiner Liste, eines charmanten jungen Mannes, der den Mädchen und den alten Damen gefiel. Er hieß François Heurtevent.
Man hatte mich mit dem Wahlkampfteam und Bergen von Flugblättern zum Wochenmarkt geschickt, um Händlern und Kunden die Hände zu schütteln, Hündchen zu streicheln, mit den Kindern zu scherzen, die runden Tomaten, das Aroma der Wurst, die Form der Eier, die Knusprigkeit der Backhähnchen, den Duft der Blumen und die Ausgewogenheit des Weins zu loben. Am Anfang war ich etwas zurückhaltend, dann kam ich auf den Geschmack, ermutigt von Derk, der wusste, welchen Nutzen er aus mir ziehen konnte. Am Stand eines Fleischers lernte ich meine spätere Frau kennen. Der Händler, ein dicker Mann mit blondem Schnurbart, warnte mich: »Für mich gibt es keine anständigen Politiker, nur das Fleisch ist anständig, Kleiner.«
Der Kleine von einem Meter fünfundachtzig versuchte trotzdem, den Mann für sich zu gewinnen.
»Das ist Pierre Cardian, der beste Fleischer auf dem Platz, die Leute lieben ihn«, flüsterte mir ein Wahlkampfberater zu, der sich auskannte und mir diskret ins Ohr sagte, wer wer war und was er wählte.
»Front national«, fügte er hinzu, um mich von dem Stand wegzubringen.
Das machte es noch komplizierter. Ich versuchte, Cardian mit einem heiklen Kompliment für seine blutbefleckte Fleischerschürze zu gewinnen, die ich als wunderbare Arbeitskleidung seines schönen Berufes bezeichnete. Ich klang wie der letzte Idiot, war aber überzeugt, dass er mit einer Bemerkung über meinen grauen Anzug und meinen Schlips antworten würde. Das tat er prompt.
»Ja, Monsieur von der Dercours-Liste, das ist meine Arbeitskleidung, Ihre kommt natürlich direkt aus der Reinigung«, entgegnete er, und die Umstehenden lachten.
»Tauschen wir?«, schlug ich ihm vor. »Sie borgen mir Ihre Schürze, ich borge Ihnen mein Jackett und bediene fünf Minuten lang die Kunden.«
»Oh oh! Die kleine Made wird mir mein ganzes Fleisch verderben, aber gut, da haben Sie das Messer, in Gottes Namen, da gibt es was zum Lachen!«, antwortete er, hielt mir sein Fleischermesser hin und knotete seine Schürze auf.
Ich zog unter den entsetzten Blicken meiner Begleiter das Jackett aus.
Der dicke Fleischer zog es vor, mein Jackett in der Hand zu halten, er meinte, wenn er da reinkäme, würde er nicht so bald wieder rauskommen. Ich zog seine Schürze an und band sie nach allen Regeln der Kunst über der rechten Schulter fest zu. Schon da änderte sich sein Gesichtsausdruck. Ich zog den Schnittschutzhandschuh an, dann nahm ich das Messer in die rechte Hand und begann meine Show.
»Und für das hübsche blonde Fräulein? Was darf es sein?«
»Zwei Lammkoteletts bitte«, sagte die junge Frau, die sich über den Scherz zu amüsieren schien.
Ich nahm das große Stück Lammrücken, schnitt zwei Koteletts vor, hackte die Knochen durch und entfernte das Fett. Verpackt, gewogen, Kassenbon und auf Wiedersehen, Mademoiselle.
Der Fleischer sah mir kopfschüttelnd zu. Immer mehr Leute drängten sich um den Stand. Dann schnitt ich von einer Kalbsoberschale zwei schöne Schnitzel, gewogen, verpackt, Kassenbon und auf Wiedersehen, Madame.
»Ich weiß nicht, wer dir das beigebracht hat, mein Junge, aber du bist kein Grünschnabel«, sagte der Fleischer. »Deinen Dercours wähle ich trotzdem nicht«, rief er in die Menge.
»Das wissen wir doch, Riton, du wählst Jean-Marie!«, rief ein anderer Händler von seinem Fischstand.
»Sicher stimme ich für ihn, auch wenn alle es wissen, das ist schließlich meine Sache!«
Wir tauschten wieder Jackett und Schürze.
»Und jetzt mal im Ernst«, sagte er leise, »das hast du doch nicht in deinen Kaderschmieden gelernt?«
»Nein«, verriet ich ihm in vertraulichem Ton. »Der beste Freund meines Vaters war Fleischer. Als Kind war ich oft bei ihm, und er hat mir viel gezeigt.«
Die Erklärung befriedigte ihn. Zum Beweis schlug er mir so kräftig auf den Rücken, dass er mir fast einen Wirbel verschoben hätte, und schenkte uns zwei Scheiben Kalbsleber.
»Die Vorstellung ist zu Ende!«, rief er als Schlusswort. »Die Zungenfertigen gehen, aber wir haben noch leckere Rinderzunge im Angebot, greifen Sie zu!«
Zwanzig Jahre später war die Vorstellung wirklich zu Ende. Inzwischen war ich mit dem blonden Fräulein verheiratet, das mir zwei Lammkoteletts abgekauft hatte. Sie hatte mich mit einem Lächeln am Nachbarstand erwartet.
»Sie sind witzig, kann man Ihnen im Wahlkampf helfen?«
»Ja natürlich, indem Sie mit mir Mittag essen«, hatte ich frech geantwortet.
Sie war so dreist zuzusagen. Unsere Tour auf dem Markt endete ein paar Stände weiter, und wir gingen zurück ins Büro. Die Wahlkämpfer, die mich begleiteten, waren mit Lebensmitteln beladen. Derks Wahlzentrale befand sich in einer ehemaligen Weingenossenschaft, zu der ein kleiner Pavillon mit Küche in einer Ecke des Gartens gehörte. Dort verspeisten wir den wie immer zu reichlichen Einkauf vom Markt. Meine Unbekannte bereitete die Kalbsleber, die uns der Fleischer geschenkt hatte, mit Himbeeressig und Bratkartoffeln zu. Ein Teller für sie, einer für mich, ein Mittagessen auf einem Wachstuch, das noch aus Pompidous Zeiten stammen mochte.
»Wer sind Sie?«, fragte ich sie.
»Sylvie Desbruyères, die Tochter von Bastien Desbruyères.«
»La Musarde?«
»La Musarde«, bestätigte sie lächelnd.
Mich überkam eine Welle von Nostalgie, fast schon Traurigkeit, als ich mich all dieser Dinge erinnerte. Anfänge sind wunderbar, in der Liebe wie in der Politik, und ich hätte viel gegeben, um diesen Sonntagvormittag noch einmal zu erleben, den dicken Front-National-Fleischer und das Wachstuch der Genossenschaft, die zehn Jahre später auf meine Anweisung hin in einen Kindergarten verwandelt worden war.
Vielleicht hatte Sylvie recht, vielleicht sollte ich zum Arzt gehen. Sie ärgerte sich nicht nur über mein Herumgammeln, sondern auch über die unvorhergesehenen Auswirkungen der Wahlniederlage auf unser Liebesleben.
»Du hast keine Lust mehr auf mich«, sagte sie eines Abends in der Stille der Nacht.
»Nicht doch«, flüsterte ich. »Daran liegt es nicht.«
»Woran dann?«
Diese Frage wurde nur vom Reiben des Lakens, dem leisen Quietschen der Federung und der Stille unseres Zimmers beantwortet. Was sollte ich sagen? Dass ich auf nichts mehr Lust hatte, weder auf sie, noch auf irgendetwas anderes?
Seit meiner Niederlage hegte ich einen leichten Groll gegen Sylvie. Für sie ging einfach alles weiter. La Musarde war ihr Leben, die Politiker kamen, der Laden lief, alle Anstrengung galt dem Ziel, den dritten Stern zu behalten. Gleich am Tag nach den Wahlen, als für mich mein allmorgendlicher Winterschlaf begann, war Sylvie ins Restaurant zurückgekehrt, als wäre alles beim Alten. Ich habe eine der besten Köchinnen Frankreichs geheiratet, ich, dem selbst pochierte Eier zwei von drei Mal missglücken. Für meine Frau ist das Kochen eine Berufung, ein heiliges Amt. Wenn man die Kochkunst auf dieses Niveau hebt, hat sie etwas Mystisches. Ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen Ducasse, Robuchon und Sylvie in Paris. Ich saß mit am Tisch, war aber völlig ausgeschlossen, ich verstand nichts von dem, was sie redeten und zeichneten. Ich fühlte mich wie auf einem Kongress russischer Chemiker mitten im Kalten Krieg. Schließlich verdrückte ich mich und ging aus Rache in den nächsten McDonald’s.
Bei uns ist der Kühlschrank ständig voller Experimente, die auf dem heimischen La-Cornue-Herd durchgeführt werden. Es gibt Gläser mit seltsamen Flüssigkeiten und der Aufschrift »Nicht öffnen«, darunter die detaillierte Zutatenliste. Merkwürdige Experimente von Austern mit Thymian oder Kalbsbries mit Honig. Gerichte, die ich sehr lecker finde, werden als »schlecht, iss das nicht« abgetan und verschwinden aus meinem Blickfeld in Richtung Mülleimer, während ich mit der Gabel in der Luft dastehe. Den Gipfel dieses Hangs zur Perfektion hat sicher Vatel erreicht, der sich am 24. April 1671 in sein Schwert stürzte, weil die Austern nicht rechtzeitig geliefert worden waren. Ein Gericht zu verpatzen ist für einen Koch wie die Abwahl für einen Politiker. Manche entscheiden sich für radikale Lösungen, um dieser Hölle zu entkommen. Jeder hat seinen Märtyrer, die Köche Loiseau, wir Bérégovoy. Angesichts ihrer Selbstmorde gefriert einem das Blut in den Adern, sie sind der letzte Ausdruck einer Ablehnung des Scheiterns, künden von einer so hohen Meinung von sich selbst, dass kein Ausrutscher erlaubt ist. Der kleinste Zwischenfall wird als Katastrophe erlebt. Dann stürzt man sich in den finstersten Abgrund, aus dem man mit den Füßen zuerst, aber mit unbefleckter Ehre herauskommt.
Ab und zu spazierte ich durch die Küchen von La Musarde, verschränkte die Hände auf dem Rücken, grüßte Sylvies Angestellte und ließ den Blick über Kochtöpfe mit undefinierbarem Inhalt schweifen. Schon als Kind hatte ich gelernt, als privilegierter Besucher an heiligen Orten der Kunst geduldet zu werden. Damals waren es nicht die Feuer der Küchenherde, sondern das Scheinwerferlicht. Meine Mutter war Schauspielerin, eigentlich ist sie es immer noch. Ich kenne den roten Samt der Theater an den Grands Boulevards, aber auch die Metallvorhänge, die die Feuerwehrleute vor jeder Vorstellung prüfen. Vor allem der Schnürboden mit seinen tausend Kabeln und Seilrollen hatte es mir angetan. Wenn die Bühne, auf der so viele Leute spielten oder herumliefen, menschenleer und ich ganz allein da oben war, wurde mir schwindlig, aber das dauerte nie sehr lange, weil mich meine Mutter suchte oder besser gesagt vom Inspizienten oder einer Hilfsgarderobiere suchen ließ, die mich in ihre Garderobe zurückbrachten.
Marie Dava hatte mehr als zwanzig Jahre lang Erfolg. Nicht mit Pinter oder Corneille, nein, ihr Register war der Boulevard, der so französisch daherkam und in Wirklichkeit aus dem Englischen übersetzt war. Appartement pour quatre, Viens dormir à l’Assemblée, L’Arnaqueuse, Lily est partie, Le vison voyageur.