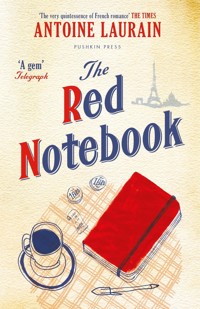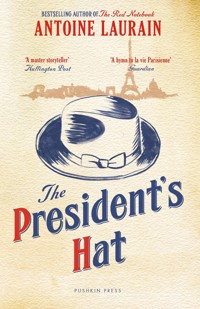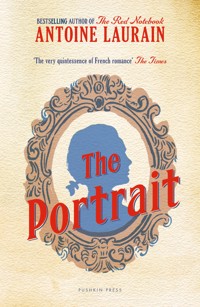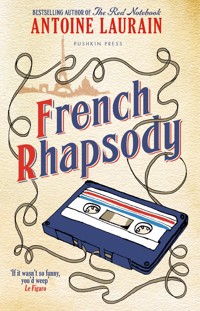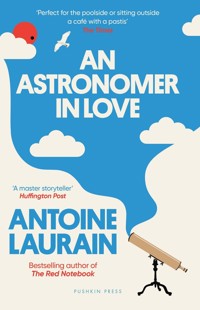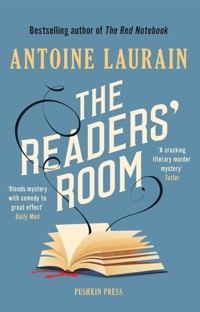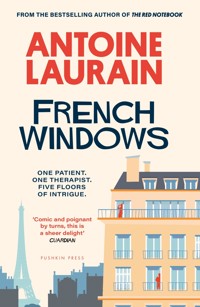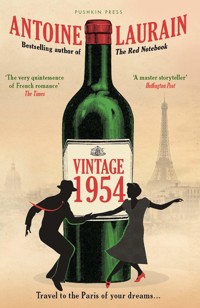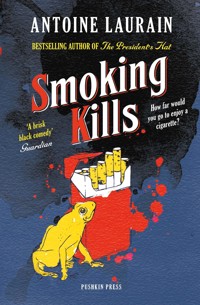11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Star-Lektorin, ein literarischer Geniestreich, dem der Autor abhanden gekommen ist, und drei hilfreiche Morde: Antoine Laurain entzündet in seinem neuen Roman ein kriminalistisches Unterhaltungsfeuerwerk. Die Pariser Star-Lektorin Violaine Lepage liegt nach einem schweren Unfall im Koma. Aber es kommt noch schlimmer: Als sie aufwacht, droht der unter ihrer Federführung erschienene Roman Die Zuckerblumen Frankreichs renommiertesten Literaturpreis zu gewinnen. Dabei ist der Autor unauffindbar! Das ist so sehr gegen die Konvention der Preisvergabe, dass Violaines Karriereende bevorsteht. Da kommen ihr drei Morde zu Hilfe, die sich just so ereignen wie im Roman beschrieben. Nun sucht auch die Polizei den unsichtbaren Autor. Wer hat Die Zuckerblumen geschrieben und warum? Die Antwort liegt gut versteckt in der realen Vergangenheit und nicht jeder will, dass sie entdeckt wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Antoine Laurain
Eine verdächtig wahre Geschichte
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Atlantik
*** Erster Teil ***
Marcel Proust öffnete seine schweren Lider und betrachtete sie mit einem wohlwollenden Blick, in dem eine Spur von Ironie lag, als wüsste er, warum sie da war. Violaine konnte die Augen nicht vom Gesicht des Autors von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit lösen; diese dunklen Augenringe, der tadellos gekämmte Oberlippenbart, die tiefschwarzen Haare. Er trug seinen Ottermantel und saß auf einem Holzstuhl direkt neben dem Bett. Seine rechte Hand ruhte auf einem Gehstock mit einem Griff aus Elfenbein und Silber, während die linke sanft über das glänzende Fell des Mantels strich. Violaine drehte den Kopf auf dem Kissen und stellte fest, dass ihr ganzes Zimmer voller schweigender, fast regloser Besucher war. Der Mann im beigen Rolli mit den zerzausten Haaren, dem eigenartigen Kinnbart und nackter Oberlippe konnte nur Georges Perec sein. Eine schwarze Katze auf einem Tischchen räkelte sich unter den Liebkosungen des Schriftstellers und streckte ihm die Schnauze entgegen. Die beiden schauten einander an, als wären sie in ein telepathisches Gespräch vertieft.
In Cordhose und verwaschenem Jeanshemd stand Michel Houellebecq am Fenster, blickte gedankenverloren auf einen Punkt am Horizont und zog sehr langsam an seiner Zigarette, deren Rauch im Gegenlicht eine milchig blaue Wolke bildete. Die strähnigen Haare, die in den Nacken hingen, und die schmalen Lippen verliehen ihm das Aussehen eines alten Hexers.
»Michel!«, wollte Violaine rufen. Aber aus ihrem Mund drang kein Laut.
Sie hatte sie nicht gleich bemerkt, doch am Fuß ihres Betts saß eine dunkelhaarige junge Frau, sie starrte auf die Wand und murmelte Sätze vor sich hin, die Violaine nicht hören konnte. Mit ihrem Haarknoten, ihrem langen weißen Kleid und diesem Kameenprofil befand sich tatsächlich auch Virginia Woolf im Raum. Violaine schloss die Augen und öffnete sie wieder. Sie waren immer noch da. Sie drehte den Kopf zum anderen Fenster, vor dem sich im Gegenlicht die Gestalt von Patrick Modiano abzeichnete. Er schien sehr gewichtige Worte mit einer blonden jungen Frau in einem schwarzen Kleid zu wechseln, deren Gesicht Violaine nicht sehen konnte. Er musste sich hinabbeugen, um mit seiner Gesprächspartnerin auf gleicher Augenhöhe zu sein. Die junge Frau nickte.
»Patrick …«, wollte Violaine flüstern. Aber wieder kam kein Wort über ihre Lippen. Modiano drehte sich dennoch langsam zu ihr um und musterte sie besorgt. Auf seinem Gesicht erschien ein leises Lächeln, dann legte er den Zeigefinger vor den Mund.
»Sie hat die Augen aufgemacht … Sie kommt zu sich«, verkündete eine Frauenstimme. »Holen Sie Professor Flavier. Es ist alles in Ordnung, Sie sind nicht allein«, fuhr die Stimme fort. Und Violaine hätte gern geantwortet, nein, sie sei nicht allein. Proust, Houellebecq, Perec, Woolf und Modiano waren bei ihr.
Zwei Millionen Französinnen und Franzosen träumen davon, veröffentlicht zu werden, wenn man den Umfragen der letzten Jahre Glauben schenkt. Die meisten träumen von einem Buch, das sie nie schreiben werden. Sie werden dieses Vorhaben ihr Leben lang im Hinterkopf behalten – eine Art Phantasie mit der sie in der Urlaubszeit liebäugeln werden. Um es dann doch jedes Mal vorzuziehen, ins Schwimmbecken zu springen oder den Grill zu beaufsichtigen, statt sich im Halbdunkel des Hauses an einen Tisch zu setzen, um im Licht eines Computerbildschirms die Seiten des Vortags zu überarbeiten. Sie werden oft von diesem Buch reden, das sie »im Kopf« haben. Ihre Freunde und Verwandten werden erst voller Bewunderung sein, und dann, wenn Jahr um Jahr nichts passiert, nachsichtige Blicke wechseln, sobald der Autor oder die Autorin in spe mit genießerischer und entschlossener Miene erneut vom geplanten Buch anfängt: »Diesen Sommer mache ich mich wieder daran.« Aber es wird nichts geschehen. Auch im folgenden Sommer nicht. Im Winter noch weniger. All diese Geisterbücher bilden eine Art gasförmiger Materie, die die Literatur umgibt wie die Ozonschicht die Erde.
All diejenigen, die nie über drei Seiten und eine rudimentäre Gliederung hinauskommen werden, sind letztendlich harmlos. Von ihnen wird nie etwas per Post in der Manuskriptabteilung des Verlags ankommen. Eine andere Kategorie von Möchtegern-Autoren wird beschließen, sich wirklich reinzuhängen. Koste es sie drei Monate oder fünf Jahre, sie wollen dieses dicke Rechteck aus weißem Papier in ihren Händen halten, mit Spiralbindung und einem Titel auf dem Deckblatt, ihrem Namen in Times New Roman Schriftgröße 25 sowie diesem kleinen Wort: »Roman«. Ihr Manuskript. Dieses endlich ausgedruckte Exemplar, vom Deckblatt bis zum letzten Satz, wird die Frucht ihrer schlaflosen Nächte darstellen, ihres Schaffens im Morgengrauen, ihrer in der U-Bahn oder auf Flughäfen in ein Heft gekritzelten Notizen, ihrer Geistesblitze, die sie unter der Dusche oder mitten in einem Geschäftsessen aus heiterem Himmel überfallen haben wie angreifende Wespen. Die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden, war, sie so schnell wie möglich aufzuschreiben, sei es in ein rotes Moleskine-Heft oder in die Notiz-App eines Smartphones. Sie werden für den Roman entscheidend sein. Oder auch nicht.
Für diejenigen, die bis zum Wort »Ende« gekommen sind, aber in der Verlagswelt niemanden kennen, wird der Tag des Versands kommen. Eines Morgens oder eines Abends werden sie in einen Copyshop gehen und zehn oder zwanzig Exemplare ihres Manuskripts anfertigen lassen, mit einem transparenten Deckblatt über dem Titel und einer kartonierten Rückseite in Schwarz oder Weiß, zusammengehalten von einer Plastikspirale – ebenfalls schwarz oder weiß, es gibt sowieso nur zwei Farben. Nachdem sie diese bleischwere Plastiktüte nach Hause geschleppt haben, machen sie sich daran, jedem Exemplar das »Anschreiben« beizufügen – eine Art Empfehlung, die man verfasst, ohne sich auf irgendeinen Prinzen oder Baron berufen zu können, mit der man jedoch versucht, das Interesse derjenigen zu wecken, die sie lesen werden.
Es gibt sehr einfache Anschreiben – die sind Violaine am liebsten – und andere, unglaublich selbstgefällige, in denen der oder die Unglückliche versucht, sein oder ihr Werk irgendwo zwischen James Joyce und Maurice G. Dantec zu verorten, oder zwischen Jim Harrison und Ernest Hemingway. Andere sind sich nicht zu schade, ganz nebenbei eine Verwandtschaft oder Freundschaft mit einer einflussreichen Persönlichkeit zu erwähnen, wie eine Art verhüllte Drohung. Die Idee einer Macht, die sich im Fall einer Ablehnung des Textes plötzlich erheben könnte. Violaine bewahrt die komischsten, die lächerlichsten, die erbärmlichsten Briefe auf und legt sie in einem Ordner ab, den sie für sich behält, für ihr privates Archiv der Manuskriptabteilung. Der Ordner trägt den Titel »Insekten«, was zu der Annahme verleiten könnte, es handele sich um Materialien über Käfer. Wenn man Violaine kennt, weiß man allerdings, dass »Insekt« – ein eigentlich ganz banales Wort der Alltagssprache – in ihrem Mund die schlimmste Beleidigung ist.
Sätze wie: »Dieses Insekt hat mir heute Morgen eine Mail geschrieben …«, oder solche, die sogar in Gegenwart der betreffenden Person ausgesprochen werden können: »Weißt du, mit wem du sprichst? Insekt …«, durchsetzen den normalerweise gepflegten und wohlwollenden Redefluss dieser eleganten Frau um die vierzig, die alle so reizend finden mit ihren grünen Augen und ihren braunen, ins Rötliche gehenden schulterlangen Haaren.
Von Violaine Lepage, Lektorin und Leiterin der Manuskriptabteilung, als »Insekt« bezeichnet zu werden, stuft einen auf den niedrigsten Rang der Lebewesen herab; da wäre man sogar besser noch ein Stein. Es wurden schon Autoren, Journalisten, Lektoren, Fotografen, Filmproduzenten und Agenten als Insekten bezeichnet. Und ist man einmal zum Insekt geworden, so bleibt man es zeitlebens, für diese Verwandlung gibt es kein Gegenmittel. Keine Möglichkeit, wieder in Gnaden aufgenommen zu werden. Der Insektenstatus wird ad vitam aeternam verliehen. So herrscht Violaine seit mehr als zwanzig Jahren über ihr Reich der Manuskripte, in dem sie als einfache Gutachterin angefangen hatte, bevor sie die Leiter der Macht erklomm.
Der Autor in spe ist an sich weder ein Insekt noch wirklich ein Mann oder eine Frau. Er hat noch kein Alter, keinen Beruf, nicht einmal ein Gesicht, sondern nur einen Vornamen und einen Nachnamen – vielleicht nicht mal seinen eigenen – zuoberst auf der ersten Seite seines »Manuskripts«. Einerlei, ob Sie Damien Perron oder Nathalie Lefort, Leila Alaoui oder Marc Da Silva heißen, ob Sie 1996 oder 1965 geboren sind, ob Sie Kellner in einem Restaurant oder Abteilungsleiter bei Axa sind, ob Sie seit zehn Generationen in der Auvergne leben oder erst vor zwei Jahren nach Frankreich eingewandert sind. Was zählt, ist Ihr Text; dieser Text, den Sie, Autor oder Autorin, an diesem grauen Morgen oder Spätnachmittag zum Postamt des Viertels bringen werden – dasjenige, zu dem Sie immer gehen, um Ihre Einschreiben und Behördenbriefe aufzugeben, und das an diesem Tag einen ganz besonderen Charakter annehmen wird. Sie werden tatsächlich empfindlicher als sonst auf die Menge reagieren, Sie werden keine Lust haben, dass man Ihnen über die Schulter blickt und all diese Verlagsnamen liest, die auf den dicken braunen Umschlägen stehen, mit dem Vermerk »Zu Händen des Lektorats/Manuskriptabteilung«, der einem Ohnmachtsbekenntnis gleichkommt – nein, Sie haben nicht die nötigen Beziehungen, um auf direkterem Weg gelesen zu werden. Der Postautomat wird den Preis für den Briefversand anzeigen, entsprechend dem Gewicht und dem Zielort, dann müssen Sie nur noch das Feld »Anzahl« ausfüllen und bestätigen. Und ebenso viele Verlage werden es sein, an die Sie die Frucht Ihrer Arbeit, Ihr Baby, die Freude Ihrer Nächte, die Qual Ihrer frühen Morgenstunden schicken werden. Ihr Werk.
Am Ende werden Sie einen großen Stapel mit beiden Händen aus der Post hinaustragen müssen, um die Umschläge nacheinander in einen der Schlitze des Briefkastens zu werfen. Meistens wird der Bestimmungsort »Paris« sein. Abgesehen von zweien oder dreien haben alle wichtigen Verlage eine Pariser Adresse. Beim dumpfen Aufprall auf dem Grund des dunklen Kastens wird Sie vielleicht das unangenehme Gefühl beschleichen, Ihren Roman in die Mülltonne zu werfen. Wer wird sich dafür interessieren? Wer wird Ihnen antworten? Dann werden Sie sich beeilen, sie in den Briefkasten zu schieben, wie man sich bei Nacht und Nebel im tiefen Wald einer Leiche entledigt.
Zurück zu Hause werden Sie sich ein großes Glas Wein oder Whisky einschenken. Ihnen wird nach Heulen zumute sein, aber Sie werden es nicht tun, und Sie werden niemandem von diesem schmerzlichen Moment auf der Post erzählen. Sie werden nicht darüber reden, so wie man mit niemandem über eine schlechte Tat spricht, aus Angst, verurteilt zu werden, und mehr noch, sich beim Erzählen selbst zu verurteilen.
»Hast du dein Manuskript losgeschickt?«, wird man Sie noch am gleichen Abend fragen.
»Ja«, werden Sie lediglich antworten und dann schnell das Thema wechseln.
»Wie ist Ihr Name?«
»Violaine … Lepage.«
»Was sind Sie von Beruf?«
»Lektorin. Wo sind sie denn alle hin?«
»Wer?«
»… Wo bin ich?«
»In einem Krankenhaus, in Paris. Es ist alles in Ordnung. Ruhen Sie sich aus, ich komme gleich zurück.«
Violaine schloss die Augen wieder.
Ich glaube nicht an das unerkannte Genie.« Diesen Satz murmelt Violaine oft vor sich hin wie ein Mantra, während ihre grünen Augen über die schweren Umschläge schweifen, die jeden Morgen auf ihrem Schreibtisch landen – es gehen täglich zwischen zehn und fünfzehn davon im Verlag ein – und dann weiter wandern zu den Stapeln von wartenden Manuskripten in den Regalen. Hinter jedem steht ein Leben, hinter jedem eine Hoffnung. Jeder Tag, den die Manuskripte in den Regalen verbringen, ist ein weiterer Tag des Bangens für ihre Autorinnen und Autoren. Jeden Morgen erwarten sie, in ihrem Briefkasten eine Antwort vorzufinden oder eine E-Mail oder einen Anruf zu bekommen. So sehr hat der Text den Verlag begeistert, so sehr eilt es der Literatur, die so lange auf ihr Talent verzichten musste, das Versäumte wiedergutzumachen.
Fünfhunderttausend abgelehnte Manuskripte pro Jahr, wenn man alle Verlage zusammennimmt. Was wird aus all diesen Geschichten? All diesen Figuren, die das Publikum nie kennenlernen wird und die von den professionellen Lesern und Leserinnen in den Lektoraten bald vergessen sein werden? Was sie erwartet, ist das Nichts, gleich diesen ausgedienten Satelliten, die durch die intergalaktischen Weiten treiben und nicht einmal mehr von den Raumstationen verfolgt werden. Dreiviertel der Autoren möchten ihr wertvolles Exemplar zurückhaben. Sie können Briefmarken beilegen, damit man es ihnen zurückschickt. Eine andere Möglichkeit ist, es direkt im Verlag abzuholen. Das tun allerdings nur die Wenigsten. Sie haben davon geträumt, diese Tür aufzustoßen, um voller Herzlichkeit und Neugier empfangen zu werden, um es sich in einem breiten Sessel bequem zu machen, das Angebot eines Kaffees dankend anzunehmen, ein bisschen von sich und ausführlich von ihrem Buch zu reden und schließlich einen schönen Füllfederhalter zur Hand zu nehmen, um ihren ersten Buchvertrag zu unterzeichnen, von dem sie – manchmal zu Recht – denken, dass er den Anfang eines neuen Lebens einläuten wird. Die Tür aufzustoßen, um am Empfang darum zu bitten, dass man ihnen ihr abgelehntes Manuskript zurückgibt, das eine Praktikantin dann holen und ihnen mit einem Lächeln und einem »Schönen Tag noch« überreichen wird, geht über ihre Kräfte.
»Madame, es ist eine Schande, dass ein Manuskript wie meines bei Ihnen und Ihrem Verlag nicht auf mehr Interesse stößt. Das sagt eine Menge über unser Land und den jämmerlichen Zustand seiner literarischen Kultur aus, und ich lese im Übrigen schon lange keine französischen Romane mehr …«
»Ich habe mein Manuskript postwendend zurückbekommen. Ich hatte auf Seite 357 ein Haar hineingelegt und muss feststellen, dass es immer noch da ist. Sie haben mein Buch nicht gelesen. Wusste ich doch, dass die Verlage nie etwas lesen.«
Anonym: »An das Lektorat: Fickt euch doch alle ins Knie!«
»Ich habe beschlossen, Schluss zu machen. Nur die Aussicht auf die Veröffentlichung meines Manuskripts hat mich noch am Leben gehalten.«
»Ich werde meinen Freund den Minister anrufen, und ich denke, dann werden Sie endlich begreifen, dass ich nicht irgendjemand bin.«
»… Alle meine Freunde und meine Familie sind sich darin einig, dass mein Buch großartig ist! Sie bringen die Leserschaft um eine wunderbare Geschichte und Ihren Verlag um einen garantierten Erfolg.«
Diese pittoresken Briefe bleiben selten. Sie befinden sich innerhalb des »Insekten«-Ordners in einem Unterverzeichnis namens: »Manchmal antworten sie sogar noch!«
Die Bestimmung einer Manuskriptabteilung besteht darin, neue Autoren zu finden und sie zu veröffentlichen.
Diese Mission wird zwei- bis dreimal im Jahr erfüllt. Das rechtfertigt all die Stunden, die mit der Lektüre der Prosa Unbekannter zugebracht werden, die Tausende von geöffneten Umschlägen, die Hunderte von verfassten Gutachten und die Tausende von Musterbriefen, die ins ganze Land und manchmal in die ganze Welt verschickt werden. »Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Text trotz seiner unzweifelhaften Qualitäten nicht in unser Programm passt.« Aber zwei- bis dreimal im Jahr gerät die Manuskriptabteilung in Wallung. Ein gemurmeltes »Ich glaube, wir haben da was« ist dafür oft das erste Anzeichen.
So ist es vor einem halben Jahr mit Die Zuckerblumen von Camille Désencres geschehen. Ein Text von hundertsiebzig Seiten, gebunden mit dem üblichen transparenten Deckblatt und der kartonierten Rückseite, adressiert an die Manuskriptabteilung. Marie, die jüngste unter den Gutachterinnen, schlug ihn auf, nachdem sie das sehr schlicht gehaltene Anschreiben gelesen hatte: »Guten Tag, ich heiße Camille Désencres, ich hoffe, mein Text wird Ihnen gefallen. Mit freundlichen Grüßen, CD.« Auf Seite 27 angelangt, sprach sie besagten Satz aus: »Ich glaube, wir haben da was.« Stéphane und Muriel blickten auf. Anderthalb Stunden später hatte sie Die Zuckerblumen zu Ende gelesen.
»Und?«, fragte Stéphane.
Marie lächelte und nahm ihren Stift, um eine Sonne auf den Umschlag zu malen. »Glutheiß sogar«, fügte sie hinzu.
Es gibt im Lektorat drei Bewertungskürzel:
Ein Quadrat: abgelehnt.
Ein Halbmond: nicht uninteressant, der Text müsste noch einmal überarbeitet werden oder der Autor könnte etwas anderes vorlegen – man wird sich an ihn erinnern und mit Interesse lesen.
Eine Sonne: dringend zur Veröffentlichung empfohlen.
Das normale Vorgehen nach der Entdeckung eines Goldklumpens im Schlamm des Flusses, den die eingehende Manuskriptflut darstellt, besteht darin, von einem der vier Schreibtische in dem dreißig Quadratmeter großen Büro voller Regale aufzustehen, den Raum zu verlassen und zehn Meter weiter an Violaines Tür zu klopfen. Am Tag der Entdeckung der Zuckerblumen war sie allerdings auf Geschäftsreise in London.
»Hallo Violaine, hier ist Marie, ich glaube, ich habe unter den Manuskripten eine Sonne gefunden, bitte sag mir, wie wir vorgehen, da du ja erst in vier Tagen zurückkommst.«
Auf die Nachricht kam mehrere Stunden lang keine Antwort, dann ging eine SMS ein: »Großartig, Marie, ich vertraue dir, aber da ich es nicht sofort lesen kann, gib es doch schnellstmöglich an Béatrice weiter. Halt mich auf dem Laufenden.«
»Bestens, ich lasse es zu Béatrice bringen.«
Béatrice ist die vierte Gutachterin der Manuskriptabteilung. Mit ihren fünfundsiebzig Jahren ist sie die Älteste, und ihr Alter und ihre Wahrnehmung der zeitgenössischen Literatur sind für Violaine wertvolle Pluspunkte. Auch Béatrice ist vier Jahre zuvor mit der Post im Lektorat angekommen, allerdings enthielt ihr Umschlag keinen schweren Packen gebundener Seiten, sondern einen bloßen Brief, in dem sie in gewählten und anrührenden Worten erklärte, dass sie im Schnitt vier Bücher in der Woche lese, über die sie zu ihrem eigenen Vergnügen Gutachten zu erstellen pflege. Wenn der Verlag eine Gutachterin für seine Manuskripte brauche, könne sie sich sehr gerne nützlich machen, da sie schon seit langem frei über ihre Tage verfüge. Sie merkte zudem an, dass sie nur fünf Minuten zu Fuß vom Verlag entfernt wohne. Violaine hatte ihr geantwortet und sie am Ende einer Mittagspause sogar zu Hause besucht.
»Ich schreibe mir den Code des Hauseingangs und die Etage auf«, hatte sie gesagt.
»Es gibt keinen Code, klingeln Sie einfach.«
Als Violaine an der einzigen, namenlosen Gegensprechanlage des Hauses geklingelt und sich angemeldet hatte, war die schwere Tür aufgegangen und hatte sie direkt in den ersten Raum des Hauses eingelassen, geschmückt mit Perserteppichen und Louis-XV-Sesseln, an der Wand ein Bild, das ganz nach einem Canaletto aussah – es sei denn, es war eine Kopie, aber Violaine begann daran zu zweifeln.
»Kommen Sie herauf, Madame Lepage, ich bin im ersten Stock!«
Der so plötzliche Übergang von der Straße in dieses prunkvolle Interieur hatte Violaine etwas aus der Fassung gebracht. Sie hatte den Vorraum durchquert und ein anderes Zimmer betreten, das mit alten Terrakottafliesen ausgelegt war und auf einen großen, sonnigen Garten hinausging, in dem man eine mit Blumen bewachsene Laube und eine Gartenschaukel erkennen konnte. Violaine hatte nicht geahnt, dass es nur fünf Minuten vom Verlag entfernt einen so unglaublichen Ort geben konnte. Sie ging eine breite Holztreppe hinauf und erreichte einen großen Salon mit kaschmirbespannten Wänden, in dem raffinierte Nippfiguren aus Glas oder Goldbronze auf Kommoden und Tischchen verteilt standen. Auf einem Sofa saß eine Frau mit kurzen weißen Haaren und dunkler Brille. Ein junger Mann in Bermudashorts und T-Shirt, erstaunlich muskulös und mit Pferdeschwanz, stand neben ihr.
»Kommen Sie näher … Entschuldigen Sie, ich stehe nicht auf, ich bin nicht gut zu Fuß. Wie nett von Ihnen, bei mir vorbeizukommen«, sagte Béatrice. Violaine drückte ihr die Hand, an der sie einen Diamanten und einen Rubin bemerkte, beide so groß wie ein Spielwürfel, und nahm dann in einem Sessel Platz.
»Marc, mein treuer Marc …«, stellte Béatrice den jungen Mann vor, der höflich lächelte.
Während sie ein Glas Orangensaft und einen Kaffee tranken, erzählte Béatrice von ihren letzten Lektüren und auch von anderen, weiter zurückliegenden. Sie erinnerte sich sehr gut, wie sie Michel Houellebecqs Ausweitung der Kampfzone gelesen hatte, als das Buch 1994 erschienen war, und sich gesagt hatte, dass der Junge es weit bringen würde. Marc reichte Violaine ein paar Gutachten über kürzlich erschienene Romane. Béatrice hatte ohne jeden Zweifel einen synthetischen Geist und verstand es, positive und negative Seiten eines Textes herauszuarbeiten.
»Ich bin durchaus nicht abgeneigt, Ihnen ein paar Manuskripte zukommen zu lassen, dann werden wir sehen, ob wir zusammenarbeiten können. Sollte es dazu kommen, würde ich Ihre Arbeit natürlich angemessen honorieren.«
»Das kommt nicht in Frage«, meinte Béatrice mit einem Achselzucken.
»Doch, natürlich«, beharrte Violaine.
»Ich bitte Sie, mir gehört die ganze Straße …«, seufzte Béatrice.
»Wie bitte?«
»Ja, es gibt noch ein paar alte Pariser Familien, die das Grundvermögen ihrer Vorfahren über die Jahrhunderte bewahren konnten. Die Straße ist übrigens nicht so lang.«
»Sie meinen, dass alle Häuser in dieser Straße Ihnen gehören?«
»Ja, alle ihre Bewohner sind meine Mieter. Ich habe nie gearbeitet, was es mir erlaubt hat, Tausende von Büchern zu lesen.«
»Sie müssten eine Vertraulichkeitsklausel unterschreiben, ein einfaches Formular, in dem Sie sich verpflichten, den Inhalt der Manuskripte, die durch Ihre Hände gehen, nicht nach außen zu tragen«, erklärte Violaine und zog besagtes Dokument aus ihrer Tasche, um es Béatrice hinzuhalten. Sogleich griff Marc behutsam danach, legte es auf den Sofatisch und unterschrieb es selbst.
»Verzeihen Sie, aber es ist nicht an Ihnen, das zu unterschreiben, Monsieur …«
»Marc ist für mich zeichnungsberechtigt … Oh, Sie haben es wohl nicht bemerkt. Wie reizend, Sie machen mir damit eine große Freude, Madame Lepage.«
»Was nicht bemerkt?«
»Ich bin blind«, klärte Béatrice sie auf.
Es entstand eine lange Pause.
»Aber … Wie lesen Sie denn dann?«
»Marc, es ist Marc, der mir vorliest. Vorher war es über zehn Jahre lang Patrick, und vor Patrick war es Fabrice … Ich habe es immer vorgezogen, mir von Männern vorlesen zu lassen.«
Bevor Violaine wieder ging, bat Béatrice sie um einen Gefallen: Ob sie, auch wenn Marc sie ihr nach Fotos aus dem Internet beschrieben hatte, ihr Gesicht berühren dürfe? Violaine war zu ihr gegangen, hatte die Augen geschlossen und Béatrices warme, trockene Hände über ihre Wangen, ihre Stirn, ihre Backenknochen wandern lassen.
»Sie sind sehr schön«, hatte Béatrice gemurmelt. »Und Sie tragen Eau de Cologne impériale von Guerlain.«
»Richtig«, hatte Violaine bestätigt und sich dabei gesagt, dass ihr Beruf doch einzigartig war, voller unerwarteter, geheimnisvoller Begegnungen.
Das Problem ist Ihr Bein. Die Rehabilitation wird langwierig sein, und ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie die volle Bewegungsfähigkeit wiedererlangen werden. Wahrscheinlich werden Sie Ihr Leben lang einen Stock brauchen.«
»Das Problem ist nicht mein Bein, sondern das da!«, entgegnete Violaine und schlug mit dem Handrücken auf die Bücherbeilage von Le Monde, die aufgeschlagen auf ihrem Krankenhausbett lag, wobei sie fast den Infusionsbeutel herunterriss. »Camille Désencres ist in der vorletzten Auswahl für den Prix Goncourt … Und wir finden ihn nicht! Wir wissen nicht, wo der Autor ist. Was sollen wir nur tun?«, beklagte sie sich bei Stéphane, Murielle und Marie, die vor ihrem Bett standen. Sie wussten alle drei keine Antwort und schauten einander an, bevor sie den Blick auf Édouard richteten, Violaines Mann.
»Du hast gerade neunundzwanzig Tage im Krankenhaus hinter dir, davon achtzehn im Koma. Du musst dich erst mal um dich selbst kümmern«, bemerkte er mit abgespannter Miene.
»Ich glaube, Ihr Mann hat recht«, meinte der Arzt, den diese merkwürdige Patientin, die sich mehr um Literaturpreise sorgte als darum, dass sie für den Rest ihres Lebens hinken würde, aus dem Konzept brachte.