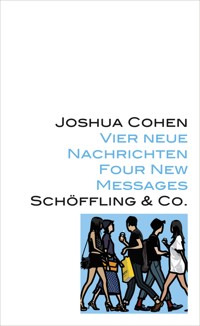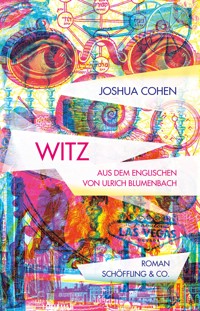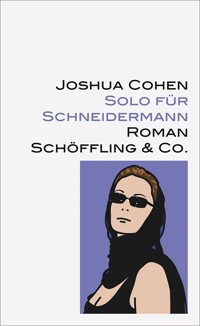21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Joshua Cohen sich unsere Gegenwart vorknöpft, geht er dahin, wo es wehtut, und setzt sich auf ganz eigene Weise beispielsweise mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober auseinander. Innerhalb der USA begibt er sich an ungewöhnliche Orte, etwa zur letzten Vorführung des Ringling Bros. and Barnum &Baily Circus. Oder er stöbert Donald Trump in den Casinos von Cohens Geburtsort Atlantic City auf und entlarvt ihn als Inbegriff des in der amerikanischen Literatur notorischen Tricksters. Seine Erkenntnisse über amerikanische und internationale Politik gewinnt er mal in einer Bar auf Staten Island, mal zu Besuch bei Netanjahus vermasseltem Staatsgründungs-Jubiläum, mal reicht er dem inhaftierten Dissidenten Liu Xiaobo die Hand. Der für seinen Sprachwitz bekannte Pulitzerpreisträger schreibt aber natürlich auch über Bücher und setzt sich als obsessiver Leser mit Werken von Bohumil Hrabal, Franz Kafka, Eimear McBride, Georges Perec, Thomas Pynchon, Gregor von Rezzori und Philip Roth auseinander. Aufzeichnungen aus der Höhle versammelt, in der Übersetzung von Jan Wilm, brillante Essays eines der klügsten Köpfe unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Joshua Cohen
Aufzeichnungen aus der Höhle
Herausgegeben, aus dem Englischen und mit einem Vorwort von Jan Wilm
Jan Wilm
Schöffling & Co.
Inhalt
Vom Glück, Joshua Cohen zu entdecken, zu lesen und zu übersetzen: Vorwort des Herausgebers und Übersetzers
Aufzeichnungen aus der Höhle
Der allerletzte Sommer: Über Donald Trump und den Untergang von Atlantic City
Glückskind: Jared Kushner
Aufzeichnungen #1
Gedanken über Kafka, gefunden auf alten Computern
Gregor von Rezzoris gewaltiges Nachkriegsmeisterwerk
In der Flüsterkneipe: Über Bohumil Hrabal
Zibaldone-Tagebuch
Über die Gegenwart schreiben: Spiegel, Körper, Schatten
Aufzeichnungen #2
Bibliothanatos, oder: Motti für ein letztes Buch
Thomas Pynchon: erstens Familie, zweitens Zweitleben
Innere Syntax: Über Eimear McBride
Teichhaltige Erinnerungen: Über G org s P r c
Passus für Liu Xiaobo
Der Besessene
Aufzeichnungen #3
Israels Zeit der Unzufriedenheit
Schloschim (aus dem Tagebuch)
Es ist ein Kreis: Zur Schließung des Zirkusses Ringling Bros. and Barnum & Bailey
Zitierte Übersetzungen
Über den Autor
Über den Herausgeber und Übersetzer
Vom Glück, Joshua Cohen zu entdecken, zu lesen und zu übersetzen: Vorwort des Herausgebers und Übersetzers
Wer von Joshua Cohen schon die Romane und Erzählungen kennt, muss unbedingt auch die Essays von Joshua Cohen kennenlernen. Wer Joshua Cohen noch nicht kennt, findet mit seinen Essays den besten Einstieg in ein fabelhaftes, funkelbuntes, vielfältiges, vieldeutiges Werk voll Sprach- wie Spielwitz, voller aktueller wie existenzieller Dichte und voller philosophischer wie philologischer Liebe und Leidenschaft für Literatur. Auf jeden Fall sind Sie hier genau richtig. Hier in diesem Buch. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, denn Sie haben das Glück, gleich einen Querschnitt durch das wunderbare Essaywerk von Joshua Cohen zu entdecken.
Nicht alle Autorinnen und Autoren von Fiktionen, Gedichten oder Stücken sind gleichzeitig auch Rezensenten oder Essayistinnen. Müssen sie auch nicht sein. Schreibende brauchen nicht auf allen Gattungshochzeiten das Tanzbein und die Schreibfeder zu schwingen. Manche sind am stärksten in der Konzentration auf ein einziges Kerngenre: So galt James Joyce’ und Marcel Prousts Fokus beispielsweise hauptsächlich den großen Romanen, während man beim Lesen ihrer Essays und Rezensionen mitunter den Eindruck gewinnt, dass sie nebensächlicher Natur und eher Beifang als Hauptziel waren. Dennoch ist das Hochzeitsbankett der Literaturgeschichte (oder besser: das Trinkgelage der Literatur) voller Schreibender, die der Fiktion oder der Lyrik immer wieder bewusst den Rücken zukehren, um sich ihnen dann wieder mit neuer Kraft und neuer Lust zuzuwenden.
Gerade in der »kleineren« Form der gelegentlichen Rezension von Büchern anderer oder in eher peri-literarischen Essays über die Welten außerhalb von Romanen haben Autorinnen und Autoren ein Übungsfeld für ihre Sprach- und Gedankenspiele gefunden. So unterschiedliche Schreibende wie Virginia Woolf, James Baldwin, Toni Morrison oder David Foster Wallace (unter den Toten – leider!) sowie John Banville, Colm Tóibín, Lydia Davis und Anne Carson (unter den Lebenden – Daumen sind gedrückt!) haben sich in der essayistischen Form warmgeschrieben, haben ausprobiert, experimentiert, haben Erfahrungen getankt, aber auch Ideen, Theorien und Szenerien sowie ästhetische Neuerungen entdeckt, die ihre Prosa- oder Lyrikwelten bereichern, ergänzen oder auch mit ihnen in eine Diskussion treten.
Die altbewährte Definition des Essays nach Michel de Montaigne mag vielleicht zu Tode geritten (oder getrampelt) sein. In der Versuchsform des essai (aus dem Französischen für Versuch, Probe, Testlauf) steckt heute aber vielleicht so viel Leben wie in der Literaturgeschichte lange nicht. Für Montaigne war der Essayein Mittel zur Selbsterforschung, aber wie die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel waren Montaignes Essays alles andere als egozentrische Nabelschau. Im Gegenteil wurde am Beispiel eines einzelnen schreibenden Ichs die sublime Wirklichkeit der Menschen in Gänze erkundet oder probeweise durchgespielt.
Literatur, große Literatur, ist letztlich nichts anderes als eine Tiefenbohrung im Stollen der Menschenwirklichkeit. Essayistinnen und Essayisten sind dabei die Kanarienvögelchen, die sich als Vorhut unter Tage begeben – als Versuchsmittel, als Frühwarnsystem –, um auszuloten, was sich in den Tiefen der Welt verbirgt, ob sie Freude, Einsicht, Nutzen oder Gefahr bergen.
Anders als Romane, die viel mehr auf Langsamkeit zählen – darauf, dass sich die Sedimente der Zeit abgesetzt, dass die Realität sich etwas beruhigt und zu etwas Historischem mariniert hat –, sind Essays manchmal ähnlich flinke Frühwarnsysteme, Auslotungen höchst aktueller ästhetischer wie politischer Phänomene und Momente.
Joshua Cohens Essays sind Kabinettstücke in literarischem Einfallsreichtum und intellektueller Strenge, die hervorstechende, aber auch gerade erst aufkeimende Aspekte der Wirklichkeit ausloten. Sie vereinen scharfe Kritik mit spielerischer Gewandtheit, die Lesende sowohl unterhalten als auch erhellen. Ein rasch herausgegriffenes Beispiel aus dieser Sammlung: Lange bevor in allen Details klar wurde, mit welchen Mobstermitteln Donald Trump sein Kabinett führen würde, verfasste Cohen einen Langessay über die gescheiterten Kasino-Geschäfte des Trumpeltiers in Atlantic City. Cohen, der in der Küstenstadt in New Jersey aufwuchs, wies in »Der allerletzte Sommer: Über Donald Trump und den Untergang von Atlantic City« früher, klüger und witziger als die meisten darauf hin, was für einen umgekehrten Midas-Finger, welch verheerendes Geschick, es eigentlich braucht, um ein Kasino in den Bankrott zu treiben. Cohens Essay über den Ort seiner Kindheit und Jugend ist dabei eine brillante Mischung aus Stadtgeschichte und persönlicher Erzählung, die den verblassten Glamour von Atlantic City und den beständigen Geist dieser vielgestaltigen Stadt und ihrer Bewohner einfängt und dabei doch ganz allgemein über die USA als ein absterbendes Reich, ein Empire auf Zeit, spricht.
Vermehrt suchen die Nachwellen und Nachwehen der Trump-Regierung Cohens Essays heim wie ein ungebetener Gast, ein unbequemer Geist. Zum Beispiel in »Israels Zeit der Unzufriedenheit« über den 70. Jahrestag des Staates Israel, in dem der Autor unter anderem die Verbandelung der Trumps mit der Netanjahu-Regierung beleuchtet, und zwar noch bevor Cohen sich als Romancier einen Kindheitsmoment aus dem Leben Benjamin Netanjahus vornimmt, in seinem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman Die Netanjahus (oder vielmehr der Bericht über ein nebensächliches und letztlich sogar unbedeutendes Ereignis in der Geschichte einer sehr berühmten Familie) von 2021.
Als jüdischer Schriftsteller, der in einer Tradition von Autoren und Autorinnen wie Saul Bellow, Philip Roth, Bernard Malamud oder Cynthia Ozick schreibt, spielt die israelische Kultur und Literatur, aber auch die israelische Politik bei Cohen immer wieder eine Rolle. So verfasste er mit dem Essay »Schloschim (aus dem Tagebuch)« kurz nach dem 7. Oktober 2023 persönliche wie politische Aufzeichnungen, die einen emotionalen und hellsichtigen Blick auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina werfen, dessen rationaler, sowohl jüdische als auch palästinensische Erfahrungen beleuchtender Ansatz, verdeutlicht, wie brennglasgenau Cohen seine Zeit, seine Wirklichkeit und sich selbst in den Blick nimmt.
Die hier versammelten Essays des 1980 geborenen Schriftstellers, der lange als Auslandskorrespondent für die Zeitung Jewish Forward sowie als Buchkritiker für die Wochenzeitschrift Harper’s tätig war, stellen lediglich eine Auswahl dar, die einem deutschen Lesepublikum erstmals einen gebündelten Eindruck von dem Essayisten Cohen vermitteln. Entstanden sind die Texte zwischen 2011 und 2023 (obschon in wenigen Fällen verwendetes Material auf Texte von 2009 zurückgeht). Die Auswahl zeigt Cohens Entwicklung von einem Insidertipp und writer’s writer – einem Autor, der am allermeisten von seinen mitschreibenden Zeitgenossen wahrgenommen wurde – zu einem household name, der heute als eine der interessantesten Stimmen – für mich die interessanteste Stimme – seiner (und meiner) Generation geschätzt wird.
Da das Diktat der Zeit uns aber ohnehin schon genügend Schwierigkeiten bereitet, habe ich mich bei der Auswahl dieser Essays ganz bewusst gegen eine Chronologie entschieden. Die Texte sind lose thematisch geordnet, und das Buch ist eher kreisförmig als linear gestaltet, lässt sich von Buchdeckel bis Buchdeckel, aber auch häppchenweise lesen. Es endet und beginnt mit Texten, die man frei nach David Foster Wallace als floating-eyeball-essays bezeichnen kann – Essays, in denen das kühn beobachtende Auge eines Schriftstellers durch die Welt schwebt und sich nicht zu literarischen Belangen äußert, sondern zu alltäglichen politischen oder kulturellen Phänomenen.
In der Mitte dieses Kreises steht mithin das, womit sich der Vielleser und Vielschreiber Cohen am besten auskennt: köstlichste Literatur. In ausführlichen Würdigungen von Franz Kafka, Gregor von Rezzori, Bohumil Hrabal und Giacomo Leopardi erarbeitet Cohen eine theoretische Grundierung von Realismus und Naturalismus und knüpft an bedeutende literaturgeschichtliche Bezugspunkte an. In blühenden, glühenden Essays über Thomas Pynchon, Eimear McBride, Liu Xiaobo und Philip Roth sowie der immer gegenwärtigen Frage nach dem Ende des Buches (was nicht immer, aber oft mit dem Ende der Literatur gleichgesetzt wird) experimentiert er spielerisch mit der Frage, wie sich am besten über (Beinahe-)Zeitgenossen und Zeitgeschichte schreiben lässt. Und in seinem Essay über Georges Perec stellt er fast nebenbei fest, dass Perecs Œuvre sich auf den ersten Blick nur beiläufig mit dem Holocaust befasst, weil die Shoah darin nicht explizit (und nie auf realistische Weise) ins Licht gerückt wird. Hier wie überhaupt dienen die in diesem Buch versammelten Essays nicht nur als Lesefreuden und Denkanstöße, sondern auch als poetologische Geheimtürchen in Cohens eigenes Romangebäude. Denn was er hier über Perec sagt, lässt sich fast lückenlos übertragen auf Cohens großen experimentellen Roman Witz aus dem Jahr 2010.
Dass Cohen im besten Sinne Witz hat – nämlich im englischen Sinne des Wortes wit, sprich gleichzeitig Humor, Komik und Geist, Intelligenz –, das wird auf beinahe jeder Seite seiner Essays deutlich. Überall wird aber sichtbar, dass zu seinen Registern auch das Lyrische wie das Melancholische, das Nostalgische wie das Leidenschaftliche, das Erregte wie das Zornige gehören. Ganz komprimiert ist dies aber auch erlebbar (erlesbar!) in den Aufzeichnungen, die erstmals in Cohens Essayband ATTENTION: Dispatches from a Land of Distraction (2018) erschienen sind und die ich ausgewählt habe, um die einzelnen Teile der Essays aufzubrechen und zu ergänzen. Da etwa zwei Drittel der Essays diesem Band entnommen wurden, scheinen mir die Aufzeichnungen darüber hinaus thematisch oder tonal den Essays zugehörig. Und wie in dem Band ATTENTION sind die Aufzeichnungen kleine Sorbets zwischen gewichtigen Gängen, die den Lesegaumen reinigen, kurz innehalten und durchatmen lassen, die Essays aber immer wieder auch konturieren und akzentuieren.
Die Gattung der Aufzeichnung ist hier aber auch weit mehr als eine reine Kurznotiz, mehr als eine marginale Tagebucheintragung und mehr als eine minderwertige Gedankenstütze. Die Aufzeichnung ist festgehaltene Wirklichkeit im Kleinen, und damit ist sie das Substrat des großen Ganzen, was Literatur ausmacht. Die Aufzeichnung ist eine Urform des Schreibens, und damit berührt sie den Kern alles Literarischen, wie Joshua Cohen es sieht. Aufzeichnen ist Einfangen des entropisch aufs Nichts zutreibenden Wirklichen. Aufzeichnen ist das Spiel mit der ephemeren und ungreifbaren Schönheit und Schrecklichkeit der Welt.
In einem hier nicht beigefügten Essay über Elias Canetti – neben Franz Kafka, E.M. Cioran, Fernando Pessoa oder Susan Sontag einer der großen Aufzeichner und Notizenmacher des 20. Jahrhunderts – schreibt Cohen über den primären Wert der Aufzeichnung als ein Mittel zur Akzeptanz und zur Wertschätzung des Fragments, des Unfertigen. (Warum der Essay hier nicht beigefügt wurde? Weil wir das Unfertige zum Weiterentdecken und Weiterlesen benötigen.)
Die Tätigkeiten des Schreibens und des Lesens, aber auch des Übersetzens werden ebenfalls stets von der Notwendigkeit zur Akzeptanz des Unfertigen berührt. Man hat niemals alles geschrieben, man hat niemals ganz gelesen und man ist niemals mit dem Übersetzen fertig. Dass darin nicht nur Wertschätzung, sondern wahres Glück liegen kann, wurde mir beim Lesen von Cohens Essays und beim Schreiben meiner Übersetzungen von ihnen ständig aufs Neue klar.
Die enormen Herausforderungen für die Übersetzung, die der mitunter enzyklopädische Detailreichtum von Cohens Essays, aber auch seine Liebe für allerlei Alliteration und sprachlosmachende Wortspielerei mit sich bringen, wurden mir bei der Arbeit nicht zu Hindernissen, sondern im Gegenteil zu Gelegenheiten. Denn wie ich nach ein paar Tagen Shakespeare-Lektüre von jambischen Pentametern durchtaktet bin und ausschließlich wie der Barde spreche, so ist Cohens Stil dermaßen spielfreudig, dass er immer wieder Anlass gibt, selbst zu spielen. Herausforderungen werden zum Geschenk.
Und was fürs Übersetzen gilt, gilt noch viel mehr fürs Lesen. Die mitunter verschachtelten und um die Ecke gedachten Ideen von Cohen sind Einladungen zum Selberdenken und zum Mitreflektieren, Einladungen, selbst ins Selbst hinabsteigen, wie es der große Montaigne sich gewünscht hat.
In seinem bekannten Werk über Montaigne schrieb Stefan Zweig einmal, dass sich beim Lesen irgendwann eine »innere Zündung der leidenschaftlichen Begeisterung, das elektrische Überspringen von Seele zu Seele« einstelle. Beim Lesen von Joshua Cohen, sowohl von der essayistisch-weitreichenden Gedankenwelt seiner Romane als auch von der romanhaften Dichte seiner Essays, bin ich Seite für Seite immer wieder von dieser elektrisch-leidenschaftlichen Begeisterung angesteckt. Auch wenn ich Cohen nie übersetzt hätte, er bliebe für mich der beeindruckendste Autor meiner (und seiner) Generation. Weil ich aber das Glück hatte, ihn übersetzen und damit mein Schreiben, mein Lesen und mein Leben bereichern zu dürfen, bleibt mir nichts, als zu hoffen, dass sich auch bei deutschsprachigen Lesenden von Joshua Cohen eine innere Zündung vollzieht, ein Überspringen von der Autor-Seele zur Lese-Seele über den hoffentlich bereichernden Umweg der Übersetzer-Seele.
Jan Wilm
Frankfurt am Main im Juni 2024
Aufzeichnungen aus der Höhle
Auf der Suche nach Prophezeiung inmitten einer Pandemie
Vor einigen Tagen tauchte abends eine E-Mail bei mir auf. Damals, vor der Zeit, als die Welt den Atem anhielt, hatte mir mein Bruder, der Arzt, selten mehr als »Abendessen am Freitag j/n?« geschrieben, und plötzlich bekam ich eine Nachricht von ihm, an die er, mitten in der atemlosen Hektik, eine Datei mit 7241 Wörtern angehängt hatte. Ich dachte, er befinde sich weit draußen in den Außenbezirken von New York, um Kranke zu intubieren oder zu dialysieren – und so war es auch –, aber irgendwie hatte er trotzdem die Zeit und die adrenalingeladene Energie gefunden, mehr Worte auf den Bildschirm zu bringen, als ich, der vorgebliche Autor, in Wochen oder gar Monaten zustande gebracht hatte. Die Anweisungen am Anfang der E-Mail machten deutlich (oder deuteten an), wie dies geschehen konnte: Diese E-Mail, so schrieb mein Bruder, sei nicht für mich bestimmt, ich sollte sie lediglich aufbewahren und im Falle seines Todes an seine Frau und seine Kinder, meine Nichte und meinen Neffen, weiterleiten, weil mein Bruder gerade von ihnen getrennt war, seit er mit der Behandlung von Kranken begonnen hatte, die mit dem neuen Coronavirus infiziert waren. Seine Familie befand sich im Norden des Landes in der Wohnung seiner Schwiegermutter, während er in diesem oder jenem Krankenhaus des Mount-Sinai-Verbunds Dienst tun musste. Diese E-Mail war nun also auf meinem Computer gelandet, und ich konnte nur auf etwas Leichtigkeit hoffen: »Soll ich sie an deine Kinder weiterleiten oder ausdrucken?«, ging mir durch den Kopf, und dann fiel mir ein, dass seine Kinder noch gar keine E-Mail-Adressen hatten und auch nur eines der beiden schon lesen konnte.
Zu diesem Zeitpunkt waren in den USA bereits mehr als zwei Dutzend Menschen (Ärztinnen, Rettungssanitäter, Pfleger) an dem Virus gestorben, die meisten von ihnen in New York; in der ganzen Welt hatten Hunderte ihr Leben verloren, darunter (angefangen mit) Dr. Li Wenliang, der chinesische Augenarzt, der versucht hatte, das Virus einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, und dafür von seiner Regierung verfolgt worden war. Mein Bruder, ein Chirurg, der Krebsgeschwüre aus Körpern herausschneidet, ist normalerweise unerschütterlich. Plötzlich aber war das anders – er war erschütterlich, erschüttert, und seinen Kindern, die so klein waren, dass er fürchtete, sie würden sich kaum an ihn erinnern, erzählte er jetzt von seinem Leben. Ich hatte noch nie erlebt, dass er sich vor irgendetwas gefürchtet oder dass er gar meinen Rat gesucht hätte: Nachdem er mir seine Anweisungen mitgeteilt hatte, sagte er, ich solle ihn wissen lassen, wenn ich in dem Text etwas ändern wolle. Ich hatte keine Änderungsvorschläge. Ich habe seine E-Mail einfach archiviert, diese E-Mail, die uns beide überleben wird, die auch seine Frau und sogar die Kinder seiner Kinder in irgendwelchen Clouds überdauern wird.
Als Einstein 1955 starb, wurde ihm bei einer unzulässigen Autopsie in einem Krankenhaus in Princeton das Gehirn entnommen. Später, an der Universität von Pennsylvania, schnitt ein Pathologe namens Thomas Stoltz Harvey es zu Forschungszwecken auseinander, behielt allerdings einige der Scheibchen für sich. 1988 zog Harvey, dem inzwischen die ärztliche Approbation entzogen worden war, nach Lawrence, dem Sitz der Universität von Kansas, wo er dem dort lebenden Autor William S. Burroughs eines der Gehirnscheibchen überreichte, und nach dessen Tod im Jahr 1997 ging das Scheibchen über in den Besitz von … nein, ich höre besser auf, denn ich will ja niemanden in Schwierigkeiten bringen. Sagen wir einfach, dass zu meiner Zeit in Lawrence, als ich an der KU unterrichtete, noch Folgendes stattfand: ein Hazing-Ritual, das auch eine Hommage war: Mit einem Löffel fischte man das Scheibchen von Einsteins Gehirn aus dem Glas und schüttelte das überschüssige Formaldehyd ab; dann gab man etwas Salz in die Daumenbeuge und leckte es ab, woraufhin man einen Schluck billigen, zimmerwarmen Tequila zu sich nahm und an dem Hirnscheibchen lutschte, bis einem der Mund taub wurde, bis das Formaldehyd Lippen und Zunge lähmte und man beim Sprechen nicht mehr verstanden wurde; es fühlte sich nicht mal mehr wie der Versuch an, Sprache von sich zu geben.
Die derzeitige Quarantäne hat mich zu Burroughs zurückgebracht, der behauptete, er glaube – was bedeutet, dass er es nicht glaubte, aber glauben wollte –, dass Sprache ein Virus sei. Auch wenn es schwierig ist, die genaue Pathologie zu entschlüsseln – Genauigkeit gehörte eher nicht zu Burroughs’ Verfahren –, könnte eine Zusammenfassung wie folgt lauten: Die Sprache ist ein Virus, das von einer außerirdischen Zivilisation herkommend die Artengrenze überschritten hat. Dieses Virus infizierte die prähistorischen Menschen und verformte ihre Kehlen, mit dem Ergebnis, dass eine infizierte Person nun Laute von sich geben konnte, mit deren Hilfe Zustände repräsentierbar wurden, die zuvor ausschließlich innerlich waren (sprich: Gedanken, Gefühle). Indem die Urmenschen diese Zustände nach außen trugen – mit anderen Worten, indem sie den Akt vollzogen, den wir als »Sprechen« bezeichnen –, infizierten diese Menschen ihre Mitmenschen und kolonisierten so den individuellen Geist mit Fremdkörpern, die ansteckend waren und sich selbst reproduzierten. Die Menschen, die am meisten oder am lautesten sprachen, waren die gefährlichsten Verbreiter dieser Quasselgrippe, und da sie sich dieser Tatsache oder zumindest dessen bewusst waren, was die virale Kultur als ihren Einfluss ansehen würde, nutzten sie das Virus in ihrem Streben nach gesellschaftlicher Kontrolle und verbreiteten Pandemien von Massenideen und Massengefühlen.
Diese Verbreiter besaßen die Macht, die Gefährdeten denken zu lassen, was sie selbst dachten, und fühlen zu lassen, was sie selbst fühlten, und zwar absolut alles; sie konnten sie dazu bringen, Fake News zu verbreiten, als wären sie wirklich, und fremde Wörter zu verwenden, als wären sie heimisch; sie konnten sie sogar davon überzeugen, dass dieses Virus nicht wörtlich zu nehmen, sondern als eine Metapher anzusehen war. In der Zwischenzeit mutierte das Virus immer weiter, sodass das, was sich in der ersten Staffel als Mund- und Ohrenkrankheit manifestierte, in den folgenden Staffeln als Augen- und Handkrankheit zurückkehrte, wobei sich die Sprache zur Schrift wandelte, die ihre Spuren in Form von Glyphen und Geprägen auf Höhlenwänden, Papyri, Pergament, Papier und Bildschirmen hinterließ.
Burroughs entwickelte mit seiner »Viralitätstheorie« nicht nur eine Medienkritik und verurteilte Technologien, Regierungen und Unternehmen, die ganze Bevölkerungen im großen Stil mit Sprache infizieren, sondern er verurteilte damit letztlich auch sich selbst oder sein Theoretisieren und Schreiben im Allgemeinen. Das Hauptanliegen seines Schreibens war, dass man nicht schreiben könne, ohne die Gesundheit zu schädigen; sich in Worten auszudrücken hieß, seine Lesenden zu infizieren und damit Macht über sie auszuüben. Besser als jeder andere verstand er, dass die Diagnose selbst eine Krankheit sein kann: Das Sprachvirus mit Hilfe der Sprache zu erklären bedeutete, es zu verbreiten.
Seiner Meinung nach – seiner von der Sprache beherrschten Meinung nach – lag die Viralität der Sprache in ihrem Drang, eine »Realität« zu definieren und auszudrücken und sie endlos zu reproduzieren. Diese »Realität« drohte die Individualität – »Zelle« für »Zelle« oder Wahrnehmung für Wahrnehmung – zu ersetzen, bis die Menschheit selbst ersetzt und in einen neu zusammengesetzten Organismus fortgepflanzt werden würde, einen Organismus namens »Publikum«. Die einzige Möglichkeit, sich diesem fatalen Prozess zu widersetzen, bestand für Burroughs darin, sich den Operationen des Zufalls hinzugeben und die eigenen Schreibentwürfe der »Cut-up-Methode« zu unterziehen, einer ehrwürdigen surrealistischen Technik, bei der man mit Scheren, Messern und Rasierklingen Textabsätze herausschneidet, Sätze seziert und ihre Syntax und Grammatik – die Adern der semantischen Übertragung – zerstückelt. Obwohl er sich darüber im Klaren war, dass die Subversion der Literatur nichts sei im Vergleich zur massenmedial vermittelten Virulenz, betrachtete Burroughs seine gelungensten Versuche als jene leichten Dosen einer Krankheit, die den Zweck einer Impfung erfüllen könnten.
Susan Sontag hat Burroughs’ Viralitätstheorie mit ihrer Kritik an Krankheitsmetaphern auf die Probe gestellt, und die Ergebnisse sind … negativ: Es handelt sich um eine Metapher. Für Sontag war schon der Begriff »Krankheit« eine rhetorische Täuschung: Die Verwendung des Wortes »Krankheit« bedeutete, »das Kranke« zu erschaffen und somit eine falsche Unterscheidung zwischen »den Kranken« und »den Gesunden« vorzunehmen. Und wenn man beispielsweise die Voreingenommenheit der Massenmedien oder ein anderes historisch unterdrückendes und verwerfliches gesellschaftliches Phänomen als »krank« bezeichnete, bedeutete dies, dass Krankheit selbst als unterdrückend und verwerflich diffamiert wurde und dass es irgendwie abartig war, darunter zu leiden. Indem sie Krankheit von einer beschämenden Abweichung zu einem natürlichen Zustand – dem Zustand der Natur – umdefinierte, indem sie den Tod (eine Sache) in das Sterben (einen Prozess) verwandelte, hoffte Sontag, den Kranken die Würde der Normalität zurückzugeben; aus Worten eine Welt zu machen, in der Krankheit nicht das Ende des Lebens war, sondern ein Teil des Lebens, ein Teil, der jeden von uns seit unserer Geburt in Wellen begleitet.
Sontag hatte ein persönliches Interesse daran, sich gegen eine solche metaphorische »Bösartigkeit« zu verwahren: Ihr erstes Buch zu diesem Thema (Krankheit als Metapher, 1978) entstand während ihrer eigenen Krebsbehandlung, und ihr zweites Buch dazu (Aids und seine Metaphern, 1989) erschien auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie, die etliche Menschen in ihrem Freundeskreis heimsuchte.
Dieses neue Virus, COVID-19 – ein Name, der die völlige Banalität einer Abkürzung (COronaVIrus Disease oder -Krankheit) mit der Anonymität einer Zahl (2019) verbindet – ruft nach einer anderen Rhetorik; die Geschwindigkeit und das Ausmaß seiner Ausbreitung haben es buchstäblich unvergleichlich gemacht. Wie ist dieses Virus beschaffen? Und was ist wie dieses Virus? Ein Virus, das unterschiedslos, sowohl symptomatisch als auch asymptomatisch, auftritt, kann nichts repräsentieren. Es kann kein Symbol sein und kein Stigma mit sich bringen, da es letztlich in uns allen steckt, universeller als etwa die »Krankheiten« Hunger, Armut und Rassismus.
Wann immer eine unheilbare Krankheit die Zahl der Toten in die Höhe treibt, kommt es zu einer entsprechenden Sprachkrise, die sich mit Burroughs’schen beziehungsweise Sontag’schen Begriffen so ausdrücken lässt: Ist Sprache ein metaphorisches Virus oder ein metaphorischer Antikörper? Ist Sprache die Vermehrung von Falschheit oder der Schutz vor ihr, oder kann sie gar beides sein, und welcher Teil ihrer Funktion findet bewusst statt?
Wenn die Toten sprechen könnten, würden sie es uns vielleicht sagen.
»Eine Theorie ist … eine metaphorische Beziehung zwischen einem Modell und einem Tatsachenzusammenhang«, schrieb Julian Jaynes in Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche (1988), seiner Erläuterung des »Bikameralismus« oder der Theorie von den zwei Kammern des vorbewussten oder präpsychologischen Gehirns. Eine weitere unzureichende Zusammenfassung könnte so lauten: Jaynes äußerte die These, dass in den frühesten menschlichen Gehirnen die kognitive Funktion geteilt oder lateralisiert war; ein Teil des Gehirns »sprach« und der andere Teil »hörte zu«. Konkret heißt das bei Jaynes, die rechte Gehirnhälfte übertrug die Sprache an die linke, die sie als das erlebte, was Jaynes eine »Halluzination« nennt: eine Heimsuchung durch eine Stimme ohne Quelle, ohne Namen, Gesicht oder Körper. Da die primitiven Menschen, die nur mit sich »selbst« sprachen, sich aber noch nicht bewusst waren, dass sie ein »Selbst« hatten, brauchten sie eine Metapher für die Stimmen, die sie hören könnten, und so erfanden sie die Götter, die Engel, die Dämonen und so weiter. Sie alle gingen dem »Bewusstsein« voraus oder spielten in der Antike die Rolle des »Bewusstseins«. Über die bikamerale Psyche schreibt Jaynes: »Wollen, Planung und Handlungsanstoß kommen ohne irgendwelches Bewußtsein zustande und werden sodann dem Individuum fix und fertig in seiner vertrauten Sprache ›mitgeteilt‹. … Das Individuum gehorcht diesen Stimmen, weil es nicht ›sieht‹, was es von sich aus tun könnte.« Und anderswo schreibt er: »Die Götter waren Organisationstypen des Zentralnervensystems; sie lassen sich als ›personae‹ … auffassen. … Die Götter sind – so würden wir es heute ausdrücken – Halluzinationen.« Und abermals anderswo schreibt er, »daß es eine Zeit gegeben hat, in der das menschliche Wesen in zwei Teile zerfiel: einen Lenker und Leiter namens Gott und einen Gefolgsmann namens Mensch. Keiner von beiden hatte Bewußtsein. … [Der Mensch] müßte auf die bikamerale Stimme warten, mit der seine aufgespeicherte praktische Lebensweisheit ihm ohne Dazwischenkunft von Bewußtsein mitteilen würde, wie er sich zu verhalten hat.«
Doch was hat diese »halluzinierten Stimmen« ausgelöst? Oder anders gefragt: Unter welchen Bedingungen kam der »exekutive« »göttliche« Teil eines alten menschlichen Gehirns dazu, Befehle zu erteilen? Jaynes’ Antwort auf diese Frage lautet – »Stress«:
Wir können annehmen, daß in der Ära der bikameralen Psyche die Streßschwelle zur Halluzinationsauslösung noch weit, weit, niedriger lag als beim Normalmenschen wie auch dem Schizophrenen von heute. Der einzig erforderliche Streß war der, der auftritt, wenn irgend etwas hinzutretend Neuartiges an einer Situation eine Verhaltensänderung notwendig macht. Alles, womit nicht auf habitueller Basis fertig zu werden war, jeder Konflikt zwischen Leistungsanforderung und Erschöpfungsgrad, zwischen Angriffs- und Fluchtneigung, jede Wahl, wem man gehorchen und was man tun solle, kurzum alles, was irgendeine Entscheidung erforderte, reichte aus, um eine Gehörshalluzination zu bewirken.
Ungefähr zweitausend Jahre vor Christus hätte ein Mensch vielleicht keinen Gott nötig gehabt, der ihm sagt, welche Höhle seine Wohnhöhle ist, doch wenn dieser Mensch sich weit weg von seiner Wohnhöhle befand und sich für einen Weg entscheiden musste, der ihn zurück nach Hause führte, war er vielleicht solchem Stress ausgesetzt, dass sich ein Gott melden und für ihn die Entscheidung treffen musste. Das nächste Mal, wenn sich dieser Mensch in der gleichen Situation befände und vor der gleichen Wahl nach dem Weg stünde, wäre ihm die Erinnerung an die vorherige Entscheidung bewusst: Er würde sich erinnern, er würde wissen, ob der Weg, den er zuvor genommen hatte, der richtige war. Das Wissen darüber, welchen Weg er nehmen musste, hätte den Status eines »Wohnhöhlen-Wissens« erlangt – es wäre zu bewusstem Wissen geworden –, und auf diese Weise entwickelte sich aus den zunehmenden Begegnungen mit neuen Bedingungen allmählich das Bewusstsein. Grundlegend für die Entwicklung dieses Bewusstseins war eine Verbesserung der menschlichen Fähigkeit, den Schaden zu erkennen, der durch ihre standardmäßige Unterwerfung unter Befehle verursacht wurde, die zu erfolglosen Ergebnissen führten, was wiederum eine wachsende Bereitschaft hervorbrachte, nicht nur diese, sondern alle »inneren Stimmen« zu hinterfragen und ihnen gar zu widersprechen.
Ungefähr zweitausend Jahre nach Christus erhalten wir andere Befehle, von Quellen, die Namen, Gesichter und Körper haben und die von unserem Bewusstsein beurteilt werden müssen. Sollen wir eine Maske tragen, wenn wir unsere Wohnhöhlen verlassen? Sollten wir Handschuhe tragen, wenn wir die Türklinken in unseren Höhlen anfassen? Und wie steht es mit dem Besuch der Höhlen unserer Freunde? Welche Freunde – und wie kommen wir dorthin? Nach Jaynes sind dies unsere »Stressfaktoren«. Meine Freunde, die mich in ihre Höhlen eingeladen haben, haben vielleicht keinerlei Symptome des Virus. Allerdings sind sie auch nicht getestet worden. Oder die Tests, die sie gemacht haben, waren widersprüchlich. Oder sie waren nicht eindeutig. Oder es waren die falschen Tests. Trotzdem haben sie sich wochen- und monatelang in ihren Höhlen verkrochen. Sie verließen sie nur, um Lebensmittel einzuholen. Im Laden aber trugen sie eine Maske und Handschuhe und desinfizierten all ihre Lebensmittel. Nur ihre Einkaufstaschen haben sie nicht desinfiziert. Oder sie haben ihre Einkaufstaschen weggeworfen und ihre Kleidung in die Wäsche gesteckt und ihre Maske vor den Handschuhen oder ihre Handschuhe vor der Maske ausgezogen und Seife oder Desinfektionsmittel zum Händewaschen verwendet, allerdings die falsche Marke Seife und die falsche Marke Desinfektionsmittel, und obwohl sie ihre Schuhe ausgezogen haben, haben ihre Füße die Matte berührt, auf der ihre Schuhe standen, und das Virus hat die Fußmatte kontaminiert. Meine Freunde werden langsam ungeduldig. Sie wollen nicht mehr, dass ich sie besuchen komme; sie wollen jemand anderen einladen, jemanden, der weniger Angst hat oder einfach weniger zaudert. Oder jemanden, der ein Auto hat und nicht mit der Bahn oder dem Bus fahren muss. Ist es dir recht, wenn ich ein Taxi nehme? Wenn es dir nicht recht ist, kannst du mich dann abholen? Und mich wieder zurückfahren? Oder kann ich einfach bei dir einziehen? Und wenn wir schon dabei sind, macht mich eine bestimmte Blutgruppe immun? Und warum greift »SARS-COV-2«, wie es mittlerweile manchmal genannt wird, im Gegensatz zu »SARS-COV-1« das gesamte Immunsystem an? Was ist eine T-Zelle? Ist ein Protein ein Gen und wo, wann oder wer ist ein Thymus? Ich wünschte, es würde ein Gott auftauchen und mir Befehle erteilen, mir sagen, was richtig und was falsch ist, mir sagen, was ich tun soll. Du sollst die Höhle deiner Freunde besuchen. Du sollst nicht die Höhle deiner Freunde besuchen. Du darfst sie besuchen, jedoch nur in Gruppen von vier oder weniger Personen. Leider sind die einzigen Götter, die in letzter Zeit vor meiner Höhlentür erscheinen – abgesehen vom Paketzustellervolk –, »Experten«, einige von ihnen wohlmeinend, andere nicht, aber alle bringen »Fakten« mit, an deren Bestellung ich mich nicht erinnern kann, Fakten, die mindestens zweideutig sind, wenn sie sich nicht widersprechen (oder umgekehrt), oder Fakten, die sich ändern können.
Jaynes über Prophezeiung:
Was ein besessener Prophet redet, ist nicht eigentlich halluziniert, nicht etwas von einem bewußten, halbbewußten oder – wie im Fall der eigentlichen bikameralen Psyche – nichtbewußten Menschen Gehörtes. Die besessene Rede wird äußerlich artikuliert und von anderen gehört. Sie tritt nur bei normalerweise bewußten Menschen auf, und zwar korrelativ mit Bewußtseinsschwund. Was berechtigt uns also dazu, zwischen diesen beiden Phänomenen – den Halluzinationen der bikameralen Psyche und der Rede von Besessenen – eine Verwandtschaft zu behaupten?
Bittet um Erleuchtung, und es wird euch gegeben (frei nach Matthäus und Lukas): »Darauf habe ich keine wirklich hieb- und stichfeste Antwort parat«, schreibt Jaynes. Auf diese witzige Weise verleugnet ein psychologischer Sucher des späten letzten Jahrhunderts, der immer noch mehr Akademiker als Mitglied der Gegenkultur war, seinen eigenen Status als Prophet.
Man betrachte mal einen Augenblick das Wort »besessen«; man stecke es sich mal in den Mund, kaue mal drauf herum (drei Bissen, be-sess-en), und dann: schlucken. So geschah es einst mit der Prophezeiung: Jesajas Mund wurde (wie der Mund Mose) durch die glühenden Kohlen von einem Altar verbrannt; Gott zwang Hesekiel, eine Schriftrolle zu essen, und streckte einen Finger aus, um die Lippen Jeremias zu bewegen. Ein Prophet ist jemand, der überrumpelt, usurpiert, zu einem Medium und dessen Mundwerk zu einem Sprachrohr gemacht wird. Ein Prophet ist ein Mensch, der zu viel Bewusstsein besitzt, um nicht zu wissen, dass er besessen ist, allerdings zu wenig Bewusstsein, um seinen Besitzer als etwas Geringeres denn eine Gottheit anzusehen. Auf die anfänglichen Worte eines Propheten – »Ich sage euch, dass Gott durch mich mit der Stimme spricht, die ihr hört« – folgt traditionell eine Ermahnung, die nicht in der ersten Person Singular des Propheten oder in der dritten Person einer auktorialen Abwesenheit vorgetragen wird, sondern in einer seltsamen Verbindung der beiden, in der zweiten Person Plural: das alles einschließende »Ihr«; ein »Ihr«, das sogar den Sprecher einschließt und dadurch noch geheimnisvoller wirkt. Dies ist das Pronomen, das ich, während ich in meiner Quarantäne Selbstgespräche führte, so gern gehört hätte. Aber stattdessen höre ich immer nur: »Wir sitzen alle im selben Boot.«
Nachdem ich deine E-Mail gelesen hatte, mein lieber Bruder, legte ich mich schlafen. Des Schlafes Bruder ist der Tod, und dann hatte ich einen Traum. Menschen mit Masken und Handschuhen warteten in einer endlos langen Schlange, um durch eine perlenbewehrte Pforte eine Einrichtung zu betreten, die nicht dafür ausgestattet war, so viele von ihnen auf einmal einzulassen. Es herrschte Chaos. Die Menschen weinten, sie bekamen Anfälle. Drinnen hetzten Engel mit Kitteln über ihren Flügeln umher, maßen Fieber und versuchten, leere Betten zu finden, und ab und zu streckten sie in völliger Verzweiflung ihre Köpfe mitsamt den Heiligenscheinen aus dem Fenster raus und schrien in ihrer Nichtsprache auf die runde, sich drehende Erde herab: »Bleibt zu Hause … gebt auf euch Acht … stoppt die Ausbreitung … flacht die Kurve ab.«
(2020)
Der allerletzte Sommer: Über Donald Trump und den Untergang von Atlantic City
Die Gesellschaftsordnungen, die sich in Casino-Hotel-Ressorts metaphorisch ausdrücken, sind in der Regel keine Demokratien, sondern Oligarchien, Autokratien, Monarchien sowie jene Imperien, die Afrika und Asien verschlungen haben. Wie das pharaonische Ägypten, das Venedig der Dogenzeit, das kaiserliche Rom oder das indische Mogulreich. In Atlantic City stehen Inkarnationen der beiden letzteren – Caesars Atlantic City und das Trump Taj Mahal –, wobei das Taj das letzte Gebäude in der Stadt ist, das noch den Namen des republikanischen Kandidaten trägt, auch wenn es eigentlich dem Hedgefondsmanager-Zar Carl Icahn gehört, der auch das Tropicana besitzt, eine zerbröckelnde Anhäufung, die der Casa de Justiciaeiner chaotischen Bananenrepublik nachempfunden ist. Je schlimmer das Regime, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass seine Schimäre überdauert. Das Revel in Atlantic City, eine gewaltige, flossenförmige Erektion – pardon, Konstruktion – aus Beton, Stahl und Glas, die rund 2,4 Milliarden Dollar gekostet hat, wurde 2012 eröffnet und 2014 wieder geschlossen; das zeigt, dass ein abstraktes Substantiv, Verb oder ein abstrakter Imperativ auf der Suche nach einem Ausrufezeichen (Revel! – feiert die Feste, wie sie fallen!) nicht dasselbe Verfallsdatum hat wie eine untergegangene Meuchelkultur.
Heute gehören die falschen Ruinen von Rom und Indien zu den saubersten und sichersten Zufluchtsorten, die man in den echten Ruinen von Atlantic City finden kann – einer sterbenden Stadt, die nur für den Sommer lebt. Als ich dorthin, zu meiner dortigen Familie, zurückkehrte, fragte ich mich, ob dieser Sommer mein letzter sein würde oder derletzte der Stadt – oder beides.
Da Atlantic City schon so lange unter Medienbeschuss steht, dass ich mich gut erinnern kann, wie beinahe jeder Sommer der sechzehn Jahre, die ich dort verbracht habe, von irgendjemandem als »entscheidend«, »folgenschwer«, »endgültig« oder als »der letzte« bezeichnet wurde, könnten vor allem andere Bewohner des Jersey Shore meine Befürchtung unverantwortlich und gar idiotisch finden – deshalb hier zur Klarstellung: Ich will damit nicht sagen, dass ich glaubte, die Stadt würde nach diesem Sommer voller großem Medieninteresse, aber wenig neuem Geld niederbrennen, oder der Atlantische Ozean würde sich endlich aufbäumen und sie verschlucken. Ich glaubte bloß, dass die Pechsträhne der Stadt bis zum Labor Day abreißen und etwas noch viel Schlimmeres kommen, sich aber niemand dafür interessieren würde.
Nach der Legalisierung indigener Stammes- sowie Nicht-Stammes-Casinos in den 1990er Jahren in Connecticut und in Pennsylvania in den 2000ern, nach der Legalisierung von Stammes-Casinos im Bundesstaat New York in den 90ern und von Nicht-Stammes-Casinos in den 2010er Jahren, nach den Schäden, die der Hurrikan Sandy 2012 in der Stadt angerichtet hat, und nach all den unzähligen, immer noch andauernden Verwüstungen der sogenannten Weltfinanzkrise, die 2014 zur Schließung von vier Casinos der Stadt führte (das Revel, das Showboat, der Atlantic Club und das Trump Plaza), wodurch Atlantic City zwischen dem vierten Quartal 2014 und heute landesweit die höchste Rate an Zwangsversteigerungen aller städtischen Gebiete aufwies, fühlte sich dieser Sommer – der Sommer 2016 – jetzt schon an wie ein finsterer Herbst. Vielleicht würde es nicht der letzte Sommer werden, in dem die Restaurants White House Subs oder Chef Vola’s noch Essen servieren, doch es könnte durchaus der letzte Sommer sein, in dem ich mich als zurechnungsfähiger, unbewaffneter und relativ friedfertiger Mensch immer noch dabei wohlfühle, diese Restaurants zu Fuß aufzusuchen, um ein Käsesteak oder Veal Parmigiana zu essen – denn ich müsste die Treppe vom überbeleuchteten Boardwalk hinunter zu den unterbeleuchteten Straßen einer Stadt nehmen, die offiziell zur gefährlichsten Stadt New Jerseys geworden ist, seit Camden seine Kriminalitätsstatistiken nicht mehr ans FBI meldet. Mir kam der Gedanke, dass meine Eltern, wenn und falls AC jemals wieder besuchbar oder genießbar sein sollte, sich bis dahin wahrscheinlich ins südliche Cape May zurückgezogen haben und die wenigen meiner Bekannten, die noch auf Absecon Island leben – der Insel, deren nördlichste Stadt AC ist –, wahrscheinlich weggezogen sein werden.
Doch was mich letztlich davon überzeugt hat, dass AC – dessen historischer Zyklus von Auf- und Abschwung sich jedes Jahr im Zyklus von »Haupt-« und »Nebensaison« wiederholt – nie mehr so (oder auch nur so ähnlich) wie früher sein würde, war das perfekte Zusammentreffen einiger vielleicht zusammenhängender, vielleicht aber auch unzusammenhängender Ereignisse.
Erstens: die Haushaltsfrist: Wenn AC bis zum 24. Oktober keinen ausgeglichenen Haushalt zur Genehmigung durch den Bundesstaat vorlegen konnte – und die meisten Einwohner hier waren davon überzeugt, dass dies weder möglich war noch von Gouverneur Chris Christie zugelassen würde –, dann würde der Bundesstaat New Jersey die Kontrolle über alle Ämter und Tätigkeiten der Stadt übernehmen und etwas einläuten, was der Bürgermeister von AC, Don Guardian (und mit ihm die ACLU und die NAACP), als verfassungswidrige Übernahme der Stadtverwaltung betrachtet. Sollte es dazu kommen, dann wäre AC die erste Stadt in der Geschichte Jerseys, die von Trenton aus verwaltet würde (abgesehen von Trenton). Der Bundesstaat hätte die Befugnis, alle Verträge von AC neu zu verhandeln, einschließlich der Gewerkschaftsverträge, und die Vermögenswerte der Stadt zu privatisieren (sprich: zu verscherbeln), etwa die Wasserwerke, die Atlantic City Municipal Utilities Authority, und den stillgelegten Flughafen Bader Field, und zwar in der Hoffnung, die Schulden der Stadt in Höhe von 550 Millionen Dollar zu begleichen und das Haushaltsdefizit von 100 Millionen Dollar zu verringern.
Zweitens: die Volksabstimmung: Am 8. November, zwei Wochen und einen Tag nach dieser wahrscheinlichen Übernahme durch den Bundesstaat, gehen die Wählerinnen und Wähler von Jersey an die Urnen, um zu entscheiden, ob sie dem »New Jersey Casino Expansion Amendment« zustimmen oder nicht. Es zielt darauf ab, das Glücksspiel – das bisher auf Atlantic County beschränkt war – auf zwei andere Bezirke von Jersey auszudehnen, die geeignete Casinostandorte darstellen könnten, allerdings mindestens 72 Meilen von AC entfernt sind. Wird der Antrag zur Änderung der Staatsverfassung angenommen – und zum Zeitpunkt dieses Essays liegt die Wahrscheinlichkeit wohl bei 50:50 –, dann mache man sich bitte gefasst auf grandiose Eröffnungsfeiern für Casinos in den Meadowlands. Die dahinterstehende Logik besagt, dass AC in den letzten zehn Jahren bereits etwa 2,5 Milliarden Dollar an Glücksspieleinnahmen an die Nachbarstaaten verloren hat und es nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendeine geschäftstüchtige Arschgeige ein Wettbüro in Manhattan eröffnet; die Errichtung neuer Casinos im Norden auf der Jersey-Seite des Hudson könnte das verhindern. Vielleicht aber auch nicht – auf jeden Fall würde es dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger der größten Stadt des Staates nicht mehr fast zweieinhalb Stunden in einem Greyhound-Bus mit defekter Toilette hocken oder fast drei Stunden in einem Amtrak-Zug herumgurken, der aufgrund von Gleismängeln über Philadelphia umgeleitet werden muss, nur um endlich ihr letztes Hemd zu verspielen.
Natürlich sollte der 8. November auch noch eine weitere Entscheidung mit sich bringen, und zwar nicht nur für New Jersey.
Ich rief Mom und Dad an, tankte das Auto auf und verließ New York über den Turnpike (Ausfahrt 11) und den Parkway (Ausfahrt 38) zum AC Expressway. Es war kein Verkehr.
Damals in den (Bill-)Clinton-Neunzigern, als die Reklametafeln, die den Expressway sowie die Black Horse und die White Horse Pike flankierten, noch nicht bis auf die Gerüste entblößt oder auf den bloßen Spruch HIER-KÖNNTE-IHRE-WERBUNG-STEHEN geschrumpft waren, als mein Vater sein Geld damit verdiente, die Casinos zu verklagen, und meine Mutter ihres damit, südasiatischen Eingewanderten, die in den Casinos arbeiteten, Nachhilfe in Akzentreduzierung zu erteilen, als die Freunde und Kolleginnen meiner Eltern und so ziemlich alle anderen Erwachsenen, die sich in der Synagoge links und rechts, vor und hinter mir verbeugten, entweder in der Casinoregulierung (für die staatliche Aufsichtsbehörde oder die Glücksspielkontrollabteilung) oder in der Casinoverwaltung arbeiteten (ihre Spielhallen, Speisen und Getränke und Abendunterhaltung) oder Waren und Dienstleistungen für die Casinos lieferten (Eis, Bettwäsche, Abfallentsorgung), blieb AC – die Stadt selbst – für mich ein Rätsel, ein Paradox. Es war ein Ort, an dem jeder seinen Lebensunterhalt verdiente, an dem aber niemand gerne ein Leben führte. Ein Ort der Fantasie (Stripperinnen!) und doch voller verwirrender Einschränkungen (man kann rund um die Uhr Alkohol in Geschäften und Bars kaufen, allerdings nicht in den Stripclubs selbst, auch wenn man in diese seinen eigenen Alkohol mitbringen kann!).
Für mich als Teenager bestand Atlantic City aus der zwei Dutzend Blocks langen Strandpromenade, dem Boardwalk, und zwei größeren, wenn auch schmutzigeren Straßen, der Atlantic und der Pacific Avenue, wo ich mich zum Spaß oder zum Schabernack herumtrieb, bevor ich mich auf den Weg zu den weniger überfüllten, weniger verschmutzten Stränden oder nach Hause machte – und dabei unternahm ich in einer einzigen Wochenendnacht die gleiche Reise, die die meisten mir bekannten Erwachsenen an jedem Wochentag machten: zwischen AC (39260 Einwohner) und den weißeren, wohlhabenderen Downbeach-Siedlungen von Absecon Island oder zwischen AC und dem weißeren, wohlhabenderen Festland. Die Erwachsenen fuhren nur zur Arbeit; ihre Kinder – oder besser spreche ich hier nur für mich selbst – hatten Drogen zu kaufen und Mädchen zu treffen.
Auch ich war einmal Angestellter in einem Casino, allerdings erst, als ich ganz sicher war, dass ich aus Atlantic City weggehen würde. Im Sommer 1998, dem Sommer zwischen der High School und dem College, arbeitete ich im Resorts, einem Casino, dem der besitzanzeigende Apostroph fehlte – es hieß eben nicht Resort’s –,vermutlich um weniger besitzergreifend zu wirken, was meine Zeit und das Geld der Kunden betraf. Ich war Münzkassierer, und meine Aufgabe bestand darin, im Smoking in einer unerträglich grellen und lauten Gitterzelle herumzustehen, die mit einer winzigen Fläche aus Kunstmarmor ausgestattet war (weil Marmorierung den Schmutz tarnt und Bargeld schmutzig ist), und durch eine kleine runde Öffnung reichten mir die Automatenzocker ihre Eimer, weiße Plastiktröge, auf denen das Resorts-Logo prangte und die vollgefüllt waren mit ihren Gewinnen. Ich schüttete den Schatz jedes Eimers in den Wirbelschlund meines automatischen Münzzählers, der das Hartgeld zusammenzählte, aber auch separierte, bevor die Fünfer und Vierteldollar – die bevorzugten Stückelungen an den Spielautomaten – in riesige Plastiktüten geleert wurden, die wie die aufgeblähten Schlünde von Pelikanen über dem Boden hingen. Ich las die Gesamtsumme von der Anzeige des Schalters ab und zahlte den Spielerinnen und Spielern die ihnen zustehenden Beträge in der von ihnen gewünschten Form aus: in Scheinen oder – und dazu sollte ich ermutigen – in Jetons, die damals als die einfachste Ersatzwährung galten, da sie von den Zockenden sofort wieder in Umlauf gebracht und also verloren werden konnten. Mit der Einführung neuer Selbstbedienungsautomaten, die keine Münzen mehr annahmen oder auszahlten, sondern vom Casino ausgegebene Kreditkarten akzeptierten und Gewinne auf sie übertrugen, sollte dieses Fiatgeld bald gänzlich aus dem Automatenbereich verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt, Mitte der 2000er Jahre, verschwand der ehrenwerte Beruf des Münzkassierers ganz einfach, gerade so wie der des Hufschmieds (der jetzt nur noch im Bally’s Wild Wild West Casino für Fotos posierte) und der des Riverboat-Kapitäns (der jetzt nur noch im Showboat für Fotos posierte).
Was ich aber erwähnen sollte: Bevor die Casinos die Münzen völlig abschafften und wir Münzkassierer durch Selbstbedienungsautomaten ersetzt wurden, verbrachten wir alle unsere Schichten damit, unsere kleineren Automaten zu warten und zu versuchen, sie zu reinigen – vor allem in den Nachtschichten, weil immer mehr Spielerinnen mit Eimern hereinkamen, die sie als Aschenbecher benutzten, sodass ihr Münzgeld mit Kippen durchsetzt war (2008 wurde das Rauchen verboten), und weil immer mehr Spieler, die zu spät fürs Abendbuffet, aber zu früh fürs Frühstücksbuffet waren, mit Eimern voller Fast Food ins Casino kamen, die sie anschließend als Behälter für ihre Jackpots recycelten. Sie hockten vor den Spielautomaten, zogen an den Hebeln oder drückten auf die Knöpfe, während sie in ihren Eimern nach gebratenen Hähnchenschenkeln oder BBQ-Rippchen fischten und das daran festklebende Metall abschüttelten, bevor sie sich ihre Snacks einverleibten. Die Kassierer waren darauf geschult, hier Abhilfe zu schaffen, und so wurde von ihnen erwartet, dass sie die Gewinne nach Knochen, verbrannten Fleisch- und Hautfetzen sowie Panade absuchten und die Eindringlinge entfernten. Dies waren die einfachsten Dinge, die einfachsten Fremdkörper, auf die man achten musste, vor allem, weil sie in Eimern von KFC oder in Schaumstoffschalen von Burger King oder McDonald’s