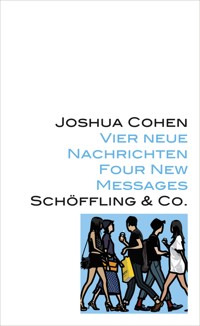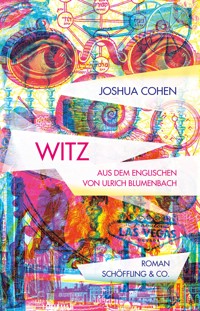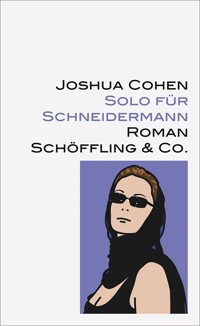16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein gescheiterter Autor verliert am 11. September alles, was ihm am Herzen liegt: Seine Frau verlässt ihn, sein Buch floppt, der Buchladen, in dem er sein Geld verdient, liegt in Trümmern. Da erhält er den lukrativen Auftrag, die Memoiren eines Mannes zu schreiben, der genauso heißt wie er und ansonsten sein genaues Gegenteil ist: Ein Internetmogul, Erfinder des Algorithmus, der die totale überwachung ermöglicht und unser aller Leben verändert.Autobiografie, Familiengeschichte, Ghostwriting für Anfänger, Silicon-Valley-Historie, internationaler Thriller, Sexkomödie - Buch der Zahlen ist ein überschäumendes Buch und in Amerika Kult.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 966
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
1
27.? 28.? August, zwei Tage vor dem Ende des Ramadan
Dubai, Hotel Burj Al-Jumeirah, 7.–8. September
ABU DHABI, PALACE HOTEL KHALEEJ, 9. September
10. September
0
LONDON
PARIS
DUBAI
ABU DHABI
1
Berlin, 1. Oktober
2. Oktober
4. Oktober
8. Oktober
Frankfurt, 14. Oktober
16. Oktober
17. Oktober
18. Oktober
19.–20. Oktober
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Über das Buch
Impressum
1
Eure Leichen aber, eure, werden in dieser Wüste fallen. Eure Söhne werden vierzig Jahre in der Wüste weiden müssen, sie tragen eure Hurerei, bis eure Leichen in der Wüste dahin sind. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land durchspürtet, vierzig Tage: ein Tag für das Jahr, ein Tag für das Jahr, sollt ihr eure Verfehlungen tragen, vierzig Jahre, ihr sollt mein Befechten erkennen!
NUMERI 14, 32–34, übersetzt von Martin Buber und Franz Rosenzweig
Herz und Fgricm, Atm – IFLO, Wildnis HZH. Legg und Bnicm Ihio Raim Wildnis, Arbaim jahrein und Nsao, At-Znoticm – bis-Tm Fgricm, Wildnis. Led Bmsfr Himim Asr-Trtm At-Erde, Arbaim Tag – Tag LSNH Tag LSNH Tsao At-Aonticm, Arbaim Jahr heraus; Und Idatm, At-Tnoati.
NUMERI 14, 32–34, übersetzt von tetrans.tetration.com/#hebräisch/englisch/deutsch
27.? 28.? August, zwei Tage vor dem Ende des Ramadan
Verpisst euch doch einfach, wenn ihr dies am Bildschirm lest! Ich rede nur, wenn man mich mit beiden Händen packt.
Papier aus Zellstoff, Deckel aus Pappe und Leinen, Faden aus Fadenzeugs oder – woraus wird der Einband gemacht? – aus Haaren und Gemüsefasern, mit Leim aus eingekochten Pferdehufen?
Das Taschenbuch war schon Kompromiss genug. Und das ist jetzt aus mir geworden: Rücken aus Papier, Extremitäten aus Papier, das Hirn aus zerknülltem Billigpapier, letzte Zuflucht der Verleger vor ihrer Kapitulation vor dem Touchscreen, dieser üble dünne, vierfach entfärbte Scheiß, 100-prozentig säurefreier Recyclingmüll.
Einige wenige Bücher habe ich dabei, Bis zur letzten Stunde: Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben, Benjamin Franklin: Der große Amerikaner, was gerade so bei Foyles an der Charing Cross Road und in der langues-anglais-Abteilung von FNAC an der Rue de Rennes auf dem Grabbeltisch lag – Bücher, die mir als Vorlage dienen, als Muster für alles, was es zu vermeiden gilt.
Ich schreibe natürlich Memoiren – halb biografisch, halb autobiografisch offenbar –, ich schreibe die Memoiren eines Mannes, der nicht ich bin.
Es beginnt in einem Badeort, in einer Suite.
Hierhin habe ich mich verkrochen, die Verdunklungsvorhänge zugezogen, mich lautem Medienlärm ausgesetzt, damit ich mich nicht mit dem Land vor der Tür auseinandersetzen muss, wieder mal.
Wenn ich die Schlafmaske und die Ohrenstöpsel aus dem Flugzeug behalten hätte, würde ich all dies nicht einmal beschreiben müssen, es gibt nichts Schlimmeres als beschreiben: Hotelzimmerprosa. Nein, Figuren bauen ist noch schlimmer. Nein, Dialog ist am allerschlimmsten. Hier soll die Mitteilung genügen, dass in diesem Zimmer jedes Kissen so groß ist wie das Bett, das ich früher in New York mitgenutzt habe. Und ein Hotel ist das hier auch nicht wirklich. Es ist eher ein Friedhof für Menschen, die tot und auf Urlaub zugleich sind und sich noch täglich auf der Arbeit melden.
Was meine Wenigkeit angeht, ich habe mir den Laptop auf ein Kissen auf meinem Schoß gestellt, damit die drahtlosen Hotspot-Wellenpartikel mir nicht ans Genital gehen und mir die Spermien braten, und – mithilfe der Technologie meines Arbeitgebers – nach mir selbst gesucht und nach Ava.
Meiner Frau, meiner Ex, meiner zukünftigen Exfrau.
\
Immer auf den nächsten Scheck warten, sich einloggen, ausloggen – ein Leben mit Fernzugriff, als Kapitalhopper, Grenzübertreter, Zeitzonenhüpfer, dabei immer mit dieser äquatorlangen Kette blinkender piepsender Nachrichten am Hals, damit nicht abbreche, was der Große Vorsitzende »das Gespräch« nennt – das macht einsam.
Uns beide.
In den Zweigstellen auf der ganzen Welt den Grüßaugust machen oder einfach nur in überteuerten Museen mit Gästezimmern absteigen, Claridge’s, Hôtel de Crillon. Besprechung mit UK-Mitarbeitern, Thema: »UK only«-Option von der Homepage nehmen? Besprechung mit frz. Mitarbeitern, Thema: der .fr-Launch von Autotet. Den CEOs von Yalp und Ilinx als Angel-Investor erscheinen. Sich ein Parkour-Exergame und eine Wett-App für Fantasy-Rugby pitchen lassen, aber den Catch nicht machen.
Das war sein Micromanagement, Microminimanagement. Nichtdelegierung, Degradierung (freiwillig), Aufgabenansichreißen (Insourcing), Dirtytasking. Alles auf einmal. Nach dem Wörterbuch des jetztgültigen Techsperanto.
Das war der Große Vorsitzende im Bosonen-Schleudergang, bloß um es, um alles zusammenzuhalten.
Zumindest bis wir mit Europa durch waren, konnten wir ensuite bleiben, konnte er sitzen bleiben und sich von mir interviewen lassen. Bei mir vorsprechen, zwischen zwei Nickerchen.
»Du nennst das Wesen, das du dir erschreibst, ›den Großen Vorsitzenden‹, und das meine ist im Wesentlichen das Internet, das Netz« – so hat er sich positioniert, so ist er auf den Punkt gekommen: der Mann, der das Teil miterschaffen hat, eher noch: der Mann, der uns alle miterschaffen und dabei das Papier, dem ich mein Leben geweiht habe, geschreddert hat wie nichts. Dabei darf man keine Sekunde lang davon ausgehen, dass er es – wie? paradox, grotesk? findet, jetzt auf einmal, da wir gemeinsam die Schwelle zur 40 überschreiten (er hat seinen Geburtstag gerade hinter sich, mir steht der meine unmittelbar bevor), den Drang zu verspüren, sein Leben in Worte zu fassen und diese Worte zu Papier bringen zu lassen.
Für das Paradoxe, das Groteske hat er keine Zeit. Zeit hat er nur für sich selbst.
\
Update von Ava: wann ist endlich WE?
margaritas tonite #maryslaw
wenn ich scheidung tippe kommt immer scheide (muss immer noch die unterlagen zustellen lassen)
hab gelesen dass ich genauso viel wiege wie sie – jubeljubel, dann der spoiler: sie ist 5 cm größer als ich – aaarrrgghh!!
»Sie«, die da fünf Zentimeter größer war, ist ein Model, und obwohl Ava Werberin ist, hätte ich nie geglaubt, dass sie so exhibitionistisch ist, dass diese Art Selbstvermarktung ihr Ding ist.
Aber sie bleibt dabei natürlich anonym.
Bei meinem letzten Mal in New York hatte ich nach »Rachava Cohen-Binder« gesucht und nichts gefunden als pure Professionalität – ihr Profil auf der Seite ihrer Agentur –, die Suche nach »Ava Binder« hatte mir eine Flut von Kommentaren beschert, die sie zu einem meiner Artikel gepostet hatte (»Netzkritischer Journalismus im Netz sehr beliebt«, New York Times). Erst in Palo Alto hatte ich »Rachav Binder« und »Ava Binder« eingegeben, und da war mir das ewige Licht ihrer Verteidigung eines meiner Artikel erschienen, in dem ich mich kritisch zu der Datenbank von Holocaustopfern geäußert hatte, die die Mormonen anlegten, um deren posthume Bekehrung beschleunigen zu können (»Im Netz gefangen«, The Atlantic), und in London oder Paris habe ich, wo weiß ich nicht mehr, wegen Vollsuff, schließlich hackedicht nach »Teva Café Detroit MI« gesucht, worauf mir vorgeschlagen wurde, lieber nach »Tevazu Café Detroit MI« zu suchen – Cyberschelte dafür, dass ich mich beim Ort meines Heiratsantrags, mit Ring und auf Knien, vertippt hatte.
Auf einer Website jedoch – einer einzigen – fand sich der gleiche Schreibfehler, und als ich mich durchklickte, fand ich noch schlimmere:
Fragen Sie Avale war ein Blog, gehostet auf einer Plattform, die mein Arbeitgeber entwickelt hat, der viel berühmter für die Entwicklung der Suchmaschine ist – eben jener, die alle nutzen, um alles zu finden, Anfangszeiten von Kinofilmen, wie repariere ich meinen Fernseher in zehn einfachen Schritten? ist das Herpes? was wiegt Gisele Bündchen?
Obwohl es ihrer Berichterstattung an Fakten mangelt – wie auch an Majuskeln und Zeichensetzung –, muss ich doch immerzu weiterlesen, muss immerzu daran denken, dass all dies in meiner, in unserer Wohnung geschrieben wurde. In den vier Wänden mit dem Neuanstrich in »univeige«, dem kosmischen Latte-Macchiato-Ton – von den Böden waren meine Spuren ebenso wegpoliert worden.
Ich war noch nicht bereit, mich wieder auf die alte junge kokette Ava einzulassen. Nicht auf diesen Blog, den sie im Sommer eingerichtet hatte, gleich nach unserer Trennung, und erst recht nicht, solange ich mich getrennt im Ausland herumtrieb, in London, Paris, Dubai, Stand: heute früh – wenn wir heute Sonntag haben, ist es bestimmt Dubai –, und der Große Vorsitzende handelt den Preis von Wüstenparzellen für ein Rechenzentrum aus.
So sieht es jedenfalls aus.
\
Da gibt es doch diesen alten Witz, sagen wir mal, er spielt auf einem Flughafen, an der Sicherheitskontrolle, ein Kontrolleur möchte in eine Tasche sehen, öffnet sie, holt ein verdächtiges Buch heraus.
»Was haben wir denn da?«, fragt er.
Und der Passagier antwortet: »Ungefähr 750 Seiten!!!!«
Vertragsabschluss vor zwei Wochen, Abgabetermin in vier Monaten. Erscheint als Hardcover in sechs Sprachen gleichzeitig, angekündigte Erstauflage 100000 Stück in den USA, nirgendwo mein Name, wenn man so will.
Bisher habe ich nichts als den Titel, der identisch ist mit dem Namen des Autors, der wiederum identisch ist mit dem Namen seines Gespensts, seines Ghosts, des Ghostwriters, geistreich oder nicht.
Dem meinen.
Obwohl mein Vertrag mit dem Großen Vorsitzenden mir Verschwiegenheit auferlegt – und darüber hinaus noch Verschwiegenheit, was diese Verschwiegenheit angeht, und eine weitere Klausel mir verbietet, online zu gehen, für den Rest meines Lebens vermutlich –, kann ich nicht anders (vielleicht haben Ava und ich noch immer das eine oder andere gemeinsam):
Ich, Joshua Cohen, schreibe die Memoiren des Joshua Cohen, mit dem ich ständig verwechselt werde – des falschen JC, der Fehlermeldung J. Des Mannes, dessen Business mir das Geschäft versaut hat, dessen Spaß mir den meinen verdorben hat, dessen Name den meinen dem Vergessen anheimgegeben hat.
Begriffsklärung:
Meinen Sie etwa Joshua Cohen? Das Genie, den Googilionär, Gründer und CEO von Tetration.com, nach heutigem Stand – mit Datum vom 27.8., Uhrzeit 22:12 Mitteleuropäischer Sommerzeit – Treffer #1 bis #324 für den Suchbegriff »Joshua Cohen« auf Tetration.com?
Oder Joshua Cohen? Den gescheiterten Romancier, Dichter, Drehbuchautor, Ehemann und Sohn, Profijournalisten, Redenschreiber und Ghostwriter, nach heutigem Stand – mit Datum vom 28.8., Uhrzeit 00:14 Gulf Standard Time – Treffer #325, »mein« bester auf Tetration.com?
#325 betrifft mein erstes Buch – und um es zu vergessen, schreibe ich dieses, mein letztes. Alle außer mir haben es schon längst beerdigt. Aber diesmal will ich mehr Geld verdienen, und sei es auf Kosten meiner Identität. Früher hat mich Ava, meine Stütze, mit beidem versorgt.
Aber erst nach meiner heutigen Sitzung mit dem Großen Vorsitzenden – zwei Joshs, die fröhlich durch die Emirate joshen – habe ich beschlossen, dieses hier zu schreiben.
Auf dem Rückweg aus des Großen Vorsitzenden orchideenpraller Suite in mein eigenes kristalllüsterlastiges Gemach, diese Orgie in Crèmeweiß, wurde mir klar, sprudelnd von den Gesprächen und munter vom Koffein, dass als einziges Zeugnis meines Lebens dieses Lebenszeugnis eines anderen bleiben würde. Dass es als falscher JC an mir war, ihnen Einhalt zu gebieten – Ava zu sagen, dass sie nicht länger nach ihrem Gatten suchen soll (hier bin ich doch!), meiner Mutter zu sagen, dass sie nicht länger nach ihrem Sohn suchen soll (hier bin ich doch!), euch beiden mein Bedauern auszusprechen und deiner zu gedenken, Papa – hoffentlich finden wir alle zusammen, auf diesem, nicht auf einem anderen Blatt.
://
Diesen September ist es zehn Jahre her, dass zehn arabische Muslime zwei Flugzeuge entführten und sie in die Twin Towers meines Lebens & Buches flogen. Mein Buch wurde zerstört – mein Leben hat sich nie wieder davon erholt.
Und so kam das Ende vor dem Anfang: Zwei Düsenflieger, befeuert von völlig Fremden, von Terroristen – zwei davon aus den Emiraten – bombardierten meine Karriere, bombardierten mich persönlich. Und nun will ich alle Verschwörungstheorien widerlegen: George W. Bush hat die Türme nicht durch kontrollierte Sprengungen zerstören lassen, die Luftfahrtbehörde hat ihre Satelliten nicht abgeschaltet, damit die Flugzeuge ungehindert in den New Yorker Luftraum eindringen konnten, die israelische Regierung hat keine Erkenntnisse über die bevorstehenden Ereignisse verschwiegen (um einen Vorwand für den nächsten Golfkrieg zu haben), und was die Theorie angeht, bei dem Angriff seien keine Juden ums Leben oder zu Schaden gekommen – was bin dann ich? was sollte das Ganze?
Jener Tag war meine letzte Seite, mein letztes Wort, Auslassungszeichen … Auslassungszeichen … Punkt – ich schließe den Buchdeckel über alles Geschriebene aus meiner Hand, alles Umgeschriebene, alle Investitionen mit all dem Geld, das mein Vater mir vererbt und meine Mutter mir geliehen hatte für Reisen, Computerausrüstung/-reparaturen, Übersetzungshilfe und Recherchematerial (Mama hat mir nie erlaubt, die Darlehen zurückzuzahlen).
Monatelang hatte ich mich abgeplagt, jahrelang hatte ich mich gequält, in Wörterbüchern nach neuen Verben gesucht, war auf und ab getigert. Konnte weder schlafen noch wachen, malte mir Szenarien für den besten, den schlimmsten oder den Normalfall aus. Die Arbeit an dem Buch war wie eine Schwangerschaft gewesen oder wie der Aufmarsch für den Einmarsch in Polen. Um schreiben zu können, hatte ich einen Teilzeitjob in einem Buchladen angenommen, hatte ich mir von meinem Teilzeitjob im Buchladen freigenommen, hatte ich sparsam in Ridgewood gelebt und meine Freunde geschnitten, hatte ich mich von meinen Freunden schneiden lassen, hatte ich mir die Mittagszeit im Battery Park vertrieben und allein auf einem Findling gesessen, vor mir eine wunderschöne blasse schwarzhaarige junge Mutter, die mit einem Fetischstiefel einen Buggy in Bewegung hielt und dabei ein Buch las, von dem ich mir einbildete, es wäre meines, und ich hatte gehofft, ihr Baby würde ewig schlafen oder wenigstens, bis ich fertig war mit dem Teil, den die Mutter las – ich war schon ewig dabei, damit fertig zu werden – ich war gerade fertig geworden, war gerade fertig geworden und hatte es abgegeben.
Ich gab es meinem Agenten, Aaron, der es las und toll fand und meinem Lektor gab, Finnity, der es las und zwar nicht toll fand, es aber wenigstens annahm und einen buchseitengroßen Scheck ausstellte – auf Ron, der seine Prozente abzog, bevor er den Rest an mich weiterreichte –, bevor er, Finnity, den Erscheinungstermin auf »die Feiertage« (Weihnachten) festlegte, was im Verlagswesen heißt: auf die Zeit vor den »Feiertagen« (Weihnachten), auf dass es im Herbst ganz vorne liege in all den unabhängigen Buchläden, die da gerade von Ketten geschluckt wurden, die bald von unser aller Lieblings-Onlinehändler geschluckt werden würden. Das Buch, mein Buch, sollte in einem Strumpf landen, der so nah am Kaminfeuer hing, dass es verbrennen würde, bevor jemand Gelegenheit hätte, es zu lesen, und so kam es im Großen und Ganzen ja auch.
Dann lektorierte Finnity – es war noch nicht das Buch, erst ein Manuskript –, nahm es in seinen Würgegriff und gab es mir zurück. Seine Änderungen galt es nun anzufechten, zu diskutieren. Ich war entsetzt, widersetzte mich, entlektorierte den Text auf eine Weise, die endlich meine Absichten widerspiegelte, dann, als alles wieder entvervollkommnet und ganz neu fertig war, meine Prosa und meine geistige Gesundheit gerettet, reichte ich das Ms. an Finnity zurück, der es an die Herstellung schickte (an Rod?), der es in Druckfahnen verwandelte und selbige Finnity schickte, der sie ausdruckte und mir schickte, worauf ich sie entfehlerte, hier ein Wort subtrahierte, dort ein Kapitel hinzufügte, bevor ich sie wieder Finnity schickte, der sie einem Korrektor schickte (Henry?), der Korrektur las (Henri?), sie dann der Herstellung schickte (Rod?), der die Änderungen übertrug und die Fahnen dann drucken, binden und mit dem Umschlag versehen ließ, mit Foto (zum Kornspeicher umgewandelte Synagoge bei Chełm, 1939, anonym, © United States Holocaust Museum), Text für Klappe und Umschlagrückseite, von mir selbst verfasst, von der Bio ganz zu schweigen, auch von mir selbst verfasst, und dem Autorenfoto für die hintere Klappe (© I. Raúl Lindsay), für das ich unter einem düsteren Bogen der Manhattan Bridge posiert hatte, die Hände schwermütig in den Taschen vergraben. All das wurde vier Monate vor dem Erscheinungstermin an die Kritiker verschickt (von Kimi!, meiner PR-Frau!), inklusive der bei Elie Wiesel und Dr. Ruth Westheimer bestellten Jubeltexte, wobei vier Monate allgemein als ausreichend galten, damit die Kritiker es lesen oder nicht lesen und ihr Gallenbitter in Prosa fassen konnten, sodass die Fahnen also ungebunden im Frühjahr in die Post gingen und meine mir etwa Mitte Mai geliefert wurden – ich stolperte über das Paket, das ein Kurier in einem Anfall von Faulheit oder Weltvertrauen in meinem Hauseingang deponiert hatte –, nachdem ich darauf bestanden hatte, noch einmal mit spitzen Fingern durch den Text zu gehen, weil ich noch mehr Gedankenstriche entfernen wollte – auch wenn ich erst Mitte August ein fertiges Exemplar in Händen hielt – als Ron zwei Krankenschwestern nach Ridgewood entsandte, die ihre Uniformen abstreiften, um aneinander Wiederbelebungsversuche vorzunehmen und mir einen Lapdance samt Herzmassage und dann mein buchgedeckeltes Werk zu verabreichen.
Immer im September liegt in der Stadt eine nervöse Frische in der Luft, das Prickeln der neuen Saison: Neue Filme kommen in die Kinos, und nach dem Donnergetöse des Sommers landen überraschenderweise doch ernsthafte schwarze und weiße Schauspieler miteinander im Bett (Rahmenhandlung: untergehendes Apartheidregime), während aufregende neue Dirigenten mit wilden Mähnen und großen goldüberkronten Zähnen ein neues Repertoire zur Premiere bringen und die Debüts aufregender neuer Solisten obskurer Nationalitäten präsentieren (ein aschkenasisch-bangladeschischer Pianist begleitet eine indonesische Violinistin mit feuerroten Haaren in Fiddler on the Hurūf), neue Galerien zeigen in neuen Ausstellungen klobige Mixed-Media-Installationen (Climate Change Up: Stanzabfall von Wahlzetteln bringt eine Wolke zum Abregnen), neue Choreografien bringen neue Themen zum Tanzen (La danse des tranches, ou pas de derivatives), in neuen Stücken am Broadway und Off-Broadway spielen Fernsehschauspielerinnen, die sich Bühnenlorbeeren verdienen und ihrer Karriere neuen Schwung geben wollen, Figuren, die an AIDS sterben oder an Legasthenie.
Im September erscheinen auch die neuen Bücher, werden in neuen Lounges und neuen Event-Locations Buchpremieren gefeiert. Und so versammelte mein Verleger meine Freunde, meine Freundfeinde, sämtlich Autoren, in jener Art von demnächst hippem Viertel, das hochzujubeln sie von Zeitungen und Zeitschriften stets unterbezahlt wurden.
Sie müssen wissen, bei meinen ersten Besuchen in New York war das Village nur in East und West geteilt. Soho ging unter, also eins rauf mit Noho! Als ich dann in die Stadt zog, machten die Immobilienhaie die Redakteure zu Helfershelfern bei der Neudefinition der Außenbezirke, Brooklyn wurde umgekrempelt, Queens auf den Kopf gestellt, und die Redakteure sahen keinen Cent dafür, stattdessen lief die Entmietung von Minderheiten an, die eigentlich in der Mehrheit waren. Zur Zeit meiner Party sollte am Broadway gerade Silicon Alley entstehen, von verglastem Stahl über dem Flatiron Building aus – jeder neue Wolkenkratzer warf seine Schatten zunächst sprachlich voraus (sarkastischer Einwurf von mir).
Nennen wir es also, wie ich es nannte, TriPackPark: Das Dreieck aus vier Blocks nördlich des Meatpacking Districts, südlich der für Parkplätze reservierten Parzellen. Oder Teneldea: diese fiese graue Gegend, die dort anfängt, wo der Verkehr auf der Tenth Avenue nicht mehr nach Süden, sondern nach Norden rollt, und an der EL, der Eisenbahnhochbrücke aufhört, die gleich hinter der New Yorker Dienststelle der Drogenpolizei, der DEA, die Avenue überspannt.
Eine Landungsbrücke, genau dort, wo einst die Lusitania ablegte und die Titanic nie eintraf, wo Dampfer und Schoner vor Anker gegangen waren, um die alten Reichtümer der Alten Welt anzulanden, güldene, silberne und kupferne Sklaven zum Beispiel, als Waren noch zum Anfassen waren, als noch günstige Handelswinde zu Wohlstand führten und nicht ein paar Mausklicks wie heute – wo die neuesten Lagerhäuser mit »Kulturkapital« gefüllt sind –, wo money, das auf Französisch noch Silber heißt (argent), auf Deutsch noch Gold (Geld), eine gentrifizierte Abstraktion geworden ist.
Ein Wrack an den Hudsonufern, bewusst unrenoviert, das Image aufpoliert – das Interieur ruinenhaft, eine verrostete, halb ausgeweidete Masse, hangargroß, fabrikmäßig. Vormals Trockendock, einst Seilerei. Als Neubau ein Wunderwerk – die Art von modernem Design, das Architekten und Ingenieure sich so gerne abquälen, Zerfall als Mittel zum Zweck des natürlichen Laufs der Dinge: Fundament instabil, Dach unlösbar, Probleme mit Strom- und Rohrleitungen.
Ein gedeckter Tisch, darauf halb teurer Wein, ausgeschenkt wurde nicht in Plastikbecher, sondern Glasgläser, so heftig investierte mein Verleger in mich, bot Roten und Weißen an, dazu, errötend, Tabletts mit stinkenden Chèvres und Goudas, mit Münster, Gruyère, einem Dutzend Kräckersorten, Veggiesticks samt Dips, sexy Cluster aus Muskattrauben, Sultaninen, kernlosen roten Trauben,Mezzemit Pitabrot.
Ein Trio spielte Klezmer, bzw. probte Klezmer, einen kreischenden Avantklez, der zwischen Probe und Aufführung keinen Unterschied kannte: Trompete, Bass, Schlagzeug, die Solos immer in dieser Reihenfolge.
Exemplare des Buches lagen aufgeschichtet zu Pyramiden? oder Zikkurats? aber die sind ja gojisch, Pyramiden sind für die Juden gedacht.
Die Presse trudelte ein, all meine zukünftigen Standesgenossen und Kollegen. Die Zeitungsleute, die Tageszeitungen, eine halbe Stunde Verspätung galt als schick. Für die Zeitschriften, die Wochen-, die Monatsblätter: eine Stunde. Aarons Scherz: Je länger der Vorlauf, desto später tauchen sie auf. Ein Becken machte tssskkk. Der Bass hängte sich an eine Note und blieb dran, es war weniger eine Note als ein leises Brummen, als wäre dies der Ehrengast, von dem jeder Notiz nehmen zu müssen glaubte, den aber niemand am Hals haben wollte, der nur Vorwand war für den umtriebigen Wirbel – dabei war dieser steinerne Gast ich selbst.
Verschämt nahm ich Komplimente entgegen, in meinem neuen Anzug, zu dem es neue Schuhe gebraucht hatte, zu denen es Socken gebraucht hatte, Gürtel, Hemd, Krawatte – nur die Unterwäsche war schon mein Eigen gewesen.
Dem Trompeter wurde das Mikro abgenommen, ein Klopfen. Dank für den Wein an das Waijngutt Pequot, für das Bier an Masholu, bitte Applaus für die großzügige Unterstützung – das war Kimi!.
Ihre Vorstellung von Finnity ging im allgemeinen Klatschen unter.
Mein Buch wurde »Migrantenstory« genannt, »eine typisch amerikanische Geschichte« – Erbe des verlorenen Landes, Vermächtnis des genetisch vererbten Leides, Volk des Buches, nach Jahrtausenden der Schriftkunde, Auslegung, Kommentierung, das Buch für das Volk des Buches, ganz hinten im Bücherregal des Jahrhunderts.
Finnity, voll gebrieft, Tonfall von Harvard, Abschluss von Yale, tweedig, Lederflicken nicht nur an den Ellenbogen, sondern auch an den Schultern – er hätte sogar an den Knien Flicken getragen, auf seinen Khakihosen. Er betonte Tzedaqa falsch, »Zett Dakar«, benutzte Teschuwa falsch, »für Israel eine Sorge im Gewand eines Tschubars«, brachte die Intifadas zur Sprache und dass Fanatismus immer selbstmörderisch sei, demokratische Vielfalt eben, sprach von Zionismen, im Plural, schloss, indem er zweimal schloss: »Dies ist das Vermächtnis zweier Generationen«, allgemeines Nicken, »eine Hommage an unser Amerika, geeint unter oder über Gott, mit oder ohne Gott«, wieder allgemeines Nicken und Klatschen.
Es sei ihm eine Ehre, mich zu verlegen, wahrlich.
Wie ein Greenhorn mit Seemannskiste schleppte ich mich zum Podium, Finnity ging zum Drücken oder Küssen auf mich los und ich versuchte, ihn mit einem Handschlag abzuwehren.
Ich hielt eine Rede – die Rede bestand aus meinen Dankesbekundungen (im Buch fehlten sie). Vielen hatte ich zu danken. Zunächst meiner Mutter, die aus Polen geflüchtet war; sie hatte mir das Geld für die Reise nach Polen gegeben, damit ich ein Buch über ihr Leben schreiben konnte. (Das Erbe meines Vaters ließ ich außen vor – ich hatte es durchgebracht.)
Ich dankte meiner Tante Idit und meinem Onkel Menashe, die ich in Israel besucht und interviewt hatte; und meiner Cousine Tzila, die mich aus einem Club in Tel Aviv direkt in einen heruntergekommenen chassidischen Minjan in Jerusalem gefahren hatte, damit ich einen ehemaligen Blockaufseher befragen konnte, der längst befragt worden war; ich dankte den entfernteren Verwandten, Schwagern ehrenhalber und Fremden, die in Krakau, Warschau, Wien, Graz, Prag, Bratislava meine Briefe beantwortet hatten; den guten Menschen von Los Angeles, Texas, Florida und Maine (Überlebende); den Lehrkörpern der Universitäten Harvard, Yale und Columbia und den strengen Damen vom polnischen Staatsarchiv, die mir geholfen hatten, Katasterbücher zu durchforsten, Deportationsakten und Zyklon-B-Bestandspapiere, die nicht nur die Erinnerungen meiner Mutter bestätigten – die Farbe eines Hutbands oder Schnürsenkels, den Geschmack der Sahne im Lieblingsgebäck –, sondern ihnen auch Substanz und Zukunft gaben – die Lage des Fleischerstandes von Gruntig (am Friedhof, der späteren Straßenecke Walecznych/Proletariuszy), das Schicksal der Schulfreundin Sara (Kuba, Aneurysma) – und grobkörnige Details beisteuerten: wie viel Gramm Brot meinen Onkeln in welchem Lager an welchem Tag zugeteilt worden war, Menge der Suppenzuteilung pro Häftling pro Woche/Monat in welchem Lager in Litern, verglichen mit dem Durchschnitt der tatsächlich gelieferten Menge. Letzte Umarmung meiner Großeltern auf dem Zgody-Platz, Krakauer Ghetto, 28.10.42, 10 Uhr.
Dank angenommen – und als ich fertig war, stürmten alle auf mich los, um mir zu gratulieren, mir die Hand zu schütteln, und Caleb nickte mir zu, aus einer Mädchentraube, und Aaron nickte auch und winkte mich über lauter Kritiker und Rezensenten hinweg zum Rauchen nach draußen. Jemand gratulierte mir und herzte und küsste mich und jemand sagte: »Ich möchte deine Mutter kennenlernen.« Aber Mama war nicht anwesend, man hatte sie nicht eingeladen. »Das hätte ihr keinen Spaß gemacht – ist nicht ihre Szene.«
Ich lehnte zwischen Messingpfosten, löste mich samtweich in zufriedenes Grinsen auf. Ron setzte einen Joint in Brand, wir rauchten ihn, die Luft bitzelte, mein Anzug war aus Wolle und Cal marschierte mit den Mädchen los.
Wir torkelten die 10th hinunter, zum Feiern oder zu heiligem Angedenken – in memoriam –, verhielten Afterpartys sich doch zu Partys wie das Leben nach dem Tod zum Leben. Bargeld suchten wir, Zigaretten, eine Magnumflasche Wodka, wollten das Spanisch an der Wand entziffern an einem Schrein für ein Kind, das dort erschossen oder erstochen worden war, und machten Klimmzüge am Baugerüst eines neuen Wohnblocks.
Gansevoort Street: Alles roch nach Fleisch und Desinfektionsmittel. An der Tür stand eine große schwarze warzige, in Leder und Ketten gewickelte Lesbe, die Ausweise checkte und einen so fest am Handgelenk packte, wenn sie einem den Handrücken abstempelte, dass jemand sagte: »Das ist ja wie im KZ«, und jemand anders: »Genau, da gab es auch keine Klimaanlage.«
Hinter der Bar hingen Fotos von Uniformierten, geschüttelt und gerührt: Cops, Feuerwehrleute, katholische Schulmädchen. In den Mauerritzen steckten Visitenkarten, als würden die Wände von Fon Fax E-Mail zusammengehalten, als ließe sich damit die ganze Müllhalde dieser Insel zusammenschweißen.
Der Barkeeper schob Cal und mir unseren Saft hin, wir trugen ihn nach hinten zu einer Sitzbank und kippten Wodka rein; Ron bestellte derweil einen Scotch oder Bourbon, und während ihm eingeschenkt wurde, klingelte sein Telefon und er ging ran, legte einen Schein auf eine Serviette und verschwand.
Jemand hatte Schluckauf, jemand rutschte auf Sägemehl aus.
Kimi! pe-errrte von der Polsterbank aus:
»Der Deal ist, der Verleger zahlt Wein und Bier«, und Cal sagte: »Warum hast du das nicht gleich gesagt?«, und Kimi! sagte: »Wie viel braucht ihr?«, und Cal zählte die Mädchen durch und sagte: »Sechs von beidem«, und Kimi! schnaubte und Cal stand auf, um ihr zu helfen, ging dann aber lieber aufs Klo.
Ich musste auch aufs Klo. Aber das ganze College hatte sich ins Ställchen gequetscht, Columbia University, Abschlussjahrgang 1992, mit einem Typen, dem ich immer die Philosophie-Essays geschrieben hatte und der jetzt iBanker geworden war, nennen wir ihn P. Sachs oder Philip S., er saß nicht auf der Brille, sondern oben auf dem Wasserkasten, mit dem Buch auf dem Schoß, das ich ihm signiert hatte – »Für P.S., in herzheuchlerischer Zuneigung«, er rollte einen Hundertdollarschein zusammen, häckselte die Lines zurecht, geschützt vom Schutzumschlag, bot Cal und Kimi! an, sich vom Klappentext was reinzuziehen, und dann mir.
»Seit dem Citigroup-Merger ist das Koks besser geworden.«
Klopf-klopf, entschlossenes Erscheinen einer Türsteherfaust, und schon öffnet sich die Tür zur nächsten Bar und zur übernächsten – aber welche es waren, das bekamen wir nicht mehr zusammen, obwohl die Hälfte von uns Journalisten war: diese Absturzkneipe über die Straße, jener Absturz auf die Straße, auf dem Mittelstreifen alle viere von sich strecken. Schnäpse im Doppelpack, Selbsteinpökelung. Das Papst-Bier mit Billigbourbon runterspülen. Auf die Jukebox hämmern, weil sie unsere Münzen schluckt. »Die Jukebox schluckt mehr als deine Mutter.« – »Schluckt mehr als die Factcheckerin.«
Wer die Factcheckerin war, wechselte von Party zu Party, von Saison zu Saison. Jedes fickbare weibliche Verlagswesen konnte die Factcheckerin sein – solange sie nachweislich zwischen 18 und 26 war und seit ihrer Ankunft in NY exakt null Menschen gevögelt hatte.
Letzte Runde, machte es die Runde, und Kimi! ging uns doppelte Bourbon und sich selbst einen Gin Tonic besorgen, und Cal und ich tranken unsere und dazu noch ihren und teilten uns eine Zigarette. Und ich hatte den Geschmack von Kupfergeld im Mund und mein Zahnfleisch brauchte einen Haarschnitt.
Das Licht ging an, die Jukebox verklang. Ich pfefferte eine weiße Billardkugel an die Dartscheibe – Finnity war mit der Factcheckerin abgezogen und Cal fragte: »Kommt noch jemand mit zu mir?«
Wir hatten noch Wodka in der Tüte und zwei Mädchen in jedem Taxi, zwei Taxis gondelten in die Bowery, zu Cals Wohnung, die seine Eltern ihm gekauft hatten, beide Börsenmakler, halb jüdisch und voll aus Connecticut. Ich saß hinten und er saß hinten und Kimi! saß zwischen uns (vorne saß die Mitbewohnerin der Factcheckerin), und ich fragte, ob jemand Ron Bescheid gesagt habe, da rief Kimi! ihn schon an, aber das muss seine Büronummer gewesen sein, weil er kein Telefon dabei hatte, damals hatten nämlich noch nicht alle immer ein Telefon dabei.
Ron wartete vor Cals Haus, seinen Seidenschal um eine Russin oder Ukrainerin gewickelt oder ein Geschenkpaket dieser Art, bibbernd, in nichts als ein rüschiges Kellnerinnenblüschen, einen Regenschirmrock und ein Namensschild verpackt – ein Präsent, das er sich selber machte. Cal stocherte mit dem Schlüssel herum, Ron stocherte von hinten mit dem Hals der Whiskyflasche an seiner Slawin herum, und wir drängelten uns alle in den Fahrstuhl, der auf jeder Etage hielt, weil Kimi! und Missy eifrig alle Knöpfe gedrückt hatten.
Ich hatte mir auf der Straße eine Fluppe angezündet, die ich im Fahrstuhl weiterrauchte, Menthol.
Missy, die mit der Factcheckerin zusammenwohnte, jammerte Kimi! und mir wegen ihres Jobs als Teilzeitrezeptionistin die Ohren voll, und »warum kann ich bloß keinen Job in einer Agentur finden?« und »könnt ihr mich nicht bittebitte Ron vorstellen?«, während Cal aufräumte und Boxershorts in Schubladen stopfte und Ron und seine Natascha? Mascha?, aufgerissen beim Bedienen im Restaurant des Jersey City Ramada, wo er bestimmt auch den Whisky her hatte, sich ans Manhattans-Mixen machten.
Cal machte Ordnung auf den Regalen und brachte all das neu in Stellung, was er offenbar für die respektable Lektüre hielt, die Lektüre der Bedeutenden und Belesenen, die volle Ladung der Brontës, Prousts und Tolstois, mittig und Buchrücken geradeaus, tauschte das Poster mit den Konföderierten-Fahnen im Wohnzimmer gegen die Leinwand mit dem abstrakten Gestrichel eines andersdenkenden Litauers vom Union Square aus der Küche aus, machte an der Stereoanlage herum, legte ein bisschen Hiphop auf und ein bisschen Rap und ließ die »Vergrößere deinen Wortschatz«-Motivations-Tapes verschwinden, die er beim Trainieren hörte. Ich überließ es Kimi! und Missy, mit ihm das Laufband ins Schlafzimmer zu schleppen, überließ es ihm, es in den Schrank zu stopfen, weil es klingelte, ging zur Tür, drückte auf den Türöffner, und da waren sie: ein Dutzend Menschen, ein Zwölferpack, das im Flur rumbaumelte wie ein Bund Schlüssel, den man von der Feuertreppe der Bekanntschaft zuwirft, der entfernteren Bekanntschaft, den Fremden, die sie mitgebracht haben – Aufmarsch der Assisterati und Rezeptionistas, der Terminplaner und Terminumplaner von früh bis spät, der Kulturarbeiter aus Vertrieb und Marketing, die ich nicht kannte und die mich nicht kannten, aber wir taten so als ob, das war unser Job. Noch mehr Hasch und Koks, das, wie P.S. erneut bekannt gab, seit dem Citigroup-Merger besser geworden war. Tequila in der Spüle, Martinis in der Dusche. Asche in beidem und in den Energydrinks. Mascha oder Nastja fragte, ob wir Games hätten, und als Cal geschnallt hatte, dass sie nicht Monopoly oder Poker meinte, brachte er seinen Nachbarn ins Spiel, der ein First-Person-Fanatiker war – und das war kein literarisches Gambit, es ging um Gaming –, und schon klopften sechs Fäuste bei Tim an und forderten die Herausgabe seines Equipments, und Tim, Mathelehrer an der Stuyvesant, machte verschwitzt und zerzaust auf, total verwirrt, und schleifte sein Equipment zu Cal in die Wohnung, schloss es sogar an Cals Fernseher an, der den größeren Bildschirm und die größeren Lautsprecher hatte, und auf die blutige Nacht folgte ein blutiger Morgen, als P.S. und irgendein Typ mit Mittelscheitel einander in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüberstanden, avatarisiert als Elefanten mit Laserstoßzähnen und wilde Liger mit Raketenwerferkrallen, und Ron verschwand mit seiner Slawin, die vor dem Zapfenstreich ihrer Cousine zurück nach Staten Island musste, und Tims Freundin torkelte grippekrank in eine aufgeblähte Decke gewickelt herein, finsteren Blickes, hustend und niesend, und ging und nahm Tim mit, aber nicht sein Equipment, und irgendein Typ mit Mittelscheitel verschwand mit seiner anständig gebauten Freundin, und Cal rieb sich an Missy und schleifte sie ins Schlafzimmer, während ich an Kimi! herummachte und rülpsen musste, worauf sie ins Bad lief und kotzte, worauf Missy ins Bad lief, um ihr zu helfen, und P.S. spielte weiter mit sich selber, und im Flur wollte Missy was mit Kimi! anfangen, aber Kimi! nichts mit Missy. P.S. riet ihnen, die Factcheckerin anzurufen und zu eruieren, ob sie an Finnity sexuelle Handlungen vornahm und welche, Missy und Kimi! zogen ab, P.S. ging mit, und als ich den bullig sich bauchenden Kühlschrank aufgerissen und dort nichts gefunden hatte als abgelaufenen Senf und Ketchup im saftigen eigenen Saft, überlegte ich, etwas zu Essen zu bestellen, aber der gute Laden hatte dicht und der schlechte Laden lieferte in diese Straße schon nicht mehr, und im Gefrierschrank war nicht nur kein Eis mehr, sondern, weil er offen gestanden hatte, auch keine Kälte, und im Flur lag ein durchgeweichtes Sitzpolster, und mich überkam ein traumloser Schlaf.
Geweckt wurde ich – in den Inhalt einer ausgekippten Dose Vitaminkapseln geworfen – von Kimi!s Telefon, das sie vergessen hatte. Cal ging ran und Kimi! schrie ihn an und er schrie mich an und schickte mich auf die Suche nach der Fernbedienung, ich fand aber nur eine Dose und Vitamine.
Dann war der Akku von Kimi!s Telefon alle und Cal war weg.
Im Mund hatte ich einen Geschmack nach Tabak und Schleim und Lipgloss, Crème de Menthe (das war komisch), Marihuana, Kokshusten.
Der Kopf tat mir weh und ich wusste nicht, ob ich kotzen sollte. Auf dem Bildschirm lief noch immer das Spiel, Player 1, Player 2, New, Resume, und auf dem Weg zum Fenster versuchte ich, den Resume-Knopf für die Zeitanzeige zu finden, aber Rauch qualmte den Bildschirm zu, qualmte den Himmel zu, und in den kommenden Wochen, den kommenden Monaten, bis ins Jahr 2002, als die Taschenbuchausgabe gestrichen wurde, und auch später noch wurde mein Buch nur zweimal besprochen, beide Male gut.
Oder einmal gut, mit Vorbehalten.
\
Miriam Szlay. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, ob sie es auf die Party geschafft hat. Entweder habe ich sie übersehen oder sie wollte mich lieber nicht ansprechen, weil sie so rücksichtsvoll war. Vielleicht hat sie auch geschwänzt – so weit ging ihre Rücksichtnahme, oder: so sehr hasste sie meine Empfänglichkeit für Schmeicheleien, oder: so ungern gab sie Geld für einen Babysitter aus.
Ich habe nie gefragt.
Miriam. Ihr Buchladen war ein wüster Sumpf im Erdgeschoss eines kleinen Hauses in der Whitehall Street – das Hochfinanz-Umfeld, wie es auf die Literatur herabblickt, sie in die Ecke drängt. Früher hatte man dort wohl Broschüren gekauft, Investmentprospekte und Rating-Berichte, ersonnen von einem ungarischen Juden, der den Krieg überlebt und mit jedem verdienten Dollar Judaica gesammelt hatte – kabbalistische Texte, die zwar nicht den Warenfluss vorhersagen konnten, im Schaufenster aber ihren Reiz hatten. Als er dahinging, hinterließ er seinen Besitz mit aller beweglichen Habe und allen Schulden seinen Kindern – Miriam und ihrem älteren und einzigen Bruder, die das Angebot um Literatur und Sachbuch für die breite Masse der Lunchwütigen im Bankenviertel erweiterten, was als Businessplan noch immer finster war und aussichtslos.
Miriam – was ihr Alter anging, blieb sie vage, irgendwo zwischen meinem und dem meiner Mutter – führte das Geschäft und stellte mich ein: frisch von der Columbia, frisch aus Jersey, ein Brücken-und-Tunnel-Kind mit Geisteswissenschaftsabschluss in der Hose und zu kurzen Armen, um an den Sohar zu kommen. Was meinen Stundenlohn anging, war sie unflexibel (8 Dollar oder den Gegenwert in Dichtkunst), bei meinen Arbeitsstunden dagegen flexibel. Sie wusste, dass ich Zeit zum Schreiben brauchte, dass ich nicht mein Leben lang als Verkäufer arbeiten würde (aber immerhin meine gesamten Zwanziger), wusste, dass das alphabetische Einordnen nur der Anfang der Ausbildung eines Schriftstellers war, nicht ihr Ende. Eine andere Lektion: Die Kategorien »Gegenstand« und »Genre« sind Unterscheidungen, die helfen, das richtige Regal für ein Buch zu finden, aber wenn man ein Buch schreibt, das sich eines Regales würdig erweisen will, sind sie verheerend.
Miriam war meine erste Leserin – mein erster Leser war ihr Bruder, der mein Agent wurde. Aaron nahm mich allein auf ihr Wort hin unter Vertrag – ein Befehl, keine Empfehlung – und half mir, meine Projekte zu sortieren. Ein Memoirenband (mir fehlten die Lebensjahre), eine Analyse des Palästinenserkonflikts (mir fehlte die Qualifikation), ein Roman über die Gestade Jerseys (es fehlte an Handlung), eine Sammlung miteinander verbundener Kurzgeschichten (es fehlte an Verbindung), ein Langgedicht, das Inquisition und Kreuzzüge verschmolz (es fehlte die Kundschaft). Dann, eines Tages im Herbst 1996, kehrte Ron ganz zerschlagen aus Budapest zurück und fuhr vom Kennedy-Flughafen in die Whitehall Street, mit einem Scheck für seine Schwester (der Laden sollte nie Gewinn abwerfen). Bei seiner Reise war es um Koitus gegangen, nicht um Klienten, aber beflissen sprach er nur von Geschäft, Mauthausen, Dachau, Geschichte. Der richtige Augenblick, um meine Mutter ins Spiel zu bringen.
Meine Mutter war mein Buch, da war er ganz meiner Meinung, und nachdem ich den Job an den Nagel gehängt hatte und an einer ersten Fassung saß, trafen wir uns einmal im Monat nach Feierabend, dann einmal die Woche, und redeten – wie man Dialog nachzeichnet, die Perspektive eingrenzt – wir trafen uns immer noch an der Kasse, wo ich Miriam grüßte und er ihr einen Scheck gab, danach gingen wir zur Belohnung in ein Café um die Ecke. Nicht in ein Café, in ein Caffè – ersteres konnte französisch sein, letzteres nur italienisch. Aaron lehrte, ich lernte: Wie man einen Windsorknoten knotete und ein Einstecktuch einsteckte, wie Einstecktuch und Krawatte miteinander korrespondieren mussten, aber nie genau zueinanderpassen durften, welcher Koch aus dem Florent jeden zweiten Donnerstag in welchem griechischen Diner aushalf, das seinem Bruder gehörte, wer wirklich am Herd stand – Mexikaner. Nein, Guatemalteken, Salvadorianer. Einen Manhattan hatte man mit Roggenwhiskey zu mixen, nicht mit Bourbon. Portiers sollte man Trinkgeld geben. Ron – caffè corretto schlürfend, den Tisch mit Asche marmorierend, als man noch rauchen durfte – kannte sich mit allem aus: Aktien und Anleihen und Immobilien, Freud und Reich, dem Schicksal der Vokale in der jiddischen Orthografie und den russischen Konjugationen auf E und И. Wann der billigste Tag zum Fliegen war (Dienstag), der billigste Tag zum Tanken (Dienstag), wo man einen Tallit bekam (Orchard St.), wo man Tefillin reparieren lassen konnte (Grand St.), an wen man sich bei der Polizei wenden konnte, bei der Feuerwehr, der Hafenbehörde, beim Katastrophenschutz, wie man ein Begräbnis ohne Leiche abhielt und eine Beerdigung ohne Grabstätte.
Am 11. September 2001 schlurfte Miriam pennermäßig die Church Street hinauf, zu einem Termin beim Allergologen. Sie muss das erste Flugzeug gehört oder das zweite gesehen haben. Wie der South Tower 2, der North Tower 1 ihre liganden Metallverbindungen lösten. Zuletzt trotzten sie dem Himmel als zwei Säulen aus Feuer und Rauch.
Irgendwann – an einem ernüchterten Punkt, den ich nicht genau bestimmen kann, denn alle Sender hatten die Uhren vom Bildschirm verbannt, um Platz für die Berichterstattung zu machen – zeigte ein überschäumender Splitscreen die Bowery, die Straße gleich nebenan, und das Bild war wie eine Dramatisierung des Poems am Fuße der Freiheitsstatue: »Eure gedrängten Massen voll Sehnsucht danach, frei zu atmen«, »Erbärmlicher Abschaum an euren wimmelnden Gestaden«: die alten Obdachlosen Seit an Seite mit den neuen Obdachlosen und anderen in ähnlicher Aufmachung, und alle gingen in Asche, nie weiß, aber auch nicht schwarz, eher grau, fuchsteufelswild, im Zaum gehalten von einer Nachrichtencrew mit Peitschen aus Kamera und Mikrofon. Ich ließ Cals Mundspülung fallen und mich dann selbst auf die Straße hinaustreiben, ließ den Fernseher laufen und dachte dummes Zeug mit Minzgeschmack über dieses Mädchen von gestern Abend, das erzählt hatte, es wohne an der Maiden Lane, als wäre ich immer dort eingeladen, nur an diesem Abend nicht; an ihr Date, an dem sie zu schwer zu tragen hatte, diesem Typen, der sagte, er sei zu besoffen, um es bis nach Inwood zu schaffen; und an mein Buch dachte ich und an Miriam und Ron und wie komisch es wäre, ganz auf Stimme des Volkes und Mann von der Straße zu machen, interviewt zu werden und gleichzeitig draußen und drinnen zu sein.
Aber unten war das Kamerateam verschwunden, oder es war nie dort gewesen – also ging ich auf die Houston und durch den Park und weiter. Nach Chinatown und weiter. Chinatown war die Triage-Grenze. Ein Feuerwehrwagen mit Kennzeichen aus Jersey, von Streifenwagen umkränzt, raste erst und kroch dann auf die Wolke zu. Ein Mann mit zur Fliege passenden Pflastern auf den Lippen betete zu einer Parkuhr. Eine blutende Frau in einem Synthetik-Trikot kniete an einem Hydranten, breitete den Inhalt ihrer Handtasche vor sich aus und versuchte, von einer Magnetkarte abzulesen, wer sie war. Ein Megafon rief in Barrio-Kantonesisch oder -Mandarin zur Ruhe. Der Wind auf den Kreuzungen peitschte wie der Schwanz einer Ratte. Kampf um Wasserflaschen. Kampf um Telefone.
Ein stetiger Strom wankender Überlebender, in Richtung Norden gegen den Verkehr, aber auch mit dem Verkehr, Fremde im Stau, die verzweifelt eine Brücke suchen oder den Fluss, um hineinzuzischen, mit zu Sirenen kahl gesengten Schädeln, die Flecken auf ihren Anzügen sind die Gesichter der Freunde. Ohne Schuhe oder mit noch einem Schuh, manche mit der Aktentasche in der Hand. Die ja immer etwas gewesen war, woran man sich festhalten konnte. Eine Todesgemeinschaft aus mittlerer Führungsebene und Hausmeisterwesen, alle gleichgemacht, blind und taub, die Hirne erschüttert, in Einheitslumpen aus verbrannter Haut mit Schnittwunden von den Glassplittern, von durch die Luft rasenden CDs, Disketten und Briefbögen, an Händen und Füßen trugen sie festgeschmorte Umschläge – sie quälten sich ab, als wollten sie sich selbst öffnen, sich öffnen und einander lesen, bevor sie stürzten und die Fluten eines schwarzen Hudson sich in die Lüfte erhoben und sie in Schlepptau nahmen.
»Wenn du über den Holocaust schreiben kannst«, hat Miriam mir einmal gesagt, »kannst du über alles schreiben« – aber dann schied sie aus dem Leben und überließ die Auslegung ihrer Worte mir.
Im Frühling spross ein Leberfleck auf jenen Weiden zwischen Liberty & Cedar und wurde beigesetzt unter einer angeschrägten Wiesenplatte auf dem Friedhof von Union Field.
Ron regelte alles mit der Versicherung, erhielt das Sorgerecht für Achsa – Miriams Adoptivtochter aus Äthiopien, damals acht. Er zog mit ihr auf die Upper East Side und baute ihr in seinem Büro eine Dschungel-Turnlandschaft. Die Nachbarn beschwerten sich, dann beschwerte sich auch Achsa: Sie sei zu alt für so was. Er schmückte den Raum stattdessen mit Drusen, Lavabrocken, Mineralien und Konkretionen.
Der Buchladen stand noch – seine historischen Fundamente bewahrten ihn vor Schaden durch die Planierraupen. Aber Ron konnte ihn nicht halten. Es waren nicht der Kundenmangel oder die Reha-Kosten, es war Miriam. Der einzige Verlust, mit dem er nicht fertigwurde. Er brachte die Judaica auf den Dachboden, pickte vom Rest das Beste heraus und verkaufte es, spendete den Gefängnissen, was übrig blieb, und verscherbelte den Buchladen selbst an eine Bank. Die ein Geldautomaten-Vestibül ohne Personal daraus machte, hell erleuchtet, geheizt und klimatisiert, auf immer und ewig.
Aber das Obergeschoss behielt er, Miriams Wohnung, zog die Tücher ab, mit denen seit der Schiv’a die Spiegel verhängt gewesen waren, baute sein Korrespondenzschränkchen hier auf, stellte die Ordner mit den Verträgen ein – fand zwischen ihrer Mikrowelle und ihrem Gewürzregal einen Platz für die Briefwaage – seine komplette Agentur. Ihren ganzen Besitz behielt er – Bett, Kommode, knarrende Antiquitäten, Eisenholz, die Kleider, die Gesichtspflegeprodukte. Schluckte ihre Angstlöser und Antidepressiva und besorgte sich eigene Rezepte, als sie alle waren. Appetitzügelnde Opiate – auch sie warf er ein.
Nur Achsas Sachen mussten umziehen, in ihrem alten Zimmer stellte er seinen Rollschreibtisch samt Schwing- und Drehstuhl auf. Computer und Telefon, zum Annehmen und Ablehnen von Angeboten und zum Überwachen der Luftwerte. Verschiedene Frauen arbeiteten als seine Assistentinnen – Erica, Erica W. und Lisabeth – in der Küche saßen Nachwuchsagentinnen an meinen Tantiemenauszügen zur Verrechnung der Rundungsfehler mit meinem Vorschuss. An deren freien Tagen aber lud er seine anderen Mädchen ein, seine Slawinnen – half ihnen bei ihren Sprachprüfungen, schrieb ihnen die Aufnahmeanträge für das LaGuardia Community College, fickte sie, fickte sie aber nur im Treppenhaus, im Flur, wo Miriams Geruch nicht hing – während unten schlaflose Untote kamen und gingen und Bares wollten –, wo einst seltene Kunstkataloge und Quartett-Partituren gestanden hatten, war nun nur noch pausenloses Abheben, Einzahlen, im Neonlicht und im Luftgebläse heiß und kalt.
Caleb dagegen war nach diesem September ein gemachter Mann. Er war besser in Geschichte gewesen, ich war besser in Englisch gewesen, er war gleich nach der Columbia Journalist geworden, schrieb für die Times, und ich war Buchverkäufer geworden, veröffentlichte aber als Erster – ein Buch.
Dann fiel ich zurück.
Was mich fertigmachte, machte Cal groß, die Alarmsirenen waren seine Berufung. Nachdem er Reportagen über Arbeitslosigkeit eingereicht hatte (als Mensch mit einem tollen Job) und über die Schwulenbewegung (als zufriedener Hetero), versetzte er sich selbst in das Ressort Tod und ging in die Dschihad-Berichterstattung. Er verließ die Bowery und kehrte nicht wieder. Er war rund um die Uhr unten vor Ort, grub zusammen mit den Grabenden, sichtete mit den Sichtenden, suchte dabei aber Fakten. In jedem Job muss man rödeln, wird man vom Horror zum Glamour befördert. So empfand ich es damals, auch wenn es für mich kein Ruhmesblatt ist.
Er folgte den Spuren eines Hijackers durch die Emirate, Ägypten, Deutschland nach Venice, Florida, und verdiente sich seine Sporen damit, dort die Unterlagen einer Flugschule zu durchforsten, Verbindungspersonen aufzuspüren, die das FBI übersehen oder die CIA entführt hatte. In einer Madrasa in D.C. bekam er einen Hinweis, dass Gelder für Al Qaida durch eine saudische Wohltätigkeitsorganisation flossen, ging der Spur nach, ergatterte den Ehrenplatz auf der Seite Eins über dem Bruch. Dann berichtete er aus Afghanistan. Er zog in den Krieg. Die Kampferfahrung machte seine Schreibe klarer. Er hatte ein paar Kontakte, keine Schutzweste. Aber als sein Brief aus Kabul den Aufstand der Taliban voraussagte, gab der New Yorker ihm eine Festanstellung. Ich gebe das nicht gerne zu. Ironiefrei lässt es sich nicht leicht sagen: Ich war neidisch auf ihn, auf das Abenteuer. Teil der Truppe sein, sich freiwillig entführen lassen, Sackleinen über dem Kopf, die Hände gefesselt, nur um das Gebrabbel eines Irren mit Ziegenbart auf Band zu haben. Er stieg auf, machte Druck, machte hin und war wichtig, auf dem Karrierepfad über Bergpässe, der Kongress tanzt in Humvees über den Fels.
Verändert kehrte Cal in die Staaten zurück – so wie Soldaten sich immer verändern, nur die Selbstmordgefährdung fehlte ihm. Er war kurz angebunden, brüsk und diszipliniert. Er brachte mir eine Karakulmütze mit und dem Rest seiner Fans ein .doc, ein Ms. Einen Stapel Brennholz zum Thema Verlust des kulturellen Erbes, der Buddhastatuen, die von den Mullahs geschleift worden waren. Über das Glücksritter- und Kriegsgewinnlertum (da kennt Cal sich aus). Über die Kupfer- und Lithium-Kartelle und die Pipelines für Öl und Mohn (den Mohn wollte Ron drin haben).
Cal hatte Angebote anderer Agenten ohne Ende, ging aber auf meinen Rat hin zu Ron. Das Buch verkaufte sich für eine sechsstellige Summe, mit einer sechsstelligen Option für Fernsehen oder Film, noch nichts Festes, aber trotzdem. Ich lektorierte das Ding, bevor es ins Lektorat kam, ging zwei Mal durch den Text, ein Freundschaftsdienst. Aber den Titel schreibe ich nur hin, wenn ich dafür bezahlt werde. Er nahm meinen Titel nämlich nicht. Weil der Verleger ihn schrecklich fand. 22 Monate auf der Bestsellerliste: »blitzend und gellend wie Schlachtgetümmel« (The New York Times, besprochen von einem hohen Ex-General), »mit schneller Feder aus der Tiefe seines Herzens, (…) schmerzerfüllt, mit spielerischer Leichtigkeit und schon jetzt unverzichtbar« (New York, besprochen von Melissa Mucalla – der Missy von meiner Buchparty). Letztes Jahr der Pulitzer-Preis – immerhin nominiert.
Mein berühmter Freund Cal, berühmt nicht im Sinne von »wird in jedem Café oder Caffè wiedererkannt«, sondern mehr im Sinne von »wird in ein, zwei Cafés oder Caffès wiedererkannt und im Lesesaal der Bibliothek an der 42nd Street« – für Schriftstellerverhältnisse anti-unberühmt. Lebt heute in Iowa als Dozent auf Stipendium. Ganz Iowa besteht offenbar aus Ackerbau und Akademikern.
»Und ich sitze am nächsten Buch«, seiner E-Mail zufolge. Diesmal was Belletristisches, ein Roman. Ron hat noch kein Wort davon zu lesen bekommen. Bevor er fertig ist, gibt Cal nichts aus der Hand. »Und ich habe viel an Dich gedacht und an Deine Lage und dass Du Dir Pessimismus in dieser Hinsicht nicht leisten kannst, denn das Leben kann sich im Nu ändern, besonders wenn man so talentiert ist wie Du«, meinte er in einer E-Mail. Als wenn ich das nicht wüsste, du mein Held, mein Schleimer!
\
Caleb war auf dem Kriegspfad und ich steckte fest, Ground Zero, am Nullpunkt. Was für mich nie der schwelende Südzipfel von Manhattan gewesen war, sondern Ridgewood, New Jersey. Metropolitan Avenue. Jenseits des Trendigen, hinein ins Billige, immer im Umbruch, Ridgewood, also Furchenholz, zerfurcht. Riesige aufgelassene Fabriken hinter Stacheldraht. Werke, in denen man dem Selters die Blasen eingeblasen und den Käsescheibletten die Scheibenform gegeben hatte. Mein Gebäude war ein Industrie-Plattenbau, nicht saniert, sondern umgewidmet, unter brutalstmöglicher Verletzung der geltenden Nutzungsvoschriften und Bestandsschutzgebote. Früher eine Druckerei, einziges Relikt aus dieser Zeit war eine Buchdruckmaschine, Handdruck, ein ungeschlachtes Teil, das unbeachtet im Hof verkam, allen Wettern ausgesetzt, zum Abräumen zu schwer. Von Zeit zu Zeit stolperte ich zwischen den Pflastersteinen über eine Letter.
Meine Wohneinheit war ein Lagerraum, drei mal drei Meter, offiziell selbst zum rastlosen Hin-und-Herlaufen völlig ungeeignet, geschweige denn zum Wohnen; ein wütender Heizlüfter spielte den ortsansässigen Antisemiten, ein Fenster gab es nicht, aus den Müllcontainern hinten hatte ich mir einen Ballen Billardtuch ziehen müssen, als Türstopper zum Lüften. Der Schreibtisch war eine aufgebockte Scheibe Drahtglas. Der Holzdrehstuhl: International Office Supply, unbequemste Sitzgelegenheit aus der Weltwirtschaftskrise. Bankerlampe. Die Regale krumm unter der Last der Druckfahnen, aus meiner Zeit als Rezensent, und meiner eigenen Druckfahnen, die mich zum Rezensierten machen würden. Die selbstgetöpferten Becher meiner Mutter, einer für meine koffeinhaltigen Getränke, einer für Zigarettenasche. In der einen Ecke meine Luftmatratze und mein Fahrrad, in der anderen die Pumpe für beides. Zum linken Bein Brooklyn, zum rechten Bein Queens, die Hände dazwischen, städtische Intimzone. Eine Tür gab es, immerhin. Abschließbar war sie, immerhin.
Meine Wohnung, mein Büro – mein Autogramm konnte ich üben, mehr gab es für mich nicht zu tun. Ich saß, lag, pumpte, verstellte meine Sessellehne.
Ich war der einzige NYer, dem man das Traurigsein verwehrte, sobald ans Licht kam, weshalb er traurig war; das Klo teilten wir uns, hinten im Flur, meine Nahrung bezog ich aus dem Deli.
Ich kaufte ein Putenbrustsandwich, Chips, Donuts mit Zuckerguss, Rubbellose, trank den Cossack-Vodka ohne Eis aus der geleerten, ungereinigten Kleingeldschale, im Flur rauchte ich Camel Lights und blies den Rauch durch das Gitter am Luftschacht, rauchte so feste, als wollte ich mir eine Rippe brechen.
Das war meine Einkaufsliste, die im Grunde täglich galt, besonders aber an jenem Tag, als ich den letzten Cent meines Vorschusses ausgab. Im Sommer 2002.
Mein Buch würde keine weiteren Gelder mehr abwerfen – nach der ganzen Arbeit. Nun lag mein Vorschuss hinter mir.
Ich versuchte mich an etwas anderem – an ein paar Storys (chassidische Geschichten in neuem Gewand), Übersetzungen (aus dem Hebräischen). Aber nichts – ich war verbraucht. Blockiert, leer gekrampft von meiner »Mogigrafie«, meinem »Grafospasmus«, übersetzt: von der ganzen Zeit, die ich online zubrachte, in einer Zelle, die überquoll von Papier. Ich wurde ein Cursorpfeil, ein Textcursor, ein Button, klickend und geklickt, und lud mir die Reaktionen auf Cals Werk immer wieder neu hoch.
Dann, als der Jahrestag nahte, meldete sich die Times. Es kam die Mail einer Redakteurin, die fragte, ob ich über mein Glück einen »Artikel« schreiben wolle, eine »Glosse«. Für den Unterhaltungsteil am Sonntag. Wochenlang öffnete und schloss ich ihre Mail, monatelang nach Abschluss dieses Sommers, bis die Miete fällig war, dazu die Nebenkosten, und dann antwortete ich. Ich schickte nicht einfach eine Zusage, ich schrieb das ganze Ding, einen Schocker. Nachdem ich so lange nicht imstande gewesen war, Worte zu finden, war ich geschockt, wie locker ich nun etwas ausspuckte und wie das aussah – alles Textkörper, keine Anhänge.
Geschockt, weil ich es rauschickte und gleich eine Absage bekam. Ich war nicht mehr zeitgemäß. Aber ich konnte noch zwischen den Zeilen lesen. Mein Ton war zu aufgeladen gewesen, meine Rhetorik zu rabiat.
Die Redakteurin jedoch, aus Mitleid oder Barmherzigkeit, reichte mich an den Literaturteil weiter, der mir mehrere Zeilen Schrifttype anbot (Imperial) – wenn ich mich zurückhalten könne, selbstlos sein, erwachsen. Mein erster Rezensionsauftrag war ein Buch über die Ereignisse – nicht wie sie mich betroffen hatten, sondern alle (anderen).
Obgleich ich inzwischen alles von diesem Buch vergessen habe – seinen Titel, seinen Autor, aber nur, weil alles online steht –, erinnere ich mich an die Arbeit selbst sehr wohl: wie sie mich demütigte, wie sie mich beglückte. Beglückende Demütigung. Wie ich die Zeitungsausschnitte sammelte. Meine neunmalklugen Wiedergänger auf vergilbtem Papier. »Thesaurus Rex«. »Moppeldeutigkeiten«.
Ich wurde ein regelrechter Kritiker, mit Zugehörigkeit zum Stamme jener, die mich links liegen gelassen hatten – und gerade weil man mich links liegen gelassen hatte, war ich gerecht, genau, prätentiös. Ich pickte mir immer die Delikatessen heraus. Wolpe in der Carnegie Hall (100. Geburtstag), Whistler im Frick (100. Todestag). The Atlantic, The Nation. Obwohl meine Aufträge sich gewöhnlich auf jüdische Bücher beschränkten, wobei die Definition nicht nur Bücher über Juden, sondern auch von solchen verfasste umfasste. Die Holocaust-Industrie. Wie das Leiden der Juden ausgebeutet wird, Geschichte des amerikanischen Judentums – für die New Republic einen Roman mit dem Titel Das Orakel oder Des Orakels Frau, der ganz im christlichen Neu Amsterdam spielte, aber von einer Frau namens Krauss geschrieben worden war – ich schrieb den Nachruf auf Edward Said für Harper’s.
Ich erklärte, erläuterte und legte aus – Mr. Manifesto, ein Geschmacksarbiteur und Applausometer, der Konsens bildete und Bildung konsensfähig machte: hinsichtlich der neuesten Erkenntnisse über Abstammung und die Entstehung von Intelligenz (Rabbi Moshe Teitelbaum und mischerbige Hochleistung), zu neuen Herausforderungen auf dem Gebiet der Linguistik (Konnektionismus vs. Chomskyismus), AIDS und Beschneidung (»Beschneidet Männer, nicht Hilfsgelder«), zur Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Übersee und, in Verbindung damit, Outsourcing von Folter (»Im Ausland bestellt: Black Boxes, Black Sites«). Alles für den flüchtigen Leser, spezialisiert auf Verallgemeinerung und Vertrautes, sonst nichts. Der Leser wollte es nicht wirklich wissen, nur etwas darüber wissen. Der Kulturkalender als Beglaubigung für den Kulturvollzug: Uhrzeiten, Adressen, Preise.
Aber dann: der Durchbruch.
Eine Webseite ging an den Start – leuchtend blauer Text auf weißem Grund, lächerlich heute, wenn es sie noch gäbe, damals aber nicht – in NY wurde noch jede neue URL mit ihrem www. getippt und diskutiert. Diese war von den Alten Medien großzügig finanziert worden, von den Neuen Medien personell großzügig ausgestattet, und sollte umsonst sein – ihre Publikation war ihre Publicity – www.kammirdamalswichtigvor.com, aber hallo.
Sie emailten eine Frage: Ob ich Joshua Cohen interviewen wolle?
Meine Antwort: Warum nicht? Aber nicht so Frage-Antwort-mäßig – lieber ein Porträt, obwohl sie nur 2000 Worte wollten. Sie hatten endlos viel Platz, Seitenränder jenseits aller Druckbereiche, jenseits allen menschlichen Vorstellungsvermögens, aber trotzdem: Sie wollten nur 2000 Worte (@ $1/Wort, immerhin).
Das war eine Masche – alles ist Masche, und wenn nicht, ist eben das die Masche –, aber ich willigte trotzdem ein, es musste sein, ich musste mir selbst begegnen.
Joshua Cohen – der Große Vorsitzende, wenn auch noch nicht der meine – würde nur eine Stunde lang in NY sein, eine Minute lang, das Zeitfenster war winzig. Mein Auftrag lautete, ihn im Firmensitz von Tetration zu treffen, zu seltsamer Zeit, in den zehn, zwölf Minuten eines Psychoanalytikers zwischen zwei Sitzungen vor oder nach der vollen Stunde. Im Firmenfoyer, dort, wo Chelsea Blick aufs Wasser hatte und der Bebauungsplan auf Firmenfoyers zugeschnitten worden war. Eben war Börsengang gewesen, Aktienstückpreis $80, Marktkapitalisierung über 22 Milliarden.
Meine erster Eindruck: ein Eisenbahnschuppen voller Rangierware, die zufällig auch aus Büromöbeln bestand – Tetration zog gerade ein. Bei meinem Eintreffen wurden gerade die Getränkeautomaten aufgestellt – die Getränke kostenlos, die Automaten leider leer. Den Schuppen hatten sie offenbar gekauft, bevor Cohen ihn besichtigen konnte. Also war es für uns beide eine Premiere.
Der Begrüßungsbeauftragte hatte kein Namensschild aus Messing, sondern einen messingfarbenen Sticker am Pullover mit V-Ausschnitt, darunter trug er schwarze Slackerjeans und einen Taser im Halfter. Er schielte auf meinen Ausweis, winkte einem schlaksig schlaffen, marfanoiden Lakaien, mich hinaufzubringen, wobei wir, statt Fahrstühle oder Rolltreppen zu nehmen, Leitern, Strickleitern und Gerüste erklommen. Ein Hindernislauf über mit regenbogenfarbenen Bändern geschmückte Verstrickungen. Wir wackelten an Androiden vorbei, die an ihren Workstations werkelten, Plüschtiere anordneten, Vexierspiele, Tangrampuzzles, Rubikwürfel, Möbiusbänder, Slinkys.
Der Konferenzraum war kolossal und leer und bestand aus nichts als Teppich mit Tapemarkierungen. Der Lakai ging, kam mit einem Stuhl wieder angerollt und positionierte dessen Rollen auf den Tapemarkierungen; um den Stuhl am Wegrollen zu hindern, verkeilte er die Rollen mit lunchboxgroßen Laptops, dann ging er endlich.
Die Deckenpaneele waren schwarz und weiß, ein Schachbrett, das der Schwerkraft trotzte, mit magnetischen Figuren in der Eröffnung f3 d5, g3 g4, b3 d7, b2 e6. Die Tapete sah aus wie eine Verhelixung der DNS der Tetration-Gründer, eine Abbildung ihrer Vergenung – oder einfach Design.
Portale, Wurmlöcher, boten eine Aussicht auf einen Platz, dessen T-förmige Gummifliesen den Vier-Farben-Satz abbildeten; dort wurden aufgetürmte Frachtcontainer und Poller zum Spielplatz umgewidmet. Die Anlegestelle meiner Buchpremiere war gleich dahinter, aber welche es war, konnte ich nicht sagen, alle Anlegestellen wurden gerade in Stahl eingerüstet oder in selbsttragende Ganzschalen aus elektrochromem Smartglas verwandelt, Locations für Hochzeiten und Bar oder Bat Mitzvot.
Unsere Zeit in Fleisch und Blut: Auftritt der Große Vorsitzende, und der einzige Stuhl war für ihn, denn er saß darauf, während ich noch stand; sonst war bei uns alles ähnlich.
»Wie geht es Ihnen hier so, in NY?«, sagte ich.
»Heftig, Hammer«, gähnend.
»Hammer, nicht knorke?«
»Was immer man gerade sagt, schreiben Sie das.«
»Sie haben wohl keine große Meinung von der Presse?«
»Immer die gleichen Fragen: Powerfarbe? HTML-Weiß, #FFFFFF. Lieblingsessen: Antioxidantien. Lieblingsgetränk? Yuanyang, Kefir, Feni-Lassi, Kombucha. Lieblingsaktivität zum Relaxen? Durch NY laufen und Journalisten vorlügen, ich hätte Zeit zum Relaxen. Denen entkommt man nicht mehr. Den Fragen, Antworten, Journalisten. Aber es ist nicht das Lügen, das wir hassen. Wir hassen alles, dem man nicht entkommt.«
»Wir? Meinen Sie sich selbst oder Tetration als Ganzes?«
»Macht keinen Unterschied. Wir sind die Firma und die Firma ist wir. Ein und dasselbe. Unsere Mission ist unsere Mission.«
»Und die wäre?«
»Das Ende der Suche …«
»… der Anfang des Findens: Ja, ich habe das Memo gelesen. Die Welt verändern. Die Veränderung sein. Die Welt nach seinem eigenen Bilde tetrieren.«
»Wenn die Mogule der älteren Generation so geredet haben, dann nur gegenüber den Medien. Die Mogule der jüngeren Generation reden so mit sich selbst. Wir dagegen kommen aus der Mitte. Wir können nicht täuschen und lassen uns nicht täuschen.«
Vom Scripting her wäre hier eine Pause angesagt gewesen.
»Jetzt kurz im Ernst«, sagte ich. »Wir schreiben das Jahr 2004, vier Jahre, nachdem alles geplatzt ist, und ich möchte wissen, wie Sie darüber denken. Ist die neue Investitionsbereitschaft, die wir hier in New York erleben, wieder eine neue Blase? Warum braucht Silicon Valley überhaupt eine Silicon Alley – ist das Zweiküstendenken, oder wie man das nennt, nicht einfach Old Economy?«
Der Große Vorsitzende blinzelte, Auf- und Zuklappen des Mundes, Atemzug durch die Nase.
»Sie – was uns nach New York gezogen hat, sind Sie, ist der Zugang zu den Medien. Steuererleichterungen und Stromkostenerlass kommen hinzu. Mehrere Zweigstellen für eine Firma, das ist natürlich Old Economy, aber das Büro an sich ist Dead Economy. Es hat allenfalls vielleicht noch eine soziale Funktion, aber jeglicher Gewinn, den es bringt, wenn Angestellte von Angesicht zu Angesicht konkurrieren, wird doppelt zunichtegemacht von den Kosten, die entstehen, wenn sie miteinander vögeln, schwanger werden, einander mit Viren anstecken, sodass man alle auf Urlaub schicken muss und ihre Arbeitsergebnisse in die Tonne treten kann.«
»Wissen die Menschen, die für Sie arbeiten, wie Sie darüber denken? Wenn nicht, wie, glauben Sie, würden sie reagieren?«
»Fragen Sie uns nicht – fragen Sie New York. Aufgaben dieser Zweigstelle werden das Digital Marketing sein, die Personalstrategie/Rekrutierung, Policy/Advocacy, PR und Pressearbeit. Das sind Abteilungen, die minimale Intelligenz erfordern. Minimale Fähigkeiten. Keine Techies, sondern Bodentruppen. Truppenteile. Luser. Loser-User. Werbeleute. Wird alles vor Ort rekrutiert.«
»Ihnen ist schon klar, dass das zur Veröffentlichung bestimmt ist – wollen Sie wirklich so zitiert werden?«
»Wir wollen Köpfe rollen sehen – bei den Verantwortlichen für diese Tapete!«
Da hatte ich einen Scoop, während der Große Vorsitzende sich seine Grube tiefer grub – immer tiefer –, es seinen Usern reinwürgte, seinen Geldgebern, allen, die es sich mit seinem vornehmen Personalpronomen verscherzt hatten: jener ersten Person Plural, die er so gnadenlos mit gestelzten Verben kombinierte (nicht »die ganze Scheiße, die wir uns anhören mussten, weil wir beim Börsengang eine Rückwärtsauktion hingelegt haben, hätten wir denen um die Ohren hauen können, ham’ wir aber nicht«, sondern »hätten wir ihnen durchaus um die Ohren schlagen können, was wir aber unterließen«).
»Fehlte den Investoren das Vertrauen in Tetration oder in den Markt?«
»Vertrauen ist als Aktivposten verpackte Verbindlichkeit und als Verbindlichkeit verpackter Aktivposten. Nur dass wir uns sicher waren, wie das laufen würde, der Börsengang.«
»Ist völlig an mir vorbeigegangen – wie groß war gleich Ihr Anteil?«
»Niemandem ist aufgefallen, dass die 14142135 Anteile Eigenzuteilung eine Anspielung auf √2 waren.«
»Wie bitte?«
»Die Quadratwurzel aus 2 – 1,414213562373 – unterbrechen Sie uns, wenn Sie genug haben.«
»Gerne.«
»095048801688724209698078569671875376 – einfach unterbrechen – wo waren wir?«
»5376?«
»7187537694?«
»Wenn ich das wähle, erreiche ich dann Ihre Tante in der Bronx?«
»Wir haben keine Tante in der Bronx.«
»Und der Name?«