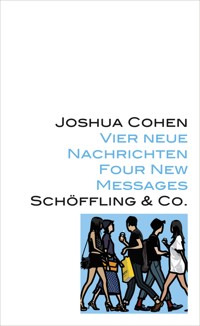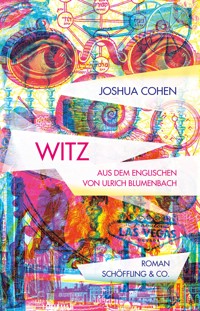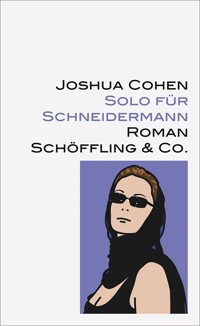12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Winter 1959-1960: Ruben Blum ist Historiker und der einzige Jude am nördlich von New York gelegenen Corbin College. Wie er immer wieder betonen muss, ist er deswegen jedoch noch lange nicht auf die Geschichte des Judentums festgelegt. Am liebsten würde er sich auch vor der heiklen Kommission drücken, bei der es um die Bewerbung eines Kollegen aus Israel geht, doch der Dekan hat ihn zur Teilnahme verdonnert. Da dieser Ben-Zion Netanjahu gleich seine ganze Familie zum Vorstellungsgespräch mitschleppt, wird Blum auch noch unfreiwillig zum Gastgeber. Die Netanjahus mit ihren drei verzogenen Söhnen fallen in sein Haus ein wie eine Plage, und bald gerät Blums mühsam errungene Akzeptanz im amerikanischen Mainstream in Gefahr. Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Campusroman Die Netanjahus nähert sich dem Thema jüdische Identität auf originelle Weise. Joshua Cohen verwandelt eine wahre Begebenheit im Leben der berühmten Politikerfamilie mit überbordender Fantasie und wilder Komik in ein literarisches Feuerwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Abspann & Gastauftritte
Zitatnachweis
Autor:innenporträt
Übersetzer:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Dem Andenken Harold Blooms gewidmet
Löscht die Diaspora aus, oder die Diaspora wird euch auslöschen.
Rede am 9. im Aw 1938, Wladimir Zeev Jabotinsky
1
Mein Name ist Ruben Blum, und ich bin Historiker, jawohl, Historiker. Bald schon, nehme ich an, dürfte ich historisch sein. Damit meine ich, ich werde sterben und selbst Geschichte werden, eine seltene Form der Verwandlung, die traditionell den Gelehrten der exakten Wissenschaften vorbehalten ist. Wenn Juristen sterben, wird aus ihnen kein Recht, wenn Mediziner sterben, werden sie nicht zu Medizin, Professoren der Naturwissenschaft hingegen verwesen zu Biologie und Chemie, sie versteinern zu Geologie, sie zergehen in ihrer Wissenschaft, ganz so wie Mathematiker zu Statistik werden. Gleiches gilt auch für uns Historiker – nach meiner Erfahrung sind wir die einzigen Geisteswissenschaftler, für die das gilt –, die einzigen, die zu dem werden, was wir erforschen; wir altern, wir vergilben, wir werden faltig und spröde wie unsere Quellen, bis unsere Leben in der Vergangenheit versinken und selbst zum Stoff der Zeit werden. Oder vielleicht spricht da nur der Jude aus mir … Gojim glauben, das Wort werde Fleisch, Juden hingegen glauben, das Fleisch werde Wort, das ist ja auch die natürlichere, rationalere Inkarnation …
Um mich weiter vorzustellen, werde ich nun eine Bemerkung des damaligen besser-namenlos-bleibenden Präsidenten der American Historical Association zitieren, den ich noch als Student kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kennenlernte: »Ah«, sagte er mit einem schlaffen Händedruck, »Blum haben Sie gesagt? Ein jüdischer Historiker?«
Die Bemerkung des Mannes sollte mich sicherlich verletzen, doch mir machte sie nichts als Freude, und selbst heute kann ich über die Beschreibung lächeln. Ich erfreue mich an der unbeabsichtigten Ungenauigkeit und daran, dass die Doppeldeutigkeit als eine Art psychologischer Test funktionieren kann: »›Ein jüdischer Historiker‹ – was denken Sie, wenn Sie das hören? Welches Bild steht Ihnen da vor Augen?« Tatsächlich ist die Bezeichnung gleichermaßen zutreffend wie unzutreffend. Ich bin ein jüdischer Historiker, aber ich bin kein Historiker, der sich mit jüdischer Geschichte befasst – oder jedenfalls war das nie mein beruflicher Schwerpunkt.
Vielmehr bin ich nach dieser Lesart ein amerikanischer Historiker – oder ich war es. Nach einem halben Jahrhundert Forschung und Lehre wurde ich vor Kurzem von meinem Lehrstuhl als Andrew William Mellon Memorial Professor für Amerikanische Wirtschaftsgeschichte emeritiert, den ich an der Corbin University in Corbindale, New York, innehatte, im manchmal ländlichen, manchmal wilden Herzen des Chautauqua County, unweit des Ufers des Eriesees zwischen Apfelplantagen und Bienenstöcken und Molkereien – oder, wie es die abschätzigen geografischen Analphabeten aus der Großstadt New York nennen, »Upstate«. (Ich gehörte selbst einst zu diesen Stadtbewohnern, und auch wenn die alte Weisheit, dass Lehrer mehr von ihren Schülern lernen als umgekehrt, nicht zutrifft, so habe ich mir dies doch frühzeitig angeeignet: Bezeichne Corbindale niemals als »Upstate«.) Mein ursprünglicher Forschungsschwerpunkt war zwar die Wirtschaft der prä-amerikanischen, britisch-kolonialen Zeit, doch mein wissenschaftlicher Ruf, so ich denn einen habe, wurde auf dem Gebiet erworben, der heute meist »Steuergeschichte« genannt wird, und vor allem durch meine Forschungen zum Einfluss der Steuergesetzgebung auf politische Entscheidungen und Umwälzungen. Um es deutlich zu sagen: Dieses Forschungsgebiet hat mir keine Freude gemacht, aber es stand mir offen. Oder besser gesagt, das Gebiet existierte gar nicht, bevor ich es entdeckte, und wie ein stümperhafter Kolumbus entdeckte ich es nur, weil es da war. Als ich in die akademische Welt eintrat, war Amerika bereits überfüllt, selbst Amerikanische Wirtschaftsgeschichte war drangvoll, und ich konnte immer ganz gut mit Zahlen umgehen. Die Beschäftigung mit der Geschichte der Steuern wies mir den Weg aus dem Ghetto der kolonialen Katallaktik und schließlich sogar aus Amerika selbst hinaus, hinein in die europäischen Stadtstaaten, feudale Steuerpacht, den Kirchenzehnt, die antike Entwicklung von Zöllen und Abgaben … bis zurück zum Stein von Rosette und sogar zur Bibel, die beide – was die meisten Menschen vergessen – im Wesentlichen bloß Steueraufzeichnungen sind …
Was ist sonst noch bemerkenswert an mir? Ich wünschte, ich wüsste es. Aber wissen wir das je? Früher habe ich manche meiner Seminare mit einem abgewandelten Zitat von Mark Twain eröffnet, der seinerseits Benjamin Franklin paraphrasierte, welcher wiederum wahrscheinlich ungenannte Briten plagiierte: »… nichts auf dieser Welt ist wirklich sicher – außer dem Tod und den Steuern und den Abgabeterminen Ihrer Hausarbeiten …«
Ich möchte meinen, dass mein Beruf mich empfänglicher als die meisten Menschen gemacht hat für den selektiven Gebrauch von Fakten und für die Art und Weise, wie jede Epoche, jede ideologische Strömung sich eine eigene maßgeschneiderte Chronik zusammenschustert, die zu ihren Zielen passt und ihrem Selbstbild schmeichelt – von Washingtons »Ich kann nicht lügen«, nachdem er die Axt an seines Vaters Kirschbaum gelegt hatte, bis zu den sensationslüstern ausgewählten Film- und Fernsehaufnahmen von der Ermordung Kennedys, die den Eindruck vermitteln, dass die Mafia, die CIA, der KGB und Marylin Monroe sich zu einem Planungstreffen in einer abgeschirmten Nische des 21 Club verabredet hatten. Meine eigene Version dieser selbstgewählten Geschichte ist meine akademische Vita, wie sie im Netz steht. Verzeihen Sie einem alten Mann, wenn er zu viel erklärt: Gehen Sie auf Corbin.edu, klicken Sie auf Fachbereiche, klicken Sie das Historische Seminar an und dort bei Personal auf meinen Namen. Dann finden Sie mehr oder weniger eine Wiedergabe meines Lebenslaufs, nur auf die Höhepunkte hin redigiert: die neun Auszeichnungen für Hervorragende Lehre an der Corbin University (1968, 1969, 1989, 1990, 1992, 1995, 1999, 2000, 2001), den Preis für den Historiker des Jahres von der American Historical Association (1993), die Ehrendoktorwürden von der London School of Economics und der Nationaluniversität von Singapur, eine ziemlich aktuelle Liste meiner Publikationen sowie eine Bibliografie. Zu meinen derzeit lieferbaren Büchern gehören Eine Allgemeine Geschichte der Steuern; Besteuerung ohne Vertretung: Eine Geschichte Amerikas in zehn Steuern; Importquoten, Exportsubventionen: Eine Übersicht nichttarifärer Handelshemmnisse; Embargo: Eine Geschichte; Blutgeld: Die Besteuerung der Sklaverei und George Sewall Boutwell: Sklavereigegner, Stimmrechtler und Vater der Bundessteuerbehörde.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin stolz auf diese Leistungen, oder vielmehr bin ich darauf dressiert, solchen Stolz auszudrücken oder gar zu empfinden, hauptsächlich weil jede Sprosse meiner immer länger werdenden Leistungsleiter mich weiter von meiner Herkunft entfernen sollte – von Ruvn Yudl Blum, geb. 1922 in der Central Bronx als Sohn jüdischer Einwanderer aus Kiew, die mich zu einem aufstrebenden Mitglied der Mittelschicht erzogen. Sie sorgten dafür, dass ich eine gute Bildung genoss, indem sie mich auf gute Schulen und Universitäten schickten, um mich dann in schamlosem Jiddisch auszuschimpfen, als ich mich zu einem Intellektuellen entwickelte.
Am Tag nach dem Angriff auf Pearl Harbor wurde ich mit meiner Jugendliebe getraut und in die US-Armee eingezogen, die mich zunächst im Rechnungswesen einsetzte, weil ich einen Buchhaltungskurs (angetreten auf Drängen meiner Familie) zur Hälfte absolviert hatte, wegen meiner schlechten Haltung (leichte Skoliose, Zwölf-Grad-Krümmung) und meiner Tippfähigkeiten (76 Wörter pro Minute). Ich überstand den Krieg, ohne das Land zu verlassen, und verbrachte den größten Teil meiner Dienstzeit damit, elegante kleine Studien fortgeschrittener Prätenziosen zu tippen, angelehnt an Eliot (»Der qualmige Kerzenstummel der Zeit / Zerrinnt. Auf der Rialto einst«) und Pound (»Wucher mordet das Kind im Mutterleib / Und hemmt des jungen Mannes Werben«), die ich an elegante kleine Lyrikzeitschriften schickte, wo sie abgelehnt wurden, Soldschecks zu bearbeiten und Reisekosten von Fort Benning nach Fort Sill und zurück zu erstatten.
Nach dem Krieg schrieb ich mich am City College in New York ein, wo meine anfängliche Neigung zu den Geisteswissenschaften, vor allem zur Literatur, durch verschiedene Zwänge (elterliche, praktische) geradegerückt und in Spalten angeordnet wurde, um sich leichter zu einer beruflichen Laufbahn addieren zu lassen. Der Kompromiss sah so aus: Aus meiner Vorliebe Literatur wurde Geschichte, aus der Vorliebe aller anderen für Buchhaltung wurde Wirtschaftslehre, und Amerika blieb Amerika. Ich blieb bis zum Abschlussexamen an der Columbia, und nach mutlosem Suhlen im Dunkel der Lehraufträge wurde ich der erste Jude, der jemals vom Corbin College (damals war die Corbin University noch ein schlichtes College) angestellt wurde, und damit meine ich nicht der erste jüdische Dozent mit Aussicht auf Professur am Historischen Seminar des Corbin College, sondern den ersten Juden überhaupt an der gesamten Hochschule – Lehrkörper und, soweit ich das beurteilen konnte, Studentenschaft eingeschlossen.
Der hervorragende und heute vergessene Literaturkritiker Van Wyck Brooks hat den Ausdruck einer »brauchbaren Vergangenheit« geprägt, womit er eine Vergangenheit meint, die jeder – und jede – »moderne«, distanzierte, entwurzelte amerikanische Intellektuelle für sich selbst schaffen muss, um Bedeutung in der Gegenwart und eine Richtung für die Zukunft zu finden. An diesen Ausdruck wurde ich jedes Mal erinnert, wenn ich auf dem Van Wyck Expressway von einem städtischen Flughafen zum Wohnort meiner Eltern kroch und abwechselnd frustriert und froh darüber war, dass ich zu spät kam; oder anders ausgedrückt: Ich hasste den Stau, freute mich aber über den Aufschub. Vor mir lagen lediglich Nörgeleien, Bitten um Gefälligkeiten und endloses Nachstellen bösartiger Nachbarschaftskonflikte: Ist das zu fassen, was Mrs. Haber gesagt hat? (nein, die andere Mrs. Haber!), kannst du dir vorstellen, was Gartner zugestoßen ist (nein, der Gartner, dem schon die Frau gestorben ist, der mit dem schwachen Herzen, dem Kind mit Polio und dem Geschwür!); die unterschlagenden, überteuernden Sünden der unverbesserlichen Schlachter, Bäcker, Lebensmittelhändler, das hartnäckige Almosensammeln der Rabbis – die volle Last dessen, was ich als »unbrauchbare Vergangenheit« betrachtete, als jüdische Vergangenheit, aus der ich mich in die heidnisch-akademische Welt geflüchtet hatte, in die Hügel und Täler meiner friedvollen Waldungen südlich des Niagara.
Summa summarum: Den größten Teil meines Lebens – im Grunde bis auf die jüngste Zeit, da eine Reihe von Fuß-, Bein- und Hüftverletzungen mich zwangen, Mobilität gegen Mortalität einzutauschen – zog ich keine Kraft aus meiner Herkunft und nutzte jede Gelegenheit, sie zu ignorieren oder sie wann immer möglich zu leugnen.
Ich kam mit nicht ganz weißer Haut auf die Welt, aber als ich heranwuchs, wurde sie dicker; wenn man während der Weltwirtschaftskrise in einem jüdischen Viertel aufwuchs, das an irische und italienische Wohngebiete grenzte, brauchte man ein dickes Fell. Durch die Straßen, die vom Grand Concourse abgingen, schwirrten gedankenlose Beleidigungen, doch im Gegensatz zu einigen meiner Altersgenossen war ich kein Kämpfer. Ich war vielmehr dazu erzogen, auf Provokationen im Stile Jesu Christi zu reagieren, auch wenn man mir regelmäßig vorwarf, ihn gekreuzigt zu haben. Verspottet und verhöhnt, hielt ich die andere Wange hin, hoffte das Beste, rechnete mit dem Schlimmsten und begriff die ganze Zeit, dass wir im Leben zwar von Kummer und Sorgen geplagt sind, dass aber weder Erleichterung noch Vergeltung und ganz bestimmt keine Würde jemals durch Beschwerden erlangt werden. Als einzige jüdische Familie in unserem kleinen Dorf auf der falschen Seite der Catskills im Nachkriegsmilieu waren die Blums (ich selbst, meine Frau Edith und meine Tochter Judith) ständigen Kränkungen ausgesetzt. Diese Kränkungen waren sicher weniger brutal als in der Stadt, sondern immer eher passiv als aggressiv, und was uns half, sie zu ertragen, war weniger innere Stärke als vielmehr der Gedanke, dass wir immerhin nicht Mrs. Johnson waren (unsere einmal die Woche erscheinende Putzfrau) oder die Dienstleistungskräfte am College, die Mensa-Bedienungen, die Wartungskräfte, die Gärtner – wir waren nicht schwarz, oder wie wir damals sagten »farbig« oder »Negro«. (Edith und ich gehörten zu der Generation, die »farbig« sagte, Judys Altersgenossen sagten eher »Negro«.) Es blieb Edith und mir jedenfalls nie verborgen, dass die dümmlichen Sprüche über Geiz vom Elektriker, der unsere Küchengeräte wartete, in den Annalen des Antisemitismus einzigartig weiche und wirkungslose Waffen waren – so wirkungslos, dass es schon unverschämt und respektlos gegenüber unseren Vorfahren schien, sie als kränkend zu betrachten. Die Griechen hatten schließlich neugeborene Juden mit ihren eigenen Nabelschnüren erdrosselt; die Römer hatten jüdischen Gelehrten mit heißen Eisenbürsten die Haut abgezogen; die Inquisition nutzte Strappado und Streckbank; die Nazis Gas und Feuer. Mit diesen historischen Grausamkeiten verglichen, was konnte ein Witz wie »Wie viele Juden passen in ein Auto?« da schon anrichten? Oder auch ein mit Mundgeruch gemurmeltes »Jid« oder »Itzig«? Was spielte es für eine Rolle, dass der alte Automechaniker mit der rot geäderten Nase, als ich meinen widerspenstigen Pontiac in die Werkstatt brachte, die schmierige Hand aus dem Overall zog, mein Bargeld im Voraus einkassierte und mir den Kopf tätschelte: »Und wann haben Sie zuletzt Ihre Hörner checken lassen?« Was Edith und ich allerdings noch häufiger als die ersten Juden in Corbindale ertragen mussten, war eine ständige, niedrigschwellige Herablassung: so ein Gefühl, dass wir uns glücklich schätzen sollten, überhaupt hier zu sein; dass uns Zutritt gewährt, der Einlass gestattet worden sei. Man ließ sich herab zu uns, zeigte sich geneigt, betrachtete uns forschend. Unsere Gegenwart belästigte manche und weckte bei allen Neugier. Widerstand gab es vor allem in den frühen Tagen, als der Golf & Racquet Club von Corbindale ständig behauptete, unsere Mitgliedsanträge verlegt zu haben (bis sie anfingen, um unsere Mitgliedschaft zu werben, hatten wir längst das Interesse verloren), als ein steter Strom von Professorenkollegen, die mein Forschungsinteresse mit Praxiswissen verwechselten und mich baten, ihre Steuern zu »machen«, und die ständigen Partys in den Weihnachtsferien, bei denen Edith und ich wie sabbernde Simpel behandelt wurden, die Rentier Rudolf nicht von Donner oder Blitzen unterscheiden und unterm Mistelzweig nichts mit ihren Lippen anzufangen wussten. Es stimmt, anlässlich der ersten Weihnachtsfeier des Historischen Seminars von Corbin (im Jahr vor den Ereignissen, von denen ich berichten werde) bat mich der Dekan, der inzwischen verstorbene Dr. George Lloyd Morse, die sonst von ihm bekleidete Rolle des Weihnachtsmannes einzunehmen und dafür ins Kostüm zu schlüpfen und Geschenke zu verteilen: »Das war der Geistesblitz meiner Frau, ein inspirierter Volltreffer«, erklärte er, »denn Sie haben einen richtigen Vollbart, wie ihr Vater einen hatte … zu seinen Zeiten waren die viel verbreiteter, heute werden sie immer seltener, was eigentlich eine Schande ist, denn so ein richtiger Bart ist viel würdiger und wirkungsvoller als ein falscher … ich wusste doch, es war klug, einen Mann mit Bartwuchs einzustellen, und wenn es der Gattin gefällt … ganz zu schweigen von der erfreulichen Nebenwirkung: Wenn Sie den guten alten Heiligen Nikolaus geben, können die Menschen, die das Fest tatsächlich feiern, sich umso unbeschwerter amüsieren.« Ich erinnere mich, wie ich meinen Kissenbezug-Sack durch den Saal schleppte, voll mit kleinen Brieföffnern, im Grunde winzige Dolche mit eingraviertem Schulwappen (Rabe mit Fesseln und einem Ölzweig im Schnabel) und Schulmotto (Petite, et dabitur vobis), die mir die ganze Zeit Wundmale in die Handflächen stachen, während ich sie der Versammlung aushändigte, und wie ich an dem Abend noch im Kostüm nach Hause kam – Mantel und Mütze mussten am Morgen zurück zur Englisch-Fakultät für die dortige Weihnachtsfeier –, meine Schnittwunden reinigte und mir das Talkumpuder aus dem Bart wusch, mit dem ich ihn weiß gefärbt hatte, und mich glatt rasierte … (Bevor ich weitererzähle, sollte ich wohl erwähnen, dass die Universität zu Beginn meiner Lehrlaufbahn an der Corbin gerade erst koedukativ geworden war und dass die Gesamtzahl farbiger Studenten Null betrug. Als ich jedoch emeritiert wurde, gab es an der Universität sowohl einen Verband Afrikanischer Studierender als auch einen Verband Afroamerikanischer Studierender, eine Hispanic Queer Alliance sowie eine Taskforce Safe Spaces für Transsexuelle. Die Anfeuerungsrufe, die früher indigene Gesänge persifliert hatten – der »Irokesen-Schlachtruf« oder der »Allegany-Banzai« – sind »gecancelt« worden; und die Statue des Universitätsgründers – der mit der Demokraten-Seilschaft Tammany Hall verbandelte Bauunternehmer und einstige Caudillo des New York State Canal Board, Mather Corbin –, die früher ohne Kontextskrupel den Rasenquadranten im Zentrum des Campus beherrschte, trägt jetzt eine interaktive Gedenktafel am Sockel, die den Sklavenhandel und den Profit aus der Leibeigenschaft von Einwanderern für »unvereinbar mit den Werten der Universität« und »problematisch« erklärt. Diese Veränderungen sind sicher alle bemerkenswert, doch Tatsache bleibt, dass die Jugend heutzutage sensibler ist als je zuvor. Ich gebe zu, dass ich nicht weiß, wie ich dieses Phänomen einordnen soll; ich habe es »ökonomisch« anzugehen versucht und die Frage gestellt, ob eine Zunahme an Sensibilität eine Abnahme der Diskriminierung herbeigeführt hat oder ob eine Abnahme der Diskriminierung zu einer Zunahme der Sensibilität dafür geführt hat, wann, wo und wie sie sich ereignet. Oder vielleicht sollte ich sagen, wann, wo und wie sie sich in der Wahrnehmung der Studentenschaft ereignet, deren lobenswerte Neigung zur Akzeptanz zu einer Kultur der Kränkung aufgebauscht wurde, vor der mir graut. Etliche meiner ehemaligen Studentinnen und Studenten – vor allem aus den letzten Jahren meiner Lehrtätigkeit – haben sich die psychosozialen Empfindlichkeiten und Ressentiments anderer mit solcher Toleranz angeeignet, dass sie selbst unerträglich geworden sind, studentische Torquemadas, Seminar-Savonarolas, die an praktisch jeder Bemerkung etwas auszusetzen hatten, überall Bigotterie und Vorurteil witterten. Ich will die Campuskriege, diese blutigen Schlachten zur Gleichberechtigung, bei denen zu Beginn – wie bei etlichen wichtigen amerikanischen Bürgerrechts- und Freiheitskämpfen – Juden an vorderster Front standen, gar nicht wieder aufwärmen. Und ganz bestimmt will ich nicht so verstanden werden, dass meiner Ansicht nach jeder einzelne Student, jede Studentin sich zu leicht triggern lässt, wie sie es gern nennen, oder alles zu persönlich nimmt oder Wohlmeinendes absichtlich boshaft interpretiert, oder dass Frauenfeindlichkeit und Rassismus und Homophobie und dergleichen inzwischen völlig vom Campus verschwunden sind. Ich will nur feststellen, dass ein Jude meiner Generation von Glück sagen konnte, wenn er als Weiß durchging, dass die meistgehasste Farbe damals Rot war, dass man beim Personalpronomen keine Wahl hatte und dass sich jede Minderheit gleichermaßen aus Tradition und dringendem Schutzbedürfnis für die Assimilierung entschied, nicht fürs Auffallen.)
Von all den schlappen Schleudersteinen und windelweichen Witzpfeilen, die Edith und ich an der Corbin zu erdulden hatten, entstammte der einzige, der mich wahrhaftig verletzte – unerwartet, unbeabsichtigt –, einer weiteren Bitte, die ebendieser Dekan Dr. Morse an mich richtete, als er mich zu Beginn des Wintersemesters 1959, im ersten Semester meines zweiten Jahres in Festanstellung an der Corbin, in sein Büro bat. Ich war auf dem Weg in mein Seminar Amerikanische Geschichte (auch heute noch eine Pflichtveranstaltung, die damals noch mit den Pilgervätern anhob, jetzt hingegen mit afrikanischer Versklavung und der erhobenen Handfläche zum Gruß an den indigenen Seneca) und schaute bei meinem Fach vorbei. In jener Ära vor E-Mails, und bevor ich weniger neurotisch auf meinen Status und meine Zukunft schaute, hatte ich mir angewöhnt, mehrmals täglich in mein Postfach zu schauen, ständig kehrte ich zu jener Wand aus hölzernen Höhlen zurück, vor und nach jedem Seminar, jeder Vorlesung, jedem Toiletten- oder Botengang, ganz egal, wohin er mich führte. Wenn nun jemand nach mir verlangte? Wenn ich irgendetwas Dringendes verpasste (jene Nachrichten, die oben den Stempel »Dringend« trugen)? Normalerweise war mein Fach natürlich leer oder enthielt höchstens schmale Papierstreifen mit nichtigen Notizen: Suchen unter den Lehrenden noch Betreuer für die Modell-UN, Interessierte kontaktieren bitte … doch diesmal lag ein gefalteter Brief darin, getippt auf Dr. Morses Fakultäts-Briefpapier: »Rube«, las ich in seiner typischen Melange aus Lässigkeit und Schwülstigkeit, »wenn Sie so zuvorkommend sein wollen, mich heute noch dazwischenzuschieben, dann würde eine Audienz mich in höchstem Maße erfreuen. Darf ich mein Büro vorschlagen, gleich nach Ihrer letzten Lehrverpflichtung?« Jawohl, Sie dürfen. Jawohl, Sie haben. Jawohl, Sir. Der Ton klang nicht nach Vorschlag, sondern nach Vorladung. Selbst heute noch kann ich die Augen schließen und Dr. Morse hören, wie er den Text dröhnend Ms. (Linda) Gringling diktiert, damals seine Sekretärin, später seine zweite und letzte Frau. Man erkannte ein Produkt aus dem Hause Gringling – eine der Mitteilungen, die sie nach seinem Diktat abgetippt und dann eigenhändig mit Dr. Morses Namen unterschrieben hatte – übrigens am ordentlichen, anständigen M. Georges eigenes M war eine geräumige Villa, deren Dach noch das O und das R verschattete, oft sogar das S und das E. Die Unterschrift sagte im Grunde: »Du gehörst mir, du wohnst hier nach meinem Belieben, ich umfasse dich«, während Ms. Gringlings Fälschungen mehr Achtung vor Grenzen zeigte.
Ich muss den kurzen Brief an jenem Tag ein Dutzend Mal gelesen haben, etwas hinein oder heraus oder zwischen den Zeilen zu lesen versuchend, wie ein Talmudist oder Bibelforscher oder liebeskranker Jüngling: Was hat er auf dem Herzen? Deutlicher gesagt: Was will er? Was habe ich angestellt? Welche Katastrophe harrt meiner? Meine jüdischen Ängste klingen inzwischen sicher abgedroschen – waren sie womöglich damals schon –, doch das ändert nichts an ihrer Realität. Sie waren einmal wahr. Und irgendwann mal waren sie auch interessant. Ich will gar nicht in die Falle tappen, diese Ängste, diese ererbten Neurosen abzutun, da an ihrer heutigen Banalität doch vor allem ihre Darstellung in Buch, Film und Fernsehen schuld ist; denn tatsächlich haben daran ja all jene mit ihrem Mangel an Kreativität schuld, die sie in den sogenannten »Medien« im letzten halben Jahrhundert kanalisiert haben. Als Stadtjunge, der zufällig auch das jüngste Mitglied des Historischen Seminars zu Beginn des zweiten Probejahres vor der Entscheidung über die Festanstellung war, verkörperte ich den übergewichtigen, von Bluthochdruck geplagten, stets besorgten, gar angsterfüllten Inbegriff des unbeholfenen, überintellektuellen, bescheidenen, selbstironischen jüdischen Klischees, mit dessen Karikierung zum Beispiel Woody Allen ebenso wie etliche andere jüdisch-amerikanische Autoren erstaunliche finanzielle und sexuelle Erfolge erzielt haben (Roth in der Generation nach, Bellow und Malamud in der Generation vor mir). Gelegentlich finde ich den Gedanken immer noch schmerzlich, dass ich zu der Alterskohorte zählte, die Amerika die Worte Schlemihl, Schlamassel, Nebbich und Klutz gelehrt hat; ein stämmiges Füllhorn schwarzhumoriger Schuld und Besessenheit, haarig, schwitzend, ölig, kompliziert durch Komplexe, in ständiger Angst vor Fehltritten, vor dem falschen Wort, vor der falschen Krawatte, vor dem Tragen einer Krawattenspange statt einer Krawattenklammer oder von Manschettenknöpfen, wenn schlichte Knopfmanschetten gereicht hätten, oder von Madras-Stoff, wo doch Cord schon wieder en vogue war, oder vor allem vor der Verwechslung von ganz Grundsätzlichem: Der Reihenfolge, in der die Staaten der Union beigetreten waren … Delaware, Pennsylvania, New Jersey … Während ich meinen Studierenden hinaus in das scharlachrote Gedränge der Universitätsblazer folgte, repetierte ich zur Beruhigung den Rosenkranz und rezitierte jede Perle: Georgia, Massachusetts, Connecticut? Oder Georgia, Connecticut, Massachusetts?
Ms. Gringling führte mich in Dr. Morses Büro und blieb noch einen Augenblick im Türrahmen stehen, um seine Getränkebestellung aufzunehmen, seine Bestellung für uns beide: »Gimlets, Linda. Ich glaube, wir sind im Gimlet-Modus.« Betrachten wir auch hier, was sich seither verändert hat: Damals war es die Aufgabe netter, ehrlicher, recht kompetenter Frauen mittleren Alters wie Linda Gringling, Diktate aufzunehmen und Termine zu machen und professionellen Historikern Drinks zu mixen, allerdings wollte Dr. Morse gelegentlich auch einen Gin-Fizz mit Schlehe oder einen Gin-Tonic, und manchmal, wenn er im Gimlet-Modus war, was bei ihm so eine Art Konjunktiv darstellte, musste der Zitronen- durch Limettensaft ersetzt werden. Ms. Gringling presste die Zitrusfrüchte selbst aus, was dazu führte, dass Dr. Morses Korrespondenz – wie auch das Briefchen, das ich jetzt auf seinen Schreibtisch legte – schwach nach Zitrone duftete.
Als würde ich eine Art Erlaubniszettel aushändigen, wie zu meinen eigenen Studentenzeiten oder in der Armee, schob ich eine Ecke des Papiers unter die Kanonenkugel auf seinem Schreibtisch, jene grimmig vernarbte Bleikugel, die an die geschrumpfte Schädeltrophäe eines metallischen Kopfjägerstammes erinnerte. Dies waren die einzigen Gegenstände auf seinem Schreibtisch, der Kanonenkugel-Briefbeschwerer und nun mein Fetzen Papier. Dr. Morse lehnte in seinem Schreibtischsessel, ruhte in seiner ganzen entspannten Riesengröße an dessen Lehne – »Den ganzen Tag schon sage ich mir: Kein Drink, bevor Rube auftaucht … Kein Drink, bevor Rube auftaucht …«
»Bitte vielmals um Entschuldigung, Dr. Morse.«
»Rube, fast hätte ich nicht durchgehalten.«
»Ich bin direkt vom Seminar hergeeilt, so schnell ich konnte.«
»Aber Sie sitzen immer noch nicht … und Sie nennen mich immer noch nicht George.«
Ich hatte zwar nie viel getrunken, aber diese Cocktailstunde beruhigte mich. Niemand wurde am Corbin College beim Cocktail gefeuert.
Mit großer Geste klappte Dr. Morse seine Kanonenkugel auf: im ausgehöhlten Cranium des Dings bewahrte er seine Rauchutensilien auf. Die umgeklappte Schädeldecke wurde zum Aschenbecher, und als die Drinks gebracht wurden, begannen wir beide zu rauchen. Ich hatte in meiner Jugend Zigaretten geraucht und beim Militär Zigarren, doch das College hatte mich zum Pfeifenraucher gemacht. Während Dr. Morse meist zwischen einer Calabash tagsüber und einer langen Churchwarden am Abend wechselte, rauchten fast alle im Seminar Billard-Pfeifen, gerade oder gebogene, während Dr. Hillard eine ausgedörrte Maiskolbenpfeife von den Lippen baumeln ließ. Meine Pfeife war eine Billard, nicht so gerade wie manche, aber auch nicht so gebogen wie andere. Im Rückblick war das alles bloß ein vergebliches Anpassungsexperiment: den von Ms. Gringling servierten Gin zu trinken und den würzig-süßen Burley-Tabak zu rauchen, der mir in der Kehle kratzte und in den Augen brannte und den Kopf benebelte, der beide verband, und am Körper einen Anzug zu tragen, dessen Karos so breit waren wie die Fensterkreuze und so leuchtend gelb-orange wie der Herbst davor.
Dr. Morse war ein forscher, leidlich passabler Historiker mit einem Schwerpunkt im sogenannten »imperialen Jahrhundert« des britischen Empires (etwa 1815–1914), und offiziell war unsere Beziehung die einer Hauptstadt zu einer Kolonie: diplomatisch und von energischer Herzlichkeit. Hilfreich war ohne Zweifel, dass ich mir meiner Stellung und dem Grund meiner Anstellung bewusst war. Dr. Morse war der monarchische Herrscher, ich war sein loyalistischer semitischer Kontaktmann und Spion unter den Amerikanisten in Corbins Historischem Seminar. Mit meiner jüdischen Eigeninitiative und meiner jüdischen Gefallsucht sollte ich für ihn in diesem unbegreiflichen Territorium Augen und Ohren offen und meine Neue-Welt-Kollegen geografisch auf Linie halten: gerade genug Eifer zeigen, dass sie fleißig blieben, und gerade genug Gewissenhaftigkeit, dass sie ehrlich blieben. Bemerkenswerterweise zeigt sich Corbin heute, Jahrzehnte nach Dr. Morses Regentschaft, immer noch exzellent in allen Bindestrich-amerikanischen Forschungsgebieten, hinkt aber meilenweit hinterher bei dem, was Dr. Morse, aber nicht nur er, früher »den Kontinent« nannten. Natürlich betrachten die heutigen Studenten das als Zeichen der Liberalität des Seminars – seiner Bereitschaft zur Weiterentwicklung – doch die Wahrheit ist harscher. In Wahrheit hat Dr. Morse nie Qualitätstiefe in europäischer Geschichte zugelassen, weil er keine Konkurrenz ertragen konnte. Europa gehörte ihm (Karten des Kontinents von Ptolemäus und Rand McNally nahmen in seinem Büro die gesamte Wand gegenüber dem Fenster ein); die überfallenen, besetzten, annektierten und aufgeteilten Außenposten eines jeden europäischen Reiches gehörten ihm und einigen wenigen anerkannt mittelmäßigen Kumpanen, die genauso gut wie er wussten, dass sie nicht gelehrt genug waren, sich echten Herausforderungen zu stellen. Diese Facette fand ich an Dr. Morse am verblüffendsten: Der Mann kannte seine Grenzen, schämte sich aber nicht dafür. Sie waren ihm egal. Er nahm seine Durchschnittlichkeit ganz locker, war beinahe stolz darauf, trug sie wie einen durchsichtigen Professorentalar, unter dem er ein nackter Verwalter war. Seine neuenglische Selbstzufriedenheit war erstaunlich, jedenfalls für einen ängstlich besorgten Menschen wie mich, für ein Kind des Garment Districts. Heutzutage würde man diesen Zustand wohl privilegiert nennen. Die völlige Entspanntheit, die absolute Behaglichkeit, die komplett ungetrübte Fähigkeit, sich in seinem eigenen gebleichten Hautkorsett wohlzufühlen, die daraus entspringt, von Geburt an in Geld, Anleihen und Aktien gehüllt zu sein; ein patrizisches Erbe, das seinen Feinschliff in Groton, Yale und Harvard erhielt. Das soll aber nicht so klingen, als wollte ich ihn herabsetzen, denn in all seiner Lockerheit, seiner Schlichtheit und Lockerheit, lehrte Dr. Morse mich eine wichtige Lektion: Namentlich dass all der Fleiß und die Besserwisserei, die mir in meiner Jugend und ganz bestimmt während des Studiums zugutegekommen waren, mich jetzt als Dozent eher behinderten. Da ich nun ganz offiziell Klassenprimus war, eine Stufe über allen anderen im Raum stand, musste ich nicht mehr so angeben. Sicher, ich sollte weiter forschen, schreiben und publizieren wie von der Tarantel gestochen, aber ich sollte dabei nie ins Schwitzen kommen oder irgendwem auch nur einen Hauch von Ehrgeiz zeigen. Ich war jetzt ein Mann des Corbin College oder sollte jedenfalls so tun, als wäre ich einer. Ich hatte es geschafft, oder zumindest musste ich lernen, das vorzugeben, indem ich tiefer und ruhiger atmete. Das, so glaubte ich, versuchte Dr. Morse mitzuteilen, indem er mich zum Trinken nötigte – wobei: Der Mann pichelte einfach selbst gern. Er trank seinen Gimlet und paffte seine Calabash, und in seiner jovialen Unmäßigkeit wirkte er viel eher wie der Weihnachtsmann als ich, ein geselliger alter Nikolaus, dem die Haare ausgegangen waren, sein kahler Schädel ähnelte dem Kürbis, der noch viel zu lange vor der Fredonia Hall nachreifte; ein seltsamer, schiefer, warziger Kürbis mit rot geplatzten Äderchen und einem Fleckmuster aus Kapillarschäden, überfroren von einer weißen Reifschicht.
Ich komme jetzt zu dem Teil dieses Berichts, wo der echte Dialog einsetzt – die erste längere Passage wirklicher Konversation zwischen Menschen, die über Unerhebliches wie Hallo, Schatz … oder Hi, wie geht’s … oder Hallo, bitte nehmen Sie doch Platz … hinausgeht, und ehe es losgeht, möchte ich gern eine diesbezügliche Vorgehensweise verkünden. Anführungszeichen oder »Abführungen«, wie verschiedene meiner Studenten sie im Lauf der Jahre genannt haben, »Häkchen«, »Gänsefüßchen« oder »die winzig kleinen Regentropfen, die einem sagen, wer spricht«, sind Historikern heilig. Beim akademischen Schreiben ist ein Zitat die Garantie, das zwei- oder vierzackige Siegel, das die Faktizität bestätigt und sagt: »Diese Worte sind schon vor mir von jemandem geschrieben oder gesprochen worden, Pfadfinderehrenwort.« Und weil ein einziges Pfadfinderehrenwort nie ausreicht, wird jedem Zitat traditionell eine Quellenangabe beigegeben, die besagt: »Für alle Zweifler – hier ist der Autor (Nachname zuerst), der Buchtitel (kursiv) und die Seitenzahl, weil ihr faul seid, und jetzt machet euch auf in eine Bibliothek und überprüft mich.« Da ich mich mein Leben lang von diesem Diktat habe leiten lassen, fällt es mir jetzt schwer, ihm zu entsagen, auch wenn keine Aufzeichnungen existieren, die mich widerlegen könnten, und ich selbst die einzige Quelle bin. Im Folgenden werde ich mich bemühen, nur das wiederzugeben, was mir gegenüber gesagt wurde, so wörtlich es meine Erinnerung erlaubt, und mit der Mahnung, dass ich im Gegensatz zu den meisten Autoren, die sich an der Heiligkeit des Zitierens vergehen – im Gegensatz zu den Religiösen, die die Chuzpe besitzen, Gott selbst Worte in den Mund zu legen – mir nur Ereignisse ins Gedächtnis rufe, bei denen ich zugegen war, und dass die seit diesen Ereignissen bis zum gegenwärtigen Augenblick verstrichene Zeitspanne beträchtlich kürzer ist als, sagen wir, die Spanne von der Schöpfung des Universums bis zum Auszug aus Ägypten, sogar kürzer als die Spanne von den Lehrtagen Jesu bis zum Verfassen der kanonischen Evangelien.
Unsere Konversation hob mit Folgendem an: der Universitätsbibliothek und der Theatergruppe der Highschool. Und wenn ich mich selbst in einer Fußnote verbürgen müsste, würde ich beide Themen mit einem Sternchen versehen und dazu schreiben: »Vgl. jedes Gespräch, das ich jemals mit Dr. Morse geführt habe, die alle mit meiner Frau und der Universitätsbibliothek sowie meiner Tochter und der Highschool-Theatergruppe eröffnet wurden.« Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. Irgendjemand musste Dr. Morse in seiner Kindheit beigebracht haben, man käme besonders höflich durchs Leben und die Welt (seine Welt), indem man genau einen Fakt über die Familienmitglieder seiner Kollegen auswendig lernte, und wenn man diese Kollegen oder ihre Familienmitglieder dann traf, konnte man durch Erwähnung dieses Faktums zugewandt und interessiert erscheinen.
Er fragte: »Und wie kommt Ihre Edith in unserer großartigen, aber unordentlichen Sammlung zurecht?«, und anstatt »Nicht so gut« zu antworten, oder »Man beschäftigt sie immer noch nur in Teilzeit«, oder »Man lässt sie immer noch bloß Regale einräumen«, oder »Ehrlich gesagt glaubt sie, von ihren Vorgesetzten bestraft zu werden, die ihre Vorschläge zur Erweiterung der Öffnungszeiten und die Ausdehnung der Ausleihe über die Universität hinaus auf das allgemeine Publikum ›kontrovers‹ und ›in höchstem Maße arrogant‹ genannt haben« – anstatt irgendetwas in der Art zu antworten, sagte ich: »Ganz okay.«
Daraufhin schwenkte Dr. Morse zu Judy, die im Jahr zuvor als die geheimnisvolle Neue an der Corbindale High zu lokaler Bekanntheit gelangt war, weil sie die Hauptrollen in Aufführungen eines Gilbert & Sullivan-Musicals und eines Shakespeare-Stücks ergatterte, weshalb er sie manchmal Julia nannte, so in der Art: »Und wie geht es der reizenden Julia dieser Tage? Sie war exzellent in Der Mikado.«
»Danke der Nachfrage«, sagte ich. »Es geht ihr gut.«
»Wie weit ist sie jetzt, im Junior-Jahr?«
»Senior. Abschluss nächstes Jahr. Sie hat Spitzennoten. Mit ein bisschen Glück wird sie als Jahrgangsbeste abschließen und die Rede halten.«
»Was für eine Erfolgsgeschichte! Mittendrin die Highschool zu wechseln und trotzdem als Beste abzuschließen – bestimmt kann sie niemand ausstehen!«
»Ach, sie hat ein paar Freunde gefunden.«
»Und sie wird sich natürlich hier bewerben? Wo wir jetzt auch Frauen zulassen, können wir ebenso gut die Besten nehmen.«
»Aber natürlich wird sie das.«
Dr. Morse grinste. »Sie sind so ein schlechter Lügner, Rube, wissen Sie das?«
Während ich noch angestrengt grübelte, was ich darauf antworten sollte, sagte er: »Ich hoffe, Sie wissen, dass ich Sie genau deshalb mag.«
Nächster Punkt auf der Konversationsliste war die Lehre. Auch das gehörte zur klassischen Reihenfolge, a.a.O. Im Altertum folgte auf die Bronzezeit die Eisenzeit, bei Dr. Morse kam nach dem Familiengeplauder das Universitätsgeplauder, immer in der Reihe, immer in Relation. Auch wenn ich es damals lachhaft fand, weiß ich inzwischen zu schätzen, dass mein Dekan mich nie nach meinem Lehrstoff oder dem Niveau meiner Studenten zu fragen pflegte, sondern ausschließlich nach der Beschaffenheit des Unterrichtsklimas: Er wollte wissen, in welche Räume meine Seminare gelegt worden und wie diese beheizt waren, ob es dort zog, und wenn ja, von woher, ob die Beleuchtung ausreichend war, ob die Tafeln regelmäßig gewischt, die Schwämme entstaubt und die Kreidevorräte aufgefüllt wurden – ob meine Umgebung »angenehm und förderlich« war. Das waren seine Worte, seine Kriterien. »Denn«, so erklärte er, »es ist wichtig, dass unsere Umgebung förderlich ist.« Nach einem Jahr hatte ich bereits begriffen, dass diese Fragen am besten mit leiser Kritik und dezenten Beschwerden beantwortet wurden, auch wenn ich gar nichts zu klagen hatte. Wenn ich ihm erzählte, dass in, sagen wir, Raum 203 in der Fredonia Hall die Heizkörper leckten und die Rohrleitungen schepperten, versetzte ich ihn in die Lage, einen Wartungsauftrag zu erteilen, wodurch er sich wirkungsvoll fühlte. Oder vielmehr notierte er Raumnummer und Problem (»203: Heizkörper leckt; Rohrleitungen scheppern … würden Sie sagen laut? Oder sehr laut?«), und wenn Ms. Gringling hereinkam, um uns frische Drinks zu bringen, ging sie mit unseren leeren Gläsern und dem Reparaturauftrag, den sie in seinem Namen erteilen würde.
Nach dem ersten Schluck von seinem zweiten Gin kam Dr. Morse zum Geschäftlichen. »Geld … ist vielleicht Ihr Lieblingsthema, aber bestimmt nicht meins … und jede Fakultät dieser Hochschule schreit nach mehr … mehr Geld, mehr Personal, höhere Gehälter, bessere Ausstattung … Englisch, Klassische Philologie, Deutsch, Französisch: So ist die Lage überall, oder vielmehr überall außer in Geschichte, und doch muss die Geschichte von Natur aus an allen Leiden teilhaben. Die Philosophie leidet, also leidet auch die Geschichte. Die Psychologie sowieso. Russisch leidet, also auch Geschichte, das kosmische russische Leiden. Doch am schlimmsten ist es bei den Naturwissenschaften mit ihren Laborbedürfnissen. Die Naturwissenschaften sind nicht bloß teuer, sie sind gierig. Die führen ihre Fakultäten, als wären wir wieder im Krieg. Man sollte meinen, dass sie nicht bloß Schweinen Stromschläge versetzen, sondern eine Bombe erfinden. Sie würden ihre Zeit und Energie besser nutzen, indem sie neue Wege ersinnen, Geld zu fälschen, und es auch gleich drucken. Denn Geld ist, was wir brauchen, die Kasse ist leer, die Taschen haben Löcher. Die Kanzler und Dekane haben Münzen gezählt, und Sie können sich vorstellen, wie das gelaufen ist. Ihnen muss ich nicht erzählen, dass man die Ökonomie am besten den Ökonomen überlässt. Anstatt Geld zu beschaffen, anstatt Stifter oder Schenkungen aufzutreiben, gehen sie die Fakultätshaushalte einzeln durch, Posten für Posten, in der Hoffnung, ungenutzte Mittel zu finden, die man umwidmen kann.«
Dr. Morses Eiswürfel klimperten, als wollten sie applaudieren, während sie in meiner zitternden Hand ans Glas klirrten. »Es geht also um Einschnitte und Kürzungen?«
Er runzelte die Stirn. »Machen Sie sich keine Sorgen, Rube. Dazu gibt es gar keinen Grund … und außerdem haben Sie das doch schon hinter sich, oder?«
Man musste mir die Angst angesehen haben, denn er setzte nach. »Entspannen Sie sich, bitte, ganz ruhig. Ich wollte das Gespräch nur durch einen Scherz über Ihre Beschneidung auflockern.«
Ich zwang mich zu einem hüstelnden Lachen, und er fuhr ernster fort. »Sie haben mein Wort, Rube, bei Ihnen wird nichts mehr beschnitten. Es geht um die Geschichte: Wir werden gebrandschatzt.«
»Warum wir?«
»Weil die Geschichtsfakultät die Ausnahme ist. Wie immer. Geschichte ist reich. Um unser Budget beneidet uns die Mathematik, sogar Geologie und Physik werden da eifersüchtig. Und warum? Weil wir nicht verschwenderisch sind. Doch die Universitätsverwaltung und -leitung wagen zu widersprechen: Sie haben mir gesagt, es liegt daran, dass wir niemanden einstellen. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich vorstellen, dass man sich Ärger einhandelt, weil man sparsam ist, um nur einen unserer vielen Vorzüge beim Namen zu nennen?«
»Nein, das kann ich nicht«, sagte ich, aber ich dachte: Ich war der Letzte, den er eingestellt hatte, die einzige neue Lehrkraft am Seminar seit Hiroshima und Nagasaki.
»Jedenfalls«, fuhr er etwas abwesend fort, »haben sie genau das getan: Sie haben mich wegen meiner mangelnden Verschwendung getadelt. Sie haben gesagt, ich müsse jemanden berufen, andernfalls würde ich riskieren, dass unsere angehäuften Mittel eingezogen und anderweitig verteilt werden. An eine Fakultät, die etwas damit anfangen kann. An eine Fakultät, die es, offen gesagt, sinnlos verprassen würde. Nur unter uns, ich betrachte dieses Ansinnen als eine Form der Erpressung. Auf jeden Fall ist es eine Drohung, aber sei’s drum. So betreibt die Universität heutzutage ihre Geschäfte, und genau so betrachtet sie das auch zunehmend – als reines Geschäft.«
»So scheint der Trend zu sein.«
Er paffte und drehte seinen Stuhl zur Wand, um mit seinen Karten zu sprechen. »Und auch wenn ich die brüderliche Intimität unserer Fakultät zu schätzen weiß, ist die Entscheidung doch eindeutig: Ich würde viel lieber einen weiteren Dozenten einstellen als die Niederlage einzuräumen und unsere mühsam erworbene Beute an Driggert in der Agrarwissenschaft oder gar, Gott bewahre, an Pumpler vom Sport weiterzureichen.«
»Wir stellen also jemanden ein?«
»Genau. Wir hängen ein Schild an die Tür mit der Aufschrift: Mitarbeiter gesucht – bitte drinnen melden.«
»Irgendwelche bestimmten Anforderungen?« Als ich mir das neue Schild am Türknauf vorstellte – Farbige, Iren oder Spezialisten in Europäischer Geschichte brauchen sich nicht zu bewerben –, hatte ich allerlei Wünsche im Kopf, alles, woran es dem Seminar mangelte: Naher Osten, Ferner Osten, Byzanz, die Anti-Whig-Perspektive, Demografie, Geschichtstheorie, Hindiphilie, Hindiphonie, eine Frau.
»Keine Anforderungen. Einschränkungen. Sie schränken unsere Autonomie ein. Sie wollen mir vorschreiben, dass unsere Fakultät wegen unseres Wohlstands jemanden anstellen muss, der auch in anderen Fachbereichen unterrichten kann – in Fachbereichen, die weniger gut gewirtschaftet haben als wir. Und weil sie versagt haben, sollen sie belohnt werden.«
»Das klingt aber nicht fair.«
»Ist es ja auch nicht. Fairness ist für diese Leute ein zu klares und ehrliches Prinzip. Die verwenden Begriffe wie Mehrfachnutzung und interdisziplinär. Effizient und stromlinienförmig. So sieht wohl die Zukunft aus: Polyfunktional, mehreren Abteilungen verpflichtet … Würde mich nicht wundern, wenn Sie in ein paar Jahren die Vorbereitungskurse für das Wirtschaftsprüfungs-Examen unterrichten müssen … Die könnten tatsächlich jede Hilfe gebrauchen; ihre Revision hat nichts als Chaos angerichtet«, worauf er den Kopf senkte, als wollte er auf das Durcheinander deuten, doch sein Schreibtisch war leer.
»Und was hat das mit mir zu tun?«
Er tauchte wieder aus seinen Gedanken auf und in seinen Drink. »Da wir diesem Übergriff machtlos ausgeliefert sind, werden wir im Lauf des Semesters ein paar Kandidaten auf den Campus einladen – zu Bewerbungsgesprächen, als Gastdozenten in einigen Seminaren, zu öffentlichen Vorlesungen.« Er beugte sich vor. »Und hier kommen Sie ins Spiel, Rube.«
»Ich?«
»Ich habe Sie hergebeten, um einen Gefallen zu erbitten.«
»Was immer Sie wollen.«
Dr. Morse zog eine Grimasse und schwenkte ergänzend zur Ankündigung sein Glas. »Ehrlich gesagt ist es weniger ein Gefallen als ein Vordrängeln. Wie Sie sicherlich wissen, muss jeder Fakultätsangehörige reihum in Berufungskommissionen sitzen. Als jüngstes Mitglied unseres Lehrkörpers wären Sie eigentlich noch lange nicht dran, erst beim übernächsten Mal oder noch später, aber wir glauben, dies ist ein besonderer Ausnahmefall, und wenn Sie einverstanden sind, werden wir auch dafür sorgen, dass Sie nicht doppelt in die Pflicht genommen werden. Sie kommen einfach jetzt an die Reihe und dafür später nicht. Tun Ihre Pflicht etwas früher.«
»Wir berufen also einen weiteren Amerikanisten?«
»Da wir Sie gerade erst eingestellt haben, leider nicht. Offenbar müssen wir unsere Dozenten in den Ecken und Winkeln der Europäischen Geschichte suchen.«
»Europäische Geschichte?«
»Ich versuche diese uns aufgezwungene Anforderung als Erleichterung zu betrachten, die mich und die anderen ein wenig von der Last Europas befreit.«
»Aber was soll ich dann in der Berufungskommission? Europa ist doch gar nicht mein Forschungsgebiet.«
Er paffte ein bisschen, als wolle er über die Frage zunächst mithilfe von Rauchwolken nachdenken. »Gremienarbeit ist verpflichtend. Alle Fakultätsmitglieder müssen ein Semester ableisten. Das Spezialgebiet der Kandidaten spielt dabei keine Rolle. Und alle anderen haben bereits Gremienverpflichtungen für das kommende Semester, viele von uns sind sogar mehrfach beschäftigt. Dr. Hillard und ich werden Sie zum Beispiel nicht bloß in der Berufungskommission begleiten, sondern auch zusammen in der Kommission sitzen, die über Festanstellungen entscheidet … über Ihre Festanstellung …«
»Ich verstehe. Verzeihung. Ich bin sehr gern zu Diensten.«
Dr. Morse winkte ab und verscheuchte damit den Qualm. »Offenbar ist einer der Kandidaten besonders vielversprechend. Ein Mediävist mit dem Fachgebiet Europa.«
»Mediävist?«
»So weit ich das sehe, ja. Spezialgebiet Iberien, glaube ich? Fünfzehntes Jahrhundert vielleicht? Jedenfalls würden wir gern Ihre Meinung hören.«
»Meine?«
»Ganz besonders Ihre.«
Das war verwirrend. Wozu wollte er meine Meinung hören? Zur Mediävistik? Oder anders gesagt zum Mittelalter? Zum finsteren