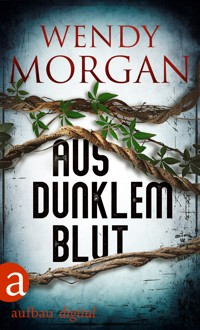
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wendy Morgan Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein schöner Ort zum Leben, ein perfekter Ort zum Sterben.
In Woodsbridge, New York, ist die Welt noch in Ordnung. Wunderschöne Häuser, gepflegte Vorgärten - hier lebt es sich ruhig und idyllisch. Kathleen Carmody zieht mit ihrer Familie zurück an den Ort, an dem sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hat. Aber mit diesem Ort verbindet sie nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch dunkle Geheimnisse, die sie seit dieser Zeit schwer belasten. Geheimnisse, die so dunkel sind, dass sie noch nicht einmal ihrem Mann davon erzählt hat. Als plötzlich mehrere Teenager verschwinden wird Kathleen klar: Ihr Geheimnis birgt eine tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Ähnliche
Über Wendy Morgan
Wendy Morgan hat englische Literatur mit dem Schwerpunkt kreatives Schreiben studiert. Nach ihrem Studium hat sie zunächst als Lektorin und Journalistin gearbeitet, um sich dann ganz ihrem Traumberuf der Schriftstellerin zu widmen. Wendy Morgan lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in New York.
Informationen zum Buch
Ein schöner Ort zum Leben, ein perfekter Ort zum Sterben ...
In Woodsbridge, New York, ist die Welt noch in Ordnung. Wunderschöne Häuser, gepflegte Vorgärten – hier lebt es sich ruhig und idyllisch. Kathleen Carmody zieht mit ihrer Familie zurück an den Ort, an dem sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hat. Aber mit diesem Ort verbindet sie nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch dunkle Geheimnisse, die sie seit dieser Zeit schwer belasten. Geheimnisse, die so dunkel sind, dass sie noch nicht einmal ihrem Mann davon erzählt hat.
Aber als plötzlich mehrere Teenager verschwinden wird Kathleen klar: Ihr Geheimnis birgt eine tödliche Gefahr ...
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wendy Morgan
Aus dunklemBlut
Roman
Ins Deutsche übertragen vonMartin Hillebrand
Inhaltsübersicht
Über Wendy Morgan
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Dank
Prolog
Erster Teil. Oktober
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Zweiter Teil. November
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Dritter Teil. Dezember
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Epilog
Impressum
WIDMUNG
Meinem zutiefst verehrten Freund und sanften Riesen
Jon Charles Gifford (7. August 1959 – 8. Juli 2003)
zum ehrenden Andenken liebevoll gewidmet.
»Auf dich und deinesgleichen.
Von euch gibt’s nur noch verdammt wenige.«
In Liebe auch für William Pijuan alias Uncle Bill,
der sich nicht unterkriegen lässt.
Und, wie immer, für Mark, Morgan und Brody.
DANK
Die Autorin bedankt sich – zur Abwechslung einmal in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge – bei folgenden Personen: Wendy Zemanski, Walter und Steve Zacharius, Mark Staub, John Scognamiglio, Joan Schulhafer, Janice Rossi Schaus, Laura Blake Peterson, Laurie Parkin, Doug Mendini, Gena Massarone, Kelly Going, Kyle Cadley und Danielle Boniello.
PROLOG
August
An jenem Dienstagabend, als sie am Straßenrand entlang nach Hause marschiert, kreisen ihre Gedanken immerfort um den morgigen ersten Schultag.
Um die Frage, was sie anziehen soll, wen sie als Klassenlehrerin oder Klassenlehrer bekommt und ob sie mit der dritten oder der vierten Schicht zum Mittagessen darf. Die Oberstufe wird immer für eine der späteren Essensausgaben eingeteilt. Das wäre zur Abwechslung mal etwas Angenehmes. Im vorigen Schuljahr war sie nämlich mit der frühen Gruppe dran. Aber wer hat morgens um zwanzig nach zehn schon Bock auf Chili con Carne oder auf Eiersalat?
Die von Schlaglöchern übersäte Fahrbahn der Cuttington Road glänzt im trüben Licht der Straßenbeleuchtung; die Seitenstreifen sind ganz schlammig nach dem heftigen Regenguss vom Vormittag.
Von ihrer Ma kommt ständig die Mahnung, sie solle, wenn sie von ihrem Nebenjob im Schnellimbiss drüben am Highway nach Hause geht, nicht auf der Straße, sondern daneben laufen. Aber das geht nicht, sie trägt Sandalen.
Und überhaupt, was soll’s – es ist ja bloß knapp eine halbe Meile. Außerdem herrscht jetzt am Abend ohnehin wenig Verkehr auf dieser alten, kurvenreichen Nebenstraße, die zu ihrem Wohnblock führt. Vor ein, zwei Jahren gab es hier sogar überhaupt noch keinen Durchgangsverkehr; da lag hier draußen in der Walachei nur Orchard Arms, eine Ansammlung klotziger, zweistöckiger Bauten mit Putzfassaden und schmiedeeisernen Baikonen, gerammelt voll mit Blumentöpfen, Kinderdreirädern und Holzkohlegrills.
Dann rollten die Raupen und Bagger an, und dort, wo einmal der Wald gewesen war, entstand eine Siedlung. Sie nennt sich Orchard Hollow, was so viel heißt wie »Obstgartensenke« – vermutlich wegen der Apfelbäume, die den Häusern weichen mussten. Folgt man heute der Landstraße nur noch ein Stückchen weiter, stößt man direkt hinter Orchard Arms auf etliche Sackgassen, die von der Cuttington Road abzweigen wie juwelengeschmückte Finger von einer schwieligen Malocherhand.
Wo früher lediglich Bäume und Brombeerbüsche standen, schössen auf einmal zwei- bis dreigeschossige Häuser aus dem Boden, mit Doppel- oder Dreifachgaragen, in denen auf Hochglanz polierte Limousinen und Nobelkombis parken. In den Häusern wohnen Menschen, die unentwegt mosern über die Schlaglochpiste und die funzelige Beleuchtung entlang der alten Straße, die nach Orchard Hollow führt. Die war zwar immer schon katastrophal, aber bis jetzt nahm niemand Anstoß daran. Nach der Belastung durch die schweren Baumaschinen sieht die Straße ramponierter aus denn je, aber es lohnt sich nicht, sie zu reparieren, weil ja immer noch gebaut wird.
Die neuen Eigenheime haben keine schmiedeeisernen Balkone mehr, sondern weitflächige Holzdecks oder Terrassen mit Klinkerpflaster. Außerdem haben sie schnieke Gärten mit Rosenbeeten, breiten, gasbetriebenen Grillrosten und hölzernen Schaukelgerüsten mit allen Schikanen.
Etliche haben sogar einen Swimmingpool auf dem Grundstück. Wenn sie an den heißesten Tagen dieses Sommers draußen auf dem Balkon saß, konnte sie manchmal in der Ferne das Planschen und das vergnügte Gekreisch der Kinder hören.
Des Öfteren schon hat sie darüber gerätselt, wie es wohl wäre, wenn sie sich mit einem der Mädchen von dort drüben anfreunden würde. Die fuhren schließlich im selben Schulbus. Vielleicht dürfte sie dann auch mal in einem der Pools baden.
Bislang hat sich da aber nichts ergeben. Die Mädchen aus der Siedlung bleiben lieber unter sich. Sie sitzt im Bus immer allein, weil keine ihrer Altersgenossinnen aus Orchard Arms stammt. Mitunter kriegt sie schon mal mit, wie die anderen Girls miteinander plaudern. Sie lassen sich über Themen aus, die auch sie interessant findet – wie etwa über die Jungs an der Woodsbridge Highschool oder über den Schlussverkauf bei Abercrombie & Fitch, drüben in der Einkaufspassage. Kommt aber die Sprache auf Dinge, mit denen sie nichts anzufangen weiß – wie abendliches Ausgehverbot oder überstrenge Väter oder neugierige Mütter, die immer zu Hause herumglucken und einem ein Loch in den Bauch fragen –, na ja, dann stellt sie die Ohren auf Durchzug.
Sie hält sich ganz am äußersten Rand der Fahrbahn, nach Kräften bemüht, den Pfützen auszuweichen, die sich in den Schlaglöchern angesammelt haben. Trotzdem kriegt sie dabei nasse und schmutzige Zehen. Morgen, so denkt sie mit einem Hauch Wehmut, wirst du zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder geschlossene Schuhe anziehen müssen. Stinknormales Schuhwerk und ganz gewöhnliche Allerweltsklamotten. Hier im Westen des Staates New York sind die für Sandalen, Shorts und Tank Tops geeigneten Tage von kurzer Dauer. Umso mehr sollte man da eigentlich meinen, man dürfte über die warme Jahreszeit bis Anfang September in leichten Sommersachen zur Schule kommen. Aber von wegen!
Die ganze Pediküre für die Katz!, denkt sie, und erinnert sich, wie penibel sie heute Morgen erst ihre Zehennägel pinkfarben lackiert hat.
Sie hört am Platschen der Pfützen, wie sich von hinten ein Auto nähert, und weicht noch weiter beiseite, um es vorbeifahren zu lassen.
Es fährt aber nicht vorbei.
Abbremsende Reifen quietschen. Scheinwerfer beleuchten den Straßenabschnitt. Sie sieht einen gespenstischen Schatten, der verzerrt auf die Fahrbahn fällt – es ist ihr eigener Schatten.
Während sie sich zu den blendend grellen Strahlern umdreht, fragt sie sich, ob das wohl eine Nachbarin ist, die extra anhält, um sie mitzunehmen.
Ihr nächster Gedanke, etwas verspätet, gilt ihrer Mutter, die immer mahnt, sie solle nicht in Fahrtrichtung des fließenden Verkehrs gehen, sondern entgegengesetzt. Damit sie erkennen kann, was auf sie zukommt.
Als der Wagentürflügel aufschwingt und man sie grob ins Innere zerrt, zuckt ihr als letzter klarer Gedanke durch den Kopf, dass sie so etwas nie und nimmer hatte kommen sehen.
Erster Teil
Oktober
1. KAPITEL
»Mrs. Carmody?«
Erschrocken hebt Kathleen den Blick und schaut hinüber zu der blondierten Arzthelferin am Empfang der kieferorthopädischen Praxis.
»Ja?«
»Wir brauchten noch mal Ihre Versicherungskarte.«
Seufzend legt Kathleen die Ausgabe der Rosie beiseite – Relikt einer verflossenen Epoche, als es eine Zeitschrift dieses Namens noch gab –, nimmt ihre Handtasche von der Lehne ihres unbequemen Stuhls und windet sich durch das proppenvolle Wartezimmer. Ihr zehnjähriger Sohn Curran, der in sein Gameboy-Spiel vertieft ist, ist der einzige Patient, der ihr nicht hinterher guckt.
Kathleen kramt ihr Kärtchen aus der Handtasche, reicht es der Zahnarzthelferin und wartet, während die Blondine das Ding stirnrunzelnd betrachtet, dann fotokopiert und nochmals die Stirn in Falten legt.
»Neue Krankenversicherung?«, fragt sie.
»Die haben wir schon seit Mai, seit wir hierherkommen.« Ob die neu ist an der Rezeption? Kathleen hat sie vorher noch nie gesehen.
»Keine neue Gruppennummer?«
»Nee.« Kathleen seufzt innerlich. Dauernd das Theater mit den Versicherungen! Mittlerweile ist es ein halbes Jahr her, seit Matt den Job gewechselt hat und sie in den Westen des Bundesstaates New York zogen. Trotzdem gibt es bei jedem Arzt-, Zahnarzt- oder Kieferorthopädentermin Komplikationen.
Die Blondine rollt mit ihrem Drehstuhl zum Computer und bearbeitet, die Versicherungskarte in der Linken, mit der Rechten die Tastatur. Die Festplatte surrt los. »Dauert ein paar Sekunden«, bemerkt die Arzthelferin. »Ich muss nur was kontrollieren, Mrs. … Katie?«
Katie …
Ein Name aus der Vergangenheit. Was nur bedeuten kann, dass die Blondine gleichfalls jemand aus jener Vergangenheit ist, eine Stimme, ein Gesicht.
Nun ist es an Kathleen, die Stirn in Falten zu legen, und zwar auf jene höfliche, seit dem Umzug perfektionierte Weise, ganz so, als wolle sie fragen: Kennen wir uns?
»Sie sind doch Katie Gallagher, nicht wahr?«
Gottlob nicht mehr!
»Das war einmal.« Sie ringt sich ein freundliches Lächeln ab. »Inzwischen heiße ich Kathleen Carmody.«
»Und ich bin Deb! Deb Duff – beziehungsweise, so hieß ich früher. Heute Mahalski.«
Der Name sagt ihr nichts. Ist auch kein Wunder. Kathleen hat versucht, so ziemlich alle Bekannten von früher aus ihrem Gedächtnis zu streichen. Es ist leichter so.
»Ich dachte, du wärst schon vor Jahren weggezogen«, plappert die Blondine weiter.
Am liebsten würde Kathleen sich ihren Filius samt Gameboy schnappen und blitzartig die Flucht ergreifen. Das aber kommt nicht infrage. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass ihr jemand über den Weg läuft, der sie von früher kennt. Außerdem hat die Zahnarzthelferin noch ihre Versicherungskarte.
»Ich … äh … war ich auch. Aber jetzt bin ich wieder da«, nuschelt Kathleen, wobei sie gedankenversunken die unfassbar langen, gebogenen, knallroten Fingernägel dieser Deb Mahalski bemerkt. Wie kann sie damit bloß tippen?, fragt sie sich.
»Wo wohnst du denn jetzt?«
»In Woodsbridge.«
Kathleen sieht, wie Deb zu der auf dem Schreibtisch liegenden Patientenakte schielt und dabei die übertrieben gezupften und nachgemalten Brauen hebt. »Orchard Hollow? Ganz schön weit gekommen seit Saint Brigid’s.«
Aha, da liegt also der Hund begraben! In einem anderen Leben waren wir zusammen auf einer katholischen Bekenntnisschule!
»Hast du das eigentlich mitgekriegt? Vor ’n paar Jahren haben sie Kirche und Schule abgerissen und einen neuen Supermarkt dahingesetzt.«
»Hab ich gehört.«
»Ist das dein Sohn?«, fragt Deb, mit dem Kopf auf Curran deutend.
»Ja.«
»Ich hab zwei Mädchen. Drei und fünf Jahre alt.« Sie deutet jetzt mit ihrer kunstvoll hochtoupierten, hinten mit einem Plastikschmetterling zusammengeklammerten Frisur in Richtung des gerahmten Fotos auf ihrem Tisch. »Hast du noch mehr Kinder?«
»Einen jüngeren Sohn noch. Und eine Tochter. Die ist … schon älter.«
»Und du bist verheiratet?«
»Hm.«
Sie kann den Fragen ja doch nicht ausweichen. Ein bisschen Recherche im Internet, und diese neugierige Person hätte im Handumdrehen alles heraus, was es über ihr Leben zu erfahren gab.
Stopp! Alles nicht!
Niemand weiß alles. Nicht einmal Matt. Oder die Kinder. Und sie werden’s auch nie erfahren!, denkt sie, die zitternden Hände in den tiefen Taschen ihres cordgefütterten Wachsmantels zu Fäusten verkrampft.
»Bin wieder zu Hause! Entschuldige die Verspätung, Jen!«, ruft Stella Gattinski. Von der angebauten Garage aus geht sie direkt in die Küche und streift sich die braunen Lederpumps ab, die ihre Füße schon den ganzen Nachmittag über malträtiert haben.
»Halb so wild, Mrs. Gattinski.«
Jen Carmody, nach Ansicht von Stellas dreijährigen Zwillingstöchterchen die »liebsteste und schönsteste Babysitterin von der ganzen Welt«, schaut lächelnd auf. Gemeinsam mit den beiden Mädchen kauert sie vor dem gemauerten Kamin nebenan im Familienzimmer, in dem die Kuscheltiere gerade ein Kaffeekränzchen abhalten.
Für Stella erwies sich jener Tag im April, an dem die aus dem Mittleren Westen stammenden Carmodys nach Woodsbridge umzogen, als ausgesprochener Glückstag. Jen kommt mit Mackenzie und Michaela hervorragend klar und ist zudem im perfekten Alter: dreizehn. Zwar alt genug, um für zwei Kleinkinder die Verantwortung zu übernehmen, aber doch noch zu jung fürs Daten, Autofahren und für die meisten Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts.
Sie rückt jeden Mittwoch an und nimmt die Zwillinge in Empfang, wenn der Bus der Tagesstätte die beiden zu Hause absetzt. An diesem Tag ist Stellas langer Tag in der Schule: Sie leitet die Französisch-AG, und die trifft sich nun mal immer am Mittwochnachmittag.
Bevor Jen ihren Dienst als Babysitterin antrat, musste Stella mittwochs immer gezwungenermaßen auf Elise Gattinski zurückgreifen, »die Schwiegermutter aus der Hölle« nennt sie sie. Sie hatte sonst niemanden, der die Kinder beaufsichtigen konnte. Früher übernahm das ihre eigene Mutter, doch seit ihr Vater im vorigen Jahr starb, bittet Stella sie nur äußerst ungern. Ihre Mutter wirkt zunehmend hinfällig; zwei Kleinkinder zu beaufsichtigen, dem ist sie einfach nicht mehr gewachsen.
Kurts Mutter dagegen ist alles andere als gebrechlich. Sie bietet sich oft an, doch Stella ging es eigentlich immer gegen den Strich, ihre Schwiegermutter regelmäßig zum Babysitten einzusetzen. Es verging nie eine Woche ohne irgendeinen Seitenhieb von Elise, vornehmlich gegen berufstätige Mütter, die ihre Kleinen und deren Bedürfnisse vernachlässigen, oder, schlimmer noch, die Bedürfnisse ihrer Göttergatten. Gottlob ist Stella mittlerweile nicht mehr auf Elises Hilfe angewiesen, es sei denn, es ist mal wirklich Not am Mann.
»Mommy? Jen muss doch jetzt noch nicht weg, oder?«
Prompt stimmt Michaela in Mackenzies Gequengel ein. »Ja, Mommy! Sie hat gesagt, wir können noch mal Candyland spielen. Kannst du nicht wieder zur Schule fahren?«
Stella muss schmunzeln. »Pech gehabt, Schätzchen. Ihr werdet mich nicht mehr los.«
Kurzes Protestgeheule hebt an. Dann bricht Michaela mittendrin ab und verkündet: »Mommy, weißt du was? Jen hat einen Marienkäfer gerettet!«
»Ja!«, wirft ihre Schwester dazwischen. »Er ist direkt auf ihrem Arm gelandet. Ich wollte ihn tothauen. Aber Jen hat’s verboten.«
»Sie sagt, man darf kein Tier totmachen«, fügt Michaela hinzu. »Nicht mal so eklige Käfer. Weil ihre Mommy sie dann vermisst.«
»Da hat sie Recht«, betont Stella lobend. »Und, Jen? Hat irgendjemand angerufen?«
»Nur Ihr Mann.« Offenbar macht es dem Mädchen nicht das Geringste aus, dass Mackenzie versucht, ihr das lange blonde Haar zu einem Zopf zu flechten. »Ich soll Ihnen bestellen, er hat noch ’ne späte Besprechung. Sie sollen schon ohne ihn essen.«
Stella vergeht das Schmunzeln. Wieder so ein spätes Meeting! Schon das zweite diese Woche. Dabei ist die erst halb rum.
»Kenz!«, mahnt sie zerstreut. »Lass deine Hände aus Jens Haaren!«
Mit wem er sich heute Abend wohl trifft?
Seine Beförderung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bei seiner Bank erschien Stella damals wie ein Segen, erfolgte der Aufstieg doch genau am Ende ihres verlängerten Mutterschaftsurlaubs. Das war indes vor fast zwei Jahren, als zwar das Geld noch knapp, der Familiensinn dafür aber umso ausgeprägter war. Ihr Haushalt hatte sich gerade zahlenmäßig verdoppelt, und eine völlig benommene Stella wandelte sich schlagartig von einer ausgelasteten Mittelschullehrerin zur Dienstunfähigen mit ärztlich verordneter Bettruhe und anschließend zur Nur-Hausfrau und Mutter. Aber mal ehrlich: Zu dem Zeitpunkt ging ihr Kurt mit seinen Banker-Arbeitszeiten ohnehin auf die Nerven.
Mittlerweile ist sie wieder im Dienst und er Vizepräsident. Sie verfügen über ein Sparkonto, einen Volvo Kombi, eine wöchentlich kommende Zugehfrau sowie eben das neue Eigenheim in Orchard Hollow, erbaut im englischen Kolonialstil mit zentralem Foyer.
Ganz zu schweigen von den schnuckeligsten kleinen Mädchen auf der Welt.
Das Leben könnte nicht besser sein.
Oder?
Nach einem Blick auf die Uhr an der Mikrowelle – was, schon bald halb sechs? – kramt Stella in ihrer Brieftasche nach einem Zwanziger und einem Zehner. Jen ist seit drei Uhr bei ihren Kindern. Eigentlich nimmt sie nur acht Dollar die Stunde, aber Stella gibt ihr immer zehn und rundet zudem noch auf. Die Zwillinge sind nämlich nicht ohne. Außerdem ist es ja nur ein Nachmittag pro Woche.
»Runter von Jens Schoß, Mädels, damit sie aufstehen kann!«, befiehlt Stella. Ihre Töchter denken gar nicht daran.
Jen kichert, als Michaela ihr die Arme um den Nacken schlingt und sie fest drückt.
Nachdem sie ihre Handtasche auf die Frühstückstheke gelegt hat, stakst Stella mit den Dollarscheinen in der Hand über den von Spielzeug übersäten Teppich. Energisch zerrt sie die zappelnde Mackenzie von Jen herunter und löst mit sanfter Gewalt Michaelas Ärmchen von Jens Nacken.
»Ich weiß ja, dass ihr zwei Jen heiß und innig liebt. Aber jetzt muss sie nach Hause. Ihre Mommy macht sich bestimmt schon Sorgen, wo sie bleibt.« Und eure Mommy fragt sich, wo euer Daddy steckt, fügt sie in Gedanken hinzu. »Jen, bestell doch bitte deiner Mutter, es täte mir leid, dass es so spät geworden ist.«
»Ach, die ist gar nicht zu Hause. Sie musste um vier mit Curran zum Kieferorthopäden nach Amherst. Ehe die da wieder raus sind, vergehen immer Stunden.«
Stimmt. Kathleen Carmody hat sich neulich noch darüber beklagt, als Stella ihr zufällig im Supermarkt begegnete. Sie erwähnte, dass ihr älterer Sohn mittlerweile drei Termine in der Praxis habe und Dr. Deare seinen vereinbarten Zeiten andauernd hinterherhinke. Und dass die Zeitschriften im Wartezimmer mindestens ein Jahr alt seien.
»Vielleicht sollte ich mit dem Sticken oder Stricken anfangen«, hatte Kathleen gemeint und dabei genervt die grünen Augen verdreht. »Das steht mir nämlich noch für Jahre bevor, das mit den Terminen. Unser Zahnarzt ist überzeugt, dass Riley auch nicht ohne Zahnspange auskommen wird.« Riley ist der jüngste Spross der Carmodys.
Nur Jen nicht. Stella betrachtet bewundernd die ebenmäßigen weißen Zähne des lächelnden Teenagers. Nimmt man noch die weit auseinander stehenden braunen Augen, den feingliedrigen Wuchs und die gertenschlanke Figur hinzu, wirkt Jen wie eins dieser frisch und unverbraucht aussehenden Models. Sie hat sogar ein ganz eigenartiges Mal, vergleichbar mit Cindy Crawfords Muttermal oder Lauren Huttons lückenhaften Schneidezähnen: eine hauchdünne helle Linie, die quer durch das Goldbraun ihrer linken Augenbraue verläuft.
Im Vergleich zu ihrem Babysitter kommt Stella sich antiquiert vor. Ihr widerspenstiges Haar wird von einem schwarzen Stirnband gebändigt – einem jener Dinger, die schon vor über zehn Jahren aus der Mode kamen, außer bei den Abiturientinnen in den Neu-England-Staaten. Und die letzten zehn Kilo Übergewicht aus der Schwangerschaft halten sich hartnäckig an Hüften und Bauch – Stella will sich immer noch nicht damit abfinden, dass sie die wohl nie wieder los wird. Aus diesem Grund trägt sie statt modischen und figurbetonten Sachen nach wie vor Röcke und Tops, die sie sich in den ersten Schwangerschaftsmonaten zulegte. Sie weigert sich standhaft, neue Klamotten in Konfektionsgröße 42 zu kaufen.
Neidvoll mustert sie Jens schlanke Figur in Jeans und einem schlichten, im Hosenbund steckenden T-Shirt. Ach, wäre man doch wieder jung und schlank …
»Brauchen Sie mich eigentlich noch für Samstagabend, Mrs. Gattinski?« Jen wischt sich die Krümel von den Jeans und wirft, während sie aufsteht, das seidige Haar lässig über die Schulter.
»Samstagabend? Ach so … ja, klar! Wir haben ja das Galadiner in der Handelskammer. Hätte ich beinahe vergessen. Mein Mann holt dich um sieben ab.«
»Ich kann doch zu Fuß rüberkommen«, protestiert Jen und murmelt ein Dankeschön, als Stella ihr die dreißig Dollar in die Hand drückt.
»Bitte schön. Aber zu Fuß gehst du auf keinen Fall. Um sieben ist es schon dunkel. Ja, genau genommen …« Über Michaelas Rotschopf hinweg guckt sie hinüber zu den verglasten Schiebetüren, die auf die Terrasse und in den umzäunten Garten führen. »Es ist ja auch jetzt schon fast finster. Los, komm, ich fahre dich schnell nach Hause. Mädels, wo sind eure Jacken?«
»Ach, das ist doch nicht nötig, Mrs. Gattinski! Bis Sie die zwei eingemummelt und in die Kindersitze geschnallt haben, bin ich längst da.«
»Meinst du wirklich …?« Noch einmal blickt Stella hinaus in die sich niedersenkende Dunkelheit. Die beiden Kleinen jetzt umständlich ins Auto packen zu müssen, das ist weiß Gott keine berauschende Vorstellung, nur …
»Ich komme schon klar. Dann also bis Samstag, ihr zwei, okay?« Jen gibt den Zwillingen Küsschen auf die Wangen und geht zum Ausgang.
Sobald die Haustür zufällt, kuschelt Stella die auf ihrem Schoß sitzenden Kleinen an sich und streicht ihnen das Haar glatt. Es ist vom selben Farbton und von derselben Fülle wie ihres. Sie seufzt zufrieden. Wieder einmal geht ein langer Tag seinem Ende zu. Jetzt bloß noch bequeme Klamotten anziehen, Sweatshirt und Jogginghose oder besser noch gleich den Pyjama, und dann ab auf die Couch!
»Ich will Jen wiederhaben!«, jammert Mackenzie.
»Ich auch!«, bekräftigt das unvermeidliche Echo.
Du hättest darauf bestehen sollen, das Mädchen nach Hause zu fahren!, schilt Stella sich stumm. Abermals fällt ihr Blick auf das schattenhafte Dunkel jenseits der verglasten Schiebetüren.
So ein junges Mädchen ganz allein nach Einbruch der Dunkelheit – das ist keine gute Idee! Nicht, dass die Gegend hier die unsicherste weit und breit wäre. Nicht so wie ihre alte Straße in Cheektowaga, wo sich im Monat vor dem Umzug drei Autobrüche ereigneten. Aber trotzdem …
April Lukoviak.
Der Name schießt Stella urplötzlich durch den Kopf und hinterlässt ein ganz ungutes Gefühl.
April Lukoviak, die mit ihrer Mutter in Orchard Arms wohnt, ein Stückchen weiter die Straße hinauf, gilt schon seit Wochen als vermisst, etwa seit Anfang September. Oder war es Ende August? Gleich zu Unterrichtsbeginn nach den Ferien wimmelte es auf jeden Fall in der Siedlung von Handzetteln – billigen, von den Anwohnern des Wohnkomplexes fotokopierten Flyern, darauf das schlecht reproduzierte Schwarz-Weiß-Foto eines hübschen Teenagers mit langem, glattem blondem Haar, wie auch Jen es hat.
Anfangs waren die Mütter an der Bushaltestelle ziemlich durcheinander wegen der Geschichte. Sie behielten ihre heranwachsenden Sprösslinge argwöhnisch im Auge, insbesondere die Mädchen. Dann ging das Gerede los: April sei nicht klargekommen mit ihrer Mutter, die sich und ihre Tochter mit Lebensmittelmarken, Sozialhilfe und ihrem Lohn als Kneipenbedienung durchbrachte. Das Mädchen, so hieß es, habe damit gedroht, es werde nach Kalifornien abhauen, wo angeblich der Vater zuletzt wohnte. Anscheinend ging die Polizei davon aus, dass an diesem Gerücht etwas dran war.
Infolge der herbstlichen Regenfälle wurden die Computerausdrucke mit Aprils Personenbeschreibung immer unleserlicher. Heftige Stürme tobten vom Eriesee her übers Land, fetzten die Flyer von den Laternenpfählen und von den schlanken Jungbäumen, und wirbelten die aufgeweichten Kopien in sämtliche Himmelsrichtungen.
Hin und wieder jedoch, wenn Stella an Orchard Arms vorbeikommt oder am Autoschalter des Schnellrestaurants, in dem April jobbte, langfährt, fällt ihr das Mädchen wieder ein. Dann rätselt sie darüber nach, was ihm wohl zugestoßen sein mag, und fragt sich, ob April tatsächlich ausgerissen ist.
Wenn Jen etwas passieren würde, trügest du dafür die Verantwortung. Beim nächsten Mal lässt du dich nicht abwimmeln und fährst sie heim. Schließlich passieren auch in ansonsten ungefährlichen Vierteln schlimme Sachen!
Schon von jeher findet Jen das Rascheln von Laub unter den Füßen angenehm. So schön sogar, dass sie extra durch die Laubhaufen streift, die über die ganze Sackgasse verteilt am Fahrbahnrand liegen. Hier in Orchard Hollow gibt’s keine Bürgersteige; die Häuser sind zudem größer und neuer und stehen weiter auseinander als in Ohio County im Bundesstaat Indiana, wo jahrhundertealte Bäume im Oktober wahre Laubberge abwerfen.
Hier gibt es zwar auch Blätter, aber nicht viele. Sie stammen von einem Grüppchen alter Bäume, die während der Bauarbeiten von den Bulldozern verschont worden waren. Die frisch gepflanzten schlanken Ahornbäumchen und Eichen, die noch mit Stricken an Pflanzpfählen gestützt werden müssen, haben kaum Äste, geschweige denn viele Blätter.
»Hier gefällt es mir nicht«, hatte Riley an dem sonnigen Aprilmorgen, als sie einzogen, gemeckert. »Kein Schatten und keine Bäume. Ich will nach Hause.«
Zuvor hatte er geschlagene sechs Stunden lang in ihrem überladenen Chevrolet Kombi herumgeheult, sodass Jen am liebsten zu ihrem Vater und Curran in den hinter ihnen rollenden Mietlaster umgestiegen wäre. Jetzt aber musste Jen ihrem Bruder Recht geben. Sie vermisst Indiana schrecklich, und zwar von Anfang an. Sogar die Bäume. Nein, vor allem die Bäume!
»Wenn die Blätter sprießen, gibt’s auch Schatten«, versprach ihre Mutter, als sie den Automatikhebel auf »Parken« drückte und mit dem Abstellen des Motors das Schicksal der Familie besiegelte. Sarah Crescent Nummer 9 – eine zweigeschossige, gelb getünchte Villa im Kolonialstil mit blauen Fensterläden und Fenstern, auf denen noch die Firmenetiketten klebten – war nun offiziell das neue Familiendomizil.
Inzwischen, sechs Monate später, betrachtet Jen das Haus – und Woodsbridge – tatsächlich doch schon als so etwas wie ihr Zuhause. Besonders jetzt, da die Schule und die Fußballsaison wieder begonnen haben und der merkwürdig kühle, zumeist wolkenverhangene Sommer im Westen des Staates New York ganz allmählich in den ihr eher geläufigen und wohltuend frostigen Herbst übergeht.
Das Leben hier gefällt ihr an sich ganz gut: die Freundschaften, die sie geschlossen hat, der feste Job als Babysitterin bei den Gattinskis. Mrs. Gattinski ist eine sehr sympathische Frau, und die beiden Mädchen sind einfach allerliebst.
Schade nur, dass mir Mr. Gattinski so unheimlich ist, denkt Jen mit einem Anflug von schlechtem Gewissen. Na gut, unheimlich ist vielleicht zu viel gesagt. Bloß guckt er sie bisweilen auf eine Weise an, dass es sie kalt überläuft. Nach ihrem Eindruck mustert er sie eingehender, als das ein verheirateter Mann – und Familienvater! – bei einem Mädchen ihres Alters eigentlich dürfte. Meistens jedoch ist er gar nicht da. Und überhaupt: Die paar Minuten, in denen sie sich beim Abholen oder Nachhausebringen mit ihm im Auto geschwollen unterhalten muss, ist der Job allemal wert.
Sie merkt auf einmal, dass sie einen Mordshunger hat, und beschleunigt ihren Schritt. Nach dem Schwenk auf die Cuttington Road marschiert sie am Straßenrand entlang, wo Schlinggewächse, Buschwerk und Bäume die noch unbebauten Grundstücke begrenzen. Von hier aus hat man einen direkten Blick auf die Handvoll Häuser, die die Sarah Crescent säumen, darunter auch das der Familie Carmody, Jens Elternhaus.
Tief atmet sie den süßlich-rauchigen Duft von Laub und Kaminqualm ein. Was ihre Mutter sich wohl zum Abendessen ausgedacht hat? Vielleicht Eintopf oder Chili aus dem Crockpot, in dem man die Gerichte ganz langsam garen lässt. Und ein paar von diesen Brötchen zum Selbstaufbacken, die so schmecken wie in einem schicken Restaurant.
In Indiana hatte ihr Vater jeden Abend Überstunden gemacht, deshalb aßen sie oft ohne ihn – gebackenen Camembert oder tiefgefrorene Pizza. Doch seit dem Umzug hierher in den Osten ist ihre Mutter voll auf dem Kochtrip. Seitdem plant und entwirft sie das Abendessen für die Familie, als wollte sie die zweite Martha Stewart werden oder so. Den Sommer über war sie die Königin von Mariniertem oder Gegrilltem; seit Neustem hat sie’s mit ihrem Crockpot …
Jen zuckt zusammen, als sie hinter sich ein Geräusch vernimmt.
Vielleicht ein Hund im Gebüsch oder ein anderes Tier, denkt sie und überfliegt die anscheinend menschenleere Straße. Was, wenn …
Ob’s hier Bären gibt?
Jetzt komm aber runter!, spöttelt sie stumm, obwohl ihr Herz heftig pocht. Wir sind hier in einem Vorort von Buffalo! Nicht in der Wildnis der Rockys!
Sie marschiert zügig weiter. Nun aber nichts wie nach Hause! Ihr Blick heftet sich fest auf die vor ihr liegenden, hell erleuchteten Häuser; die Ohren hingegen richten sich auf das Buschwerk zu ihrer Linken.
Knistert da was im Dickicht? Raschelt es da im Laub? Sind das Schritte?
Jen kommt sich zwar blöd vor, kriegt es indes doch mit der Angst zu tun und verfällt in Laufschritt. Sie hastet um eine Begrenzungshecke in die Sarah Crescent – und kracht frontal mit jemandem zusammen.
Ein gellendes Kreischen entfährt ihr.
Die Person stößt ebenfalls einen Schrei aus – den schrillen Schrei einer Frau.
»Sissy!«, ruft Jen aus, als sie Maeves Putzhilfe erkennt. »Hast du mich erschreckt!«
»Und du mich erst!«
»Entschuldige.«
»Du bist doch Jane, nicht wahr? Die Freundin von Erin Hudson?«
»Jen.«
»Ach, richtig. Jen.« Die junge Frau presst sich die Rechte auf die Brust, als müsse sie so ihr Herz beruhigen. Jetzt fällt Jen auf, dass sie einen Stapel Papier in der anderen Hand hält.
Handzettel. Wahrscheinlich trägt sie neue Flyer von dem vermissten Mädchen aus. Der Gedanke an April bringt Jen in Erinnerung, wieso sie die ganze Zeit ein mulmiges Gefühl hatte.
»Was rennst du denn so?«, fragt Sissy. »Ist einer hinter dir her?«
»Ach, Quatsch, ich war nur …«, aus den Augenwinkeln sieht Jen, wie ein mit Jogginganzug bekleideter Nachbar in flottem Tempo herangetrabt kommt, »… nur ’ne Runde joggen.«
Ach, du liebe Zeit! Joggen in Jeans und Stiefeln, und mit der Büchertasche über der Schulter!
Aber Sissy sagt: »Mache ich auch – joggen. Ist ’n prima Training. Da tut man wenigstens was für die Figur.« Sie weist an sich herunter, mager, wie sie ist. Sie trägt Schlabberhosen, in denen sie immer drüben bei den Hudsons putzt. Man kann ihr Alter nicht wirklich schätzen.
Die will doch bloß nett sein!, begreift Jen. Die hat gemerkt, dass ich mich zu Tode erschreckt habe!
»Klar, hält einen fit«, bekräftigt sie, dem vorbeitrabenden Nachbarn zuwinkend.
Sie richtet den Blick auf ihr Elternhaus. Es ist das einzige nicht beleuchtete Gebäude im ganzen Straßenzug. Ihre Mutter ist noch nicht zu Hause. »Also dann«, sagt Jen zögerlich zu Sissy, »ich muss los.«
»Ich auch. Du, hör mal, braucht deine Mutter vielleicht zufällig ’ne Putzhilfe?«
»Meine Mutter?« Jen lacht. »Nee!« Dabei ist ihr durchaus bewusst, dass sie die einzige Familie in Orchard Hollow sind, die ihr Haus selbst sauber hält. Aber so will’s ihre Mutter nun mal.
»Kann ich dir trotzdem einen von meinen Handzetteln mitgeben?«, fragt Sissy. »Mein Stundenlohn ist niedrig, und ich arbeite ja schon für etliche andere Familien hier in der Gegend. Die können mich bestimmt empfehlen.«
Hoppla. Also geht’s doch nicht um das vermisste Mädchen.
Jen nimmt den angebotenen Flyer entgegen und stopft ihn in den Rucksack, wohl wissend, dass sie sich nie und nimmer die Mühe machen wird, das Ding an ihre Mutter weiterzugeben. »Nacht, Sissy.«
»Bis dann …« Sissy hält inne und schließt dann auf eine Weise den Mund, als habe sie schon wieder vergessen, wie ihr Gegenüber heißt.
»Jen.«
»Richtig. Ich werd’s mir merken.«
Damals in Indiana kannte Jen nur eine Familie mit eigener Putzhilfe: die Remingtons. Und die waren Snobs durch und durch.
Jen kann sich noch gut entsinnen, wie Melina Remington immer so hochnäsig auf die anderen Mädchen heruntergeschielt hatte. Für einen flüchtigen Augenblick wünscht sie sich, ihre Mutter würde Sissy doch zum Putzen anheuern. Aber das würde Melina Remington ja sowieso nie mitkriegen. Außerdem hält die Hausarbeit ihre Mutter auf Trab. Und je mehr sie auf Trab gehalten wird, desto weniger Zeit bleibt ihr, an Jen herumzunörgeln.
Jen rennt nicht weiter im Laufschritt nach Hause. Wenn sie langsam genug geht, so ihre Hoffnung, sind ihre Mutter und ihre Brüder vielleicht vor ihr da.
Sie hat sich geirrt!
Jen streift durchs ganze Haus, schaltet sämtliche Leuchten ein, späht hinter jede Tür, in alle Schränke und unter sämtliche Betten … nur so zur Sicherheit.
Warum tust du das?, fragt sie sich, während sie ins Wohnzimmer zurückkehrt und durchs Fenster auf die menschenleere Straße späht. Weil du allein im Hause bist? Warum solltest du nicht allein sein? Wen willst du denn schon finden? Einen durchgeknallten Killer vielleicht?
Ach, was! Natürlich nicht.
Trotzdem bleibt sie nahe beim Fenster und bei der Haustür, einem potenziellen Fluchtweg. Und ihr Atem entspannt sich erst, als sie die hellen Scheinwerfer des Wagens ihrer Mutter sieht, der in die Garageneinfahrt biegt.
»Klasse gespielt, Jen! Juchhu!« Gegen die morgendliche Oktobersonne anblinzelnd, reckt Kathleen triumphierend die Faust und winkt ihrer Tochter auf dem Fußballplatz zu.
»Mann, Mom!« Ihrem Sohn Curran, der sich vor ihrem faltbaren Nylonstuhl am Boden räkelt, ist das anscheinend peinlich. »Geht das nicht ’n bisschen leiser?«
»Deine Schwester hat schon wieder ein Tor geschossen! Ich bin halt stolz auf sie.« Mit einem schelmischen Funkeln in den grünen Augen schickt sie noch einen schrillen Schlachtruf hinterdrein und grinst, als ihr Filius genervt das Gesicht verzieht. Er trollt sich davon auf ein weiter entferntes Rasenstück und tut so, als gehöre er nicht zu ihr.
Maeve Hudson, die neben Kathleen auf einem Klappstuhl gleicher Bauart sitzt, muss lachen. Sie schiebt sich die Designer-Sonnenbrille auf ihre dunklen Locken und neigt sich Kathleen zu. »Was machst du denn, wenn der Mal Quarterback im Fußballteam der Highschool wird? Rückst du dann mit Tröte und Cheerleader-Fummel an? Damit du ihn so richtig blamierst?«
»Der und Fußball?« Kathleen schüttelt den Kopf. Sie spürt es knistern, als sich ihr Haar an ihrer Fleecejacke statisch auflädt. Es geht ihr durch und durch. Auch jetzt wieder, als sich eine Haarsträhne in einem rissigen Fingernagel verhakt.
Ihre Nägel müssten dringend gefeilt, ihr Haar mal wieder geschnitten werden. Kathleen stößt einen stummen Seufzer aus. Zuweilen ist sie drauf und dran, sich so eine Igelfrisur verpassen zu lassen, wie sie sie schon einmal zu Teenagerzeiten trug. Kurzes Haar ist einfach pflegeleichter.
Aber Matt hat’s lieber, wenn sie es lang trägt. Bei Jen übrigens auch.
Als sie eine Stunde zuvor das Haus verließen, war das Haar ihrer Tochter noch akkurat zu einem Zopf geflochten. Inzwischen haben sich lange Strähnen selbstständig gemacht, die Jen sich immer wieder ungeduldig hinter die Ohren steckt, weil sie ihr sonst beim Abstoppen in die Augen fallen.
Kaum zu fassen, dass Jen auf dem Fußballplatz ein solcher Wildfang ist, andererseits aber stundenlang das Badezimmer blockiert, um sich aufzubrezeln – vornehmlich dann, wenn andere, namentlich ihre Mutter, gern unter die Dusche möchten.
Und damit nicht genug: Kathleen ist überzeugt, dass ihre Tochter wieder einmal die Schubladen ihrer Mutter durchwühlt hat, und zwar ungeachtet der wiederholten Mahnung, sie solle sich nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis Kathleens Klamotten »borgen«. Als Kathleen nämlich am Morgen ihren gelben Lieblingspullover aus der Kommode nahm, fiel ihr ein winziger Ketchupfleck am Ausschnitt auf.
»Matt hat auch Fußball gespielt, oder?«, fragt Maeve.
Kathleens Blick schweift von ihrer Tochter hinüber zu ihrem sportlichen Gatten, der hinter den Mädchen und dem Ball über das Spielfeld trabt, die Trillerpfeife im Mund.
Ja, Matt hat Fußball gespielt. Baseball und Basketball auch. Zum Nachweis hat er eine ganze Kiste voller Pokale unten im Keller. Damals im alten Haus standen sie in seinem Arbeitszimmer auf dem Regal, aber bislang hat Kathleen noch nicht den richtigen Platz dafür gefunden. Das Familienzimmer gegenüber der Küche ist sowieso schon voll – Fernseher, Playstation, DVD-Player, Stereoanlage, Computer-Arbeitsplatz mitsamt dem ganzen technischen Zubehör wie Disketten und CDs.
»Ja, Matt hat Fußball gespielt«, sagt sie zu Maeve, »aber Curran schlägt mehr nach meiner Familie. Der ist ein typischer Gallagher, jedenfalls dem Körperbau nach.«
So, wies aussieht, wird der schmächtige Curran wohl weder die ein Meter neunzig seines Vaters erreichen noch dessen breitschultrige Statur. Ja, es schaudert Kathleen förmlich, wenn sie sich vorstellt, wie ihr elfenhafter Sohn unter einem Fleischberg aus Muskelprotzen begraben wird.
An ihrem Pappbecher Kaffee nippend, bemerkt Maeve: »Dann haben Jen und Riley wohl Currans Portion Carmody-Blut abgekriegt, was?«
Ohne näher darauf einzugehen, späht Kathleen zu ihrem Jüngsten hinüber, der sich in einigen Metern Entfernung gerade kopfüber eine Böschung hinunterpurzeln lässt. »Jetzt guck dir bloß Riley an! Er ist nachher voller Grasflecken, der verrückte Kerl, und dabei habe ich kein Fleckenmittel mehr im Hause. Wenn der die Kindheit ohne Knochenbrüche übersteht, hat er Glück.«
»Er sieht genauso aus wie Matt«, meint Maeve. »Er bewegt sich auch so.«
Stimmt. Mit den dunklen Locken und seinem temperamentvollen Naturell ist der Junge das Ebenbild seines Vaters. Und Jen …
Also, Jen sieht Matt kein bisschen ähnlich. Aber sie ist gleichwohl sein Ein und Alles.
»War das eigentlich schon Jens zweites Tor in diesem Spiel?« Maeve hat den Anstoß verpasst, weil sie erst ihren allmorgendlichen Abstecher zu Starbucks machen musste, um sich ihre Dosis Kaffee abzuholen.
»Ihr drittes.«
»Das dritte schon? Meine Güte, was tust du der ins Frühstück?«
Kathleen kann sich ein Strahlen nicht ganz verkneifen und wendet ihre Aufmerksamkeit wieder dem Spielfeld zu. Unter einem knallig blauen Himmel jagt dort eine Meute langbeiniger Mädchen mit nackten Knien, Stutzen und Schienbeinschonern das runde Leder über den grünen Rasen. Der rauchige, holzige Geruch eines Kaminfeuers mischt sich mit dem von feuchter Erde und welkem Laub.
Komisch!, denkt Kathleen, als sie den Blick quer über den Platz in die spätmorgendliche Helle schweifen lässt. Da beobachtet einer das Match von jenseits des Platzes, genau gegenüber, weit weg von den übrigen Zuschauern. Er steht am äußersten Rand der Parklichtung, vor einem Hintergrund aus Herbstlaub in seiner buntesten Farbenpracht; es sieht fast so aus, als wäre er eben erst aus dem Gehölz gekommen, das an den Sportpark grenzt.
Oder ist es eine Sie? Aus der Entfernung kann man unmöglich erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt – wegen des mantelähnlichen Kleidungsstücks, das die Person trägt.
Von den östlichen Großen Seen her weht zwar ein kühler Herbstwind herüber, aber ein Wintermantel wäre in diesem Familiengetümmel aus Fleecejacken, Jogginganzügen und Jeans doch ziemlich deplatziert. Ein Kleid oder ein Rock allerdings auch.
Während sie so gegen die Sonne blinzelt, beschleicht Kathleen eine unerklärliche, dumpfe Ahnung, die sie fröstelnd erschauern lässt. Hätte sie nur ihre Sonnenbrille nicht auf dem Armaturenbrett des Ford Explorers liegen lassen!
An sich ist an einem Zuschauer, der an der »falschen« Spielfeldseite steht und ein langes Kleidungsstück trägt, nichts Verdächtiges.
»Auf geht’s, Jen!«, brüllt Maeve, derweil Kathleens Tochter mit gekonnter Ballführung im Alleingang über den ganzen Platz dribbelt.
»Jawohl, Jen, geh!«, kreischt auch Kathleen, die vorübergehend den merkwürdig gekleideten Fremden vergisst. Schrill pfeift sie auf zwei Fingern, als Jen in den Sechzehnmeterraum eindringt. »Los, nun schieß doch!«
Über die Schulter wirft Curran ihr einen sengenden Blick zu. Sie straft ihren Filius mit Missachtung und sieht, wie der Ball auf den Kasten zufliegt … abgewehrt! Die Torhüterin des gegnerischen Teams pariert den Schuss.
»Knapp!« Maeve seufzt. »Ach, wenn meine Erin sich doch auch so für Fußball begeistern könnte! Guck sie dir an! Als könnte sie’s gar nicht abwarten, bis das Spiel endlich zu Ende ist! Damit sie nach Hause und wieder ins Bett krabbeln kann.«
Kathleen beobachtet, wie Maeves hübsche blonde Tochter hinter der manikürten Hand ein Gähnen zu verbergen versucht. »Die schlägt halt nach ihrer Mutter«, betont sie lachend.
»Ja, nur ohne den Kaffeetick«, bekräftigt Maeve und setzt ihre Sonnenbrille wieder auf. »Ich stand heute Morgen schon kurz davor, ihr mit Gewalt ’nen Espresso einzutrichtern, um sie aus den Federn zu kriegen. Sie benimmt sich, als ob ich sie foltern wollte! Dabei hat sie immer darauf beharrt, Fußball zu spielen. Und jetzt tut sie so, als wäre es meine Schuld, dass wir in dieser Herrgottsfrühe hier draußen in der Kälte hocken. Und das an dem einzigen Morgen in der Woche, an dem ich erst nach neun aufstehen müsste!«
Kathleen nickt zwar, aber Herrgottsfrühe kann man die Zeit weiß Gott nicht nennen. Und für Maeve, deren Dasein als allein erziehende Mutter wahrlich nicht stressfreier sein könnte, bringt sie nur wenig echtes Mitleid auf. Maeves Ex ist Zahnarzt; ihre zwei Jahre alte Kolonialstilvilla mit vier Schlafzimmern sowie der zwei Jahre alte Lexus sind bar bezahlt. Und dank der üppigen Unterhaltszahlungen und des Kindergeldes für Erin braucht Maeve auch keinen Finger zu rühren.
Es gibt einen neuen Angriff – diesmal einen der gegnerischen Mannschaft. Mit einem flauen Gefühl im Magen blickt Kathleen nochmals hinüber zu den Bäumen. Sie will Maeve auf den Fremden aufmerksam machen, aber der Platz vor dem Wäldchen ist verwaist.
Verdutzt überfliegt sie den Spielfeldrand. Doch von der Person, die sie vorhin gesehen hat, fehlt jede Spur. Ganz so, als habe das dichte Gehölz sie – oder ihn – wieder verschluckt.
Wieder rinnt ein kalter Schauer Kathleen den Rücken hinunter. Dieses Mal hat er nichts mit statischer Elektrizität oder ungefeilten Fingernägeln zu tun.
Natürlich klingelt genau in dem Moment, in dem Lucy sich erschöpft auf einen der Küchenstühle setzt, das Telefon. Mit wild hämmerndem Herzen springt sie wieder auf, hastet über das abgewetzte Linoleum und reißt, bevor es noch mal bimmelt, den Hörer von der Sockelstation. Henry hat nämlich Nachtschicht diese Woche und liegt schlummernd oben im Schlafzimmer.
Sie legt den Hörer ans Ohr und flüstert ein gehetztes, gedämpftes »Hallo?« Dann wartet sie mit angehaltenem Atem.
Die vertraute Männerstimme sagt nur drei Worte.
Doch es sind genau die, die sie halb hoffend, halb bangend hören wollte.
»Sie ist es.«
2. KAPITEL
»Und, Jen?« Erin lässt sich der Länge nach auf Jens zerwühltes Bett plumpsen und öffnet den Reißverschluss des mitgebrachten Kosmetikköfferchens. »Hast du den Typ heute Morgen auch wieder gesehen? Drüben am Spielfeldrand?«
»Wen denn?«
»Na, diesen komischen Vogel, der letzte Woche da schon rumgespukt ist! Vor dem Spiel, direkt am Wald! Ich schätze, das ist so ’n religiöser Spinner. Läuft in so ’ner langen Kutte rum.«
»Letzte Woche? Ich hab keinen rumspuken sehen«, betont Jen und schaut von ihrer Fingernagelpflege auf. »Du und Amber – ihr zwei wart die Einzigen, die den gesehen haben wollen!«
»Vorige Woche hing er da auf jeden Fall rum und heute wieder! Das ist bestimmt ’n Kinderschänder oder ’n Serienkiller. Wetten, dass der sich die April geschnappt hat?«
April. Das Mädchen, das zu Schulbeginn verschwand. Jen kannte sie nicht persönlich. Erin zwar auch nicht, aber trotzdem bezeichnet sie sie als asozial.
»Ich dachte, du hättest gesagt, die wäre abgehauen«, wirft Jen ein.
»Sagt meine Mom, aber das nehme ich der nicht ab. Der hat die bestimmt gekidnappt, der fiese Typ! Und dann vergewaltigt und umgebracht.«
»Du hast wohl zu viele Folgen von CSI gesehen«, bemerkt Jen trocken.
»Nicht nur ich! Amber und Rachel haben auch gesehen, wie der da heute auf der Lauer lag.«
Auf der Lauer! Was für ’n dramatischer Ausdruck! Genervt verdreht Jen die Augen.
Dann fällt ihr etwas ein. »Dass der am Sportplatz rumlungert, muss ja nicht gleich bedeuten, dass er ’n Stalker ist.« Jens Stimme klingt zwar fest, aber der Nagellackpinsel zittert doch kaum merklich, sodass etwas von dem roten Lack auf die Nagelhaut gerät.
Neulich, vor ein paar Tagen, als sie vom Babysitten bei den Gattinskis nach Hause kam, hätte sie schwören können, dass ihr einer folgt.
Vermutlich ging da die Fantasie mit ihr durch.
Vielleicht aber auch nicht.
So oder so, sie ist nicht erwischt worden.
Jedenfalls neulich nicht.
Vielleicht hat sie nur Schwein gehabt, weil vorher der Marienkäfer auf ihrem Arm gelandet war. Marienkäfer bringen nämlich Glück. Sagt ihre Mutter immer.
»Echt schade, dass du heute Abend babysitten musst«, bemerkt Erin, die ihre Nägel feilt. »Ich gehe nämlich mit Rachel ins Kino. Da läuft Anruf um Mitternacht. Soll total gut sein, der Streifen.«
»Da würde mich meine Mom sowieso nicht reinlassen«, erwidert Jen. »Auch wenn ich nicht auf die Kinder aufpassen müsste. Der ist nämlich ab achtzehn.«
Erin wirft ihr langes Haar zurück. »Soll ich meiner Mom verklickern, sie soll sich deine mal vorknöpfen? Vielleicht hört sie dann mit ihrem Geglucke auf. Meine Mom meint, deine sei manchmal ganz schön streng.«
Stirnrunzelnd fixiert Jen den Zeigefinger, an dem sie gerade pinselt. Irgendwie behagt ihr Erins Bemerkung nicht. Obwohl, ganz unrecht hat ihre Freundin nicht. Was andere Mädchen dürfen, darf Jen noch lange nicht. Ihre Mutter erlaubt ihr auch kein Handy. Oder einen Pager. Dabei haben alle so ’n Ding. Ja, sie will nicht einmal diese Anklopffunktion am Telefon installieren lassen, die während eines Gesprächs anzeigt, dass noch jemand anruft. Wenn sie das hätten, könnte Jen weiter mit ihren Freundinnen telefonieren, ohne dass ihre Eltern dauernd damit nerven, ihnen ginge ein Anruf durch die Lappen.
Auch einen eigenen PC gesteht Kathleen ihrer Tochter nicht zu. Jen muss also auf den im Familienzimmer zurückgreifen, aber da hat sie immer das Gefühl, als gucke ihr einer über die Schulter, insbesondere beim Chatten mit ihren Freundinnen.
Und was die Härte ist: Wenn sie das Haus verlässt, bestehen ihre Eltern auf einem Abschiedsküsschen, egal, ob sie bloß zur Schule geht oder zum Babysitten. Peinlich, so was. Zumal sie relativ neu sind in der Gegend. Das fehlte noch, dass die anderen sie für so ’n überbehütetes Mäuschen halten!
Sei’s drum: Dass Erins Mutter so hintenrum auf diese Art über ihre Mutter redet, gefällt ihr überhaupt nicht – auch wenn’s zu ihrem eigenen Besten ist. Mrs. Hudson zählt zu den engsten Freundinnen ihrer Mutter. Sie sind zusammen aufgewachsen und gemeinsam nach Saint Brigid’s gegangen, hatten sich allerdings nach dem Abschluss aus den Augen verloren.
Kaum waren die Carmodys nach Buffalo umgezogen, hatten Erins und ihre Mutter da wieder angeknüpft, wo sie damals als Schulfreundinnen aufgehört hatten. Was sich für Jen als Glücksfall erwies, denn in Erin Hudson, einem der beliebtesten Mädchen der Jahrgangsstufe 9, wurde ihr quasi die beste Freundin gleich mitgeliefert. Es war nämlich Erin, die sie überall herumreichte und den Trainer des Schwimmteams dazu brachte, mal fünfe gerade sein zu lassen, damit Jen im vergangenen Frühjahr noch in der Kunstspringermannschaft mitmischen durfte, obwohl die Anmeldefrist schon abgelaufen war.
Die Jugend-Bezirksmeisterschaften hatte Jen dann allein, aus eigener Kraft, gewonnen. Sie war sogar im Lokalfernsehen von Buffalo gewesen – zwar nur für ein paar Sekunden, aber immerhin; sie waren mit einem Kamerateam und Reportern angerückt und hatten von diesem regionalen Ereignis berichtet.
»Was ist nun, Jen?«, bohrt Erin nach. »Soll ich …«
»Nein, sag deiner Mutter nichts!« Jen taucht den Pinsel wieder ins Nagellackfläschchen. »Ich bin das inzwischen gewohnt mit meiner Mom. Außerdem ändert sie sich sowieso nicht. Sie meint, sie hält mich nur deshalb so kurz, damit ich nicht denselben Mist baue wie sie, als sie jung war. Bei ihr hat’s damals nämlich keinen gejuckt, wo sie sich rum trieb oder wann sie nach Hause kam.«
»So ’n Glück möchte ich auch mal haben«, brummt Erin.
»Ach, als ob du’s so schwer hättest!« Jen schüttelt den Kopf. »Deine Mom lässt dich doch machen, was du willst!«
»Aber nicht mit Robby ausgehen.«
»Ja, hallo? Der ist kriminell!«
»Ist er gar nicht!«
»Er handelt mit Drogen.«
»Mit Drogen nicht. Mit Hasch. Und kiffen tut doch jeder, also …«
»Ich nicht! Du auch nicht!« Oder kifft Erin etwa doch? Mitunter beschleicht Jen das Gefühl, als sei ihre Freundin ihr einige gewaltige Schritte voraus.
»Bei uns ist das was anderes. Aber Robby ist in der Oberstufe. Da ist man ja quasi erwachsen. Außerdem raffe ich nicht, wieso alle so ’n Theater machen, nur weil er sich hin und wieder mal ’nen Joint reinzieht.«
»Er war nicht nur high, Erin. Er ist beim Dealen erwischt worden.«
Erin verrollt die Augen. »Also, ich möchte mal gerne wissen, wie meine Mom das rausgekriegt hat. Du hast das doch nicht etwa deiner Mutter erzählt, oder?«
»Hab ich dir doch gesagt!«, faucht Jen kopfschüttelnd. »Wahrscheinlich stand es in der Zeitung.«
»Der Name doch nicht! Der kommt nicht in die Zeitung, wenn man noch keine achtzehn ist.«
»Na, ist ja nicht so, als würden die Leute hier nicht tratschen. So was spricht sich rum. Neulich hab ich zum Beispiel gehört …«
Nein. Das sollte sie nicht sagen. Das gehörte sich nicht. Schließlich kann sie Mrs. Gattinski echt gut leiden. Die gibt ihr immer ein paar Dollar extra und achtet darauf, dass beim Babysitten immer was Leckeres zum Naschen da ist.
»Was denn?«, hakt Erin nach. »Was hast du gehört?«
»Ach, nichts.«
Ist wahrscheinlich sowieso nicht wahr, redet Jen sich ein, während sie nach einem Wattebausch greift und nach dem Fläschchen mit Nagellackentferner, um sich einen roten Klecks von der Hand zu wischen. Dieses Rot, grübelt sie fröstelnd, hat haargenau denselben Farbton wie frisches Blut.
»Meinst du nicht, das Babysitten wird ihr zu viel?«, fragt Matt, als sich am Samstagabend die Haustür schließt und Jen zum am Bordstein wartenden Wagen von Kurt Gattinski eilt. »So jung, wie sie ist!«
»Sie wird in ein paar Wochen vierzehn.«
»Eben; zu jung. Sie ist ja überhaupt nicht mehr zu Hause.«
»Das war sie den ganzen Nachmittag«, stellt Kathleen klar, von der neusten People-Ausgabe aufblickend. »Wenn einer weg war, dann Riley. Der war zum Spielen verabredet.«
»Da sagst du was. Für so einen kleinen Kerl hat er zu viele Verabredungen.«
»Er ist halt beliebt.« Schmunzelnd hebt Kathleen die Schultern. »Und wie gesagt – Jen war zu Hause. Insofern sehe ich nicht ganz ein, wieso du …«
»Zu Hause schon, ja – aber in ihrem Zimmer. Mit Erin. Hinter geschlossenen Türen.«
»Mädchen in dem Alter müssen mal unter sich sein.«
»Was glaubst du, was die da drin machen?«
»Ihre Fingernägel. Die Haare.«
»Mit dem Ziel, wie Zwillinge auszusehen? Als Jen vorhin um die Ecke bog, hätte ich schwören können, dass es Erin ist. Sie hatte die gleichen Sachen an und die gleiche Frisur.«
»Ist bei Teenagern gang und gäbe, Matt«, versichert ihm Kathleen lachend. »Sie machen sich gerne gegenseitig alles nach und wollen dazugehören.«
»Dann geht’s also nur ums Aussehen?«
»Und ums Klatschen über Freundinnen. Und ums Reden über Jungs, die sie mögen. Du weißt schon … der übliche Weiberkram. Immerhin ist sie hier, wo wir sie im Blick haben.«
Seufzend zielt Matt mit der Fernbedienung auf den Fernseher.
»Weißt du noch, vorigen Winter? Da haben wir Samstagabends immer Spiele gemacht.«
»Ein einziges Mal!« Kathleen lacht wieder. »Höchstens zwei. Außerdem war es total chaotisch. Schon vergessen, wie Riley seine Spielsteine unbedingt selbst setzen wollte und das ganze Spielbrett durcheinanderbrachte? Und Curran warf Jen andauernd Schummelei vor. Sag bloß nicht, dass du das vermisst!«
»Was mir fehlt, ist, die Kinder an einem Samstagabend um mich zu haben, und zwar alle. Denn ehe wir uns versehen, hat Jen plötzlich die ersten Rendezvous. Und dann ist sie weg, aufs College …« Kopfschüttelnd bückt er sich und ruckt am Einstellhebel seines ledernen Fernsehsessels.
»Und dann heiratet sie … kriegt Kinder … und wir müssen am Samstagabend auf die Enkel aufpassen …« Kathleen befeuchtet den Zeigefinger und blättert die Zeitschriftenseite um. Auf Hochglanz strahlt ihr Jennifer Lopez entgegen, angetan mit einem tief ausgeschnittenen, perlenbesetzten Abendkleid. Kathleen schüttelt den Kopf und stellt sich vor, wie sie selbst wohl in dem Outfit wirken würde.
Ihr ausgelaugter zweiunddreißigjähriger Körper hat drei Babys ausgetragen, was die schlaffen Bauchmuskeln – und die Brüste! – deutlich bezeugen. Nicht, dass sie übergewichtig wäre. Sie trägt dieselbe Konfektionsgröße wie Jen, Jen ist nur größer und zartgliedriger; die Sachen stehen ihr einfach. Sie ist schlank, Kathleen hingegen hat schwaches Bindegewebe. Im Gegensatz zu ihrer Freundin Maeve hat Kathleen keine Lust, sich die Pölsterchen im Fitnessstudio abzutrainieren und permanent Kalorien oder sonst was zu zählen.
Die Gedanken an J. Lo und Diäten durch rasches Umblättern verwerfend, fragt sie Matt: »Hast du Hunger?«
»Du denn?«
Unschlüssig zuckt sie die Achseln. »Och, auf ’nen Happen schon.« Vor ein paar Stunden erst, nach einem verspäteten Lunch aus in der Mikrowelle aufgewärmtem Eintopf mit Rindfleisch und Eiernudeln, hätte sie glatt geschworen, das mache sie satt bis zum nächsten Tag. Jetzt allerdings …
»Soll ich uns Buffalo Wings bestellen?«, fragt Matt.
Kathleen verzieht das Gesicht. »Aber nur, wenn du sie nicht mehr so nennst. Nur Zugezogene sagen Buffalo Wings. Hier heißen sie …«
»… Wings. Einfach gegrillte Hähnchenflügel, scharf. Weiß ich. Okay, ich verspreche, dass ich mir künftig größere Mühe gebe, wie ein Alteingesessener zu reden.«
»Und ich verspreche, mal ordentlich einzukaufen und gleich morgen wieder mit dem Kochen anzufangen.«
»Es war nie die Rede davon, dass du jeden Abend was Warmes kochen sollst. Und ich hab dir auch immer gesagt, du kannst dir ruhig ’ne Haushaltshilfe besorgen, wenn du willst. Das Haus ist nun mal ziemlich groß. Das musst du nicht alles allein putzen.«
»Weiß ich, will ich aber. Ich möchte, dass die Kinder und du … dass ihr …« Sie bricht ab. Sie hat das schon so oft gesagt, dass Matt prompt den Satz für sie zu Ende spricht.
»… dass wir das haben, was du nie hattest.«
»Genau.«
»Sie haben eine Mutter, Kathleen«, betont Matt leise.
»Das weiß ich.« Die hatte sie auch. Vor langer Zeit.
Tief durchatmend, stellt sie sich mit geschlossenen Augen den so beklemmend vertrauten Duft von Teerosenparfüm vor, der in der Luft schwebt. Im Geiste blitzt ganz kurz ein grünes Augenpaar auf, funkelnd – ihre eigenen Augen im Gesicht einer Frau, die vor fünfundzwanzig Jahren starb.
Auch die Augen ihres Vaters sind grün, wenngleich von einem etwas dunkleren Moosgrün, aber funkeln tun sie nicht. Solange sie zurückdenken kann, haben sie nie jemanden lustig angefunkelt – weder Kathleen, noch seine Enkel, noch die wenigen attraktiven Altenpflegerinnen im Seniorenheim.
Das Funkeln, wenn es denn überhaupt eines gab, verlosch an jenem bedeckten Novemberabend, als sich ein Tieflader auf der eisglatten Transit Road querstellte und in den entgegenkommenden Verkehr schlitterte.
Kathleen, damals acht Jahre alt, saß mit ihrer Mutter im Auto. Im Kindersitz auf der Rückbank rechts hinter dem Beifahrerplatz angeschnallt, wurde sie ohne einen Kratzer aus dem Unfallwagen geborgen, zu jung, um sich genau an alles zu erinnern. Die Bilder in ihrem Kopf – rotierendes Blaulicht, Flammen, fremde Männer mit düsteren Mienen, Schneegestöber am nächtlichen Himmel – entstammen gewiss allein ihrer Fantasie. Schließlich stand sie ja unter Schock. Den Tod der Mutter miterleben zu müssen, das hatte sie dermaßen traumatisiert, dass sie wochenlang nicht mehr sprach.
Sie weiß das alles, weil Tante Maggie, die Zwillingsschwester ihrer Mutter, es ihr erzählt hat. Nach dem Unfall war sie aus Chicago angereist. Es gab eine Totenwache und die Beerdigung, jedoch keinen offenen Sarg. Hinter dem Lenkrad eingeklemmt, war Mollie Gallagher, als während der Rettungsversuche der Benzintank in Flammen aufging, verbrannt. Wie Kathleen später erfahren sollte, verbrannte ihre Mutter bei lebendigem Leibe und bei vollem Bewusstsein. Gott sei Dank kann Kathleen sich daran nicht erinnern.
Tante Maggie behauptet, sie hätte ihre Nichte mit sich nach Chicago nehmen wollen, aber ihr Vater habe sich quergestellt. Ihr Vater, damals Stahlkocher in mittleren Jahren, bestand darauf, dass seine Tochter bei ihm blieb. Den Grund wird Kathleen wohl niemals verstehen. Während die Jahre vergingen, würdigte er seine Tochter kaum eines Blickes und wechselte nur selten ein Wort mit ihr.
»Weil du deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten bist, Katie«, erklärte Tante Maggie dann immer mit ihrem leichten irischen Zungenschlag bei den wenigen Besuchen, die ihr Vater erlaubte. »Es quält ihn, denn jedes Mal, wenn er dich ansieht, sieht er, was er verloren hat.«
Warum hat er mich dann nicht fortgelassen? Warum ließ er mich nicht bei Tante Maggie und Onkel Geoff und meinen Cousins wohnen?
Dass sie in einem liebevollen Heim mit vier Kindern hätte aufwachsen können, mit Nestwärme und Fröhlichkeit, das tut nach all den Jahren immer noch weh. In einer Familie, in der man, solange man klein war, abends zu Bett gebracht wurde, wies sich gehörte. Und in der es, je älter man wurde, keineswegs einerlei war, wann man des Nachts nach Hause kam.
Hätte ihr Vater sie damals gehen lassen, dann wäre so manches anders gekommen.
Nur hättest du dann Jen nicht, denkt Kathleen.
»Also dann … Wings?«, fragt Matt, der seine Sessellehne wieder hochhebelt, wobei das Ding vernehmlich quietscht.
»Mit extra viel Blauschimmelkäse«, hebt sie lächelnd hervor, während sie in die Küche geht.
Ich bin ein Glückspilz, dass ich ihn habe und die Kinder und dieses Haus!
Ihr Blick schweift durch das gemütliche Familienzimmer, in dem sie am Nachmittag noch geschlagene zwei Stunden herumgewienert hat. Bewundernd überfliegt sie die weinrote Ledergarnitur, den butterfarbenen Teppich, auf dem noch die Staubsaugermuster zu sehen sind, die Wände mit der cremefarbenen Textiltapete, die sie eigenhändig gestrichen hat, und zwar in einer bestimmten Wischtechnik aus einer der Einrichtungsshows im Kabelfernsehen.
Als Maeve damals auf einen Sprung vorbeikam und Kathleen auf Händen und Knien vorfand, über und über mit Wandfarbe bekleckst, brach sie in Gelächter aus. »Für so was kannst du dir doch einen Handwerker bestellen!«, rief sie.
»Will ich aber nicht. Macht mir Spaß!«
Spaß? Darunter versteht Maeve Schönheitssalons und Fitnesstrainer. Andauernd bekniet sie ihre Freundin, sich mehr zu gönnen. In letzter Zeit redet sie ihr unaufhörlich ein, sie müsse sich eine Putzhilfe zulegen. Obwohl Kathleen gleich protestierend einwandte, für sie habe das Putzen therapeutische Wirkung.
»Schon diese Bemerkung belegt, dass du in eine Therapie gehörst!«, bekundete Maeve.
Irgendwie sind sie trotz alledem Freundinnen. Immer noch oder wieder, je nach dem, von welcher Warte man es betrachtete. Es gab ein paar Jahre, in denen Kathleen die Schulkameradin aus den Augen verlor, ebenso wie sämtliche sonstigen Bekannten aus ihrem alten Leben draußen am Stadtrand von Buffalo – ihren Vater eingeschlossen. Aber man kann eben nicht ewig davonlaufen.
Doch, kann man schon. Nur merkt man möglicherweise, dass man’s im Grunde gar nicht mehr will. Wenn Zeit und Abstand die alten Wunden geheilt und geschlossen haben und der Ehemann einen Traumjob bei einem der umsatzstärksten Unternehmen der USA angeboten bekommt, zumal ausgerechnet in der alten Heimatstadt, gelangt man eventuell zu dem Schluss, dass es Zeit wird, mit dem Davonlaufen aufzuhören,
Also?
Also nahm Matt das Angebot an, und da sind sie nun. Und im Grunde genommen geht’s ihnen bestens.
Sie setzt sich nicht mehr Tag für Tag mit unangenehmen Erinnerungen auseinander. Sie hat keine Angst mehr davor, jemand könnte sie ansehen und Bescheid wissen.
Und was ist mit Jen?
Was, wenn jemand …
Ach, Quatsch. Das geht überhaupt nicht. Das passiert auch nicht. Das kann unmöglich jemand wissen, dass …
Ein wenig aus der Fassung gebracht, zieht sie nun doch die Stirn kraus, denn urplötzlich fällt ihr wieder das Fußballspiel vom Morgen ein und diese Person, die sie da sah – oder zu sehen glaubte. Die Gestalt, die am gegenüberliegenden Rand des Spielfelds stand.
»Noch einen Weißwein?«
Stella sieht ihren Mann an, dann auf das halb volle Glas in ihrer Hand und auf das leere in der seinen. Erst überlegt sie ein schelmisches Augenzwinkern, begnügt sich indes mit einem bedeutungsvollen Schmunzeln. »Soll das ein Versuch sein, mich beschwipst zu machen? Damit ich dir später umso leichter zu Willen bin?«
»Menschenskind, Stella, was soll das?« Kurts braune Augen lassen erkennen, dass er die Bemerkung keineswegs komisch findet. Er späht erst über die eine Schulter, dann über die andere, als befürchte er, eines der Vorstandsmitglieder seiner Bank könne womöglich heimlich lauschen.
Peinlich berührt nippt Stella an ihrem Wein und verkneift sich den Blick auf ihr Spiegelbild in der verglasten Säule, neben der sie stehen. Ihr ist klar, dass ihr Kleid dadurch keine Nummer größer und ihre Taille keine Nummer schmaler wird als beim letzten Kontrollblick. Eigentlich soll schwarz ja schlank machen! Sie hat das Mittagessen ausgelassen, damit sie ohne große Verrenkungen den Reißverschluss zubekommt, dennoch kann sie eine gewisse Verlegenheit nicht unterdrücken, ist ihr doch unangenehm bewusst, dass ihr Kleid zu eng ist, von altmodisch ganz zu schweigen. Die anderen Damen im Festsaal – etliche davon Anwalts-, Bankiers- oder Arztgattinnen, viele auch selbst Banker, Juristinnen oder Medizinerinnen – kommen ihr ungleich schlanker und eleganter vor.
»Ich hol mir noch ’nen Schluck«, brummt Kurt. »Bin gleich wieder da.«
Sie spart sich die Mahnung, er möge es lieber langsam angehen lassen mit dem Whiskey. Er ist bereits unterwegs zur Bar. Aber er muss sie noch heimwärts chauffieren. Sie sieht nämlich im Dunkeln nicht gut genug, um auf der Autobahn zu fahren. Nachtblindheit, wie ihr Vater das zu bezeichnen pflegte.
Kurt hält es für Blödsinn. Er meint, wenn sie ihre Brille aufsetzt, müsste sie eigentlich prima sehen können.
Stella nippt wieder an ihrem Weinglas, verwünscht dabei stumm ihren Mann und sehnt ihren Vater herbei. Seit dessen Herzinfarkt ist zwar beinahe ein Jahr vergangen, doch trotzdem vergisst sie bisweilen, dass er nicht mehr ist. Jeder Augenblick der Erinnerung ist ein Moment, in dem sie sich aufs Neue beraubt fühlt. Einer weniger auf der Welt, der sie bedingungslos liebt.
Aber du hast ja noch deine Mutter. Und die Kleinen. Und Kurt!
Nur – bedingungslos liebt Kurt sie nicht. Zuweilen fragt sie sich gar, ob er sie überhaupt noch liebt.
Noch ein Schluck Wein! Stellas Blick gleitet forschend über die Menge, die sich in Dreierreihen vor der Bar drängt. Angeregt mit einem älteren Paar plaudernd, wartet Kurt offenbar auf seinen Drink. Sein blassblondes Haar zeigt Geheimratsecken; auch er hat in den vergangenen Jahren einige Pfündchen zugelegt. Trotzdem hat er sich prima gehalten. Damals, als sie ihm begegnete, sah er ihrem Gefühl nach aus wie ein skandinavischer Skilehrer: blond, hochgewachsen, umwerfend. Seinerzeit hätten dieselben Adjektive auch für Stella gegolten.
Heute ist sie immer noch groß und blond, aber – nein! Umwerfend auf keinen Fall, das braucht sie sich nicht einzubilden. Wenn sie jetzt ihr Spiegelbild betrachtet, fallen ihr ganz andere Eigenschaftswörter ein. Weniger schmeichelhafte: füllig, fade, ohne Pep.





























