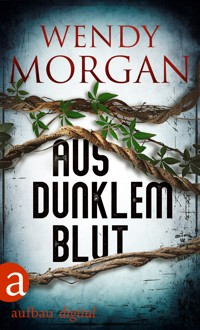8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wendy Morgan Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Townsend Heights ist die perfekte Kleinstadt: verschlafen, mit baumgesäumten Straßen und guten Schulen. Genau der richtige Ort, um sich mit ihrer Familie niederzulassen und die Kinder großzuziehen, denkt Tasha Bank. Bis man die erste weibliche Leiche findet und sich Tashas Traum vom Glück zusehends in einen Albtraum verwandelt. Als auch ihre Freundin ermordet wird, macht sich Panik in Townsend Heights breit. Bringt ein Serienkiller junge Mütter um? Und wer steht als nächstes auf seiner Liste?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Ähnliche
Über Wendy Morgan
Wendy Morgan hat englische Literatur mit dem Schwerpunkt kreatives Schreiben studiert. Nach ihrem Studium hat sie zunächst als Lektorin und Journalistin gearbeitet, um sich dann ganz ihrem Traumberuf der Schriftstellerin zu widmen. Wendy Morgan lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in New York.
Informationen zum Buch
Townsend Heights ist die perfekte Kleinstadtt: verschlafen, mit baumgesäumten Straßen und guten Schulen. Genau der richtige Ort, um sich mit ihrer Familie niederzulassen und die Kinder großzuziehen, denkt Tasha Bank. Bis man die erste weibliche Leiche findet und sich Tashas Traum vom Glück zusehends in einen Albtraum verwandelt. Als auch ihre Freundin ermordet wird, macht sich Panik in Townsend Heights breit. Bringt ein Serienkiller junge Mütter um? Und wer steht als nächstes auf seiner Liste?
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wendy Morgan
Verliebt, verlobt,verstorben
Thriller
Deutsch von Jutta Lang-Limbrunner
Inhaltsübersicht
Über Wendy Morgan
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
MITTWOCH, 10. OKTOBER
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
DONNERSTAG, 11. OKTOBER
6. Kapitel
7. Kapitel
FREITAG, 12. OKTOBER
8. Kapitel
9. Kapitel
SAMSTAG, 13. OKTOBER
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
SONNTAG, 14. OKTOBER
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Epilog
Anmerkungen
Impressum
Prolog
Komm schon, mach nicht so ein entsetztes Gesicht. Du kannst doch noch von Glück sagen, Janey.«
Glück …
Jane erfasst die Worte wie durch einen grauenhaften Nebel, der sich lähmend über ihre Sinne legt.
Glück?
Ja, denkt sie benommen, das Glück war immer auf meiner Seite. Wie oft hat sie das über die Jahre hinweg gehört, von verträumten Mitschülerinnen oder neidischen Freundinnen und sogar der eigenen Schwester?
»Mit deinen blonden Naturlocken und den großen blauen Augen hast du wirklich Glück gehabt, Jane … du Glückliche, kannst essen, was du willst, und siehst trotzdem klasse aus …«
»Du kannst von Glück sagen, deine Familie schwimmt im Geld, und du brauchst nie arbeiten zu gehen.«
»Mit Owen hast du einen Glückstreffer gelandet, Jane. Er betet dich an. Und um deine Zukunft brauchst du dir keine Sorgen zu machen …«
Owen.
Was wird er machen, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und sie noch nicht vom Joggen zurück ist? Wahrscheinlich nimmt er an, dass sie mit Schuyler und ein paar »Gymboree«-Freundinnen im Starbucks ist und völlig die Zeit vergessen hat, was in letzter Zeit schon öfter mal vorkam …
Aber nicht nach Einbruch der Dämmerung. Sie bleibt nie nach dem Dunkelwerden draußen.
Meistens badet sie Schuyler gerade, wenn Owen heimkommt. In der großen Marmorbadewanne im Elternbadezimmer macht es Schuyler besonders viel Spaß, weil sie sich in den Spiegelwänden ringsum sehen kann. Und wenn Owen den Zug um 18.44 Uhr ab Grand Central verpasst und später kommt, ist Jane mit dem Baby im Kinderzimmer, wo sie ihm Wiegenlieder vorsingt und es sanft in den Schlummer wiegt.
Großer Gott!
Owen!
Schuyler!
»Bitte …«, fleht Jane.
Sie bettelt um ihr Leben.
»Nein, Janey«, kommt die unnachgiebige Antwort. »Es tut mir Leid, aber es muss so sein.«
»Aber … warum?«, bringt sie mühsam durch ihre vor Angst klappernden Zähne hervor.
Ihr Körper zittert nun unkontrollierbar. Jane wagt es nicht, sich umzudrehen. Nur mühsam gelingt es ihr, das Gleichgewicht auf der Felsspitze, auf die sich setzten musste, zu halten. Ihre Beine baumeln über dem Abgrund. Eine falsche Bewegung, und sie würde über den Rand in den Tod stürzen, hinab auf die schroffen Felsen, die tief unten den Hudson River säumen.
Sie kann sich auch nicht umschauen. Kann den Anblick ihres geliebten Kindes nicht ertragen, ihre kleine Schuyler fest im Griff dieser Person, die ihr alles andere als fremd ist. Wie aus dem Nichts stand sie plötzlich vor ihr, als sie auf dem einsamen Pfad, der sich durch den malerischen Naturpark windet, um eine Biegung lief.
Obwohl sie verblüfft war, in dieser Abgeschiedenheit überhaupt auf eine Menschenseele zu treffen, spürte sie keinerlei Furcht. Nicht als sie erkannte, wer es war.
Sie hatte keine Angst, bis sie begriff, was vor sich ging. Dann erst wurde ihr klar, wie naiv und blind sie gewesen war. Niemals hatte sie auch nur die leiseste Ahnung von der furchtbaren Wahrheit gehabt.
Weshalb hatte sie niemals den Verdacht geschöpft, dass solch ein teuflisches Wesen in ihrer vertrauten, überschaubaren Kleinstadtidylle hausen könnte? Dass ganz in ihrer Nähe ein Ungeheuer lauerte – hinter einer überzeugend harmlos wirkenden Maske –, das zufällig wie jedermann aussah, sich wie jedermann verhielt und nie auch nur den Anschein von Bösartigkeit verriet … bis jetzt.
Und jetzt ist es zu spät.
»Du weißt doch, weshalb ich das tun muss, Janey.«
Im Gebrauch ihres Spitznamens schwingt eine spöttische Vertrautheit.
Jane ist speiübel und schwindelig. Als würde sie jeden Moment in Ohnmacht fallen.
Nein! Nicht ohnmächtig werden! Sonst fällst du hinunter … Und wenn du fällst …
»Du weißt, was du getan hast, Janey. Jetzt musst du dafür bezahlen.«
Wenn du fällst, bist du tot.
»Nein! Bitte …«
»Spring, Janey. Spring einfach.«
»Nein …«
»Wenn du nicht springst, lass ich sie fallen.« Die Stimme klingt kalt und ruhig.
Jane spürt eine Bewegung hinter sich. Aus den Augenwinkeln sieht sie die Hände, die ihr geliebtes Kind gepackt halten. Die Arme sind jetzt ausgestreckt, halten ihr Baby wie eine Opfergabe über den Abgrund.
Schuyler beginnt zu wimmern. Es hört sich an, als schreie sie nach ihrer Mama.
Mahhh-mahhh.
Jane fährt das Wimmern wie ein Messerstich durch den Leib. Mit größter Mühe hält sie sich aufrecht und widersteht dem Impuls, sich umzudrehen und das Kind den todbringenden Klauen zu entreißen.
Es wäre zwecklos. Sie würde das Gleichgewicht verlieren und in die Tiefe stürzen und Schuyler womöglich mit sich reißen.
»Du hast versprochen, ihr nichts zu tun«, sagt sie. Sie findet ihre Sprache wieder, hört die fremdartige Hysterie in ihrer Stimme. »Du hast es versprochen.«
»Richtig. Und du weißt, ich werde ihr nicht wehtun. Solange es nicht nötig ist. Also, spring endlich! Wir werden Mama auch brav winken, nicht wahr, Schuyler? Danach setz ich sie wieder in ihren Buggy, decke sie schön zu und schiebe sie den ganzen Weg zurück, damit man sie leichter findet. Das mach’ ich für dich, Janey Okay?
Betrachte es als Abschiedsgeschenk. Und jetzt, tu was ich dir sage!«
»Mein Gott …« Ihre Stimme bricht, Angst schnürt ihr die Kehle zu. Passiert all das wirklich?
Ist dies das Ende?
Muss ich wirklich sterben?
Ja.
Hier.
Jetzt.
»Du hast Glück, Janey … nicht so wie die anderen. Es ist nicht so … eine Schweinerei.«
Sie versucht, das panische Entsetzen abzuschütteln, will verzweifelt einen klaren Gedanken fassen, um einen Ausweg zu finden, einen Funken Hoffnung.
Vielleicht kommt zufällig ein Jogger vorbei …
Doch sie ist zu weit vom Weg entfernt. Hier gibt es nur ein Gewirr von Bäumen und Kletterpflanzen, Vögel und Eichhörnchen und diese Felswand, die den Park im Westen begrenzt und jäh zum Fluss abfällt.
Den Sturz in die Tiefe wird sie nicht überleben.
Selbstmörder überleben nie.
Man wird ihren aufgeschwemmten, zerschmetterten Körper im Fluss finden – wie viele andere Tote zuvor, zumeist Teenager, lebensmüde Kinder, die den verzweifelten Familien Abschiedsbriefe hinterließen.
Ob Owen glaubt, sie sei freiwillig gesprungen?
Wird Schuyler wohl in dem Bewusstsein aufwachsen, ihre Mutter habe sie im Stich gelassen?
»Denk doch mal nach, Janey. Die anderen mussten richtig leiden.«
Die anderen?
Sie kann sich nicht konzentrieren.
Kann an nichts anderes als an Schuyler denken. Und an Owen.
Sie brauchen mich.
Ihre Finger krallen sich verzweifelt in das raue, bröckelnde Gestein.
Dreh dich nicht um!
Schau nicht nach unten!
»Du musst nicht leiden wie die anderen. Nur ein paar Sekunden, dann ist alles vorbei.
Du wirst gar nichts spüren.«
Jane öffnet den Mund, um erneut um ihr Leben zu betteln.
»Spring!«, brüllt die Stimme auf einmal. »Mach schon! Ich hab’ nicht den ganzen Tag Zeit. Spring!«
»Nein … bitte … Ich kann nicht«, stammelt sie, die Stimme brüchig und zitternd vor Angst.
Stille.
Kein Ton ist zu hören. Nur das Rauschen der Bäume im Wind.
Dann, hinter ihr, plötzlich ein tiefer, beunruhigender Seufzer. »Wie du willst, Janey. Wenn du nicht springst, werf ich deine Tochter vor dir hinunter. Das wird dich auf Trab bringen.
Du kannst ja versuchen, als Erste unten anzukommen und sie aufzufangen, okay?«
Jane wendet den Kopf, als ein böses Lachen ihr in den Ohren gellt. Langsam dringt die Bedeutung der Worte in ihr Bewusstsein.
Von Entsetzten gepackt, sieht sie, wie sich die Hand erneut um Schuylers rundliches Ärmchen schließt.
Das Baby schwingt, an einem Arm gehalten, über dem Abgrund.
Das klägliche Wimmern geht in gellendes Geschrei über.
Ihr Kleines schreit!
Sie muss das Kind retten!
Ich muss Schuyler retten. Muss alles tun, was von mir verlangt wird. Alles. Schuyler darf nichts geschehen.
»Eine letzte Chance zu springen gebe ich dir noch, Janey. Wenn du dann nicht springst, lass’ ich sie fallen.« Emotionslos übertönen die Worte das Schreien des verängstigten Kindes.
»Maaaaah-maah!«
OhmeinGottmeinGottmeinGott …
Nicht umdrehen.
Nicht nach unten schauen.
»Schuyler«, schluchzt sie auf, bevor sie sich mit einem herzzerreißenden Schrei und einem Stoßgebet – für ihr Kind und ihre eigene Seele – mit den Händen vom Felsen abstößt und ins Leere stürzt.
Sie fällt …
Fällt. Bilder schießen ihr durch den Kopf, scheinen auf wie Blitzlichter.
Ihr Elternhaus in Scarsdale, eine herrschaftliche Villa im Tudorstil …
Ihre Pferde, das Puppenhaus, ihr Himmelbett …
Daddy, noch zu seinen Lebzeiten, jung und gut aussehend, wie er in der Auffahrt aus dem Rolls-Royce steigt, die Arme nach ihr ausstreckt, sie hochhebt und im Kreis herumwirbelt …
Owen, jung aussehend, im Cutaway vor dem Altar. Er lächelt sie an, während sie in der blumengeschmückten presbyterianischen Kirche auf ihn zu schreitet.
Ihr viktorianisches Haus am Harding Place mit 18 Zimmern und einer Dreifachgarage, mit dem Kinderzimmer, das sie selbst gestrichen hat, in einem lichten, zarten Gelb, weil sie nicht wussten, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden würde …
Und dann endlich Schuyler als Neugeborenes, noch klebrig vom warmen Blut, ein zitterndes, sich windendes Bündel in ihren Armen …
Bevor ihr Körper auf den mitleidlosen, spitzen Felsen aufschlägt und zerschmettert wird, hat Jane Armstrong Kendall noch einen letzten Gedanken: Ihr Glück hat sie am Ende doch verlassen …
Genau wie sie es schon immer hatte kommen sehen.
MITTWOCH, 10. OKTOBER
1
Okay, Kinder, Mommy zieht sich nur eben schnell an. Bin gleich wieder da«, ruft Tasha Banks über die Schulter, während sie flink das Sicherheitsgitter am Treppenabsatz in der Diele öffnet.
Rasch schließt sie den Riegel von der anderen Seite und läuft, zwei Stufen auf einmal nehmend, die mit Teppich belegte Treppe hinauf.
Sie hat die Kinder im großen Wohnzimmer, das sich im hinteren Teil des Hauses befindet, allein gelassen.
Um den sechsjährigen Hunter braucht sie sich keine Sorgen zu machen. Der sitzt im Schneidersitz auf dem Boden vor dem Fernseher und ist in die Zeichentrickserie Pocket Dragons vertieft.
Victoria, die Dreijährige, ist im Moment zwar mit ihren Buntstiften beschäftigt, doch Tasha traut ihr nicht ganz. Kürzlich hat sie Max mit einem Plastikhammer auf den Kopf geschlagen und erklärt, sie spiele Werkstatt. »Ich bin der Arbeiter, und Max ist der Nagel«, sagte sie trotzig, als Tasha sich den elf Monate alten hilflosen Max schnappte, um seinen zarten kleinen Kopf auf Wunden zu untersuchen.
Ein paar Minuten kann ich die Rasselbande wohl allein lassen, denkt Tasha und hebt zwei schmutzige Kindersöckchen vom Boden auf.
Als sie letztes Jahr im November mit Max aus dem Krankenhaus nach Hause kam, akzeptierte Hunter das neue Familienmitglied sofort, was Tasha nicht weiter überraschte. Hunter war immer schon problemlos gewesen und reagierte auf Neues stets gelassen. Auch die Rolle des großen Bruders akzeptierte er von Anfang an ohne Schwierigkeiten.
Dabei rechneten sie und Joel durchaus mit Problemen, als sie Hunter kurz nach seinem zweiten Geburtstag eine kleine Schwester präsentierten, da sie schon so viel über Geschwistereifersucht gelesen hatten. Doch Hunter reagierte sehr lieb und verständig, als er Mommy und Daddy plötzlich mit Victoria teilen musste. Als Max kam, lief es genauso problemlos. Wenn Tasha sich um das Baby kümmern und Hunter warten musste, beschäftigte er sich selbst. Er schaute sich ein Buch an oder spielte mit seinen Bauklötzen, bis sie Zeit für ihn hatte.
Doch nicht Victoria.
Als Max im letzten Jahr seinen Einzug hielt, war sie offensichtlich bestürzt. An Tashas erstem Tag nach dem Krankenhausaufenthalt sprach Victoria kein einziges Wort mit ihr. Mit der Zeit wurde sie zwar wieder zugänglicher, doch immer, wenn Tasha das Baby stillte, musste Victoria unweigerlich irgendetwas haben. Sofort. Wenn Tasha sie bat zu warten, bekam sie einen Wutanfall.
Sie hat ihren Zorn jedoch noch nie an Max ausgelassen, sondern stets an Tasha und Joel. Das Baby liebt sie über alles.
Zumindest sieht es so aus, sagt sich Tasha, steckt den Kopf ins Kinderbadezimmer und wirft die Socken in den überquellenden Wäschekorb.
Letzte Woche konnte sie gerade noch verhindern, dass Max mit dem Kopf gegen die Kante des Couchtisches schlug. Als er mit seinen neuen Laufschuhen herumkrabbelte, versetzte Victoria ihm einen Stoß. Natürlich machte die Kleine ein unschuldiges Gesicht und behauptete, sie habe ihm nicht wehtun wollen, sondern nur umarmen.
»Sie hat gelogen, Joel«, hatte Tasha abends ihrem Ehemann erzählt und sich maßlos darüber aufgeregt. »Und, hast du sie bestraft?« »Ich habe ihr für den Rest der Woche ihre Lieblingsvideos gestrichen.«
»Wie grausam von dir«, sagte er grinsend. »Das wird ihr eine Lehre sein.«
»Aber ich bezweifle, dass es ihr wirklich Leid tut. Sie erkennt wohl gar nicht, wie weh sie ihm hätte tun können.«
»Eifersucht unter Geschwistern ist etwas ganz Normales, Tasha. Das legt sich. Außerdem hat Max einen harten Kopf. So leicht bringt ihn nichts aus der Fassung. Er krabbelt auf eine Wand zu, schlägt sich den Kopf an und lacht.« Joel verschwand hinter der Kleiderschranktür, um seinen Anzug hineinzuhängen, und Tasha wusste, dass das Thema damit für ihn erledigt war.
Schon lange ärgert sie sich darüber, wie Joel in letzter Zeit alles, was mit den Kindern oder ihrem Hausfrauendasein zu tun hat, leichthin abtut, weil er durch den Stress bei der Arbeit keinen Nerv für solche Dinge hat.
Vielleicht liegt es aber auch an ihr. Vielleicht mache ich wirklich aus jeder Mücke einen Elefanten. Das hatte er ihr nämlich vorgeworfen, als sie gestern Abend die Auseinandersetzung mit dem Kundenservice der Kabelfernsehgesellschaft Wort für Wort wiederholte. Tasha hatte sich darüber beschwert, dass diesen Monat zwei Dollar zu viel abgebucht wurden. Sie war so wütend über das Gespräch, dass sie sich schriftlich darüber beschweren wollte.
»Ist die Sache geklärt?«, unterbrach Joel sie.
»Ja, aber darum geht es gar nicht. Ich habe die Frau höflich gebeten, die Rechnung noch mal zu überprüfen, und sie hat sich aufgeführt, als würde ich weiß Gott was von ihr verlangen. Dabei war es deren Fehler, und zwei Dollar sind zwei Dollar.«
»Der Betrag wird uns gutgeschrieben oder nicht?«
»Ja, aber …«
»Dann lass es dabei bewenden.«
Das war der Moment, wo er ihr sagte, dass sie in letzter Zeit dazu neige, sich über alles und jeden aufzuregen – nicht nur über die Frau vom Kundenservice.
Tasha fühlte sich sofort angegriffen. »Was für Dinge?«, fragte sie unwirsch.
Ganz beiläufig – und das war es, was sie schier verrückt machte – sagte er dann, er habe das Gefühl, sie überfalle ihn jeden Abend mit einer neuen Katastrophe. Entweder hätte eines der Kinder etwas angestellt oder dieses und jenes im Haus müsse dringend repariert werden.
»Weißt du, Tash, ich bin hundemüde und erledigt, wenn ich abends um acht Uhr nach Hause komme. Ich habe einen anstrengenden Tag im Büro hinter mir und dann noch die lange Zugfahrt, eine Stunde von Grand Central …«
»Ich bin genauso erschöpft:!«, fiel sie ihm erregt ins Wort. »Glaubst du vielleicht, so ein Tag mit den Kindern ist nicht anstrengend?«
Sie kamen gar nicht dazu, weiter darüber zu streiten. Victoria stand im Nachthemd in der Tür und behauptete steif und fest, ein großes lila Ungeheuer mit langen, scharfen Zähnen verstecke sich in ihrem Kleiderschrank. Joel brachte sie zurück ins Bett.
Während Tasha Hunter bei den Hausaufgaben half, wärmte sich Joel den Chili auf, den Tasha zum Abendessen gekocht hatte, und schlang ihn hinunter. Und als sie Hunter zu Bett gebracht hatte und ins Wohnzimmer zurückkehrte, war ihr Gatte im Fernsehsessel bereits eingeschlafen und schnarchte, während das Endspiel der Yankees lief.
Tasha eilt nun ins Schlafzimmer und verzieht das Gesicht beim Anblick des ungemachten Himmelbettes und des grässlichen Durcheinanders. Es gibt keinen Flecken, auf dem sich nichts türmt.
Nicht einmal Zeit zu duschen hatte sie heute Morgen, bevor die Kinder wach wurden und sie brauchten.
Man möchte meinen, ein erwachsener Mann könnte hin und wieder sein Bett machen. Nicht so Joel. Es scheint ihn nicht zu stören, sich abends ins zerwühlte Bett zu legen.
Tasha macht den Fernseher an, um den Wetterbericht zu hören.
Denn sobald sie Hunter zur Schule gefahren hat, möchte sie mit Victoria und Max zum Spielplatz im High Ridge Park gehen.
Aber inzwischen sieht es nach Regen aus.
Sie schaltet um auf Kanal vier, legt die Fernbedienung auf den Nachttisch und schüttelt die Kissen und Bettdecken auf. Dann zieht sie rasch die Laken glatt und breitet die creme- und rosafarbene Tagesdecke darüber.
Joel kaufte ihr die Patchworkdecke im ersten Jahr ihrer Ehe, während eines Wochenendurlaubs im Pennsylvania Dutch Country.
Sie erinnert sich noch genau, wie überrascht sie war, als er gerade diese Decke aussuchte.
»Sie ist rosa«, sagte sie und fuhr mit den Fingern über den handgenähten Quilt.
»Ich weiß. Du liebst doch Rosa.«
»Aber du kannst die Farbe nicht ausstehen.«
»Das ist in Ordnung. Ich liebe dich«, sagte er und hauchte einen Kuss auf ihr Haar.
Im Fernsehen diskutieren Matt Lauer und Katie Couric über Newcomer in der Wirtschaft, als die Nachrichtensendung mit Ann Curry eingeblendet wird.
Es dauert also noch ein paar Minuten, bis der Wetterbericht kommt. Tasha stellt den Ton ab, um mitzubekommen, was unten vor sich geht.
Bis jetzt verhalten sich die Kinder ruhig.
Im Hintergrund ist nur Hunters Zeichentrickserie zu hören.
Bevor Tasha nach oben ging, setzte sie Max mit ein paar Spielsachen in den Laufstall, und Victoria saß an ihrem Kindertisch und malte in ihrem Malbuch.
Doch was ist, wenn Victoria sich nach Tashas Abwesenheit direkt auf Max gestürzt hat? Normalerweise passt Hunter auf seine Geschwister ganz gut auf. Nicht jedoch, wenn der Fernseher läuft.
Tasha wirft die herzförmigen Zierkissen aufs Bett und rennt auf den Gang hinaus. »Was macht ihr drei?«, ruft sie, über das Treppengeländer gebeugt.
Stille.
»Hunter?«
»Was ist, Mommy?«
»Ist alles in Ordnung da unten?«
»Ja-aa.«
»Was macht Max?«
»Der beißt in seine Rassel.«
»Und Victoria?«
»Sie malt.«
»Ich bin in einer Minute bei euch. Halt einstweilen die Stellung, okay?«
»Welche Stellung?«
Sie lächelt. Hunter nimmt gerne alles wörtlich.
»Pass einfach ein bisschen auf, okay?«
Sie eilt zurück ins Schlafzimmer und sammelt Joels Pyjamahose und sein T-Shirt vom Boden auf und wirft sie im blau-weiß gefliesten Badezimmer in den Wäschekorb. Auch der quillt bereits über. Schon gestern wollte sie sich die Wäsche vornehmen, aber sie kam nicht dazu. Es war wieder einer jener Tage gewesen, an denen sie so gut wie nichts schaffte, was sie sich vorgenommen hatte.
Wieder im Schlafzimmer geht sie zum Fenster gegenüber dem Bett und zieht die elfenbeinfarbene Jalousie hoch. Der Himmel ist in ein milchig-graues Licht getaucht, das eher nach März als Oktober aussieht.
Vom Fenster aus sieht man in den großen, schattigen Garten, der von einer Reihe hoher Rhododendronbüsche begrenzt wird. Verwüstet vom Rotwild, das regelmäßig aus dem angrenzenden Wald kommt, bieten die Büsche keinen schönen Anblick. Doch die voll erblühten Chrysanthemen im Blumengarten sind eine Pracht. Tashas Blick wandert weiter zu der Holzschaukel, die sie nach Joels letzter Beförderung für die Kinder gekauft haben, und zu dem neuen grünen Ford in der Einfahrt.
Und ganz im hintersten Winkel des Gartens befindet sich der Gemüsegarten der Kinder. Zwar haben die Rehe und Hirsche die letzten Tomaten und Bohnen schon längst gefressen, die Krönung des Beetes jedoch blieb unbeschadet: ein riesiger Kürbis, den Hunter und Victoria aus Samen selbst gezogen haben.
Monatelang haben die Kinder den Kürbis, den Tasha mit einem Netz bedeckte, gehegt und gepflegt. Nun wollen sie ihn dieses Wochenende beim alljährlichen Herbstfest zum Kürbiswettbewerb einreichen.
Vom Schlafzimmerfenster aus sieht man durch die Bäume noch zwei weitere Häuser im Kolonialstil. Sie sind weiß mit schwarzen Fensterläden. In dem einen wohnen die direkten Nachbarn der Banks, die Martins, das andere, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, gehört den Leibermanns. Tashas und Joels Haus unterscheidet sich nur durch die grünen Fensterläden.
»Ach Joel, lass’ uns doch mal aus der Reihe tanzen«, hatte Tasha ihn im Sommer vor zwei Jahren gedrängt, als sie im Baumarkt standen und überlegten, ob sie bei Schwarz bleiben oder zu Grün greifen sollten, als der Neuanstrich der Türen und Fenster anstand.
»Warum sollen wir nicht etwas anderes wagen?« Sie nahm einen Pinsel aus dem Regal und kitzelte ihn an der Nase.
»Komm, du Frosch, spring über deinen Schatten und nimm Grün!«
»Du machst dich über mich lustig, Tash«, sagte er beleidigt.
»So? Und was ist mit dir? Du hast dich doch gestern über mich lustig gemacht, als ich den Salat, den Ben und Jerry mitbrachten, ganz allein verdrückte«, konterte sie und kniff ihn in den Arm.
»Es sah aber auch zu komisch aus, wie du mit der Schüssel auf dem dicken Bauch dagesessen und in dich hineingeschaufelt hast, als hättest du wochenlang nichts zu essen bekommen.«
»Ich bin schwanger«, verteidigte sie sich und fügte wie üblich hinzu: »Ich muss schließlich für zwei essen.«
»Zwei was?«, pflegte er darauf scherzhaft zu erwidern, und sie stimmte in sein Lachen ein.
Mein Gott, es scheint eine Ewigkeit her zu sein, seitdem wir das letzte Mal so unbeschwert waren, denkt Tasha nun und wendet sich vom Fenster ab. Joel ist immer so weit weg, hat nur seine Arbeit im Kopf. Und ich bin …
Ja, was eigentlich?
Beschäftigt?
Natürlich. Drei Kinder halten einen auf Trab. Aber das ist es nicht allein. Sie ist nicht nur beschäftigt, sie ist auch ständig … rastlos. Tasha seufzt und sieht wieder auf den Bildschirm. Al Roker ist endlich dran und bringt den Wetterbericht. Sie macht die Lautstärke wieder an und erfährt, dass für später Sonnenschein und Temperaturen bis zu 12 Grad Celsius zu erwarten sind. Nicht gerade umwerfend, aber auch nicht schlecht für Mitte Oktober im Nordosten.
Es ist wirklich höchste Zeit, die Wäsche zu waschen, sagt sie sich, als sie eine Schublade der Wäschekommode öffnet und sieht, dass sie fast leer ist. Sie nimmt eine Levi’s heraus, die sie schon eine Weile nicht mehr getragen hat, und stellt stirnrunzelnd fest, dass sich der Reißverschluss nicht so leicht schließen lässt, wie er sollte. Die letzte Schwangerschaft liegt fast ein Jahr zurück. Nur noch ein paar Wochen, und ihr Bauch kann endgültig nicht mehr als »Babybauch« entschuldigt werden – zumindest nicht nach ihren eigenen Ansprüchen.
Als sie mit Hunter schwanger war, nahm sie 30 Pfund zu, die sie sechs Monate nach der Geburt wieder verlor. Mit Victoria waren es 40 Pfund, und es dauerte fast ein Jahr, bis sie ihr altes Gewicht wiederhatte. Doch selbst dann passten ihr die verwaschenen Lieblingsjeans und die engen Sommerkleider wieder, wenn auch alles ein bisschen knapper saß als früher. Aber dieses Mal nahm sie 55 Pfund zu, von denen sie immer noch zehn mit sich herumschleppt. Vielleicht sollte sie eine Diät machen? Und Fitnesstraining. Aber wer hat mit drei Kindern schon Zeit für Fitnesstraining?
Bei den ersten beiden Kindern brauchte sie weder eine Diät noch ein besonderes Training. Die Pfunde purzelten wie von selbst.
Mit Hunter lebten sie noch in der Stadt, und da ging sie jeden Tag zu Fuß zur Arbeit, 25 Blocks die Third Avenue hinunter zum Verlag, wo sie als Cheflektorin für Unterhaltungsliteratur zuständig war. Sie hatte so viel zu tun, dass sie sich in der Mittagspause nur schnell eine Banane oder einen Magerjoghurt aus dem Supermarkt an der Ecke holte.
Als Victoria unterwegs war, zogen sie hierher nach Townsend Heights. Es lohnte sich dann nicht mehr, dass sie zur Arbeit ging, da eine Kindertagesstätte oder eine Tagesmutter im Westchester County ein Vermögen kostet. Die Betreuung der Kinder hätte praktisch ihr gesamtes Gehalt verschlungen. Und da Joel ohnehin eine Sprosse nach der anderen auf der Karriereleiter nach oben kletterte, verdiente er bald so viel, dass ihr fehlendes Gehalt in Kürze ausgeglichen war.
So war Tasha nach dem Umzug also »nur« Hausfrau und Mutter geworden. Sie war es gerne.
Damals war sie richtig glücklich und zufrieden, fühlte sich ausgefüllt mit ihren zwei Kindern und dem neuen Haus. Nach dem winzigen Apartment in der Stadt kam es ihr wie eine Villa vor. Jetzt freilich, nachdem der Reiz des Neuen verflogen ist, wirkt es längst nicht mehr so gigantisch und außergewöhnlich, vor allem nicht für Tasha, die in einer viktorianischen Villa in Centerbrook in Ohio aufgewachsen ist. Ihr Elternhaus, in dem ihre verwitwete Mutter immer noch lebt, ist voller Erkerfenster und Winkel, voller Balkone, Bögen, Bleiglasscheiben und hölzerner Ornamente.
Das Haus der Banks ist vom Grundriss her fast identisch mit den anderen Häusern in der Orchard Lane. Die Räume, Fenster und Türen sind ausnahmslos rechteckig. Betritt man das Haus, steht man in der gefliesten Diele. Rechts geht das kleine Wohnzimmer ab und links das Esszimmer. Gegenüber der Haustür führt eine Treppe direkt in den ersten Stock; darunter befindet sich ein kleines Gäste-WC. Im hinteren Teil des Hauses ist ein relativ großzügiger Wohn- und Küchenbereich mit offenem Kamin und Glasschiebetüren, die auf die Terrasse hinausführen. Im ersten Stock befinden sich drei kleine Kinderzimmer, ein bis unter die Decke reichender Wäscheschrank und das Kinderbadezimmer. Am Ende des Flurs liegt das Elternschlafzimmer mit angrenzendem Badezimmer.
Nein, es ist mit Tashas Elternhaus nicht zu vergleichen. Es hat nicht diesen unverwechselbaren Charakter, und es fehlt die gewisse Atmosphäre. Obwohl Tasha ihr Bestes getan hat, diesem Haus eine persönliche Note zu geben und es zu ihrem Zuhause zu machen. Sie tapezierte und strich fast alle Zimmer selbst und nähte bunte Vorhänge für die Kinderzimmer.
Wie sie diese Zeit genossen hat! Wie glücklich sie damals war, fernab vom Getriebe der Großstadt ein kleines, behagliches Nest für sich und ihre Familie zu bauen. Keine Sekunde lang vermisste sie die Hektik in der Stadt, den Stress im Verlag oder die Geschäftsreisen …
Sie weinte ihrem früheren Leben keine Träne nach.
Doch jetzt …
Mittlerweile fragt sie sich, ob es nicht ein Fehler war, all dies aufgegeben zu haben. Wäre es nicht wieder einmal schön, sich chic zu machen? Morgens in ein elegantes Kostüm zu schlüpfen, Make-up aufzulegen und sich zu frisieren, um dann schnell zum Zug zu laufen und in die Stadt zu fahren? Sie könnte dann ganz gemütlich im Zug ihre Zeitung lesen und einen Kaffee trinken, ohne ständig gestört zu werden. Kein Kindergeschrei, keine vollen Windeln, keine verschüttete Milch, nicht dieses ewige Kindergedudel aus dem Fernseher oder Kassettenrekorder …
Gerade das, was man nicht hat, erscheint einem am erstrebenswertesten …
Das hatte Joel gesagt, als sie kürzlich laut darüber nachdachte, wie es wäre, wieder zur Arbeit zu gehen.
»Das willst du nicht wirklich, Tasha. Glaub mir. Du hast es gut, dass du nicht mehr dem Druck bei der Arbeit ausgesetzt bist.«
»Ich weiß, Joel, aber …«
»Schau, ich würde liebend gern mit dir tauschen. Ich gäbe alles darum, zu Hause bleiben zu können, anstatt jeden Morgen nach Manhattan zu hetzen und diesen fürchterlichen Stress zu haben.«
Stress.
Er scheint über nichts anderes mehr zu reden. Jeden Abend stöhnt er über den Stress in seiner hektischen Werbeagentur, in der er vor Jahren seine Karriere begann. Er fing als Rechnungsprüfer an, stieg dann stetig erst zum Kundenbetreuer und schließlich zum Teamchef auf. Im vergangenen Frühjahr wurde ihm dann die Stelle des stellvertretenden Firmenchefs angeboten, und er übernahm zusätzlich zu dem großen Kosmetikkonzern, den er schon länger betreute, einen neuen Kunden aus der Schnellimbiss-Branche. Seitdem wird Joel von seiner Arbeit völlig vereinnahmt. Die hohe Gehaltserhöhung müsse er sich erst mal verdienen, pflegt er zu sagen. Das heißt offensichtlich, fast jeden Abend spät nach Hause zu kommen, bergeweise Akten mitzubringen und manchmal sogar am Wochenende ins Büro zu fahren.
Außerdem ist er viel öfter auf Geschäftsreise als früher. So auch nächstes Wochenende, wo er am Sonntagabend schon wegen eines für Montagmorgen angesetzten Meetings nach Chicago fliegen muss. Tasha ist jedes Mal Bange, wenn Joel nicht da ist, da sie nachts nicht gerne allein im Haus ist. Er sagt, das komme daher, weil sie noch nie allein gelebt habe. Nachdem sie zu Hause ausgezogen war, lebte sie in einem Studentenwohnheim, wo sie sich das Zimmer mit einer Kommilitonin teilte. Danach lebte sie in einer Wohngemeinschaft mit drei weiteren Frauen. Zu viert bewohnten sie ein winziges Apartment in Manhattan. Als Neuling im Verlag musste jede von ihnen mit einem mickrigen Anfangsgehalt auskommen, und so blieb nur die Wahl zwischen einem kleinen Häuschen in einem öden Kaff außerhalb der Stadtgrenzen New York Citys oder gar in Jersey, was gänzlich unerträglich gewesen wäre, und jenem Ein-Zimmer-Apartment in Downtown Manhattan. Das Leben in der Wohngemeinschaft war gar nicht so schlecht. Man hatte immer jemanden, mit dem man reden konnte, wenn einem danach war, und nachts war man nie alleine.
Es heißt ja, in Bars lerne man keine netten Männer kennen. Doch ausgerechnet in einem Pub begegneten sich Tasha und Joel zum ersten Mal. Er war mit ein paar Freunden zusammen – allesamt gut aussehende, geschniegelte Werbefritzen, die noch zu haben waren – und sie mit ihrer Clique: lauter hübsche, adrette junge Verlagsdamen, entweder perlenbehängt oder doppelt und dreifach gepierct. Man kann sagen, was man will, die Verlagsbranche ist doch ein Hort origineller Zeitgenossen.
Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, geschweige denn, dass sie scharf auf ihn gewesen wäre. Damals hatte sie alles andere als einen wie aus dem Ei gepellten Typen im Sinn. Sie stand eher auf unkonventionelle Männer mit Dreitagebart, Zottelmähne und Leidenschaft fürs Künstlertum: Musiker, Bildhauer oder Ähnliches. Aber dann kam Joel: attraktiv, sympathisch und mit viel Sinn für Humor. Sein Humor war ihr an dem Abend, als sich seine und ihre Freunde zusammentaten und vom Pub in einen Nachtclub wechselten, als Erstes an ihm aufgefallen. Deshalb sagte sie auch Ja, als er sie zu ihrer Überraschung fragte, ob sie sich Wiedersehen könnten. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass er sich für sie interessierte. Aber so ist das mit Joel. Er ist in seiner zurückhaltenden Art nicht immer leicht zu durchschauen.
In letzter Zeit ist es gerade diese Eigenschaft, die sie am meisten stört. Oftmals fragt sie sich, ob er wegen seiner Arbeit so unbeteiligt und geistesabwesend wirkt oder ob ihre Ehe an einem kritischen Punkt angelangt ist.
Aber es fehlt ihr wohl der Mut, dieses Thema direkt anzusprechen.
Auf jeden Fall herrscht im Bankschen Haushalt in letzter Zeit wenig Frohsinn.
Mit Joels Humor und Schlagfertigkeit scheint es nicht mehr weit her zu sein.
Tasha zieht ein graues Sweatshirt über den Kopf, schüttelt ihr schulterlanges braunes Haar und betrachtet sich im Spiegel über dem wuchtigen Eichenholzschreibtisch.
Ihr Haar sähe erheblich besser aus, wenn sie es föhnen würde. Aber daran ist nicht zu denken. Sie ist schon froh, wenn sie Zeit zum Duschen hat. Und das klappt nur, wenn sie es schafft, so früh aufzustehen, dass Joel noch ein Auge auf die Kinder werfen kann, bevor er sich zur Metro North Station aufmacht.
Dabei geht er ständig auf und ab, schaut immer wieder auf die Uhr und klopft an die Badezimmertür, um zu drängeln, dass er gleich seinen Zug verpasst.
Als ob sie da drinnen ein langes, entspannendes Bad nehmen würde!
Ha!
Die Beine hat sie vergangenes Wochenende zum letzten Mal rasiert, und eine Pflegespülung fürs Haar ist ein Luxus, den sie sich schon länger nicht mehr gegönnt hat. Zeit, sich eine modische Föhnfrisur zu machen? Schön war s.
Als das Telefon schrillt, wirft Tasha einen Blick auf den Wecker. Joel kann es nicht sein. Der ist noch mit dem Zug unterwegs. Er hat zwar sein Handy dabei, aber weshalb sollte er, kurz nachdem er aus dem Haus gegangen ist, zu Hause anrufen?
Wer kann es dann sein? Normalerweise ruft vor neun Uhr niemand an, bevor sie Hunter an der Schule abgesetzt hat. Stirnrunzelnd hebt sie den Hörer ab, während sie einen Fuß in den Turnschuh steckt und sich bückt, um ihn zuzumachen. »Hallo?«
»Tasha?«
»Rachel?«
»Ja, ich bin’s.«
»Was ist los?« Der viel sagende Unterton in der Stimme ihrer Freundin ist ihr nicht entgangen. Sie richtet sich auf und blickt aus dem Fenster hinüber zu Rachel Leibermans Haus, als erwarte sie von dort irgendein erklärendes Zeichen.
»Hast du heute schon die Journal News gelesen?«
»Soll das ein Witz sein? Die liegt wahrscheinlich noch draußen. Morgens komme ich nie dazu, die Zeitung zu lesen.«
»Dann weißt du es also noch gar nicht.«
»Was?«
»Im Fernsehen kam es auch, in der Today Show.«
»Die schau ich mir gerade an.«
Tasha schaut auf den Bildschirm. Al Roker im Interview mit einer völlig aus dem Häuschen geratenen, rotbackigen Frau, die ein handgeschriebenes Schild hin- und herschwenkt: »HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM HOCHZEITSTAG BIG DADDY UND MAMA LULU IN SLIDELL, LOUISIANA!«
»Sie haben es gerade in den Nachrichten gebracht.«
»Die hab ich nicht gesehen. Was ist denn passiert?«
»Kennst du Jane Kendall?«
»Jane Kendall …« Der Name kommt ihr bekannt vor, aber es dauert eine Weile, bis sie weiß, wer gemeint ist. »Jane aus der Mutter-Kind-Gruppe?« – »Ja.«
»Was ist mit ihr?«
»Sie ist verschwunden.«
»Verschwunden? Wieso verschwunden?«
»Sie ist gestern Abend vom Joggen im High Ridge Park nicht mehr zurückgekommen. Hab ich nicht immer gesagt, die trainiert bestimmt wie verrückt. Nicht umsonst hat jemand mit einem Kleinkind so einen durchtrainierten Körper.«
»Aber sag mir doch endlich, was passiert ist«, sagt Tasha ungeduldig und zieht den anderen Schuh an.
»Das weiß man nicht. Sie ging gestern aus dem Haus, hat ihre Tochter im Babyjogger mitgenommen und kam nicht wieder.
Man hat aber … Einen Moment, Tasha. Noah! Nimm die Finger da weg, bevor du einen Stromschlag kriegst! Entschuldige. Jemand hat das Kind im Park gefunden. Es saß im Babyjogger und schrie. Mutterseelenallein in der Dunkelheit.«
»Das ist ja schrecklich!«
»Ganz furchtbar.«
»Was ist mit ihrem Mann?«
»Owen? Er hat sie als vermisst gemeldet.«
»Du kennst ihn?«
»Wer kennt ihn nicht? Ich hab dir doch von ihrer Hochzeit erzählt. Weißt du nicht mehr? Er ist ein Kendall. Das sind die mit den Staubsaugern, du weißt schon.«
Nein, Tasha weiß das alles nicht. Sie ist im Gegensatz zu Rachel, die in Westchester aufwuchs, ein Neuling in der Welt des Vorstadtadels.
»Jedenfalls sind die Kendalls stinkreich. Ich bin mit einem von Owens Cousins zur Schule gegangen. Dillard Kendall. Das war vielleicht ein Blödmann. Sie ist eine Armstrong.«
»Tatsächlich?« Tasha ist Rachels verwirrende Redeweise gewöhnt. Sie ist gespickt mit beiläufigen Bemerkungen über alle möglichen Leute, wodurch sie stets vom Hundertsten ins Tausendste kommt.
»Ja, wenn ich’s dir sage. Die Armstrongs haben Scarsdale praktisch gegründet. Ganz alter Adel, keine Neureichen. Nicht so wie wir oder ihr.«
»Uns kannst du nicht meinen, Rachel«, erwidert Tasha mit einem schiefen Lächeln. »Wir haben zurzeit absolut kein Geld.«
»Ich dachte, Joel hat eine saftige Gehaltserhöhung bekommen.«
»Hat er. Aber wir haben auch einen neuen Wagen zu bezahlen. Unser Honda hat kurz nach Joels Beförderung seinen Geist aufgegeben. Außerdem war ein neues Dach fällig und ein neuer Boiler und …«
»Schon gut, schon gut«, fällt Rachel ihr ins Wort. »Ihr seid also pleite. Mach dir nichts draus. Im Vergleich zu den Armstrongs und Kendalls sind wir das nämlich alle. Jane kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, der Kendall-Clan aber schwimmt förmlich im Geld. Deshalb verursacht ihr Verschwinden ja solchen Aufruhr.«
»Wurde sie entführt, um ein Lösegeld zu erpressen?«
Der Gedanke erscheint irgendwie irreal. Passieren solche Dinge wirklich?
»Keine Ahnung. Man kommt sich vor wie in einem schlechten Film, findest du nicht? Sie haben eine Belohnung von einer Million Dollar ausgeschrieben für … Warte einen Moment. Mara! Lass sofort seine Nase los! Siehst du denn nicht, dass er das nicht mag?«
»Ich ruf dich später zurück, Rachel«, sagt Tasha eilig, weil ihr plötzlich einfällt, dass sich ihre eigenen Kinder noch immer unbeaufsichtigt im Wohnzimmer aufhalten. »Ich hab im Moment nicht das Schnurlose in der Hand, und es ist verdächtig still da unten.«
»Sieh schnell nach«, sagt Rachel, die als Mutter für Tashas plötzliche Unruhe vollstes Verständnis hat. »Wir reden später weiter.«
Tasha legt den Hörer auf, schaltet den Fernseher ab und rennt hinaus zur Treppe.
Jane Kendall hat sie erst vor kurzem kennen gelernt. Es war, als sie und Rachel sich der Mutter-Kind-Gruppe in Mount Kisco anschlossen, die sich zweimal wöchentlich morgens trifft. Die Kinder sollen Gelegenheit bekommen, mit anderen zu spielen und Kontakte zu knüpfen. Doch Tasha hatte eher den Eindruck, dass in erster Linie die Frauen – die meisten von ihnen Vollzeitmütter und »nur« Hausfrauen – verzweifelt nach Anschluss suchten. Rachel und sie haben dadurch einige Frauen kennen gelernt, und mit ein paar von ihnen treffen sie sich nach der Gruppe regelmäßig zum Kaffeetrinken im Starbucks.
Jane Kendall ist auch hin und wieder dabei. Sie sagt nie viel, sitzt meistens still da, die Tochter auf dem Schoß, lächelt und nippt an ihrem Cappuccino.
Was, um Himmels willen, mag ihr zugestoßen sein?
Vielleicht ist sie beim Laufen gestürzt, hat sich den Kopf angeschlagen und das Bewusstsein verloren? Vielleicht ist sie schon wieder zu sich gekommen und wurde längst gefunden?
Nein, sagt sich Tasha, und es läuft ihr eiskalt den Rücken hinunter, so harmlos ist die Sache bestimmt nicht. Sie hat zu viele Berichte über Verbrechen gesehen und gelesen, als dass sie nicht wüsste, dass eine Frau wie Jane Kendall – schön, privilegiert, glücklich verheiratet – nicht einfach mir nichts, dir nichts verschwindet und dann plötzlich wieder auftaucht. Wenn so jemand verschwindet, dann für immer.
Irgendetwas Schreckliches muss mit Jane Kendall geschehen sein.
Etwas ganz Schreckliches.
Aber … In Townsend Heights?
Hier passiert so etwas doch nicht.
In diesem kleinen, verschlafenen Städtchen, das fast abgeschieden von der harten Realität der hektischen Großstadt erscheint, wo so viele ihrer Einwohner zur Arbeit hinfahren.
Hier braucht man, wie der Immobilienmakler Tasha und Joel versicherte, Fenster und Türen nicht zu verriegeln. Das macht zwar keiner, aber man. könnte es zumindest. Im Laden wird man mit Namen angesprochen, und dass Jugendliche einem Erwachsenen auch mal die Tür aufhalten, ist hier noch nicht aus der Mode gekommen. Die Kinder können auch nach Einbruch der Dunkelheit draußen spielen – am liebsten Fangen und Verstecken –, und die Familien, alle mit Eigenheim und Garten, sind noch intakt.
Tasha und Joel verliebten sich auf Anhieb in das Städtchen. Wer könnte sich dem Charme der ruhigen, schattigen Straßen im Ortskern entziehen, dem bestechenden Flair der bunten viktorianischen Häuser mit schmucken Holzzäunen und gepflegten Gärten? Tasha hatte sich genau solch ein malerisches Haus in den Kopf gesetzt, das so sehr dem ähnelte, in dem sie aufgewachsen war. Doch dann wurde ihr klar, dass aufgrund des boomenden Immobilienmarktes in Westchester keines unter einer Million Dollar zu haben war.
Daher konzentrierten sie sich bei der Haussuche auf eine Neubaugegend nicht allzu weit vom Zentrum entfernt. Die Läden in der »Einkaufsmeile« sind bequem zu erreichen, und in der Townsend Avenue gibt es eine Reihe von Cafes und Boutiquen, deren Besitzer alle ortsansässig sind. Der Reiz von Townsend Heights liegt in der altmodischen Kleinstadtatmosphäre, mit seinen Geschäften, die von Alteingesessenen geführt werden, genauso wie in Tashas Geburtsort in Ohio.
Dort ist die Haupteinkaufsstraße seit kurzem allerdings ziemlich verwaist, und das ganze Viertel darum herum ist wie ausgestorben. Die meisten der kleinen Läden, die seit Jahrzehnten von ein und derselben Familie geführt wurden, gibt es nicht mehr. Die verbliebenen Geschäfte wurden an den Stadtrand in Highway-Nähe verlegt und unter dem Dach riesiger Einkaufszentren untergebracht.
Mit solch einer Entwicklung ist in Townsend Heights eher nicht zu rechnen, da die reichen Bewohner den Kleinstadtcharakter des Ortes schätzen und lieben und alles dafür tun, dass ihre Geschäfte florieren. Tasha vergisst immer wieder, dass dies hier nicht Ohio ist. In den Lebensmittelläden gibt es exotische Delikatessen, und zum Lunch oder Dinner werden Drei-Sterne-Menüs angeboten. Doch das macht gerade den Charme der Stadt aus. Die Kinder können unbeschwert aufwachsen, was für Joel und sie das wichtigste Kriterium war.
Nie würde sie vergessen, wie sie durch Townsend Heights spazierten und sich sofort heimisch fühlten. Sie hatten sich einen Wagen gemietet und waren eine Stunde Richtung Norden gefahren, um sich einen Tag lang Häuser anzuschauen, nachdem sie Hunter zu Joels Eltern nach Brooklyn gebracht hatten. Tashas Schwiegereltern, die sonst immer gerne auf ihr geliebtes erstes Enkelkind aufpassten, machten es Tasha und Joel nicht leicht und taten alles, um sie von dieser Fahrt abzuhalten.
»Ein Haus? In Westchester? Weshalb wollt ihr so weit rausziehen? Warum bleibt ihr nicht in der Stadt? Könnt ihr euch Westchester überhaupt leisten?«
Sogar als sie dieses Kolonialhaus im Orchard Way, in einer sich sanft schlängelnden und von Büschen und Bäumen gesäumten Sackgasse unweit des Stadtkerns, fanden, waren die Banks pessimistisch.
»Es fällt ihnen eben schwer, uns ziehen zu lassen. Sie hätten uns am liebsten ganz nah bei sich«, sagte Joel.
»Deinen Eltern geht es doch nur um dich und Hunter«, erwiderte sie. »Mich sähen sie am liebsten ganz weit weg. Die würden mir sogar beim Packen helfen.«
»Das ist doch lächerlich!«, widersprach er gereizt. So reagierte er immer, wenn sie behauptete, seine Eltern könnten sie nicht leiden.
Aber sie mögen sie wirklich nicht. Haben sie noch nie gemocht.
Am Anfang glaubte sie, es läge daran, dass sie keine Jüdin ist. Damit hätte sie leben können, zumal sie mit so einer Reaktion gerechnet hatte. Doch dass ihre Schwiegereltern sie nicht mögen, weil … einfach weil sie sie nicht leiden können, trifft sie sehr. Vor allem weil sie immer und überall beliebt gewesen war. In der Highschool wurde sie sogar einmal zur beliebtesten Schülerin gewählt.
»Wie kommst du auf die Idee, sie würden dich nicht mögen?«, hatte Joel vor langer Zeit einmal gefragt, als er noch offen war für Gespräche über seine Eltern.
»Deine Schwester hat es mir gesagt.«
»Auf Debbies Geschwätz brauchst du nichts zu geben«, hatte er mit einer wegwerfenden Handbewegung entgegnet. »Sie war früher schon eine Unruhestifterin. Die weiß doch nicht, was sie redet.«
»Doch, das weiß sie sehr wohl. Schließlich kennt sie ihre Eltern gut genug. Sie hat mir gesagt, es habe nichts damit zu tun, dass ich keine Jüdin bin. Deine Freundin im College, Heather Malloy, war auch nicht jüdisch, und deine Eltern haben sie sehr gemocht.«
»Heather Malloy?«, wiederholte er mit einem matten (oder vielmehr zärtlichen?) Lächeln. »Sie mochten sie nicht besonders.«
»Debbie behauptet das Gegenteil. Mich können sie nicht ausstehen, Joel.«
»Das bildest du dir ein.«
Tasha hat es längst aufgegeben, solche Gespräche mit ihm zu führen, weil es zu nichts führt. Er ist entweder blind oder will den Tatsachen nicht ins Auge sehen und wählt den einfachsten Weg, indem er den Kopf in den Sand steckt und die Wahrheit ignoriert.
Am Fuß der Treppe geht Tasha durch das Sicherheitsgitter, bleibt in der Diele kurz stehen und wirft einen Blick aus dem kleinen Fenster neben der Haustür. Die Journal News in der gelben Plastiktüte liegt wie jeden Morgen vorn in der Einfahrt. Ob sie die Kinder noch ein paar Sekunden allein lassen kann, um die Zeitung zu holen und sich über Jane Kendalls Verschwinden zu informieren? Oder soll sie lieber warten, bis sie Hunter zur Schule bringt?
Die zehn Minuten kann ich meine Neugier noch bezwingen, sagt sich Tasha und beschließt, sofort nach den Kindern zu sehen. Sie hat ohnehin schon ein schlechtes Gewissen, weil sie Victoria und Max so lange allein gelassen hat.
Sie bleibt in der Tür stehen und steckt, aufs Schlimmste gefasst, vorsichtig den Kopf ins Wohnzimmer.
Doch der noch haarlose Max sitzt nach wie vor friedlich im Laufstall vor dem Kamin und kaut zufrieden an einem gelben Winnie-the-Pooh-Zahnring. Am anderen Ende des Raums sitzt Victoria, den dunkel gelockten Schöpf tief über den Kindertisch gebeugt, und malt eifrig. Hunter mit seinem glatten braunen Haar und den großen, stets ernst blickenden braunen Augen sieht gebannt auf die Mattscheibe, über die noch immer die Pocket Dragons flimmern.
»Hallo, ihr Süßen«, sagt Tasha und will Max aus dem Laufstall heben. Er zappelt vor Freude, als er sie sieht. Doch dann überlegt sie es sich anders und geht stattdessen zu Victoria. »Wie schön, mein Schatz. Hast du das alles ganz alleine ausgemalt?«
»Ja, ganz alleine«, sagt sie stolz und hält ihr Werk hoch. »Sieh mal, Mr. Salt und Mrs. Pepper! Schau, welche Farbe ich genommen habe!«
»Blau.«
»Weil es meine Lieblingsfarbe ist. Was ist deine Lieblingsfarbe, Mommy?«
»Grün«, antwortet Tasha, die mit den Gedanken ganz woanders ist, und streicht ihrer Tochter über das Haar. Arme Jane Kendall …«
»Grün?«, wiederholt Victoria enttäuscht. »Aber Mommy, gestern hast du gesagt, Rot ist deine Lieblingsfarbe!«
»Ach ja, stimmt. Es ist Rot. Das habe ich wohl ganz vergessen«, erwidert Tasha.
»Du bist aber dumm, Mommy.«
»Ich weiß, meine Kleine. Jetzt legen wir die Farben aber weg. Hunter, es ist Zeit, mach dich bitte für die Schule fertig!«
»Nein!«, ruft Victoria trotzig.
Tasha seufzt.
Hunter schaltet gehorsam den Fernseher aus.
»Victoria, du legst sofort die Farben weg. Sofort! Und Hunter, zieh dir bitte die Schuhe an.«
»Bitte, Mommy, lass mich noch ein bisschen malen«, bettelt Victoria.
»Noch eine Minute«, gibt Tasha nach, weil es einfacher ist und weil noch genügend Zeit ist.
Victoria strahlt übers ganze Gesicht und malt eifrig weiter. Lass ich ihr das jetzt durchgehen weil sie das mittlere Kind ist und ich Angst habe, sie könnte zu kurz kommen?
In den Elternratgebern, die ihre Freundin Karen immer liest, steht, dass ein Nein stets ein Nein bleiben sollte, weil die Kinder lernen müssen, Grenzen zu akzeptieren. Aber manchmal ist es so schwer, konsequent zu sein und beim Nein zu bleiben, weil man sich dann das Geschrei anhören muss und schon morgens völlig fertig ist. Und heute, wo einem der Kopf schwirrt, weil eine Bekannte spurlos verschwunden ist, ist es eben zu viel verlangt, sich lehrbuchmäßig zu verhalten. Tasha geht zu Max und nimmt ihn auf den Arm. Er strampelt vor Freude und strahlt bis über beide Ohren, wie stets, wenn sie ihn auch nur ansieht.
Babys brauchen ihre Mutter so sehr, denkt sie und drückt einen Kuss auf den zarten, kaum sichtbaren Flaum auf seinem Kopf.
Arme, kleine Schuyler Kendall. Wo ist deine Mommy? Wird sie jemals wiederkommen?
Jeremiah Gallagher hängt seine Jeansjacke in den schmalen Garderobenschrank und betrachtet sie einen Moment lang glücklich. Onkel Fletch hat sie ihm gestern geschenkt.
»Ich dachte mir, du könntest eine neue Jeansjacke gebrauchen, Jer«, sagte er und klopfte ihm in seiner kumpelhaften Art auf die Schulter.
»Ich hab doch schon eine«, erwiderte Jeremiah – was kein wirklicher Protest sein soll, denn die neue Jacke gefällt ihm wirklich gut. Sie sieht verwaschen und hip aus und sehr teuer. Nicht so wie seine alte Jacke, die völlig daneben ist. Steif und in einem viel zu dunklen Blau, ein ganz billiges Ding.
Seine Stiefmutter hat sie ihm kurz vor ihrem Tod gekauft. Ironischerweise ist ausgerechnet diese Jacke, wie nur ganz wenige seiner Sachen, nicht in dem Feuer verbrannt, in dem Melissa umkam. Jeremiah hatte das verhasste Stück an, weil sie darauf bestand.
Schade, dass die Jacke nicht mit ihr zusammen in den Flammen aufgegangen ist, dachte er später. Ein Gedanke, der sogleich heftigste Schuldgefühle in ihm auslöste.
Doch diese Gefühle kann Jeremiah einfach nicht unterdrücken. Er konnte die Jacke nie ausstehen. Genauso wenig wie Melissa.
Was soll’s, Melissa gibt es jetzt nicht mehr.
Und die blöde Jacke ist auch endlich weg. Dank Onkel Fletch, der ein Gespür für solche Dinge hat, sieht Jeremiah nun auch so aus wie all die anderen Kids von der Highschool in Townsend Heights.
Na ja, vielleicht noch nicht ganz.
Aber Onkel Fletch wird das schon hinkriegen. Er hat Jeremiah versprochen, mit ihm zum Optiker zu gehen und ihm Kontaktlinsen zu kaufen, als Ersatz für seine Brille, die er seit dem dritten Lebensjahr trägt. Außerdem hat er ihm erlaubt, jederzeit seinen Hometrainer und seine Hanteln zu benutzen. Wahrscheinlich hofft er, sein Neffe werde dadurch endlich ein paar Muskeln entwickeln. Als ob er seinem Onkel dann ähnlicher sähe!
Jeremiah konnte nie recht glauben, dass er mit Fletch Gallagher verwandt ist. Sein Vater behauptet zwar nach wie vor, Fletch sei sein Bruder und Jeremiah sein leibliches Kind. Aber wie kann ein nur 50 Kilo schwerer, kurzsichtiger und mit Akne übersäter Schwächling von derselben Sippe abstammen wie der Fletch Gallagher?
Der gut aussehende, muskulöse Athlet, der früher Pitcher bei den Cleveland Indians war, und zwar nicht irgendein Pitcher, sondern der Star unter ihnen, eine regelrechte Berühmtheit. Seitdem er während der Baseballsaison als Trainer bei den New York Mets arbeitet, kennt ihn jedes Kind.
Aidan, Jeremiahs Vater, ist zwar längst nicht so attraktiv wie Fletch, doch auch er ist eine imposante Erscheinung mit einer starken maskulinen Ausstrahlung. Besonders in seiner Offiziersuniform. Nicht dass Jeremiah ihn darin oft sehen würde – er sieht seinen Vater sowieso kaum, weil er seit den letzten Auseinandersetzungen mit dem Irak im Nahen Osten stationiert ist. Kurz nach Melissas Tod haben sie sich zuletzt gesehen.
Früher war Dad öfter zu Hause. Für Jeremiah war es das einzig Gute an der Heirat mit Melissa, die seinem Vater nicht wie Mom überallhin folgen wollte.
Als seine Mutter noch lebte, lernte Jeremiah unzählige Armeestützpunkte der Welt kennen. Mom verstand es, jeden Umzug als neues Abenteuer zu sehen und all die hässlichen, immer gleich aussehenden Wohnungen in den Mietskasernen der Militärbasen in ein gemütliches Zuhause zu verwandeln.
Nicht so Melissa.
Sie bestand von Anfang an darauf, in der North Street in Townsend Heights wohnen zu bleiben, während Dad in Übersee stationiert war. Sie verkündete, sie habe nicht die Absicht, ihre Töchter Lily und Daisy um den halben Erdball zu schleifen. Schließlich hätten sie schon genug durchgemacht, womit sie auf den Vater der Zwillinge anspielte, der seine Familie wegen einer anderen Frau im Stich ließ.
Je besser Jeremiah seine Stiefmutter kennen lernte, desto besser verstand er ihren Exmann. Sie konnte einen mit ihrer zickigen Art richtig nerven. Eine total verwöhnte Tussi. Soviel Jeremiah wusste, besaßen ihre Eltern – sie starben, kurz nachdem Melissas Ehe in die Brüche gegangen war – zwar kein großes Vermögen. Aber sie erfüllten ihrer einzigen Tochter zweifellos jeden Wunsch. Auch Jeremiahs Vater las ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Weshalb er die Zicke auf Händen trug, war Jeremiah ein Rätsel. Wahrscheinlich, weil sie eine schöne Blondine war, das krasse Gegenteil von seiner Mutter. Dad konnte gar nicht glauben, dass er so eine Frau abgekriegt hatte.
Doch in Jeremiahs Augen war Melissa diejenige, die sich glücklich schätzen konnte. Sie hätte es gar nicht besser treffen können. Als eine Frau, die man sitzen gelassen hatte, mit zwei kleinen Kindern und ohne elterliche Unterstützung, wäre sie ohne seinen Dad aufgeschmissen gewesen. Mit ihm hat sie sich einen großen Fisch geangelt.
Nach der Heirat lebten Melissa, Jeremiah und seine Stiefschwestern in Townsend Heights, und Aidan kam so oft es ging nach Hause. Manchmal blieb er ziemlich lange. Jeremiah konnte mit Melissa leben, wenn er dadurch seinen Dad öfter zu Gesicht bekam. Doch dann starb Melissa, und im Irak begann es zu brodeln. Jetzt ist Aidan wieder dort, und Jeremiah, Lily und Daisy müssen eine Weile bei Onkel Fletch und Tante Sharon wohnen. Doch Dad hat versprochen, bald wieder zu Hause zu sein – vielleicht sogar für immer. Vielleicht werden sie dann endlich ein normales Leben führen.
Was immer man unter »normal« versteht.
Jeremiah greift ins oberste Fach des Schranks und kramt in dem Durcheinander nach seinem Chemieheft.
Da fliegt die Schranktür neben ihm auf. Er schaut zur Seite und sieht Lacey Birnbach, die gerade ihre Lederjacke auszieht und sich mit ein paar Freundinnen unterhält.
»Hi«, sagt Jeremiah unbeholfen. Es klingt heiser und ist kaum zu hören. Er räuspert sich und versucht es noch einmal, ein bisschen lauter.
Doch das, was Lacey ihren Freundinnen mitzuteilen hat, ist offenbar so wichtig, dass die Worte nur so aus ihrem Mund sprudeln und sie Jeremiah gar nicht beachtet. Nicht, dass er das erwartet hätte. Sie ist die Art von Mädchen, die nicht einmal weiß, dass er überhaupt existiert. Und von dieser Sorte gibt es hier in der Highschool mehr als genug, denkt Jeremiah geknickt und sucht weiter nach seinem Schulheft.
»Dann ist Peter ja richtig berühmt«, sagt eine von Laceys Freundinnen.
»Aber klar doch. Er hat mir gesagt, er kommt heute Abend um sechs Uhr in den Nachrichten. Ich ruf meine Mutter an und sag ihr, sie soll es für mich aufnehmen. Wir haben heute Abend nämlich noch Cheerleader-Training.«
»Ich brauche unbedingt eine Kopie von dem Video«, meint ein anderes Mädchen. »Er ist so süß. Vielleicht wird er fürs Fernsehen entdeckt und wird ein großer Star!«
»Mensch Alyssa, er wird nur wegen des Babys interviewt, das er beim Joggen gefunden hat«, erwidert Lacey und wirft mit einer energischen Handbewegung ihr dunkles, glänzendes Haar über die Schulter. »Er tritt doch nicht in einer Talentshow auf. Außerdem ist er kein Schauspielertyp. Damit hat er absolut nichts am Hut.«
»Aber er sieht so toll aus! In dem engen grauen Sweatshirt, das er beim Football-Training immer trägt, sieht er einfach umwerfend aus. Da kann man ganz deutlich seine …«
Alyssa und die anderen Mädchen stecken die Köpfe zusammen, und Jeremiah bekommt kein Wort mehr mit. Als sie anfangen zu kichern, schießt ihm Röte ins Gesicht, und er tritt verlegen von einem Bein aufs andere.
Sie sprechen über Peter Frost. Ganz bestimmt. Er gehört zum Team der Highschool-Football-Mannschaft, und Jeremiah hat ihn schon einmal in dem knallengen grauen Outfit gesehen, das die Mädchen erwähnten. Wenn ich so etwas tragen würde, würde ich lächerlich aussehen, denkt er. Peter Frost aber sieht aus wie eine jüngere Kopie von Onkel Fletch. Er ist muskulös und charmant, und alle Mädchen sind verrückt nach ihm.
Einen Unterschied gibt es allerdings zwischen Peter Frost und Onkel Fletch: Peter Frost würde Jeremiah niemals helfen. Im Gegenteil, es scheint ihm besonders viel Spaß zu machen, ihn zu ärgern und ihm bei jeder Gelegenheit eins auszuwischen, besonders beim Sportunterricht. Ständig macht er sich hinter vorgehaltener Hand über ihn lustig.
Irgendwann zahl ich es ihm heim, denkt Jeremiah verbissen. Als er endlich das Chemieheft gefunden hat, knallt er wütend die Schranktür zu. Sogleich verstummt das Gekicher, und Jeremiah merkt, dass er Lacey und ihre Freundinnen erschreckt hat.
»Oh, hi«, sagt Lacey beiläufig, als sich ihre Blicke treffen. »Das war ganz schön laut.«
»E-e-entschuldigung.« Jeremiah spürt, wie er puterrot wird.
Er stottert wieder. Verdammt, jedes Mal, wenn er nervös ist, fängt er zu stottern an. Trotz der Therapien, die seinen Vater viel Geld gekostet haben, hat er es nie ganz überwunden. Es ist, als hätte er einen unsichtbaren Verfolger, der stets aufs Neue darauf wartet, über ihn herfallen zu können.
»Hey …«, sagt Lacey und zögert einen Moment, woran er merkt, dass ihr sein Name nicht einfällt, »hast du schon von der Frau gehört, die gestern Abend im Park verschwunden ist?«
»Ja, es k-k-kam heute M-m-morgen in den N-n-nachrichten.« Jeremiah versucht, ruhig zu bleiben und das Stottern zu bezwingen. Er kann kaum glauben, dass Lacey Birnbach ihn angesprochen hat.
»Rat mal, wer ihr Kind gefunden hat?«
Jeremiah zuckt mit den Achseln. Er lässt sich nicht anmerken, dass er ihr Gespräch belauscht hat.
»Peter Frost. Da staunst du, was? Er war joggen und hat das kleine schreiende Ding im Buggy gefunden. Und jetzt ist er praktisch der Held des Tages.«
»Wow.« Es misslingt ihm gründlich, überrascht und angemessen bewundernd zu klingen. Lacey wendet sich wieder ihren Freundinnen zu. So überflüssig und fehl am Platz hat sich Jeremiah schon lange nicht mehr gefühlt.
Er dreht sich um und geht hinaus auf den Gang, wo er sich unter die Schülerschar mischt. Schade, denkt er, dass es nicht Peter Frost war, der gestern im High Ridge Park verschwunden ist.
»Na, so eine Überraschung! Dass ich dich hier treffe!«
Paula Bailey fährt herum und sieht in ein lachendes, bekanntes Gesicht, vom Schirm einer Yankee-Mütze halb verdeckt.
»Oh, hi, George.« Ihr Blick wandert an ihm vorbei zu der dreistöckigen viktorianischen Villa hinter dem schmiedeeisernen Tor.
»Bist wohl einem richtigen Knüller auf der Spur, mit Mord und Totschlag und so?«
»Glaubst du, ich schreibe nur über goldene Hochzeiten und Backwettbewerbe?«, erwidert Paula scheinbar lässig.
Es ist nicht einfach. Jedenfalls nicht für sie. Und schon gar nicht mit so jemandem wie ihm.
Ich brauch jetzt unbedingt eine Zigarette.
Sie und George DeFand kennen sich noch aus der Zeit im Community College, wo sie beide jedes Seminar belegten, das in dem kleinen Institut für Kommunikationswissenschaften angeboten wurde. Nach den zwei Jahren im College hängte er natürlich noch ein Studium an der Columbia University dran, während sie, inzwischen schwanger von ihrem Freund, auf eine akademische Laufbahn verzichtete.
George, der mit einem Sternchen aus der Filmbranche (Marke Seifenoper) verheiratet ist, hat sich in Rye niedergelassen und arbeitet als Journalist für die New York Post. Paula ist dagegen allein erziehende Mutter und lebt in einem Ein Zimmer-Apartment in Townsend Heights. Sie schreibt Artikel für die wöchentlich erscheinende Townsend Gazette.
Für die New York Times hat’s bei ihm auch nicht gereicht, denkt sie, weil sich plötzlich Minderwertigkeitsgefühle bei ihr einschleichen. Die Post ist ein ganz billiges Blatt, der Kerl braucht sich gar nichts darauf einzubilden. Aber seine khakifarbene Freizeitjacke hat mindestens 200 Dollar gekostet.
Ihr Designerkostüm ist aber auch nicht ohne, und sie kann sich darin durchaus sehen lassen. Gekauft hat sie es zwar in einem Second-Hand-Laden in Mount Kisco, doch die Tweed-Jacke und der dazugehörige enge Rock sehen aus wie neu. Die Lederpumps sind neu und sehen sogar teurer aus als sie waren. Das rötlich schimmernde Haar hat sie zu einem flotten Pferdeschwanz zusammengebunden, und sie trägt Make-up. Sie ist sich bewusst, dass sie wie eine moderne Lois Lane aussieht – viel professioneller als all die anderen Reporter in ihren ausgebeulten Jeans. Selbst George macht da keine Ausnahme.
In den letzten Jahren sind sie sich hin und wieder begegnet, und jedes Mal hat er ihr unter die Nase gerieben, dass er sich als Reporter schon einen Namen gemacht habe. George hatte nämlich das Glück, die wahren Hintergründe dieser Schießerei in den Bronx, bei der auch zwei Cops beteiligt gewesen waren, aufzudecken. Der Fall, der nun schon einige Jahre zurückliegt, hat einigen Staub aufgewirbelt, und Georges Story brachte die Bombe zum Platzen: Nicht der Drogendealer hatte die tödlichen Schüsse abgefeuert, sondern ein Cop, und zwar gezielt.
Paula hat wirklich keine Lust, sich die Geschichte noch einmal anzuhören. Als sein winziges Motorola-Handy klingelt, atmet sie auf. Vielleicht bleibt ihr heute die alte Leier erspart. »DeFand«, sagt er wichtigtuerisch.
Die Gunst des Augenblicks nutzend, lässt Paula ihn stehen und bahnt sich einen Weg durch die Menge von Presseleuten und Polizisten, die sich entlang dem schmiedeeisernen Zaun vor dem Anwesen der Kendalls drängen.
Das imposante rote Backsteinhaus befindet sich auf einem riesigen Eckgrundstück, das von einem hohen Zaun umgeben ist. Von der Straße aus ist lediglich die Rückseite der Villa und ein Teil des parkähnlichen Gartens zu sehen, der weiter hinten von einem Wald begrenzt wird. Von Jane weiß Paula, dass das Anwesen früher Teil eines Landsitzes gewesen ist und Ende des 19. Jahrhunderts von dem millionenschweren Kaufmann Henry DeGolier erbaut wurde. Große Teile des Besitzes wurden schon Vorjahren stückweise verkauft, und die meisten der weit verstreut liegenden Häuser sind mit der Zeit verfallen oder wurden abgerissen, um Neubauten Platz zu machen.
Sobald sich der Ehemann an die Öffentlichkeit wandte, lieferte Paula ihren Sohn Mitch bei seinem Freund Blake ab und fuhr hierher. Sie war die Erste vor Ort, aber ihrem Ziel ist sie noch keinen Schritt näher gekommen: ein Exklusivinterview mit einem der Familienangehörigen, Hausangestellten oder Anwälte der Kendalls, die sich hier seit zwölf Stunden die Klinke in die Hand geben.