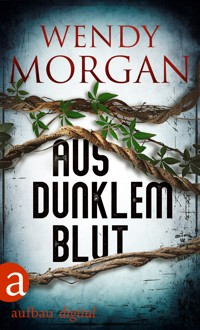8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wendy Morgan Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Auf einer einsamen Insel vor New England wartet er geduldig auf sie. Streicht liebevoll über die weißen Spitzenkleider, die er extra für sie angefertigt hat. Sie werden wundervoll darin aussehen, wenn sie darin sterben werden ...
Drei Frauen begegnen sich in einem abgelegenen Hotel. Sandy hat auf eine vielversprechende Kontaktanzeige geantwortet. Liza hofft auf einen lukrativen Buchvertrag mit einem scheuen Autor. Und Jennie will einfach mal in Ruhe ausspannen. Scheinbar verbindet die drei Frauen nichts miteinander. Aber dann bricht ein furchtbarer Sturm los und nach und nach ahnen die Frauen, dass ihr Gastgeber einen grausamen Plan verfolgt. Denn alle drei kennen diesen Mann aus ihrer Vergangenheit und seine Zeit der Rache ist nun gekommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Ähnliche
Über Wendy Morgan
Wendy Morgan hat englische Literatur mit dem Schwerpunkt kreatives Schreiben studiert. Nach ihrem Studium hat sie zunächst als Lektorin und Journalistin gearbeitet, um sich dann ganz ihrem Traumberuf der Schriftstellerin zu widmen. Wendy Morgan lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in New York.
Informationen zum Buch
Auf einer einsamen Insel von New England wartet er geduldig auf sie. Streicht liebevoll über die weißen Spitzenkleider, die er extra für sie angefertigt hat. Sie werden wundervoll darin aussehen, wenn sie darin sterben werden...
Drei Frauen begegnen sich in einem abgelegenen Hotel. Sandy hat auf eine vielversprechende Kontaktanzeige geantwortet. Liza hofft auf einen lukrativen Buchvertrag mit einem scheuen Autor. Und Jennie will einfach mal in Ruhe ausspannen.
Scheinbar verbindet die drei Frauen nichts miteinander. Aber dann bricht ein fruchtbarer Sturm los und nach und nach ahnen die Frauen, dass ihr Gastgeber einen monströsen Plan verfolgt. Denn alle drei kennen diesen Mann aus ihrer Vergangenheit und seine Zeit der Rache ist nun gekommen...
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wendy Morgan
Bis der Toduns eint
Thriller
Aus dem Englischen vonMartin Hildebrand
Inhaltsübersicht
Über Wendy Morgan
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Epilog
Impressum
Widmung
John Scognamiglio, meinem großartigen Herausgeber,
in Liebe und Dankbarkeit gewidmet.
Ebenso meinen Lieben daheim: meinem Mann Mark sowie
Morgan James, unserem neugeborenen Sohn,
dessen unerwartete Ankunft das Schreiben
dieses Buches unterbrach – und der häufig
auf meinem Schoß einschlief,
als ich den Roman dann zu Ende brachte.
Prolog
Als Sandy Cavelli die vereiste Treppe zum roten Klinkerbau des Postamtes hinauf hastet, wirft sie einen Blick auf ihre Armbanduhr: gleich fünf Uhr. Sie hat genau eine Minute Zeit, ihre Post abzuholen, ehe Feierabend ist.
Eilig strebt sie auf die Wand mit den rechteckigen, vergitterten Metalltürchen zu und dreht gespannt den runden Schlüssel im Schloss von Postfach Nr. 129 – packvoll, wie immer am Montag. Freitagmorgens erscheint nämlich die Connecticut Singles, und allmählich gewinnt Sandy den Eindruck, dass sämtliche männliche Wesen im Großraum Hartford, die fürs Wochenende noch nichts vorhaben, freitags und samstags die Kleinanzeigen hinten im Heft studieren und auf Anzeigen antworten.
Sie nimmt den Briefstapel aus dem Fach und zählt die Umschläge im Geiste rasch durch. Neun – nein, zehn. Zehn Männer haben diese Woche auf ihr Inserat reagiert. Vorläufig. Wenn alles nach dem Muster verläuft, das sich im letzten Monat herausgebildet hat, stoßen über die nächsten paar Tage noch zwei oder drei Nachzügler dazu. Falls sie sich entscheidet, die Anzeige um eine Woche zu verlängern – wozu ihr bis Mittwochabend sechs Uhr Bedenkzeit bleibt –, wird am kommenden Montag der nächste Packen Briefe auf sie warten.
War auf alle Fälle eine prima Idee, das Postfach zu mieten, lobt Sandy sich stumm – auch wenn sie dadurch um über dreißig Dollar ärmer geworden ist. Auf diese Weise erspart sie sich die Fragerei, mit der ihre Eltern sie unter Garantie löchern würden, wenn plötzlich allwöchentlich zu Hause eine Brieflawine über sie hereinbräche. Dass ihre Tochter einen Mann über Kontaktanzeigen kennenlernt, würden sie nie und nimmer tolerieren. Selbst heute noch bleiben die beiden abends auf und warten, wenn ihre Tochter bis Mitternacht nicht zu Hause ist!
Gedankenversunken schlendert Sandy auf die Flügeltür am Ausgang zu und blättert dabei die Umschläge durch. Wie üblich fehlt bei einigen die Absenderangabe; diejenigen mit Rückanschrift stammen meist aus Hartford oder der direkten Umgebung … Ein Brief mit Postfach auf Tide Island ist dabei!
Neugierig geworden, steckt Sandy den restlichen Stapel in ihre große schwarze Schultertasche und beginnt, den Umschlag mit einem ihrer manikürten Fingernägel aufzuschlitzen.
»Miss?«, ruft ein uniformierter Postbeamter, der vorn am Eingang wartet. Demonstrativ klimpert er mit einem Schlüsselring. »Wir schließen!«
Sandy blickt auf. »Oh, Entschuldigung!«
»Kein Problem.« Er lächelt. Seine Zähne sind weiß und ebenmäßig, und er hat lustige Fältchen um die Augen. »Schön kalt draußen, hm?«
»Aber wirklich. Soll heute Nacht wieder schneien.«
Er kommt ihr nicht bekannt vor. Muss wohl neu sein. Ansonsten ist ihr nahezu jedes Gesicht in Greenbury vertraut; sie ist schließlich hier aufgewachsen.
Normalerweise steht sie zwar nicht auf Rothaarige, aber sei’s drum – ein hübsches, energisches Kinn hat er, und das Haar hat so einen kastanienbraunen Schimmer. Zudem gefällt ihr der Schnitt: seitlich kurz und oben auf dem Kopf strubbelig.
»Noch mehr Schnee? Konnte der nicht ’n paar Wochen früher runterkommen? Zu Weihnachten, wies sich gehört?« Gut gelaunt hält er ihr die Tür auf.
»Da sagen Sie was.« Sie zuckt die Achseln; automatisch fällt ihr Blick auf den Ringfinger an seiner linken Hand.
Verheiratet.
Das war wohl nichts.
»Vielen Dank und schönen Feierabend«, wünscht sie und geht rasch zur Tür hinaus. Auf dem eisglatten Betonpodest bleibt sie stehen, um den Umschlag, den sie in der Hand hält, endgültig zu öffnen.
Ein Windstoß fegt durch die Einkaufsstraße und lässt Sandy so sehr frösteln, dass ihre Zähne klappernd aufeinanderschlagen. Zum Lesen ist es hier draußen zu kalt, mag sie auch noch so gespannt sein. Sie steckt den Brief in ihre Handtasche und kramt in ihren Manteltaschen nach ihren Handschuhen. Rasch streift Sandy sie über und stakst vorsichtig die vier Stufen zum Bürgersteig hinunter. Krampfhaft hält sie sich an dem vereisten Stahlgeländer fest.
Schritt für Schritt kämpft sie sich dann in ihren flachen schwarzen Wildlederschuhen über die nahezu menschenleere, vereiste Straße zu ihrem Wagen, der auf dem gemeindeeigenen Parkplatz von Greenbury steht, gleich um die Ecke. Hohl und einsam hallen ihre Schritte wider.
Vor gut einem Monat noch, zur schönsten Weihnachtszeit, strahlte der Ortskern von Greenbury im Glanz funkelnder weißer Lichterketten, und festliche rote Schleifen schmückten die altmodischen Laternenmasten. An den Backsteinwänden des Rathauses waren Lautsprecherboxen angebracht, aus denen Weihnachtslieder durch die frostklare Luft klangen, und auf der Einkaufsmeile herrschte bis weit nach fünf Uhr abends Hochbetrieb, sogar an Werktagen.
Das malerische Greenbury mit seinem historischen Kern liegt nur fünfundzwanzig Kilometer außerhalb von Hartford, der Hauptstadt des Bundesstaates Connecticut. Selbst den alteingesessenen Bürgern ist die Ansichtskartenidylle des Städtchens wohl bewusst: weiß getünchte Kirche mit Turm, Läden mit Schaufenstern, ein breiter Dorfplatz mit Statuen und Springbrunnen. Als eine der wenigen Kleinstädte im mittleren Connecticut hat Greenbury noch ein florierendes Geschäftszentrum – im heutigen Amerika sehr selten. Sogar Kunden, die sonst die Mails und Megamärkte am Stadtrand von Hartford bevölkern, kommen zum Einkaufen her.
Jetzt im Januar allerdings, da Weihnachten vorbei ist, schließen die Läden entlang der High Street schon früh, und im frostigen Licht der Abenddämmerung liegt der Ortskern so gut wie verwaist da.
Sandys Wagen zählt zu den wenigen, die noch auf dem Parkplatz stehen – im Grunde nur eine hinter dem Rathaus gelegene, von Reifenspuren zerfurchte Wiese. Ein paar Schneereste umkurvend, stapft Sandy auf ihren Chevrolet zu und bemerkt beim Näherkommen die schmutzigen Eisklumpen, die hinter den Radkästen am Unterboden haften.
Sie spart sich die Mühe, die Brocken loszutreten. Das Auto bietet auch so einen hässlichen Anblick; Roststellen überall an der Karosserie, und hinten, wo eine Scheibe fehlt, ein Fetzen Plastikfolie über der dreiecksförmigen Öffnung. Allmählich ist Sandy die alte Rostlaube verhasst; sie gehörte mal ihrem Vater, der sie ihr kostenlos überließ. Doch Sandys Dankbarkeit hält sich inzwischen in Grenzen.
Seit sie im vorigen Frühjahr den Job als Verkäuferin in der Mode-Boutique Greenbury Gal antrat, spart sie auf einen neuen Wagen. Einen neuen gebrauchten, versteht sich. Im August ging ein gehöriger Batzen ihrer Rücklagen für die Gebühren am städtischen College drauf, und kommende Woche, wenn sie sich für die neuen Kurse anmeldet, wird der Semesterbeitrag fürs Sommersemester fällig.
Trotzdem bleiben ihr immer noch an die viertausend Dollar auf dem Konto. Allein im Dezember wanderten über fünfhundert Dollar in den Sparstrumpf, da ihre Umsatzbeteiligung erheblich höher ausfiel als sonst. Das bleibt natürlich nicht so. Heute beispielsweise war den ganzen Tag nichts los im Laden, und die Arbeitszeit hat man ihr auch schon mächtig gekürzt.
Sandy lässt sich hinters Lenkrad gleiten. Schaudernd vor Kälte dreht sie den Zündschlüssel; nach einigen Versuchen springt der Motor an, und sogleich stellt sie das Heizungsgebläse auf höchste Stufe. Ein kalter Luftschwall weht ihr ins Gesicht, sodass sie schnell die Klappen über den schwarzen Plastikdüsen schließt. Ehe das rauschende Gebläse überhaupt Warmluft produziert, wird sie vermutlich schon zu Hause angekommen sein, aber sie lässt es trotzdem weiterlaufen.
Gespannt greift Sandy in ihre Handtasche und zieht den Brief mit Absender Tide Island heraus. Er enthält einen einzigen Briefbogen, echtes Briefpapier, seidig und dick.
Ist ja ganz was Neues!, denkt sie, während sie sich mit den Zähnen den rechten Handschuh abzieht, den sie gleich dort eingeklemmt lässt. Die meisten Männer, die sich bisher auf ihre Anzeige meldeten, haben entweder auf Normpapier geschrieben oder auf Bögen mit dem Briefkopf ihrer Firma darauf.
Das Birnchen der Wageninnenbeleuchtung ist schon vor langer Zeit durchgebrannt. Um den Brief überhaupt lesen zu können, muss Sandy das Blatt so schräg halten, dass der fahle Schein der einige Schritte entfernten Straßenlaterne auf die Zeilen fällt.
Liebe Sandra,
als ich Ihre Anzeige in der Connecticut Singles las, fiel mir im Nu auf, wie sehr unsere Interessen sich ähneln. Mir scheint, Sie sind die Frau, auf die ich ein Leben lang gewartet habe. Wie Sie hätte auch ich es nie für möglich gehalten, dass ich einmal zum Mittel der Kontaktanzeige greifen müsste, um jemanden kennenzulernen. Als Arzt mit florierender Praxis bin ich beruflich sehr eingespannt, und deswegen fällt es mir schwer, Kontakte auf althergebrachte Weise zu knüpfen. Anbei ein Foto …
Foto? Verdutzt späht Sandy in den Umschlag. Doch, tatsächlich. Hat sie wohl übersehen. Da steckt ein Bild drin. Sie nimmt es heraus und hält es gegen das Licht.
Der sieht ja blendend aus!, durchzuckt es sie sofort.
Er hat etwas Kerniges – und der Körperbau erst! Auf dem Foto trägt er kein Hemd; die Aufnahme stammt wohl von einer Segeltour, als er gerade das Segel einholt, oder was man beim Segeln so macht. Selbst bei dem trüben Licht kann man den sonnengebräunten, haarlosen Brustkorb sowie die beachtlichen Armmuskeln unschwer erkennen. Er grinst in die Kamera und zeigt dabei einen Gesichtsausdruck, den Sandy gleich als offen, intelligent und herzlich einstuft.
Gespannt liest sie weiter.
… damit Sie mich erkennen, falls wir uns treffen sollten – was hoffentlich bald der Fall sein wird. Allerdings habe ich noch bis Mitte Februar jedes Wochenende Bereitschaftsdienst im Krankenhaus. Ich bin so frei, davon auszugehen, dass Sie nichts gegen ein romantisches Wochenende auf der Insel Tide Island, auf der ich ein Wochenendhaus besitze, einzuwenden haben. Da mir klar ist, dass Sie nicht ohne weiteres bei einem wildfremden Menschen übernachten möchten, habe ich Sie im Gasthaus Bramble Rose einquartiert. Die Kosten werden selbstverständlich in vollem Umfang von mir übernommen.
Als Romantiker durch und durch nehme ich an, dass eine Vertagung unseres Rendezvous bis zum Valentinstag einer Begegnung aus der hoffentlich eine Dauerbeziehung erwächst, zusätzlichen Zauber verleihen wird. Ich bin sicher, dass auch Sie dies so empfinden. Herr Jasper Hammel, der Geschäftsführer und Gastwirt des Bramble Rose, hat sich bereit erklärt, als Postillon d’Amour zwischen uns zu fungieren. Sollten Sie meine Einladung annehmen, erreichen Sie ihn unter der Nummer 508-551-1493. Ich freue mich auf unsere Begegnung, Sandra.
Herzlichst
Ethan Thoreau
Ethan Thoreau? Kopfschüttelnd wirft Sandy den Brief auf den Beifahrersitz. Das kann nur Schmu sein … ein Spaßvogel, der sich daran hochzieht, auf Kontaktanzeigen zu antworten und sich so an Frauen ranmacht.
Grimmig legt Sandy den Sicherheitsgurt an und den Gang ein. Während sie auf die Fahrbahn einbiegt und den Heimweg einschlägt, geht sie das Schreiben im Geiste noch einmal durch.
Es klingt zu schön, um wahr zu sein: ein umwerfend attraktiver Arzt, der auch noch Ethan Thoreau heißt – wie einer der Helden in den Liebesromanen, die Sandy so gerne liest.
Ein romantisches Wochenende auf einer Insel! Am Valentinstag! Dass ich nicht lache! Und dieses Gasthaus gibt’s vermutlich gar nicht.
Den Gastwirt anrufen …
Auf so einen dämlichen Trick fall ich nicht rein, denkt Sandy.
Na ja, im Grunde hätte sie damit rechnen müssen, dass sich früher oder später so ein Blödmann auf ihre Annonce meldet. Ihre Freundin Theresa, Veteranin der Kontaktanzeigen, hat sie schon vorgewarnt und angekündigt, dass so etwas nicht ausbleibt.
Egal: Was, wenn der Typ am Ende doch echt ist? Könnte ja sein, oder? Immerhin hat er ein Foto beigefügt …
Ein Arzt!
Ein umwerfend attraktiver, athletischer Mediziner. Ein Bild von einem Mann mit gut gehender Praxis und einem Wochenendhaus auf Tide Island.
Nachdenklich an der Unterlippe nagend, setzt Sandy den Blinker und biegt in die Webster Street ein.
Und wenn er nun doch echt ist? Was dann?
Kommt ja durchaus vor, so etwas, nicht? Und ob! Ihr fällt ein, dass sie vor ein paar Jahren mal von einem einsamen Junggesellen las, der eine Anzeige schaltete und per Chiffre eine Partnerin suchte. Einer der Frauen, die sich auf seine Annonce hin meldeten, machte er schon einen Heiratsantrag, noch ehe sie sich getroffen hatten.
Dieser hier, dieser Ethan Thoreau, lädt sie bloß zu einem Rendezvous ein. Er erwartet nicht einmal, dass sie bei ihm übernachtet.
Gasthaus Bramble Rose … Jasper Hammel …
Sandy nimmt den Fuß vom Gaspedal, als sie sich ihrem Elternhaus nähert. Es ist ein so genanntes Cape Cod, ein im Kolonialstil gebautes, rechteckiges Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss, schnurgeradem Satteldach und Holzverkleidung. Die Fassade ist von hellgrüner Farbe wie Eisbergsalat und brauchte dringend einen neuen Anstrich.
Ein weißer, total verschmutzter Pritschenwagen mit der Beschriftung CAVELLI & SÖHNE – GAS, HEIZUNG, SANITÄR steht in der Hofeinfahrt. Innerlich stöhnend, stellt Sandy ihren Chevy hinter dem Pick-up ab. Jetzt, in den Semesterferien, setzt sie alles daran, abends vor ihrem Vater zu Hause zu sein, damit sie am nächsten Morgen, wenn er zur Arbeit fährt, nicht extra früher aus den Federn muss, nur um ihr Auto aus der Einfahrt zu setzen und den Weg freizumachen.
Sandy schnappt sich ihre Handtasche vom Beifahrersitz und nimmt sich noch einmal gedankenverloren den Brief und das Foto von Ethan Thoreau vor.
»Also, wie sieht’s aus?«, fragt sie. »Bist du nun echt oder nicht?«
Seufzend steckt sie den Umschlag zu den anderen in ihre Tasche. Dann setzt sie die Füße behutsam auf die eisglatte Einfahrt und tappt vorsichtig den überfrorenen Plattenweg entlang auf die Haustür zu.
In der Küche steht Angie Cavelli gerade vor dem Herd und rührt in einem Topf. Die Vorderseite ihres gelben Sweatshirts ist voller tomatenroter Fettflecken.
»Hi, Ma!«, grüßt Sandy, zieht die Tür hinter sich zu und streift sich auf der abgewetzten Fußmatte neben der Tür die Schuhe ab.
»Du bist spät dran!«, moniert ihre Mutter und kostet vom Kochlöffel. »Ich dachte, du wolltest um halb fünf Feierabend machen!«
»Habe ich auch. Musste noch was erledigen.« Sandy schält sich aus ihrem Wintermantel und geht über das abgetretene Linoleum.
»Dein Vater sitzt schon am Tisch. Er möchte essen.«
Sandy verkneift sich die Bemerkung »Soll er doch!«
Nach fünfundzwanzig im Elternhaus verbrachten Lebensjahren wird sie den Teufel tun und die väterliche Hausordnung in Frage stellen. Eine seiner Regeln lautet: In diesem Haus wird abends um fünf gegessen, und zwar am Tisch im Esszimmer. Gemeinsam. Die ganze Familie.
Ihre Tasche in der Hand, wendet Sandy sich zum Flur, der gleich neben der Küche liegt.
»Halt!«, ruft ihre Mutter. »Wo willst du hin?«
»Nur rasch umziehen. Bin gleich zum Abendessen unten, Ma. Zwei Minuten.«
»Zwei Minuten!«, echot ihre Mutter mit einem warnenden Unterton. Sie steht inzwischen schon an der Küchenspüle und kippt eine dampfende Ladung gekochter Pasta in den verbeulten Durchschlag aus Edelstahl.
In ihrem Zimmer angelangt, schlenkert Sandy sich die Schuhe von den Füßen und zieht zum dritten Mal den Brief aus der Tasche.
Unschlüssig starrt sie auf den Umschlag.
Falls sie nicht dieses Gasthaus anruft, grübelt sie vermutlich ihr Leben lang darüber nach, ob sie damit wohl die Chance vertan hat, sich einen gut aussehenden, gut situierten Arzt zu angeln.
Ruft sie hingegen an, könnte sich herausstellen, dass er tatsächlich ein Zimmer für sie gebucht und im Voraus bezahlt hat. Dass es ihn wirklich gibt.
Sie lässt sich die Sache eine Weile durch den Kopf gehen.
Dann schleicht sie mit dem Brief quer über den Flur ins Schlafzimmer ihrer Eltern. Im Gegensatz zum übrigen Haus, in dem sich über Jahrzehnte allerlei Krempel angesammelt hat – Sandys Zimmer eingeschlossen –, ist das Elternschlafzimmer eher spartanisch eingerichtet. Die Wände sind leer bis auf das über dem Bett hängende Kruzifix; die einzigen sonstigen Möbelstücke sind eine Frisierkommode und ein wackeliger Nachttisch. Auf dem steht das Telefon fürs Obergeschoss.
Behutsam hockt Sandy sich auf die Bettkante mit der alten weißen Paradedecke, nimmt den Hörer ab und beginnt zu wählen.
Liza Danning sind Montagabende ein Graus.
Insbesondere regnerische, schneematschige Montagabende im Januar, wenn kein Taxi zu kriegen ist und man nur noch mit der U-Bahn vom Büro in der 40. Straße West zur Wohnung auf der Upper East Siele gelangt. Entweder so oder per Bus … und die überdachten Unterstände an den Bushaltestellen sind so gerammelt voll, dass man im strömenden Regen auf einen nicht zu überfüllten Bus warten müsste, der am Ende womöglich sowieso vorbeirollt. Das wäre alles noch halb so schlimm, wenn Liza einen Regenschirm dabeihätte.
Hat sie aber nicht.
An diesem Morgen war sie direkt von Alex’ Wohnung, wo sie übernachtet hatte, zur Arbeit gefahren. Und da beim Aufstehen die Sonne lachte, war Liza gar nicht auf den Gedanken gekommen, sich von Alex für alle Fälle einen Schirm zu borgen. Im Übrigen hatte sie viel zu viel damit zu tun gehabt, seine Versuche abzuwimmeln, sie fürs kommende Wochenende auf etwas festzunageln.
»Ich weiß nicht, Alex …« Seinem forschenden Blick ausweichend, war sie in ihren Designertrenchcoat geschlüpft – ein Geschenk von Lawrence, einem ihrer Verflossenen – und hatte sich den Gürtel eng um die Taille gezogen. Im Flur hatte sie prüfend einen Blick in den mannshohen Spiegel geworfen und sich ein paar seidige blonde Strähnen in den eleganten Nackenknoten gesteckt. »Ich glaube, ich hab schon was vor.«
»Was denn?«
»Steht noch nicht fest«, nuschelte sie achselzuckend.
»Du hast was vor, weißt aber nicht, was?«, fragte er süffisant.
Da hatte sie ihm reinen Wein eingeschenkt. Er ließ ihr keine andere Wahl. »Du, hör mal …« Sie bückte sich nach ihrem burgunderroten Attachekoffer. »Ich mag dich. War toll heute Nacht, Freitag und Samstag auch. Aber ’ne feste Wochenendbeziehung, das ist noch nichts für mich, okay?«
Er hatte sie angestarrt, die blauen Augen, die ihr am Freitagabend noch so hinreißend erschienen waren, nun eisig und hart. »Na, dann eben nicht«, hatte er gemurmelt, seinerseits ebenfalls seinen Aktenkoffer geschnappt – schwarzes Leder – und seinen Trenchcoat, auch der schwarz.
Danach waren sie zum Aufzug gegangen, schweigend die dreiundfünfzig Stockwerke hinunter zur Lobby gefahren und in den frischen Manhattan-Morgen hinausgetreten. Alex hatte den Portier gebeten, ihnen getrennte Taxis zu rufen. Dabei liegt seine Kanzlei gerade mal zwei Straßenzüge entfernt von dem Verlagshaus, in dem Liza als Lektorin arbeitet.
Der Portier hatte mithilfe seiner Trillerpfeife postwendend ein gerade heransausendes Taxi erwischt. Alex hatte ihm einige Scheine in die Hand gedrückt, sich dann in das Taxi gebeugt und Liza, die auf dem Rücksitz Platz nahm, noch einmal mit seinem eisblauen Blick fixiert.
»40. Straße West, Ecke Sixth Avenue«, hatte sie zum Fahrer gesagt und an Alex gewandt hinzugefugt: »Ruf an.«
»Alles klar«, lautete seine Antwort, und da wusste sie gleich, dass er sich nicht melden würde.
Als das Taxi anfuhr, hatte sie nonchalant die Achseln gezuckt. Pech, dass er sich von dem kleinen Techtelmechtel mehr versprochen hatte als sie. Nun, da musste er durch.
Jetzt steht sie zögernd auf der Straße vor ihrem Bürogebäude in der Dunkelheit und möchte sich am liebsten einreden, doch die U-Bahn zu nehmen. Das allerdings hätte zur Folge, dass sie zu Fuß die zweieinhalb Straßenzeilen bis zum Bahnhof unweit der Bibliothek auf der 42. Straße gehen müsste. Von dort hieße es, eine Haltestelle mit der Linie 7 bis zum Bahnhof Grand Central fahren und auf den Pendler-Shuttle zu warten.
Das dauert ewig.
Entschlossen den Kopf schüttelnd, wirft Liza einen Blick auf die teure Armbanduhr an ihrem Handgelenk. Viertel nach sechs. Wenn sie jetzt wieder hochgeht in ihr Büro und bis sieben weiterarbeitet, kann sie mit einem Firmenwagen nach Hause fahren. Der Verlag zahlt einen Hungerlohn und bietet auch keine Zusatzleistungen an – außer der freien Benutzung von Firmenwagen für Mitarbeiter, die Überstunden machen. Das ist aber auch das Mindeste der Gefühle, denn die Belegschaft besteht überwiegend aus weiblichen Angestellten, und die Straßen von Manhattan werden nach Einbruch der Dunkelheit zunehmend gefährlich.
Energisch geht Liza zurück in die Eingangshalle.
Von Carmine, dem Nachtwächter, wird sie wie immer anerkennend taxiert. Zum Glück spart er sich diesmal den Hinweis, sie sehe aus wie Sharon Stone, und auch die Frage, ob sie nicht überlegt habe, mal Schauspielerin zu werden.
»Was vergessen?«, fragt er, den Blick auf ihren Busen geheftet, obwohl der von einem weiten Trenchcoat verhüllt ist.
»Genau«, erwidert sie knapp und stöckelt an ihm vorbei in Richtung Aufzug, im Ohr das Klappern ihrer Pumps auf den Bodenfliesen.
Gerade setzt eine Aufzugkabine auf, und so tritt Liza beiseite, um die Ladung Passagiere aussteigen zu lassen.
»Liza? Was gibt’s? Ich dachte, du wärst gegangen«, bemerkt eine zierliche Brünette, die sich aus dem Gedränge löst.
Liza erkennt sie flüchtig als eine der neuen Verlagsassistentinnen, die unmittelbar vor Weihnachten angefangen haben – eine von den exaltierten Tussis frisch von der Elite-Uni, die es sich leisten kann, den untersten Einsteigerjob im Verlagswesen anzunehmen, weil der reiche Papi die Miete für das teure Studio in der Upper East Side übernimmt.
»Muss noch mal hoch«, wirft Liza ihr kurz angebunden zu. »Was vergessen.«
»Ach so. Na, dann schönen Abend. Bis morgen«, flötet die Zierliche munter und schließt dabei den obersten Knopf des flauschigen Wollmantels.
Liza erkennt den teuren Schnitt, das satte Korallenrot und die goldenen Zierknöpfe. Vor einer Woche hatte sie sich das gute Stück in einem Modehaus näher angeschaut. Laut Preisschild sollte der Mantel einen schlappen Tausender kosten. Natürlich musste sie ihn zurückhängen.
»Bis dann«, echot sie und betritt die Kabine. Allein fährt sie hinauf zum fünften Stock, der den verwaisten Empfangsbereich des Verlagshauses Xavier House Limited beherbergt.
Liza angelt ihr Schließkärtchen aus der Tasche und hält es vor das elektronische Bedienfeld neben den verglasten Doppeltüren gleich hinter dem Empfangstresen. Ein Klicken ertönt, und sie kann die Tür aufdrücken.
Rasch geht sie den matt beleuchteten Flur entlang, vorbei an einem Putzwagen, der vor einem der Büros steht. Von irgendwo ertönt das dumpfe Brummen eines Staubsaugers. Liza biegt um eine Ecke und strebt durch den kurzen Zwischenflur auf ihr Büro zu. Die anderen Lektorinnen, die in diesem Bereich arbeiten, sind entweder längst weg oder sitzen hinter geschlossenen Türen an Manuskripten, die über die Feiertage liegen geblieben sind.
Liza öffnet die Tür mit dem Schild LIZA DANNING und tritt ein. Sie hängt ihren Mantel auf einen Bügel, der an einem am Türblatt befestigten Haken baumelt, und streicht seufzend ihren Kaschmirpullover glatt. An sich ist ihr nicht nach Lesen zumute, obwohl ihr durchaus daran gelegen sein müsste, den Stapel Manuskripte, der auf dem niedrigen Aktenschrank liegt, etwas abzuarbeiten.
Du könntest die Post durchsehen!, sagt sie sich mit einem Blick auf den Packen Briefe in ihrem Eingangskorb. Heute ist sie noch nicht dazu gekommen. Freitag, nebenbei gesagt, ebenfalls nicht.
Sie setzt sich an ihren Schreibtisch und greift nach dem obersten braunen Großumschlag. Zum Aufschlitzen benutzt sie den Brieföffner mit dem schmuckverzierten Griff, ein Geschenk von Douglas. Oder stammt er von Reed? So genau kann sie das nicht mehr sagen. Spielt sowieso keine Rolle. Wer immer der edle Spender gewesen sein mag, er ist längst passe. Liza entnimmt dem Umschlag einen Stapel Blätter und überfliegt die oberste Seite – ein akribisch aufgesetztes Anschreiben, getippt auf einer antiquierten Schreibmaschine mit unsauberem Anschlag. Eine übereifrige Möchtegern-Autorin, Hausfrau aus dem Mittleren Westen, umreißt das beigefügte erste Kapitel eines historischen Liebesromans und liefert eine Zusammenfassung der Story, die sich um die Romanze zwischen einem Korsaren und einer indischen Prinzessin dreht. »Pirat« schreibt sie mit IE – Pierat.
Liza wirft das Schreiben in den Papierkorb und kramt in der Schublade nach den darin aufbewahrten standardisierten Absagen. Sie holt eines der Formulare heraus und schiebt es unter die Büroklammer, die das Teilmanuskript zusammenhält. Das Ganze wandert in den von der Schreiberin mitgeschickten frankierten und adressierten Rückumschlag, den Liza zuklebt und im Fach für den Postausgang deponiert. Dann nimmt sie sich den nächsten Umschlag vor.
Eine halbe Stunde später ist der Stapel in ihrem Posteingangskorb geschrumpft, während der für den Ausgang überquillt. Die größeren Umschläge sind allesamt erledigt; nun kommen die Standardbriefe an die Reihe.
Zerstreut überfliegt Liza den Absender des ersten Kuverts. Was da steht, lässt sie jäh stutzig werden, und sie schaut genauer hin.
D.M. Yates, Postfach 57, Tide Island, Massachusetts.
D.M. Yates? Etwa David Mitchell Yates, der öffentlichkeitsscheue Bestsellerautor? Liza fällt ein, dass er ein Haus besitzt auf einer der Küsteninseln vor Neuengland.
Sie schnappt sich den Brieföffner und schlitzt hastig den Umschlag auf. Ein geknickter, cremeweißer Briefbogen kommt zum Vorschein. Beim Auseinanderfalten bemerkt sie am oberen Rand ein mit einer Büroklammer befestigtes Ticket. Ein Fahrschein erster Klasse, gültig für eine Bahnfahrt von Penn Station bis Westwood, Bundesstaat Rhode Island.
Gespannt überspringt Liza die formalen Details und wendet sich gleich dem Hauptteil des Schreibens zu.
Liebe Ms. Danning,
wie Ihnen bekannt sein dürfte, bin ich der Verfasser einer Reihe umsatzstarker Spionageromane, die in den letzten zehn Jahren beim New Yorker Verlagshaus Best & Rawson erschienen sind. Seit mein Herausgeber Henry Malcolm im vorigen Monat in den Ruhestand trat, befinde ich mich auf der Suche nach einer neuen Heimat für meine Bücher. Besteht bei Ihnen Interesse an einem Gespräch bezüglich einer künftigen Zusammenarbeit zwischen mir und Ihrem Hause?
Beigefügt finden Sie eine Fahrkarte für das zweite Februarwochenende nach Westwood, Rhode Island. Dort werden Sie von einem Fahrer abgeholt und zum Schiffsanleger in Crosswinds Boy gebracht, wo Sie die Fähre nach Tide Island nehmen. Auf der Insel ist für Sie ein Zimmer im Gasthaus Bramble Rose reserviert. Selbstverständlich werden alle für Ihre Reise anfallenden Kosten von mir übernommen. Ich befinde mich in den kommenden Wochen auf einer Auslandsreise. Zur Bestätigung der Buchung wenden Sie sich bitte an den Gastwirt Jasper Hammel (Tel. 508-551-1493). Ich muss Sie allerdings bitten, strengstes Stillschweigen über das geplante Treffen zu bewahren.
Ich sehe unserer Zusammenkunft mit Freude entgegen.
Mit besten Grüßen
David Mitchell Yates
Liza ist wie elektrisiert. David Mitchell Yates!
Der Mann ist Gold wert!
Andererseits gilt er als exzentrischer Sonderling, dessen Gesicht dem Vernehmen nach noch keiner auf der ganzen Welt gesehen hat. Seine Bücher tragen nie sein Konterfei und enthalten auch keine biografischen Angaben. Über die Jahre ist das Gerücht aufgekommen, der Name David M. Yates sei vielmehr ein Pseudonym für einen hochrangigen Regierungsbeamten. Mitunter heißt es, er sei eine Frau; dann wiederum wird behauptet, im Vietnamkrieg sei ihm das Gesicht zerschossen worden.
Letzte Woche erst widmete Publishers Weekly, das Börsenblatt des amerikanischen Buchhandels, die Titelstory dem Rückzug von Yates’ langjährigem Herausgeber sowie dem erbitterten Streit über eine Vertragsverlängerung, der in einem Bruch zwischen dem Autor und dem Verlagshaus Best & Rawson endete. Dem Artikel zufolge stand Yates kurz vor einer Europareise anlässlich der Recherchen für seinen neuen Roman und hatte noch keine Entscheidung bezüglich eines neuen Verlages getroffen, obwohl er von mehreren renommierten Häusern umworben wurde.
Wie in aller Welt kommt der ausgerechnet auf mich?, wundert sich Liza.
Ja sicher, in letzter Zeit findet sie selbst auch schon mal hin und wieder im Publishers Weekly Erwähnung. Erst kürzlich landete sie einen viel beachteten Erfolg auf dem Sachbuchsektor, als sie die Rechte für das Enthüllungsbuch eines aalglatten, skandalträchtigen Senators an Land zog. Natürlich ahnt in der Führungsetage ihres Verlages niemand, auf welche Weise sie den Verfasser herumgekriegt hat.
Und von ihr wird’s auch keiner erfahren.
Freudig erregt greift sie zum Telefon und wählt die Nummer des Bramble Rose.
Kaum betritt Jenny Towne den Windfang im Erdgeschoss des restaurierten Stadthauses im Bostoner Stadtteil Back Bay, wummern ihr schon die dröhnenden Bässe eines alten Bruce-Springsteen-Songs um die Ohren. Sie verdreht die Augen und eilt geradeaus auf eine geschlossene, weiß lackierte Tür mit einer angenagelten dunkelgrünen 1 zu.
Sie lässt den Stapel Post von der rechten in die linke Hand wandern, steckt den Schlüssel ins Schloss und dreht ihn um. Wie immer klemmt das Türblatt, sodass sie ziehen muss.
Schließlich gibt die Tür nach, und Jenny betritt die Wohnung. Sie stampft sich die schneebedeckten Stiefel auf der Matte ab und deponiert ihre Post auf dem dreifüßigen runden Mahagonitischchen, das früher in Quincy, im alten Haus ihrer Großeltern, neben der Haustür stand.
»Laura?«, ruft sie und begibt sich schnurstracks zu der in die Schrankwand eingepassten Musikanlage. Sie dreht die Lautstärke auf nahezu null herunter.
Von nebenan schallt prompt ein entrüstetes »He!« herüber.
»War zu laut«, ruft sie ihrer Schwester zu, die in Sekundenschnelle in der Wohnzimmertür erscheint.
»Meine Güte!« Verstimmt wirft Laura den Kopf in den Nacken. Ihr superkurzes glänzend schwarzes Haar scheint wie ein Helm an der Kopfhaut zu haften.
»Mensch, Laura! Soll die Willensky etwa wieder hier unten antanzen und uns den Vermieter auf den Hals hetzen?«
Laura quittiert die Frage mit einem Schulterzucken. »Keegan hat angerufen«, nuschelt sie.
»Was wollte der denn?« Jenny, die sich gerade die Stiefel auszieht, blickt auf.
»Na, was wohl? Mit dir reden. Er hätte es schon im Laden versucht, meinte er, aber du wärst schon weg gewesen. Du sollst zurückrufen. Er hat Nachtschicht und fährt um halb sieben aufs Revier.«
Jenny nickt nur.
»Rufst du ihn zurück?«
»Keine Spur.«
»Ach, komm, Jenny, nun hab dich nicht so. Der Arme hörte sich total fertig an. Also, er hat zwar nicht direkt was gesagt, aber der dreht ohne dich durch, der Junge, das konnte man raushören.«
Der Gedanke, dass Keegan leidet, versetzt Jenny einen scharfen Stich, den sie indes ignoriert. »Nichts zu machen, Laura. Einmal muss endgültig Schluss sein. Sonst geht das Hin und Her ewig so weiter.«
»Ah, verstehe«, kontert ihre Schwester trocken, wobei sie die Arme verschränkt und Jenny unverwandt mustert. »Du liebst ihn; er liebt dich; ihr steht beide auf Kinder und Hunde und die Boston Red Sox und Antiquitäten und das Meer … deshalb kann’s überhaupt nicht klappen mit euch!«
»Laura …«
»Mensch, Jen, mir ist schon klar, was das eigentliche Problem ist, aber allmählich musst du darüber hinwegkommen. Es ist jetzt drei Jahre her, seit …«
»Ich will nicht darüber reden!« Jenny fährt ihrer Schwester resolut ins Wort und bringt sie mit einem Blick zum Schweigen.
Laura seufzt. Sie bemerkt den Stapel Briefe, den Jenny auf dem Tischchen neben der Tür deponiert hat. »Was Schönes für mich dabei?«, fragt sie hoffnungsvoll. »Luftpost etwa?«
Shawn, ihre neue Flamme, ist momentan geschäftlich in Japan. Seit seiner Abreise direkt nach dem Neujahrstag bläst sie Trübsal.
»Hab nicht geguckt«, brummt Jenny achselzuckend. Sie knöpft ihren Wintermantel auf und hängt ihn in den Einbauschrank, während Laura die Post durchblättert.
»Rechnungen, nichts als Rechnungen«, hört sie ihre Schwester nörgeln. Dann: »Hoppla, was haben wir denn da?«
Jenny schaut auf. Laura hält einen länglichen weißen Umschlag in der Hand.
»Ein Brief von Shawn?«, fragt Jenny und fährt sich dabei mit der Hand über das eigene glänzend schwarze Haar, das exakt dieselbe Beschaffenheit wie das von Laura hat, nur dass ihres bis auf die Schultern fällt. Im Augenblick ist es statisch aufgeladen, was sie nervt.
Ich sollte es mir einfach abschneiden lassen, sagt sie sich. So wie Laura. Gleichzeitig hallt Keegans Stimme in ihrem Kopf wider: »Ich liebe dein Haar lang, Jen. Lass es dir bloß nicht stutzen!«
»Nein, von Shawn kommt der nicht. Der Absender ist ein Postfach auf Tide Island«, murmelt Laura stirnrunzelnd. »Da kenne ich doch überhaupt keinen.«
»Na, dann mach auf!«
»Ich trau mich nicht.«
Jenny weiß, was ihr durch den Kopf geht. Brian, Lauras Exmann, stellt ihr seit der Scheidung im letzten Frühjahr erbarmungslos nach. Letztendlich war Laura sogar gezwungen gewesen, eine gerichtliche Verfugung gegen ihn zu erwirken. Direkt danach verschwand er von der Bildfläche. Vermutlich ist er zurück nach Cape Cod zu seinen Eltern.
Jenny ist klar, dass Laura Angst hat, er könne wieder aus der Versenkung auftauchen und sie aufs Neue belästigen. Nach außen hin wirkt Brian täuschend manierlich und gesittet. In angetrunkenem Zustand aber wird er zum ausgesprochenen Ekel. Schon des Öfteren war Jenny Zeugin seiner gewalttätigen, alkoholbenebelten Ausfälle. Dass er seiner Frau gegenüber handgreiflich wurde, ahnte Jenny noch, ehe ihre Schwester es zugab.
»Keine Angst«, wiegelt sie jetzt ab und mustert Laura dabei scharf. »Ist sicher bloß eine Reisebroschüre. Oder irgendeine Wohltätigkeitsorganisation bittet um ’ne Spende. Und falls nicht, falls das wirklich von Brian sein sollte, kannst du damit ja zur Polizei gehen.«
»Weiß ich.« Mit verkrampfter Miene öffnet Laura vorsichtig das Kuvert und entnimmt ihm einen weißen Bogen.
Jenny sieht, wie sich Lauras Züge, die den ihren bis auf eine kleine Narbe am linken Auge – ein Andenken an den rabiaten Ehemann – so sehr ähneln, in den folgenden Sekunden nach und nach entspannen.
»Na los, sag schon! Was ist es?« Sie eilt quer durchs Zimmer auf ihre Schwester zu und späht über deren Schulter.
»Ich glaub’s nicht!«, stößt Laura hervor und reicht ihrer Schwester das Schreiben. »Lies mal! Dabei gewinne ich doch sonst nie was!«
Jenny nimmt ihr den Brief ab und bemerkt dabei, dass das Papier schwer und teuer wirkt. Am oberen Rand prangt eine feine Tuschezeichnung von einem zauberhaften Haus, darunter der Aufdruck: Bramble Rose, Gasthaus, Postfach 57, Tide Island, Massachusetts. Jenny überfliegt den fett gedruckten Text.
Sehr geehrte Ms. Towne,
wir haben eine erfreuliche Nachricht für Sie: Sie sind die Hauptgewinnerin in der Spenden-Lotterie der Neuengland-Gesellschaft für leukämiekranke Kinder. Dadurch haben Sie Anspruch auf einen kostenlosen Aufenthalt für eine Person auf Tide Island am zweiten Februarwochenende. Der Preis beinhaltet drei Übernachtungen mit allem Komfort im Gasthaus Bramble Rose inklusive aller Mahlzeiten und des Transfers ab Fährhafen Crosswinds Bay und zurück.
Bitte bestätigen Sie die den Erhalt dieses Schreibens fernmündlich unter der Telefonnummer 508-551-1493.
Mit freundlichen Grüßen
Jasper Hammel, Geschäftsführer
Jenny lässt den Brief sinken und sieht Laura an. »Hört sich doch ziemlich gut an«, bemerkt sie vorsichtig.
»Fände ich auch, wenn es ein anderes Wochenende wäre. An dem Samstag kommt Shawn nach Hause, gerade rechtzeitig zum Valentinstag. Ich habe in der Firma schon meine Stunden umgelegt, damit ich mir frei nehmen und mit ihm zusammen sein kann. Ich kann nicht fahren.«
»Vielleicht lässt es sich auf ein anderes Wochenende legen«, schlägt Jenny vor. »Dann könnt ihr beide hin, du und Shawn.«
Laura schüttelt den Kopf. »Lies mal das Kleingedruckte unten. Da steht, das Angebot gilt nur für das angegebene Wochenende. Ich weiß noch, ich habe das Los unmittelbar vor Weihnachten gekauft. Der Verkäufer wies damals darauf hin, dass der Gewinn nur für eine Person ohne Begleitung gilt. So ’ne Art Verwöhnurlaub, mal die Seele baumeln lassen.«
»Neuengland-Gesellschaft für leukämiekranke Kinder?«, sinniert Jenny, wobei sie das Kleingedruckte überfliegt. »Nie gehört.«
»Ich auch nicht. Der Typ meinte aber, die gäb’s schon eine ganze Weile. Kam mir irgendwie bekannt vor, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Vermutlich hat er schon öfter Spenden gesammelt, und da habe ich mich bestimmt gedrückt. Hätte ich an dem Tag nicht gerade meinen Lohn gekriegt und mich reich gefühlt, hätte ich ihm vermutlich nicht mal ein Los abgenommen.
Laura hält einen Moment inne. »Obwohl … vielleicht doch, wenn ich geahnt hätte, für welchen Zweck es ist«, setzt sie hinzu.
Natürlich würden sich weder Laura noch Jenny weigern, dieser Wohltätigkeitsorganisation eine Spende zukommen zu lassen. Ihre jüngere Schwester Melanie starb fünfzehn Jahre zuvor an Leukämie.
»Wo hast du das Los denn gekauft?«, fragt Jenny mit einem nochmaligen Blick auf den Brief.
»Auf dem Parkplatz beim Supermarkt. Keine Angst, Jen, war keine Bauernfängerei.«
»Hab ich auch nicht behauptet«, kontert Jenny.
»Aber du denkst, Brian könnte was mit der Sache zu tun haben, stimmt’s? Dass das alles Theater ist, um mich auf die Insel zu locken, wo er mich so lange bekniet, bis ich ihm noch ’ne Chance gebe. Stimmt doch, oder?«
Zerknirscht sieht Jenny ihrer Schwester in die veilchenblauen Augen. »Na ja, ging mir so durch den Kopf.«
»Verlass dich drauf, so gerissen ist der nicht. Kannst du dir vorstellen, dass der sich so eine Mühe macht? Eine falsche Wohltätigkeitsorganisation vortäuschen, sich einen Komplizen beschaffen, der mir das Los andreht, das Briefpapier von dem Gasthaus besorgen und ein Schreiben vom Geschäftsführer fälschen?«
Jenny lacht. »Da ist was dran. Das würde der nie und nimmer hinkriegen.« Abermals senkt sie den Blick auf die Tuschezeichnung von dem Gasthaus. »Jammerschade, dass du nicht hin kannst. Sieht echt gemütlich aus.«
»Fahr du doch!«, sagt Laura plötzlich.
»Hast du das Kleingedruckte nicht gelesen? Der Gewinn ist nicht übertragbar, steht da.«
»Ja und?«, fragt Laura mit spitzbübischem Grinsen. »Wir sind doch eineiige Zwillinge. Wann haben wir das letzte Mal die Rollen getauscht?«
Jenny lächelt. »Ich dachte, wir wären uns einig, dass wir das lassen. Denk mal an unsere Schulzeit!«
Der damalige Freund ihrer Schwester war nicht eben begeistert gewesen, als er entdeckte, dass Jenny von Laura zu einem Rendezvous geschickt worden war, während sie selbst mit einem anderen ausging. Natürlich hätte der junge Mann es nie gemerkt – hätte Jenny nicht so dilettantisch Magenschmerzen vorgetäuscht, um nicht mit ihm intim werden zu müssen.
Laura hatte bewusst unerwähnt gelassen, dass sie und ihr Freund schon über ein Jahr miteinander schliefen und er daher Sex für ganz selbstverständlich hielt.
»Jen«, sagt Laura nun, »wir sind nicht mehr in der Schule. Nimm meinen Führerschein als Ausweis mit und fahr auf die Insel. Kannst da ja ein bisschen malen und zeichnen oder so. Viele Alternative und Künstler leben da.«
»Echt?«
»Ja. Noch nie gehört?«
»Nein.«
»Sieht dir ähnlich. Also manchmal bist du wirklich hinterm Mond, Jen«, brummt Laura kopfschüttelnd. »Na, jedenfalls tummeln sich da im Sommer jede Menge langhaarige Typen in Hippieklamotten. Sitzen den ganzen Tag rum und malen.«
Die Idee, ihre Malutensilien auf ein idyllisches Eiland mitzunehmen, hat für Jenny etwas Verlockendes. In letzter Zeit hatte sie einfach zu viel um die Ohren, um sich ihrem Hobby zu widmen. Trotzdem …
»Auf dem Bild im Führerschein hast du aber kurze Haare. Meines ist lang«, gibt sie zu bedenken.
»Na und? Ich hab ihn vor einem Jahr neu ausstellen lassen. Seitdem könnte das Haar nachgewachsen sein. Gib dir einen Ruck, Jen. Nach diesem ganzen Theater mit Keegan brauchst du mal ’ne Auszeit.«
Keegan! Jenny verzieht schmerzhaft das Gesicht.
Ach, Gott! Ob es wohl irgendwann so weit ist, dass sein Name nicht diese Reaktion bei ihr hervorruft?
Jenny betrachtet die Zeichnung des Gasthofs: ein altmodisches Haus wie aus dem Bilderbuch – Mansardendach mit Gauben und Giebeln, das Grundstück umgeben von einem Staketenzaun, und auf dem Torpfosten eine Katze. Alles sieht aus wie ein verträumtes, malerisches Örtchen, an dem man es sich mit Zeichenblock und einem Becher Tee gemütlich machen und das schmerzliche Ende einer Beziehung vergessen kann.
»Vielleicht hast du recht«, gibt sie zögerlich nach.
»Und ob ich recht habe!« Mit einem Satz springt ihre Schwester zum Telefon, das in Reichweite auf einem Tisch steht. Sie nimmt den Hörer ab, lässt ihn am Kabel baumeln und sieht ihre Schwester erwartungsvoll an. »Lies mal die Nummer vor, die da auf dem Bogen steht. Ich wähle. Und nicht vergessen: Du heißt Laura!«
Jenny seufzt. »Na schön. Dann bin ich eben Laura.« Den Blick auf den Brief gerichtet, beginnt sie, die Nummer laut vorzulesen.
1. Kapitel
Die Fähre ist noch nicht zu sehen, nicht einmal als Punkt weit draußen am dämmrigen Horizont. Er weiß aber, dass sie da ist, dass sie mit Kurs auf Tide Island die kabbeligen grauen Fluten vor der Küste Neuenglands durchpflügt. Ehe sie unten ausgangs der Straße am Kai anlegt und ihre Ladung Fahrgäste ausspuckt, wird längst völlige Dunkelheit herrschen.
Sommertags ist die Freitagabendfähre stets voll von Wochenendheimfahrern, Familien auf Urlaub, Studenten, die in der Gastronomie oder als Rettungsschwimmer jobben, von Liebespaaren und Kindern mit klebrigen Gesichtern.
Jetzt aber, im kürzesten Monat des Jahres, wenn der Winter am unwirtlichsten ist und das Eiland nichts weiter zu bieten hat als stille, frostige Abgeschiedenheit, werden nicht viele Passagiere an Bord sein. Höchstens ein paar eingefleischte Naturliebhaber, die unverdrossen den Elementen trotzen; vielleicht einige Insulaner, die von einer Einkaufstour auf dem Festland zurückkehren; eventuell eine Handvoll Sommerhausbesitzer, die nach dem Orkan vom Dezember die Schäden an ihren Anwesen in Augenschein nehmen und nach dem Rechten sehen wollen.
Das wär’s aber auch schon.
Und natürlich seine drei …
Er weiß, dass sie sich an Bord befinden – alle drei. Untereinander noch Fremde, doch für ihn nicht.
Er beobachtet sie schon so lange.
Und er wartet.
Freudige Erregung lässt ihn erschauern, sodass er sich ganz bewusst mahnen muss, locker zu bleiben, sich zu beherrschen. Ausgerechnet jetzt, da sich endlich alles fugt, kann er es sich nicht leisten, Risiken einzugehen.
Nach all den Jahren …
Bald, versichert er sich. Es dauert nicht mehr lange.
Fast schwindlig vor Erregung, lässt er nochmals den Blick über die Wasserfläche wandern. Vor einer Weile hat er den Wetterbericht im Radio gehört, und danach wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es an diesem Wochenende stürmisch werden könnte.
Wäre das nicht perfekt?
In diesem Augenblick genießen die drei womöglich sogar den aufregenden Wellenritt durch die Dämmerung. Er stellt sich vor, wie sie in unterschiedlichen Ecken sitzen, an Deck oder in einer Kajüte, jede ihren Gedanken nachhängend, im Geiste schon bei dem kommenden Wochenende und voller gespannter Erwartung.
Sie sind nicht die Einzigen, die sich darauf freuen.
Entzückt verzieht er das Gesicht und unterdrückt ein Glucksen.
Bald, sehr bald!
Er zieht die hauchdünne Spitzengardine zurück vor die Scheibe und wendet sich vom Fenster ab.
Vor der Ankunft gibt es noch eine Menge zu tun.
Als die Fähre in Crosswinds Bay ablegt und Kurs auf den offenen Atlantik nimmt, hält Jenny das Gesicht in den kalten Wind und lächelt.
Welche Wohltat, einmal alles hinter sich lassen zu können, und sei es auch nur für ein paar Tage! Sie merkt schon, wie ihre chronische Verkrampftheit allmählich von ihr abfällt. Tief lässt sie die salzige Seeluft in ihre Lungen dringen und stößt einen befriedigten Seufzer aus.
Als sie zwanzig Minuten zuvor den Fähranleger erreichte, tat ihr die gesamte Kieferpartie weh, auch Nacken- und Rückenmuskulatur waren total verspannt vom Stress.
Wohl wissend, dass freitagabends der Verkehr aus Boston heraus immer eine Katastrophe ist, war sie schon um drei Uhr aufgebrochen, um dem Ansturm zuvorzukommen. Leider hatte sich auf der Autobahn ein Lkw mit Anhänger quergestellt und ein anderes Fahrzeug gerammt. Infolgedessen saß sie also schon um Viertel nach drei im Stau fest, und als der Verkehr dann endlich im Schneckentempo an der Unfallstelle vorbei kroch, zog sie unwillkürlich verängstigt den Kopf ein.
Rotierende gelb blitzende Warnlichter und Sirenengeheul versetzen Jenny stets zurück zu jenem furchtbaren Tag drei Jahre zuvor – auch der Anblick von Blut, und seien es nur Tröpfchen. Vor zwei Tagen erst hat sie sich mit einem Schälmesser in den Finger geschnitten, und selbst eine geschlagene halbe Stunde später zitterte sie noch am ganzen Körper.
Am Nachmittag hatte sie alle Mühe gehabt, die bestürzenden Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis zu bannen und sich auf die Fahrbahn zu konzentrieren. Sie war zügig weitergefahren, um die Fünf-Uhr-Fähre ab Crosswinds Bay an der Südwestküste von Rhode Island noch zu kriegen. In der Regel überschreitet sie das Tempolimit nie um mehr als zehn Stundenkilometer, doch diesmal blieb ihr keine andere Wahl, wollte sie übers Wochenende noch weg. Und das hatte sie sich fest vorgenommen.
Jenny war, als winke der behagliche Gasthof Bramble Rose schon von weitem – Aussicht auf eine kurze Zeit der Ruhe. Die Fähre durfte sie keinesfalls verpassen; es war die letzte an diesem Abend. Um die noch zu erwischen, hätte sie ein Strafmandat wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in Kauf genommen. Es war ihr so vorgekommen, als sause alle Welt mit hundertdreißig Sachen an ihr vorbei. Da war auch sie mit ihrem roten Kleinwagen auf die linke Spur gewechselt und hatte die Tachonadel auf hundertzehn klettern lassen. Kurz hinter Providence war sie von einer humorlosen Motorradstreife gestoppt und prompt zur Zahlung eines Bußgeldes verdonnert worden.
Noch den Kopf darüber schüttelnd, dass sie bei dieser Aktion saftige fünfzig Dollar losgeworden ist, zieht Jenny ihre schwarzen Lederhandschuhe aus der zu ihren Füßen stehenden Tasche und streift sie über die von der Kälte rissigen Hände. An Deck ist es zwar eisig, aber noch möchte sie nicht den Schutz der Kabine aufsuchen.
Es hat etwas Reinigendes, hier draußen zu stehen, wo einem die frische, fischig riechende Luft durch die Haare weht und in die Wangen beißt, bis sie anschwellen. Irgendwo über ihr von der Brücke läutet eine Schiffsglocke – ein hallendes Lebewohl hinüber zum Ufer, das sie rasch hinter sich lassen.
»Verzeihung, wissen Sie, wie spät es ist?«
Beim Klang der Stimme dreht Jenny sich um. Hinter ihr steht eine junge Frau, die sich mit einer Hand an der Reling festhält, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Sie ist so dick in Daunenjacke und Schal eingemummelt, dass man nur ihre hübschen braunen Augen sieht und eine Stupsnase, die von der frostigen Luft schon ganz rot ist.
Jenny streift die Handschuhe zurück und guckt auf ihre Uhr. »Gleich Viertel nach sechs.« Sie muss quasi brüllen, um sich über den Wind und das Klatschen der Wellen hinweg Gehör zu verschaffen.
»Danke. Haben Sie eine Ahnung, wann wir planmäßig einlaufen sollen?«
»Etwa halb acht, glaube ich. Laut Fahrplan zumindest.«
»Gott sei Dank. Ich sterbe vor Hunger.«
»Ich auch.« Bei der Gelegenheit fällt Jenny ein, dass sie seit dem halben Blaubeer-Muffin, den sie am Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Wagen hinunterschlang, nichts mehr gegessen hat. Zu sehr beschäftigt mit Packen und frühem Aufbruch, hat sie das Mittagessen total verschwitzt.
Mit der behandschuhten Hand greift die Mitreisende in die Jackentasche und zaubert einen Müsliriegel hervor. »Möchten Sie die Hälfte? Zur Überbrückung?«
Jenny zögert. »Ach, lassen Sie nur, ist nicht nötig …«
Ohne viel Federlesen bricht die junge Frau den Riegel mitten durch und reicht Jenny grinsend die eine Hälfte. »Hier. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Ding jetzt ganz allein verputzen würde. Zumal ich auf Diät bin.«
»Vielen Dank«, ruft Jenny.
»Nichts zu danken. Ist fettfrei, schmeckt wie ’n Stück Pappe. Ich bin also nicht so großzügig, wie Sie denken.«
Jenny erwidert ihr Lächeln, drückt den Riegel mit ihren behandschuhten Fingern unbeholfen aus der durchgerissenen Verpackung und beißt ein Stückchen ab.
Eine Weile stehen die zwei knabbernd nebeneinander und starren hinaus aufs Meer. Dann sagt die Unbekannte: »Ich heiße Sandra Cavelli, aber alle nennen mich Sandy.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Jen … äh … Laura. Laura Towne.« Fast hätte sie sich versprochen, aber wo sie nun schon dabei ist, kann sie sich auch getrost an den Namen gewöhnen, damit ihr der Fauxpas im Gasthaus nicht noch einmal passiert.
Auf die Reling gestützt, starren die zwei noch geraume Zeit in die sich niedersenkende Dunkelheit und lassen sich ihren Müsliriegel schmecken.
»Waren Sie schon mal auf Tide Island?«, fragt Sandy, wobei sie sich den letzten Bissen in den Mund steckt. Dann knüllt sie das Papier zusammen und stopft es in die Tasche.
»Nein, Sie?«
»Ein Mal. Als Kind mit meinen Eltern und meinen Brüdern. Viel ist mir nicht in Erinnerung geblieben – außer dass wir eines Tages auf eine Horde FKK-Anhänger stießen, als wir am Strand ein Picknick machen wollten. Meine Eltern sind ausgeflippt.«
Jenny lächelt. »Kann ich mir denken.«
»Sie fanden die Insel ohnehin nicht so doll. Von Hippies überlaufen, meinten sie. Mein Vater behauptete das immer.«
»Ja, ist wohl immer noch so«, bemerkt Jenny, die sich an Lauras Hinweis erinnert. »Sagt meine Schwester jedenfalls.«
»Genau, hab ich auch gehört.«
»Soll aber wunderschön dort sein.«
»Richtig, und um diese Jahreszeit ist nicht viel los.« Sandy schüttelt den Kopf. »An sich wollte ich meinen Eltern ja gar nicht verraten, wohin ich am Wochenende fahre, aber meine Mutter hat zufällig mitgehört, wie ich mit meiner besten Freundin darüber am Telefon geredet habe. Natürlich hat sie mich ausgequetscht und es postwendend meinem Vater gesteckt, und der ging gleich hoch, wie üblich. Aber von denen brauche ich mir keine Vorschriften machen zu lassen, oder? Ich wohne zwar unter einem Dach mit ihnen, aber ich bin ja volljährig.« Trotzig reckt sie ihr Doppelkinn.
Jenny nickt, obwohl sie das Gefühl hat, dass ihre neue Bekanntschaft gar nicht so überzeugt ist, wie sie tut. Sie hört sich fast an wie ein rebellischer Teenager, und sie sieht auch so aus.
Abrupt wechselt das Mädchen das Thema. »Und was hat Sie hierher verschlagen? Warum jetten Sie nicht auf die Jungferninseln? Ist doch so üblich, wenn man mitten im Winter Urlaub macht, oder?«
Jenny zieht die Schultern hoch. »Keine Ahnung. Ist vermutlich ziemlich voll in der Karibik, wenn wir hier im Nordosten Winter haben.«
Vermutlich? Wieso vermutlich? Du weißt es doch!
Aber an den Jamaika-Urlaub mit Keegan im November möchte sie lieber nicht erinnert werden.
Sandy lächelt. »Ja, voll von lauter alleinreisenden Männern, nehme ich an.«
»Sind Sie Single?«
»Allerdings, leider. Ich war mal verlobt, aber es hat nicht sollen sein. Und Sie?«
Um ein Haar hätte Jenny gesagt: Ich habe gerade mit jemandem Schluss gemacht. Sie kriegt aber eben noch die Kurve, denn sie neigt nicht dazu, wildfremden Menschen persönliche Details auf die Nase zu binden. Außerdem würde sie dieser Sandy Cavelli sowieso nicht die volle furchtbare und schmerzliche Wahrheit erzählen. Selbst ihre Kolleginnen und Kollegen wissen nichts davon.
»Gar nicht so einfach, einen halbwegs anständigen Mann kennenzulernen«, seufzt Sandy melancholisch. »Ich hatte schon seit zwei Monaten kein Date mehr. Und wie steht’s mit Ihnen?«
Das Mädchen hat etwas an sich, das Jenny, ganz gegen ihre Gewohnheit, dazu drängt, sich ihm anzuvertrauen. Trotzdem hält sie sich zurück. »Eigentlich auch nicht«, weicht sie aus.
»Ich treffe mich auf der Insel mit jemandem«, verrät Sandy.
Vermutlich, denkt Jenny, hat sie sich fest vorgenommen, an diesem Wochenende einen netten Typen aufzureißen. Aber dann redet Sandy weiter und sagt: »Wird so was wie ’n Blind Date.«
»Schön.«
»Ja. War seine Idee. Er hat da ein Haus. Er ist Arzt.«
»Arzt? Donnerwetter!« Jenny tut beeindruckt, weil sie vermutet, dass Sandy das erwartet.
»Ja, was?«
»Wo hat er denn seine Praxis? Auf der Insel selbst?«
»Nein, da hat er nur sein Wochenendhaus«, erklärt Sandy. Es klingt ein wenig blasiert, aber dann fügt sie verlegen hinzu: »Na ja, wo die Praxis ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, ist ein Blind Date. Ich weiß nicht viel über ihn.«
»Ach so. Klingt romantisch.«
»Sie sagen es. Ist mir auch egal, wo er arbeitet, denn ganz gleich, wo es wäre – wenn es zwischen uns funkt, würde ich da im Nu hinziehen. Ich mache drei Kreuze, wenn ich Hartford den Rücken kehren kann. Es sei denn, er wohnt da zufällig auch.«
»Ach, da wohnen Sie? In Hartford?«
»Ja. Das heißt, nicht direkt … in der Nähe … genauer gesagt in Greenbury. Das ist eine Kleinstadt.« Auf Jennys verständnislosen Blick hin schiebt Sandy nach: »Noch nie gehört, hm? Wundert mich nicht. Und woher kommen Sie?«
»Aus Boston.«
»Und was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Antiquitätenhändlerin«, sagt Jenny, bevor ihr einfällt, dass sie sich ja als Laura ausgibt, die bei einer Bekleidungskette arbeitet. Egal – jetzt ist es sowieso zu spät.
Offenbar verrät ihre Miene etwas, denn Sandy sagt: »Auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, hm?«
»Ach, so würde ich das nicht sagen, nur …«
Nur ist es so, dass mich alles an Keegan erinnert. Das ist das Problem.
»Was gefällt Ihnen denn nicht?«
»Oh, gefallen tut’s mir durchaus.« Jenny sieht in den Himmel. »Haben Sie auch gerade einen Tropfen abgekriegt?«
»Nein, ich bin so eingemummelt – ich würde es nicht mal merken, wenn ich ein faustdickes Hagelkorn abbekäme. Regnet es etwa?«
»War wohl bloß Gischt. Aber ich glaube, ich verziehe mich jetzt nach drinnen. Ich kriege schon ganz taube Füße.«
»Gut. Ich bleibe noch ein Weilchen draußen.
Vielleicht kriege ich ja ’n bisschen Windröte ab. Ich sehe viel besser aus, wenn ich etwas Farbe habe.«
»Danke für den Snack.«
»Keine Ursache.«
»Man sieht sich.« Jenny löst sich von der Reling und wankt auf unsicheren Beinen auf die Tür zu.
Ein Schwall warmer Luft schlägt ihr entgegen, als sie die Fahrgastkabine betritt. Nach dem Tosen des Windes draußen empfindet man die Stille ganz besonders. Jenny öffnet den obersten Jackenknopf und steuert einen freien Platz auf einer Bank direkt an der Wand an.
Beim Hinsetzen bemerkt sie, dass eine aparte junge Frau neben ihr sitzt, die sich den Bauch hält und ziemlich blass um die Nase ist. Noch unter dem Eindruck von Sandys ausgesprochen kontaktfreudigem Wesen, fasst Jenny in die Jackentasche und tastet nach den Magentabletten, die sie für alle Fälle eingesteckt hat.
Sie wendet sich an ihre blonde Sitznachbarin. »Entschuldigen Sie, ich hab was gegen Übelkeit dabei. Möchten Sie eine Tablette?«
Die Blonde schüttelt kaum merklich den Kopf und schließt abrupt die Augen, wie um sich von allem abzuschütten.
Na, sagt Jenny stumm zu sich, wenn ich seekrank wäre, wäre ich vermutlich auch nicht sonderlich mitteilsam. Sie zieht eine Illustrierte aus ihrer Reisetasche.
Während sie sich zurücklehnt und zu lesen beginnt, verglüht am Himmel der letzte Hauch von Abendrot. Zügig tuckert die Fähre durch die Dunkelheit auf die Insel zu.
Von der Landungsbrücke aus setzt Liza den Fuß auf den alten Holzanleger und lässt den Blick kreisen. Es ist nichts zu sehen. Ringsum nur Schwärze – das Wasser, der Himmel, die wenige hundert Meter entfernten Gebäude. Das einzige Licht kommt vom Deck der Fähre hinter ihr, und selbst das wirft einen so trüben Schein, dass die Umgebung noch unheimlicher wirkt.
Sie weiß nicht, was sie erwartet hatte. Zwar war ihr klar, dass außerhalb der Saison nicht gerade Hochbetrieb auf der Insel herrscht, dass nicht viele Läden und Lokale geöffnet haben.
Aber das hier … Das erinnert an eine Geisterstadt.
Drüben, jenseits des Anlegers, kann man durch die wabernden Nebelschleier hindurch die Hauptstraße ausmachen. Liza erkennt sie von einer Broschüre wieder, die sie aus einem heimischen Reisebüro mitgenommen hat. Auf dem Foto hatte die Straße mit den prachtvollen viktorianischen Hotels und malerischen Läden bezaubernd ausgesehen. Nun ragen die Mansardendächer mit ihren Gauben und Giebeln gespenstisch stumm in den Nachthimmel. Offenbar sind die Häuser menschenleer, die Fenster zum Schutz gegen die Unbilden des Winterwetters mit Sperrholzplatten vernagelt.
Während um sie herum weitere Fahrgäste aussteigen und eilig dem nahe gelegenen Parkplatz zustreben, verharrt Liza noch unschlüssig am Kai. Begrüßungsrufe hallen durch die Nacht; anscheinend werden einige Passagiere von Freunden oder Verwandten am Landungssteg abgeholt.
Neugierig guckt sie in die Runde. Was ist wohl mit der Mitreisenden, die ihr zuvor auf der Fähre die Tabletten gegen Übelkeit anbot? Möglich, dass die sie für seekrank hielt. Dem war aber nicht so.
Sie hatte vielmehr über Robert nachgedacht, mit dem sie ein paar Mal ausgegangen war. Diese Woche hat er ihr fünfundzwanzig Mal auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ist der Kerl etwa so schwer von Begriff?
Als die Mitreisende sie ansprach, stand Liza nicht der Sinn nach Gesellschaft. Jetzt allerdings wäre ihr die Frau mit den veilchenblauen Augen mehr als willkommen.
Weit und breit keine Spur von ihr.
Von einem plötzlichen Gefühl der Einsamkeit erfasst, greift Liza zu ihren Handschuhen. Sie stellt ihre Reisetasche auf die groben Planken zu ihren Füßen, lässt die Finger in das kuschelige Kaschmirfutter gleiten und fühlt sich schlagartig besser.
Sie überlegt, welche Richtung sie wohl einschlagen muss, um zum Bramble Rose zu gelangen.
Als sie ihr Zimmer reservieren ließ, hatte der Geschäftsführer gesagt, sie müsse der Main Street gut dreihundert Meter folgen, dann komme sie automatisch hin. Können Sie nicht verpassen, hatte er ihr versichert.
Irgendwie kann sie sich nicht dazu aufraffen, den Anleger zu verlassen und sich zu der menschenleeren Straße zu begeben. Vom Parkplatz dringt das Brummen anspringender Motoren herüber. Etliche Scheinwerferpaare schwenken in Richtung Main Street; nach und nach verglimmen die Rücklichter in der Dunkelheit.
Hinter Liza gehen noch einige Nachzügler an Land. Auch die werden bald weg sein, ebenso wie die Fähre selbst. Dann steht sie mutterseelenallein auf diesem trostlosen Fleck.
Liza holt tief Luft, nimmt ihre Tasche und wendet sich zur Straße. Während sie der verwaisten Strandpromenade folgt, die parallel zur Straße verläuft, hört sie das Klopfen ihrer Stiefelabsätze auf den Holzbohlen – ein hohles, einsames Hallen, das ihr Herz noch schneller schlagen lässt. Keine Straßenlaternen, keine vorbeifahrenden Autos; nichts.
Klagend jault der Wind über die Wasserfläche. Über das Heulen hinweg dringt das Dröhnen der Dieselmotoren, als die Fähre im Hafenbecken wendet.
Angestrengt späht Liza voraus in die Schwärze. Solch einen gottverlassenen Ort, so eine stockfinstere Dunkelheit hat sie noch nie erlebt. Kein Mond, der ihr den Weg beleuchten würde, nirgendwo der anheimelnde Schein von erhellten Fenstern; nicht das geringste Anzeichen, dass hier überhaupt jemand wohnt.
Bemüht, sich gegen den wachsenden Anflug von Panik zu stemmen, verlässt Liza die Promenade, die am letzten Haus der Häuserzeile endet. Von hier an geht es weiter auf einer breiten, sandverwehten Straße, die sacht ansteigend vom Ufer weg in einem Bogen landeinwärts führt.
Liza bleibt stehen, unschlüssig, ob sie dem Weg folgen soll oder nicht. Umkehren kann sie ja jederzeit, und …
Über ihr kracht plötzlich ein Fensterladen zu. Liza zuckt zusammen und stößt einen Schrei aus, bis sie merkt, woher das Geräusch kam.
Die zitternden Hände zu Fäusten geballt und gegen den Mund gepresst, wird sie sich bewusst, dass ihre Nerven blank liegen.
Lachhaft, das Ganze! Was hat sie mutterseelenallein hier draußen im Stockfinstern verloren? In New York würde es ihr nicht im Traum einfallen, nächtens ohne Begleitung durch die Gegend zu laufen. Nicht mal der Dümmste käme auf eine solche Idee. Eine Frau, allein und dann auch noch im Dunkeln – das fordert Ungemach geradezu heraus!
Sie muss zurück.
Pfeif auf D.M. Yates!, denkt Liza.
Sie will nur eins: heim in ihr vertrautes Manhattan.
Genau in diesem Moment hallt von unten die Glocke, die ihr verrät, dass die Fähre wieder Kurs nimmt aufs Festland.
Wartet!, möchte sie schreien. Nehmt mich mit! Lasst mich hier nicht alleine!
Aber es ist schon zu spät. Den Dampfer wird sie jetzt nicht mehr erwischen, auch wenn sie im Sprinttempo bis zum Landungssteg rennt.
Also eilt sie weiter, die Finger so krampfhaft um den Griff der Tasche gekrallt, dass sich die Nägel durch den Handschuh hindurch in den Handballen bohren.
Der Nebel scheint ständig dichter zu werden. Getrieben vom unablässigen Wind, wallt er gespenstisch vom Meer herüber.
An diesem Abschnitt säumen einige niedrige Gebäude die Straße, auch sie offenbar verlassen wie alles ringsum. Die Schilder – manche mit witzigen Aufschriften wie Sun & Fun Surf Shop oder Big Buddy’s Fahrradverleih – wirken in dieser düsteren Umgebung auf das Absurdeste deplatziert.
Liza spürt ein Steinchen, das sich in ihren Stiefel gemogelt zu haben scheint. Bestrebt, es einfach zu ignorieren, stapft sie erst unverdrossen weiter, hält dann aber doch an, um es herauszuholen. Sie stellt die Tasche ab, zieht sich, auf einem Bein balancierend, den Stiefel aus und kippt den Kiesel auf den frostharten Beton.
Während sie die Schnürsenkel wieder zubindet, fragt sie sich, wie weit sie wohl schon gekommen ist. Dreihundert Meter doch bestimmt!
Plötzlich merkt sie, wie sich ihre Nackenhaare sträuben. Ein unverwechselbares Gefühl beschleicht sie.
Das Gefühl, beobachtet zu werden.
Den Stiefel nur halb zugeschnürt, schnappt sie sich ihre Tasche und marschiert weiter.
Die unheimliche Ahnung wird stärker.