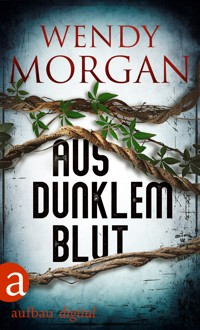8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wendy Morgan Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Es gibt kein Entkommen.
Mit neununddreißig Jahren hat Peyton Somerset ein beneidenswertes Leben, mit einer erfolgreichen Position in der Werbebranche und einer schönen Wohnung in Manhattan. Sogar ihr sehnlichster Wunsch - ein Baby zu bekommen - wird bald erfüllt. Der Vater des Kindes hat sich zwar aus dem Staub gemacht, doch Peyton plant ihr Kind alleine großzuziehen. Aber dann wird ihr Glück überschattet. Peyton wird das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Jemand beobachtet sie. Jemand war in ihrer Wohnung. Jemand verfolgt sie. Ist es nur eine hormonelle Paranoia, dass sie allen um sich herum zu misstrauen? Oder ist Peyton wirklich in Gefahr? Ihre Angst steigert sich, als eine gute Freundin, die ebenfalls schwanger ist, plötzlich spurlos verschwindet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Ähnliche
Über Wendy Morgan
Wendy Morgan hat englische Literatur mit dem Schwerpunkt kreatives Schreiben studiert. Nach ihrem Studium hat sie zunächst als Lektorin und Journalistin gearbeitet, um sich dann ganz ihrem Traumberuf der Schriftstellerin zu widmen. Wendy Morgan lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in New York.
Informationen zum Buch
Mit neununddreißig Jahren hat Peyton Somerset ein beneidenswertes Leben, mit einer erfolgreichen Position in der Werbebranche und einer schönen Wohnung in Manhattan. Sogar ihr sehnlichster Wunsch - ein Baby zu bekommen - wird bald erfüllt. Der Vater des Kindes hat sich zwar aus dem Staub gemacht, doch Peyton plant ihr Kind alleine großzuziehen.
Aber dann wird ihr Glück überschattet. Peyton wird das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt.
Jemand beobachtet sie. Jemand war in ihrer Wohnung. Jemand verfolgt sie.
Ist es nur eine hormonelle Paranoia, dass sie allen um sich herum zu misstrauen? Oder ist Peyton wirklich in Gefahr? Ihre Angst steigert sich, als eine gute Freundin, die ebenfalls schwanger ist, plötzlich spurlos verschwindet ...
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wendy Morgan
Schlafe sanftund ewiglich
Roman
Ins Deutsche übertragen vonMartin Hillebrand
Inhaltsübersicht
Über Wendy Morgan
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Dank
Prolog
Zehn Jahre später. Erster Monat. Februar
1. Kapitel
Zweiter Monat. März
2. Kapitel
Dritter Monat. April
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Vierter Monat. Mai
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Fünfter Monat. Juni
9. Kapitel
10. Kapitel
Sechster Monat. Juli
11. Kapitel
12. Kapitel
Siebter Monat. August
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Achter Monat. September
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Neunter Monat. Oktober
Epilog
Impressum
Widmung
Für Andrew Caleb Sypko, meinen neuen kleinen Neffen,
der einen sehr, sehr langen Weg zurücklegen musste,
um endlich nach Hause zu gelangen.
Und für Mark, Morgan und Brody, die mein Zuhause sind.
Danksagung
Ich bedanke mich bei all meinen Verwandten und Freunden für ihre ständige Unterstützung und Inspiration. Insbesondere gilt dieser Dank Sonya Aydell, Kathy Barker, Beverly Barton, Janine Bauert, Anne Boehm, Anita Borgenecht, Tricia Caitlin, Kathy Carson, Toni Cramer, Gaile Davis, Patty und Rick Donovan, Cindy Gaston, Elizabeth Hannah, Meredith Haynes, Thjodie Hess, Denise Hodder, Lisa Jackson, Brooke Dunn-Johnson, Sheryl Madden, Gena Massarone, Michele Mazur, Joanne Masten, Doug Mendini, Patti Nota, Phil Pelletere, Elaine Pharrel, Katie Plotkin, Rhoda Rudnik, Helen Rush, Joan Siegel, Kelly Spagnola, Mark Staub, Natalie Syrba, Jan Wallace und Wendy Zemanski.
Eine besonders liebevolle Umarmung geht an Laura Blake Peterson, meine Agentin, sowie an alle bei Curtis Brown, desgleichen an meinen Herausgeber John Scognamiglio und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kensington Publishing.
Prolog
»Bitte! Bitte, tun Sie mir nichts! Ich möchte doch bloß mein Baby …«
»Aber gewiss doch!« Ihr Gegenüber verzieht die Lippen und entblößt weiße, ebenmäßige Zähne. »Sie werden Ihr Baby bekommen.«
Die Worte – und das Lächeln – können Heather nicht im Geringsten beruhigen. Sie wird von einem kalten Schauder gepackt.
Nur unter Aufbietung aller Kräfte gelingt es ihr, die aufkommende Panik zu unterdrücken. An ein Entkommen ist nicht zu denken; hochschwanger liegt sie auf dem Bett ausgestreckt, Hände und Füße an die Bettpfosten gefesselt. Selbst wenn man sie lange genug allein ließe, um die Hände aus den Stricken zu zwängen, selbst wenn sie in Hochform wäre und rennen könnte – weit käme sie nicht. Was jenseits der Zimmertür lauert, weiß Heather nicht – mit verbundenen Augen und unter vorgehaltener Waffe wurde sie an diesen Ort gebracht. Jetzt ist die Augenbinde ab und die Pistole versteckt, doch Heather ahnt ihre Nähe. Ein Risiko darf sie nicht eingehen. Todesangst überkommt sie.
Körperlich hilflos, kann sie sich nur mental wehren. Sie zerbricht sich den Kopf nach einem Ausweg, nach einer schlüssigen Erklärung. Der einzige logische Gedanke, den ihr verworrenes Hirn zu formen vermag, ist der, dass sie in Wirklichkeit gar nicht hier ist. Das Ganze ist völlig unmöglich. Sie muss zu Haus ein ihrem Bett liegen. Es muss sich um einen jener verrückten Albträume handeln, von denen sie seit ein paar Wochen heimgesucht wird.
Die Lider fest zugekniffen, gibt sie sich selbst ein Versprechen: Wenn sie bis zehn zählt und dann die Augen aufschlägt, sieht sie garantiert die vertraute weiß-rosa Streifentapete, den Kuscheltierzoo und über dem Bett die Pinnwand mit den Fotos von ihr und Ryan beim Abschlussball und im Cheerleader-Trainingslager im vergangenen Sommer.
Eins … zwei … drei …
Das Sommerlager war ihr von ihrer Mutter geradezu aufgezwungen worden. Im Vorjahr hatte Heather noch um die Teilnahme gebettelt, aber da konnten sie es sich angeblich nicht leisten. Diesmal hatte ihre Mutter das Geld dafür irgendwie zusammengekratzt, allen Protesten zum Trotz. Heather wäre viel lieber zu Hause geblieben, in der Nähe von Ryan, der im städtischen Schwimmbad als Rettungsschwimmer jobbte.
Natürlich war Ryan der eigentliche Grund, weswegen ihre Mutter sie den Sommer über von Staten Island weghaben wollte. Sie war nämlich der Ansicht, Heather hocke viel zu häufig mit ihm zusammen. Sie hatte Angst, der Tochter könne genau das passieren, was schon ihr selbst passiert war. Alles Betteln und Flehen half nichts: In Sachen Cheerleader-Camp blieb ihre Mutter hart. »Du fährst, Heather. Ende der Diskussion.«
… vier … fünf…sechs …sieben …
Ende der Diskussion? Von wegen. Nach der Rückkehr aus dem Sommerlager stellte Heather fest, dass ihre Periode ausgeblieben war. Von einem Tag auf den anderen wurde aus Heather das wandelnde Klischee – das römisch-katholische Schulmädchen, das bei der Abschlussfeier der Mittelstufe die Unschuld verliert und sich ein Kind andrehen lässt. Der schlimmste Albtraum ihrer Mutter.
Schlimmer. Sie kam sich vor wie ihre Mutter selbst.
… acht… neun … zehn!
Keine rosa-weiße Streifentapete.
Kein Kuscheltierzoo.
Keine Pinnwand.
Der Verzweiflung nahe lässt Heather den Blick durch das unscheinbare, kastenförmige Zimmer schweifen. Weiß getünchte Wände. Kommode, Stuhl, hölzernes Bettgestell. Ein Fenster mit geschlossenen Jalousien; schlichte beige Vorhänge an einer Gardinenstange aus Metall.
Wo bin ich, verdammt noch mal?
Von grenzenlosem Heimweh erfasst, sehnt sie sich nach den bauschigen weißen Tüllgardinen, die ihre Mutter im vergangenen Jahr beim Ausverkauf im Supermarkt erstanden hatte. Heather hatte die Dinger viel zu babyhaft für eine Fünfzehnjährige gefunden. Jetzt würde sie alles dafür geben, sie noch einmal zu sehen. Ihre Mutter wiederzusehen.
»Bitte …« Wimmernd fugt sie sich in die Erkenntnis, dass dies alles doch kein Albtraum ist.
Sondern Wirklichkeit.
Wieder ragt die Gestalt drohend über dem Bett auf. Jetzt ist Heather fest davon überzeugt, dass ihr Leben – und das ihres Ungeborenen – in Gefahr ist.
»Was gibt’s? Hast Angst, was? Armes Ding.«
Die Augen, die auf sie herunterblicken, sind sonderbar leer und bar jeder menschlichen Regung. Die fröhliche Stimme, die Heather noch Hilfe beim Beladen ihres Autos angeboten hatte, ist einem beklemmend sachlichen, monotonen Säuseln gewichen. »Ist fast vorbei. Keine Sorge.«
Was soll bald vorbei sein? Oh, lieber Gott, hilf mir!
Heather muss auch noch für ein zweites Klischee herhalten: der hübsche Teenager, der nach einem Bummel durchs Einkaufszentrum spurlos verschwindet.
Noch so ein wahr gewordener Albtraum ihrer Mutter.
Der schlimmste.
»Sieh zu, dass du ein bisschen ruhiger wirst. Das Zittern ist nicht gut für das Kind, hörst du?«
Oh, bitte, bitte! Ich will zu meiner Mom! Ich will nach Hause!
»Hast du Hunger? Quatsch, dumme Frage! Klar hast du Hunger. Du musst ja für zwei essen, und es ist kurz vor sechs. Zeit fürs Abendbrot.«
Sechs Uhr erst?
Dabei kommt es ihr so vor, als sei es schon Stunden her, seit sie aus dem Einkaufszentrum kam und sich im gefrierenden Regen über den vereisten Parkplatz tastete. Um auf die Armbanduhr zu sehen, versucht Heather instinktiv, das linke Handgelenk anzuheben. Doch das wird gehalten von dem Strick, der sie an den Bettpfosten fesselt.
Verzweifelt wimmernd schließt sie die Augen. Eine ganze Bilderflut stürmt auf sie ein.
Die Bestürzung in Ryans schönen blaugrünen Augen, als sie ihm mitteilte, der Schwangerschaftstest sei positiv.
Bittere Enttäuschung und Resignation auf dem Gesicht ihrer Mutter.
Ein winziger Punkt auf dem Ultraschallmonitor. Ein Punkt, von dem sie sich wünschte, er möge auf wundersame Weise verschwinden, damit Ryan wieder Teil ihres Lebens wäre.
Doch das liegt fast acht Monate zurück.
Das alles ereignete sich, bevor sie zum ersten Mal den schnellen Herzschlag des Kindes hörte; bevor sie das erste sachte Flattern spürte, die erste Regung von Leben in ihrem schwellenden Leib. Das alles geschah, ehe die kaum spürbaren Kindsbewegungen den ersten Tritten und Stößen wichen, bisweilen auch einem stakkatoartigen leisen Klopfen – dem Schluckauf des Ungeborenen, so der Arzt. Diese pochenden Laute waren es, bei denen ihr die Schwangerschaft erst so richtig bewusst wurde.
Zu Anfang als Fluch empfunden, hat sich ihr süßes Geheimnis in einen Segen verwandelt; inzwischen sieht Heather dem Datum, vor dem ihr einst regelrecht graute, mit gespannter Vorfreude entgegen. Und es ist bald so weit.
Knapp achtundvierzig Stunden bis zur vorausberechneten Niederkunft.
In letzter Zeit war sie total erledigt und das Wetter dazu auch noch lausig. Warum ist sie da nicht einfach zu Hause geblieben? Wieso musste sie unbedingt noch ein allerletztes Mal im Babyausstattungsladen vorbeischauen?
Weil es ihr nicht passte, dass die Erstausstattung für ihr Baby so bescheiden aussah. Weil sie sich einredete, das Kleine benötige noch ein paar Strampler, noch ein paar Mützchen und winzige Söckchen …
Vielleicht auch deswegen, weil sie sich innerlich nach einem letzten Einkaufsbummel sehnte. Nach einer Verbindung zu ihren unbeschwerten Teenagertagen, die sie hinter sich gelassen hatte, als ihr Bauch dicker wurde und Ryan sowie ihre Freundinnen nichts mehr von ihr wissen wollten.
»He!« Ein heftiger, schmerzhafter Stoß gegen den Arm reißt Heather jäh in die grausige Gegenwart zurück. Als sie abrupt die Augen aufschlägt, sieht sie über sich aufs Neue das unheimliche, fremde Gesicht. »Du hast meine Frage nicht beantwortet! Ob du Hunger hast!«
Oh, bitte, lieber Gott! Mach, dass dieser verrückte Mensch mir nichts tut!
»Ich will nach Hause.«
Eine überraschend sanfte Hand streichelt ihr über den Kopf. »Still. Alles wird gut.«
Still …
Still, still … weil’s Kindlein schlafen will …
Die Melodie des Wiegenliedes, das sie, wenn sie allein ist, schon seit Monaten vor sich hin summt, kommt Heather in den Sinn.
»Bitte! Bitte, lassen Sie mich nach Hause!«
Bitte! Ich möchte mein Baby wiegen und Schlaflieder singen. Bitte!
»Bedaure, das geht nicht.« Das Lächeln weicht einer geschäftsmäßigen Mine, die Heather noch beklemmender vorkommt. Sie hat das Gefühl, als diene es einem bestimmten Zweck, dass man sie hier gefangen hält. Als gäbe es einen besonderen Anlass dafür.
»Was möchtest du essen? Hast du Heißhunger auf was Besonderes? Eingelegte Gurken und Eis vielleicht?«
Der Frage folgt ein irres Gelächter, das aber genauso schnell verstummt, wie es losbrach. »Also – was soll ich dir zu essen machen?«
Diese Person ist sicher nicht richtig im Kopf, aber harmlos!, redet Heather sich ein. Wahrscheinlich ist es das Beste, du spielst einfach mit, bis jemand hier auftaucht und dich rettet. Wo immer »hier« sein mag.
Sie hat keine Ahnung, in welche Richtung es ging, nachdem sie hinten in den Laderaum eines Lieferwagens gestoßen worden war. Der Kleinlaster stand auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums, dicht neben dem Auto ihrer Mutter – so dicht, dass es Heather eigentlich hätte stutzig machen müssen.
Wieso hast du deine dämlichen Einkäufe nicht selbst geschleppt?
Warum hat sie nicht auf die Mahnungen ihrer Mutter gehört, sich nie von Unbekannten ansprechen zu lassen?
»Ich warte!«, zischt die Stimme jetzt. »Los, sag schon! Was möchtest du essen?«
»Irgendwas!« Vor Todesangst ist Heather die Kehle wie zugeschnürt. Nur mit Mühe würgt sie dieses eine Wort heraus.
»Ach, komm schon! Du hast doch sicher einen besonderen Wunsch! Sogar zum Tode Verurteilte dürfen sich die Henkersmahlzeit selbst aussuchen.«
Die Henkersmahlzeit.
In diesem Augenblick fällt es Heather wie Schuppen von den Augen. Sie wird nie mehr nach Hause kommen. Nie wieder heim zu ihrer Mom. Und wird nie selbst eine Mommy werden.
In Tränen aufgelöst, fleht sie um ihr Leben, obwohl sie ahnt, dass alles vergebens ist. »Bitte!«, jammert sie wieder und wieder. »Lassen Sie mich gehen. Ich möchte nur mein Baby bekommen.«
»Das wirst du! Versprochen! Glaub mir, was ich verspreche, das halte ich. Immer.«
»Bitte …«
»Bleib ruhig. Du kriegst dein Kind …«
Das kapiert doch kein Mensch!, durchzuckt es Heather noch wild. Dann hört sie die grausigsten Worte überhaupt: »Du bekommst dein Kind, und zwar direkt nach deiner letzten Mahlzeit. Und eins kannst du mir ruhig abnehmen: Was auf dich zukommt, erfordert deine ganze Kraft.«
Zehn Jahre später
Erster MonatFebruar
1. Kapitel
»Mrs. Somerset, ich habe eine gute Nachricht für Sie!« Mit dem Klemmbrett in der Hand und einem breiten Lächeln auf dem attraktiven Gesicht tritt Dr. Lombardo schwungvoll ins Untersuchungszimmer.
»O mein Gott!« Die Tränen schießen Peyton in die grauen Augen. »Wann ist es so weit?«
»Wie bitte? Da haben Sie wohl was missverstanden. Mit der guten Nachricht meinte ich den Dow-Jones-Index. Der ist gerade einundvierzig Punkte nach oben geschossen.«
Er macht bloß Spaß!, versichert sich Peyton. Trotzdem verspürt sie einen leichten Anflug von Beklommenheit, als wäre alles zu schön, um wahr zu sein. »Ich bin aber doch schwanger … oder?«
»Und ob Sie schwanger sind!« Der Geburtshelfer ergreift ihre Rechte und umschließt sie mit seiner warmen Hand. »Herzlichen Glückwunsch!«
Peyton stößt einen Seufzer der Erleichterung aus. Nicht, dass sie ernsthaft gezweifelt hätte. Vier zu Hause vorgenommene Schwangerschaftstests konnten unmöglich irren. Dennoch hat sie auf Anraten der Arzthelferin die Praxis aufgesucht und eine Blutuntersuchung machen lassen. Um Gewissheit zu bekommen.
Und die hat sie jetzt also.
In ungefähr acht Monaten wird sie Mutter sein.
»Ich verschreibe Ihnen noch pränatale Vitamine«, teilt Dr. Lombardo ihr mit, wobei er eifrig seine Aufzeichnungen durchblättert. »Ferner müssen ein paar Untersuchungstermine festgelegt werden. Ultraschall, Amniozentese …«
»Fruchtwasserpunktion?«
»Die empfehle ich all meinen Patientinnen über vierzig. Bei Spätgebärenden liegt ein erhöhtes Risiko für gewisse Schädigungen beim Ungeborenen vor, und deshalb …«
»Ich werde doch erst im September vierzig.« Nach Peytons Berechnungen müsste das Kind im darauf folgenden Monat zur Welt kommen.
Der Arzt zieht die Schultern hoch. »Letzten Endes müssen Sie’s selbst wissen. Ich gebe Ihnen ein paar Informationsblätter, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.«
Sie nickt zwar, weiß aber jetzt schon, wie diese Entscheidung ausfallen wird. Sie hat zur Vorbereitung auf Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft weiß Gott genug Material studiert. Für sie als mündige Patientin steht ohnehin fest, dass die Tests überflüssig sind. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass das Kind irgendeine schlimme Fehlbildung hätte – was der liebe Gott, so hoffte sie, verhütete –, würde sie es trotzdem austragen. Ganz bewusst.
Wenn Peyton Somerset sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, zog sie es auch durch. Auf ihre Tour.
Der Arzt schildert inzwischen lang und breit alle möglichen Symptome, mit denen sie eventuell zu kämpfen haben könnte. Peyton unterbricht ihn. »Darf ich mir schnell meine Handtasche holen? Dann kann ich mir einiges gleich in mein Filofax eintragen.«
»Nicht nötig. Ich gebe Ihnen eine unserer Broschüren mit. In denen wird alles Notwendige erklärt.«
»Prima, vielen Dank.« Peyton ist froh, dass sie nicht an Lombardo vorbei nach nebenan marschieren muss, wo ihre Sachen an einem Garderobenhaken hängen. Unter dem schlecht sitzenden Patientenkittel ist sie nämlich splitternackt.
Sicher, im Grunde genommen hat Lombardo bei ihr schon alles gesehen, und zwar zur Genüge. Aber sie kann nichts dafür. Er sieht halt gut aus, der Arzt.
Er doziert weiter und weist sie darauf hin, dass er in einer Gemeinschaftspraxis mit etlichen Spezialisten sowie einer staatlich geprüften Hebamme arbeitet. Danach erklärt er ihr, was sie bei den kommenden Terminen zu erwarten hat. Zu versunken in Gedanken an ihre unmittelbare Zukunft, hört sie ihm kaum zu. Morgendliche Übelkeit? Mag sein. Umstandsmode? Aber gewiss!
Sie lächelt in sich hinein und fragt sich, was jetzt wohl mehr Spaß machen könnte als der sonst obligatorische Frühlingseinkauf. Eine komplette Umstandsgarderobe wird fällig. Nichts in Pastellfarben oder mit Rüschen …
»Ich kann Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, sich für einen Schwangerschaftskurs einzutragen«, bemerkt Dr. Lombardo gerade. »Wir bieten einen an, der von unserer praxiseigenen Hebamme geleitet wird. Außerdem läuft ein guter im Krankenhaus. Der umfasst nicht nur Atemtechnik, sondern auch Schmerzbehandlung und -bewältigung.«
Peyton verdrängt vorübergehend ihre Visionen von den zahlreichen Boutiquen, die sich in Manhattan gezielt auf zahlungskräftige berufstätige Mütter in spe spezialisiert haben. »Ich glaube«, teilt sie Dr. Lombardo mit, »ich werde mich für eine natürliche Geburt entscheiden.«
»Das mag sich für Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz toll anhören, aber …«
Exakt. Er kennt sie eben zu wenig und begreift nicht, dass sie sich von Horrorgeschichten aus dem Kreißsaal nicht so leicht umwerfen lässt. Mittlerweile lässt sich eine Peyton Somerset nicht mehr schnell ins Bockshorn jagen. Was streng genommen sowieso schon immer galt.
Jawohl, nur vor einem hat sie echt einen Horror: dass sie die Fassung verliert. Die Herrschaft über ihren Körper, ihre Gefühle, ihre Zukunft.
Ja, Beherrschung ist das Schlüsselwort.
Dr. Lombardo nimmt den Faden wieder auf. »Aber wenn ich«, fährt er fort, »einen Dollar gekriegt hätte für jede Patientin, die anfangs jeglicher Betäubung abschwört und es sich, kaum dass der Muttermund sich ein paar Zentimeter öffnet, dann doch anders überlegt – da könnte ich mich glatt schon aufs Altenteil begeben. Als junger Privatier.«
Peyton kichert pflichtschuldig. Wie alt mag er sein? Etwa in ihrem Alter; etwas jünger vielleicht. Im Grunde genommen der Inbegriff des hochgewachsenen, dunkelhaarigen Dr. Beauty, wie er in nachmittäglichen TV-Seifenopern auftritt.
»Außerdem sollten Sie sich überlegen, wen Sie bei der Geburt dabei haben wollen, Ms. Somerset«, fügt er hinzu. »Als Beistand.«
»Sie können ruhig Peyton zu mir sagen.«
Er lächelt. »Besorgen Sie sich einen Geburtsbeistand, Peyton. Jemanden, der Ihnen Tag und Nacht nicht von der Seite weicht. Von dem Moment an, wo sie den ersten Krampf spüren, bis hin zur Niederkunft.«
Peyton zwingt sich dazu, seinem Blick standzuhalten, und nickt. »Kein Problem.«
»Gut.«
Kein Problem?
Hätte sie so jemanden – jemanden, der gewillt wäre, ihr Tag und Nacht nicht von der Seite zu weichen und ihr durch die größte Herausforderung ihres Lebens zu helfen –, dann wäre sie überhaupt nicht hier.
Sondern wieder zu Hause in Talbot Corners, und sie würde ihr Baby auf die althergebrachte Weise bekommen.
Aber sie ist nun mal hier in Manhattan und muss mit Schwangerschaft und Geburt ganz allein fertig werden.
Du hast es dir so ausgesucht!, mahnt sie sich. Du lebst dein Leben auf deine Art. Jetzt gibt’s kein Zurück mehr. Du willst auch gar nicht zurück.
Doch für Peyton Somerset, für die Beherrschtheit das Schlüsselwort ist, scheint die Zukunft auf einmal unsicher.
Was, wenn sie jetzt ihren Job verliert? Wo sie doch schwanger ist. Oder weil sie schwanger ist. Wie soll sie dann sich und das Kind ernähren?
Mal angenommen, sie behält ihren Arbeitsplatz: Was, wenn sie keine anständige Kindertagesstätte findet? Wenn dem Kleinen etwas zustößt? Oder wenn ihr nach der Geburt selbst etwas passiert? Einer Alleinerziehenden?
Schluss damit, Peyton! Seit wann hast du Selbstzweifel? Seit wann wirst du wankelmütig?
Unsicherheit ist nicht erlaubt. Und damit Schluss.
»Also?«, fragt Dr. Lombardo. »Noch Fragen, Mom?«
Mom! Toll! Du wirst jemandes Mom!
»Nein«, antwortet Peyton, der nun der Kopf schwirrt. »Überhaupt keine.«
»Es fallen Ihnen bestimmt welche ein, kaum dass Sie hier raus sind. Zögern Sie nicht, in der Praxis anzurufen. Jederzeit. Sie können uns auch eine E-Mail schicken, wenn das für Sie bequemer ist. Wir sind für Sie da und gewöhnt an Patientinnen, die auf sich allein gestellt sind.«
»Das hört man gern.« Denn in diese Kategorie passt sie hundertprozentig. In der Tat: So allein hat sie sich im ganzen Leben noch nicht gefühlt.
»Mr. und Mrs. Cordell?«
Derry schaut von ihrer Illustrierten auf. Bisher hat sie so getan, als lese sie angestrengt in einer veralteten Ausgabe eines Frauenmagazins, sich aber die Fingernägel bis aufs Nagelbett dabei abgeknabbert.
Dr. Lombardos Sprechstundenhilfe winkt.
Linden, der neben Derry sitzt, springt auch prompt auf und wirft die Ausgabe des Wissenschaftsblattes beiseite, in das er sich die vergangenen zwanzig Minuten voll und ganz vertieft hatte. Dabei müsste man eigentlich annehmen, dass er genauso aufgeregt wäre wie sie! Sehr zu Derrys Unmut wirkt ihr Mann indes vollkommen entspannt, erst recht, seit er weiß, dass die Krankenversicherung die Kosten des Besuchs übernimmt.
Nicht einmal über die zehn Dollar Zuzahlung hat er gemeckert. Für ein Schnäppchen ist er eben immer zu haben.
»Fertig?«, fragt er.
Sie nickt. Gibt’s das überhaupt, dass man als Frau bereit ist zu erfahren, warum die Regel Monat für Monat genauso präzise eintrifft wie die Telefonrechnung? Nachdem man über ein Jahr lang probiert hat, schwanger zu werden?
Nur die Ruhe, einmal wird’s schon klappen. Pustekuchen. Die haben alle leicht reden: Ihre Mutter, ihre älteren Schwestern, ihre Freundinnen. Bei denen ist alles anders. Normal. Die wollten Kinder und kriegten auch welche.
So soll’s ja auch sein. Bloß …
»Derry?«
Sie guckt hoch. Ihr Mann wartet.
»Gleich.« Sie steht auf, legt das Heft auf den von Zeitschriften überhäuften Tisch neben dem Stuhl und ordnet dann kurz das Durcheinander. Dabei redet sie sich ein, sie müsse es nur richtig machen, dann werde schon alles funktionieren.
Jawohl, wenn sie dafür sorgt, dass sämtliche Hefte im Stapel akkurat ausgerichtet sind, Kante an Kante, dann hat Dr. Lombardo bestimmt eine gute Nachricht für sie.
Er wird ihr mitteilen, es liege keine medizinische Indikation für ihre Kinderlosigkeit vor. Oder es gebe zwar einen Grund, aber er verschreibe ihr ein Medikament, und morgen sei alles in bester Ordnung.
Meinst du nicht, Derry, »morgen« ist ein bisschen unrealistisch? Gut Ding will Weile haben.
Stimmt, da ist was dran. Na gut, dann eben nächste Woche. Oder kommenden Monat. Wenn sie’s das nächste Mal probieren, sie und Linden, dann klappt es unter Garantie. Problem gelöst.
»Mrs. Cordell?« Die Sprechstundenhilfe klingt besorgt. »Ist Ihnen nicht gut?«
»Doch, doch, alles in Ordnung.« Sie strafft sich und wendet sich vom Tischchen ab.
Natürlich ist alles in Ordnung mit mir! Ich bin weder steril noch empfängnisunfähig oder wie man die sonst noch nennt, die Frauen, die keine Kinder bekommen können.
Es muss alles in Ordnung sein mit mir!
Lieber Gott, mach, dass ich gesund bin.
Wenn ich’s in weniger als zehn Schritten bis zur Tür hinter dem Empfangstresen schaffe, dann sagt Dr. Lombardo bestimmt, dass alles bestens ist.
Stumm ihre Schritte zählend, folgt sie ihrem Mann durchs Wartezimmer. Beim Vorbeigehen spürt sie die Blicke der anderen wartenden Paare auf sich. Einige schauen eher desinteressiert drein und widmen sich gleich wieder ihren Zeitschriften oder Zeitungen oder ihren Unterhaltungen im Flüsterton. Andere, besonders die Frauen, sind neugierig oder so angespannt, wie es Derry war, während sie wartend dasaß, das weiß sie ganz sicher, obwohl sie sie nicht anschaut.
Für die ist das alles genauso neu wie für uns, denkt Derry sich. Die glauben, es besteht noch Hoffnung. Oder sie haben gerade erfahren, dass es keine gibt, und sind jetzt hier, um weitere Möglichkeiten zu erörtern …
Wie immer die aussehen mögen. Aber so weit voraus will Derry nicht denken. Das erlaubt sie sich nicht.
Sie und Linden sind nämlich total pleite, zu pleite, um weitere Möglichkeiten auch nur ins Auge zu fassen. Mit den Raten für ihre Hypothek sind sie schon einen Monat im Rückstand. Linden drängt Derry bereits seit einiger Zeit, ihre Eltern oder Geschwister zu Hause in Kalifornien anzupumpen, aber das bringt sie nicht fertig. Ihre Verwandten stehen ihr nicht sonderlich nahe. Im Übrigen: Die Eltern kommen mit der Sozialhilfe sowieso nur gerade so über die Runden. Und ihre Geschwister haben ihrerseits Kredite abzustottern und Rechnungen zu bezahlen.
Außerdem sind potenziell kostspielige medizinische Alternativen für Derry und Linden ohnehin nicht nötig. Es sei denn, der Gynäkologe stellt fest, dass einer von beiden steril ist.
Aber dazu wird’s bestimmt nicht kommen.
Die vielen Untersuchungen, die sie letzte Woche haben machen lassen, werden beweisen, dass nichts Gravierendes vorliegt.
Immerhin hat Derry den Weg bis zur Tür in nur acht Schritten geschafft. Folglich wird der Arzt feststellen, einer Schwangerschaft stehe eigentlich nichts im Wege. In einem Jahr, vielleicht auch schon eher, könnte sie dann ein Neugeborenes im Arm halten, eines, das ihr ähnlich sieht – mit kastanienbraunem Haar und grünen Augen oder blond wie Linden mit blauen Augen. Möglicherweise sogar mit einer umwerfenden Kombination von allem.
Mehr will sie ja gar nicht. Nur ein eigenes Kind, ein leibliches, mit dem Blut der Familien Cavanaugh und Cordell in den Adern. Ist das etwa zu viel verlangt?
»Gleich hier entlang, bitte«, sagt die vertraute, ständig lächelnde Arzthelferin, die in der Hand ein Klemmbrett und einen DIN-A4-Umschlag hält. »Wie geht’s uns denn heute, Mrs. Cordell?«
»Gut«, nuschelt Derry.
Im Durchgang windet sich eine attraktive Dame mit schulterlangem, hellbraunem Haar an ihnen vorbei. Offenbar kommt sie aus dem ans Sprechzimmer grenzenden Umkleideraum. Sie trägt ein teuer aussehendes Kostüm vom selben Farbton wie ihr Haar. Über der linken Armbeuge hält sie einen Kamelhaarmantel, und am rechten Arm baumelt eine todschicke lederne Schultertasche.
Sie zählt zu jenen Frauen, die Derry schon immer beneidet hat: hochgewachsen, schlank, gepflegt; das Haar hinter die Ohren gesteckt, schlicht und doch irgendwie elegant wirkend. Vermutlich hat sie perfekt manikürte Finger, und Pediküre auch. Derry mit ihren vom ständigen Nägelkauen viel zu kurzen, rissigen Nägeln und ihren welligen, von einer Plastikklammer gehaltenen Strähnen kommt gerade mal auf eins fünfzig und schleppt permanent zehn, zwölf Kilo Übergewicht mit sich herum.
Während die Frau sich an ihr vorbeidrückt, hat Derry große Mühe, sie nicht anzugaffen. Oder sie mit einem bösen Blick zu mustern.
»Vielen Dank noch mal, Nancy«, ruft die Dame über die Schulter der Arzthelferin zu.
»Nochmals herzlichen Glückwunsch, Peyton«, erwidert diese strahlend.
Herzlichen Glückwunsch? In einer gynäkologischen Praxis wie dieser kann das nur eines heißen: Die ist in anderen Umständen.
Durchzuckt von einem heftigen Stich Eifersucht, bleibt Derry für einen Augenblick regungslos stehen und starrt der davongehenden Unbekannten bestürzt hinterher.
Sei nicht so missgünstig!, schilt sie sich dann stumm. Schöpf lieber Hoffnung! Wenn die da schwanger werden kann, kannst du das auch!
Und falls die Frau eine Fertilitätsbehandlung privat bezahlt hat? Dem äußeren Eindruck nach kann sie sich eine leisten. Derry in ihren Billigturnschuhen vom Ausverkauf und ihren knatschengen, zehn Jahre alten Jeans kann das jedenfalls nicht.
An und für sich hat sie hier gar nichts verloren. Ihr eigentlich zuständiger Gynäkologe praktiziert oben in der Bronx, wo sie wohnt. Eine Nachbarin hat ihr allerdings diesen Schickeriaspezialisten in Manhattan empfohlen. Wenn der nicht gewesen wäre, so die Nachbarin, hätte ihre Tochter ihr nie und nimmer drei Enkelchen schenken können.
Für Derry gäb’s nichts Schöneres, als ihrer alternden Mutter drei Enkel zu schenken. Vielleicht fände man dann zurück zu den Gemeinsamkeiten, die sich im Mutter-Tochter-Verhältnis nach und nach verflüchtigt haben. Besonders, seit Derry gegen den Willen ihrer Eltern quer über den Kontinent an die Ostküste gezogen ist.
»Gleich hier hinein«, bittet die Sprechstundenhilfe liebenswürdig und weist auf einen leeren Untersuchungsraum.
»Danke sehr, Nancy«, sagt Derry nickend, als redeten sie und die Sprechstundenhilfe sich schon immer mit dem Vornamen an. Dabei hat sie vorher nie auf das Namensschild am Kittel geachtet.
Von jetzt an solltest du auf solche Kleinigkeiten besser achtgeben, mahnt sie sich.
Dabei hätte ein vertrauliches oder freundschaftliches Verhältnis zum Praxispersonal sicher überhaupt keinen Einfluss darauf, ob sie selbst auch irgendwann einmal Glückwünsche entgegennimmt, weil sie schwanger ist. Aber schaden kann’s ja nicht, oder?, denkt Derry.
Linden lässt ihr den Vortritt ins Sprechzimmer. Ganz bewusst setzt sie zuerst den rechten Fuß hinein.
Denn wenn sie mit dem rechten Bein voran das Zimmer betritt, wird sich alles zum Guten wenden.
Draußen auf der Straße wird Peyton von einem eisigen Windstoß begrüßt. Über ihr heben sich die Konturen der Wolkenkratzer vor einem pastellblauen Himmel ab. Diesiger Februarsonnenschein ergießt sich zwischen den Hochhäusern hindurch in die Straßenschluchten und wirft: Peytons schlanken Schatten auf den trockenen Betonbürgersteig.
Sie lächelt bei dem Gedanken, wie drastisch sich ihre Silhouette in den kommenden Monaten verändern wird. Während sie ihren langen Kaschmirmantel zuknöpft, schaut sie sich auf den Bauch und bildet sich ein, dass er schon ein ganz klein wenig dicker geworden ist. Sicher, noch ist er das nicht, das weiß sie. Aber demnächst wird er es sein.
Ein Passant im Trenchcoat eilt an ihr vorbei und rempelt sie leicht mit der Aktentasche an. Automatisch kreuzt Peyton die Arme vor sich, um ihren Leib mit dem kostbaren Gut darin abzuschirmen. Bei der flüchtigen, instinktiven Reaktion wird ihr erst richtig bewusst, welch ungeheure Verantwortung nun vor ihr liegt.
Ein menschliches Leben ruht jetzt in ihren Händen.
Für immer.
Wie soll sie das allein schaffen?
Jetzt gibt’s kein Zurück mehr, mahnt sie sich, indem sie sich auf die standfeste Geisteshaltung der Somersets besinnt. Das schaffst du schon! Heutzutage müssen das jede Menge Leute bewerkstelligen!
Zu Hause im Mittleren Westen, in der Provinz, mag eine ledige Schwangere ja immer noch einen Makel tragen. Hier in der City hingegen, von den Medien ganz zu schweigen, gilt Mutterschaft ohne Mann als etwas Alltägliches. Liegt schon beinahe im Trend.
Fürs Erste beruhigt, guckt Peyton auf ihre Armbanduhr und hält dann Ausschau nach einem freien Taxi. Das einzige weit und breit ist allerdings besetzt; der Fahrer versucht gerade, sich rückwärts aus einem Stau in der 52. Straße zu manövrieren. Kein Wunder, die ganze Straßenzeile ist verstopft, auf Grund von Bauarbeiten verengt sich die Fahrbahn auf eine Fahrspur. Dröhnende Presslufthämmer und quäkende Hupkonzerte; unachtsame Fußgänger hasten über die Straße, Fahrradboten schlängeln sich durch den aufgestauten Verkehr. Das übliche mittägliche Manhattan-Chaos.
Von Zeit zu Zeit wird Peyton von einem unerklärlichen Heimweh nach Kansas gepackt. Dann fragt sie sich stets, wieso sie eigentlich die heile Kleinstadtwelt gegen dieses Tohuwabohu eingetauscht hat. Solche Anwandlungen legen sich aber glücklicherweise schnell.
Besonders heute, so geht es ihr durch den Kopf, wobei sie zerstreut dem glücklosen Taxifahrer bei seinem Versuch zusieht, in die Lexington Avenue zurückzusetzen. Heute lässt sie sich ihre Hochstimmung durch nichts verderben.
Peyton ist rundum zufrieden mit ihrer augenblicklichen Situation. Kansas und ihre Vergangenheit sind lediglich ein Fleck in einem Rückspiegel, in den sie selten guckt.
Und genau so, sagt Peyton sich, wobei sie schon wieder ein ungutes Gefühl beschleicht, soll es auch bleiben.
Jäh aufgeschreckt von quietschenden Reifen und dem hässlichen Krachen von Metall auf Metall, hebt sie den Blick und sieht, dass das Taxi rücklings einen anderen Wagen gerammt hat. Die zwei Fahrer stehen bereits auf der Fahrbahn und brüllen sich an in verschiedenen Sprachen, scheinbar versteht keiner von beiden den anderen.
Von wegen nicht in den Rückspiegel gucken!, sagt sich Peyton mit einem ironischen Kopfschütteln. Dann macht sie sich auf und geht zu Fuß die Straßen hinunter.
An Tagen wie diesem würde Anne Marie Egerton sonst was dafür geben, wenn sie ein Kindermädchen hätte.
Oder zumindest einen Ehemann, der nicht wie zurzeit wieder mal auf Geschäftsreise ist und irgendwo über dem Atlantik in Richtung London düst.
Da die zweite Alternative nicht infrage kommt, lässt Anne Marie sich auf den nächstbesten Küchenstuhl sacken und überlegt sich die erste Variante.
Schon seit Monaten liegt Jarrett ihr in den Ohren und sagt ihr, sie soll sich jemanden besorgen, der ihr bei den Jungs hilft. Er versteht nicht, warum sie das nicht will. Am Geld liegt’s bestimmt nicht. Seit seiner kürzlich erfolgten Beförderung steht es so gut wie fest, dass Geld für sie beide nie eine Rolle spielen wird.
Nicht etwa, dass es das je getan hätte.
Man verliebt sich ebenso leicht in einen reichen Mann wie in einen armen.
Das hat ihre Großmutter richtig gesehen. Und dass der reiche Mann sich seinerseits in Anne Marie verliebte … also, sie war stets überzeugt, dass ihre italienischstämmige Grandma da ihre Hand im Spiel hatte. Anne Marie hat nicht den geringsten Zweifel, dass Grace DeMario selbst im Jenseits noch genauso die Fäden zieht wie zu ihren Lebzeiten – als himmlische Puppenspielerin sozusagen. Auf jeden Fall hat sie sich den Himmel wohl so vorgestellt.
Und Anne Maries Vorstellung vom Paradies, jedenfalls theoretisch, wäre damals ihre jetzige Situation gewesen: Ehefrau von Jarrett Egerton III und die Mutter seiner Kinder zu werden, in Bedford zu wohnen, die schönsten Designerklamotten und italienische Lederschuhe zu tragen.
Wehmütig erinnert sie sich an eine weitere Redensart ihrer Großmutter: Überlege dir gut, was du dir wünschst, denn es könnte wahr werden.
Um ihre Nerven zu beruhigen, holt sie tief Luft und blickt durch das hohe Bogenfenster hinaus auf die öden weißen Spaliere ihres von einem Landschaftsgärtner gestalteten Rosengartens jenseits der abgesenkten, gepflasterten Terrasse. Der New Yorker Winter ist diesmal strenger als üblich. Es fällt schwer, sich an das üppige Grün und die duftenden Blüten zu erinnern. Nur braunes Dornengestrüpp ist davon übrig geblieben.
Doch die Rosen werden wieder blühen. Das tun sie immer, wenn man nur lange genug wartet.
Mühsam rafft Anne Marie sich auf und quält sich vom Stuhl herunter.
»Mommy kommt, Jungs«, ruft sie und schnappt sich dabei ein Tablett mit drei unterschiedlichen Portionen Apfelmus, drei gebutterten Toastscheiben, drei Nuckelbechern mit Vollmilch, drei Lätzchen und drei Löffeln.
Drei.
Von allem drei.
Alles für ein Trio Dreijährige, die es um ein Haar nicht geschafft hätten.
Als sie ins Frühstückszimmer tritt, lächelt sie ihren lärmenden Drillingen fröhlich zu. Die Knirpse sitzen an einem Tischchen direkt vor dem riesigen, an die Wand montierten Plasmafernseher. Das Zeichentrickvideo, das Anne Marie kurz zuvor eingeschaltet hat, verstärkt den Radau noch zusätzlich.
»So, ihr drei, Zeit für ein Häppchen!«, ruft sie über den Krach hinweg und verteilt Tassen und Löffel.
Binnen weniger Minuten ist der Fußboden mit Krümeln übersät; eine Milchpfütze kriecht gefährlich nahe an den importierten Wollteppich heran. Das meiste vom Apfelmus landet auf der Kleidung der Zwerge, die lauthals Nachschlag verlangen.
Anne Marie betrachtet das Chaos mit einem resignierten Seufzer. Das soll das Paradies sein?
Sie lächelt. Doch. Es stimmt. Dies ist der Himmel.
Wirklich.
Wenn einer das weiß, dann sie.
Denn falls jemand tatsächlich schon mal durch die Hölle gegangen ist, dann war es Anne Marie Egerton.
Im Gleichschritt mit einem Strom an ihr vorbeihastender New Yorker zwängt sich Peyton durch die Menschenmassen bis zur Ecke 52. Straße/Lexington Avenue. Dort biegt sie ab in Richtung Grand Central Station und U-Bahn. Falls die Linie 6 keine Verspätung hat, könnte Peyton eventuell rechtzeitig die dreißig Häuserblocks bis zum Büro schaffen und wieder an ihrem Schreibtisch sitzen, ehe Tara auffällt, dass sie die Mittagspause auf zwei Stunden ausgedehnt hat.
Vermutlich, so denkt Peyton sich, wirst du das in den kommenden Monaten ziemlich häufig machen. Wenn sie Glück hat, wird ihre Chefin Verständnis haben und Nachsicht üben. Ja, vielleicht sollte man direkt zu ihr reinmarschieren und die Schwangerschaft melden. Gleich von Anfang an für klare Verhältnisse sorgen.
Andererseits – lieber nicht. Es könnte sich womöglich als kapitaler Fehler herausstellen.
Peyton liebäugelt nämlich mit einer Beförderung zur Referentin im Koordinierungsstab der Geschäftsleitung. Der Posten wird frei, sobald Alain im April oder Mai wieder zurück in die Pariser Vertretung versetzt wird. Wenn jedoch damit zu rechnen ist, dass die mögliche Nachfolgerin über kurz oder lang in Mutterschaftsurlaub geht, wäre Tara möglicherweise wenig geneigt, Peyton die Stelle anzubieten.
Peyton hat erlebt, wie etliche ihrer schwangeren Kolleginnen bei Beförderungen oder Zusatzleistungen übergangen wurden. Demzufolge empfiehlt es sich wohl, die Schwangerschaft so lange wie möglich für sich zu behalten. Denn dass sie Mutter werden und sich damit für die Zukunft aufs berufliche Abstellgleis manövrieren könnte, das vermutet kein Mensch in der Firma.
Vor ein paar Jahren erst, als sie noch in Talbot Corners wohnte, da hätte auch Peyton selbst sich das nicht träumen lassen. Ihre Träume von New York, von der Madison Avenue, von einer Karriere als Powerfrau und Mutter – die hatte sie da längst ad acta gelegt.
Zwanzig Jahre zuvor, unmittelbar nach ihrem Abschluss am College, hatte sie diese Wunschträume vertagen müssen. Da verstarb nämlich überraschend Douglas, damals seit fünf Jahren ihr Stiefvater.
Peyton brachte es nicht übers Herz, ihre verwitwete Mutter, von der sie allein großgezogen worden war, im Stich zu lassen. So musste sie mit ansehen, wie ihr Schatz Gil Blaney, mit dem sie seit Kindertagen befreundet war, ohne sie an die Ostküste zog. Vorübergehend redete sie sich ein, irgendwie würden sie trotzdem heiraten und Kinder bekommen. Doch während sie ihm lange Briefe schrieb und sich bei sämtlichen Firmen im Umkreis von einhundert Meilen um ihren Heimatort bewarb, startete Gil seine Karriere an der Wall Street – und eine Beziehung zu der Frau, die er später ehelichen sollte.
Zum Glück fand die Trauung in einer New Yorker Kirche statt und nicht in der Pfarrkirche von Talbot Corners, nur einen Steinwurf entfernt von Peytons Verandaschaukel.
Zu dem Zeitpunkt hatte Peyton eine Stelle bei einem Handels- und Konsumgüterunternehmen in Kansas City gefunden. Sie musste zwar pendeln, arbeitete sich aber nach und nach von einer Einstiegsposition im Versand hoch bis ins Marketing und wurde schließlich Betriebsleiterin.
Die ganze Zeit über merkte sie überhaupt nicht, wie ihre biologische Uhr leise weitertickte. Schlagartig aber verwandelte sie sich in eine Art Zeitbombe, und zwar an Peytons siebenunddreißigstem Geburtstag, der zufällig mit einer gelösten Verlobung einherging – der zweiten seit Gils Abgang.
Drei gescheiterte Beziehungen. Peyton war sich fast sicher, dass sie nicht für das Eheleben bestimmt war.
Rückblickend muss sie zugeben, dass Scott, der auf Gil folgte, auch nicht der Richtige für sie war – älter, irgendwie arrogant und für ihren Geschmack viel zu dominant. Sie kriegte kalte Füße, und das war ihr Glück. Als Scotts Ehefrau wäre sie ihres Lebens nicht mehr froh geworden.
In den Nächsten, in Jeff, verliebte sie sich Hals über Kopf. Wie hätte es auch anders sein können? Als ehemaliger Footballstar war er der Stolz von Topeka, der Hauptstadt von Kansas. In Talbot Corners kannte ihn jedes Kind; alle Welt war hellauf begeistert, dass sich ein einheimisches Mädchen einen Helden wie ihn geangelt hatte. Inzwischen vom Leistungssport zurückgetreten, hatte er seine Schäfchen im Trockenen und reiste als Sportkommentator durch die Lande. Angesichts seines Bekanntheitsgrades, seines umwerfend attraktiven Aussehens und seiner finanziellen Sicherheit war die ganze Geschichte zu schön, um wahr zu sein.
Jedenfalls nach Meinung von Peytons Mutter.
Leider sollte sie Recht behalten.
Jeff ließ die Braut zwar nicht direkt vor dem Traualtar sitzen, aber verdammt dicht davor stand er schon. So dicht, dass Kirchenschiff und Gestühl in Talbot Corners bereits für sage und schreibe tausend Dollar mit weißen Rosen und kostbaren Girlanden geschmückt waren. Peyton stand plötzlich da mit einem bereits bezahlten seidenen Brautkleid im Kleiderschrank und einer ganzen Wagenladung Porzellangeschirr und Kristallgläser, die sie wieder zurückschicken musste.
Er habe kalte Füße bekommen, so Jeff.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, kommentierte Peytons Mutter tiefsinnig, als stamme diese abgedroschene Weisheit von ihr höchstpersönlich.
Aber manche Redensarten enthalten tatsächlich ein Körnchen Wahrheit. Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Beth Somerset lag wieder mal richtig.
Als Folge der misslungenen Märchenhochzeit gab es für Peyton nur eine Möglichkeit, den bohrenden Fragen und mitleidigen Blicken zu entrinnen: nichts wie weg.
Sie hätte ebenso gut in Los Angeles, Boston, Chicago oder Phoenix landen können. Aber der Zufall wollte es, dass sich ihr eine Stelle in der Kundenakquise bei Kaplan & Klein in Manhattan bot, einer Werbeagentur, die schon Peytons frühere Firma als Großkunden beraten hatte. Bei ihrer Erfahrung in der Kundenbetreuung war Peyton die Position geradezu auf den Leib geschneidert.
So ist sie also endlich in der Großstadt angekommen – zwanzig Jahre, nachdem sie erstmals davon träumte. Und endlich auch schwanger, wenngleich sie schon zwanzig Jahre zuvor den Gedanken an Mutterschaft so gut wie aufgegeben hatte.
Scott hatte zwei halbwüchsige Kinder aus erster Ehe. Mehr Kinder wollte er nicht, Schluss. Rückblickend gesehen war das wohl mit ein Grund, warum Peyton vor einer Heirat mit ihm zurückschreckte. Vielleicht hatte sich da bereits tief in ihrem Inneren instinktiv ein Gedanke an mögliche Mutterschaft im reiferen Alter festgesetzt.
Jetzt, da sie bis in die letzten Fasern von diesem Gedanken durchdrungen und mit Leib und Seele werdende Mutter ist, gibt es für sie keinen Zweifel über ihr Schicksal: Sie, Peyton Somerset, bekommt ein Kind.
Ein Baby!
Am liebsten möchte sie’s gleich erzählen.
Irgendjemandem. Egal, wem.
Wenn sie nur jemanden hätte, dem sie es sagen könnte.
So. Das war’s.
Monatelang gehofft und geplant; wochenlang besorgt gerätselt, warum es nicht klappt; tagelanges Warten und Beten wegen der Befunde …
Und dann das.
Schluss mit Planen und Rätseln und Beten.
Jetzt hat sie es schwarz auf weiß.
Benommen bemüht Derry sich, Blickkontakt mit Dr. Lombardo zu halten. Sie nickt angestrengt und tut so, als höre sie ihm bei seinem Vortrag interessiert zu. In Wirklichkeit hat sie jegliches Denken schon ein paar Minuten zuvor abgeschaltet.
Direkt nachdem er ihr und Linden mitteilte, dass sie keine Kinder bekommen könnten. Genauer gesagt: dass Derry kein Kind empfangen und austragen kann.
Beeinträchtigte Fertilität – so lautet der Fachbegriff. Was soll denn das heißen, verdammt noch mal?
»Ich weiß, es ist schwer für Sie, Mr. und Mrs. Cordell«, sagt der Arzt sanft und macht dazu passend eine ernste Miene.
Schwer? Ihr ganzes Leben lang ist Derry fest davon ausgegangen, dass sie mal Frau und Mutter wird. Das war zwar nicht ihr einziger Lebensinhalt, aber es war ihr immer sehr wichtig gewesen. Sie wollte beides, Kinder ebenso wie College und Karriere. Peggy, ihre ältere Schwester, hatte im Gegensatz zu ihr nie eine höhere Bildung oder eine Berufslaufbahn angestrebt.
Und jetzt … jetzt hat sie gar nichts.
»An diesem Punkt müssten Sie andere Optionen ins Auge fassen«, fährt der Arzt fort.
Ach ja. Optionen. Optionen heißt, sie muss sich mit der Situation abfinden. So wie schon einmal, damals, zu Hause in Kalifornien, nach dem Abi. Da hätte sie an etlichen Privathochschulen an der Ostküste anfangen können, konnte die aber nicht bezahlen, nicht einmal mit staatlicher Förderung. Ihre Eltern waren nicht in der Lage, die Tochter zu unterstützen; wollten es vielleicht auch nicht. Die hatten sie erst in späten Jahren bekommen, vor ihr zwei weitere Töchter großgezogen. Die waren ausgelaugt.
Also ging sie einige Semester aufs städtische College in San Diego, glaubte sie doch, sie könne danach mit guten Noten zumindest weiter auf eine staatliche Uni.
Ihre Zensuren waren gut, ihre Finanzen nicht.
Sie schmiss das Studium, um hauptberuflich als Serviererin zu arbeiten – nur vorübergehend, wie sie sich einredete.
Denkste.
Tolle Karriere. Eltern und Geschwister taten so, als hätte Derry sie bis auf die Knochen blamiert. Bekannte und Freunde von früher gingen voll im akademischen Leben auf. Derry versank in Einsamkeit und Depression.
All das fiel schlagartig von ihr ab, als sie Linden kennenlernte. Von da an war sie von einem Wunsch beseelt: die tiefgreifende Vereinsamung abzuschütteln und Linden quer durch Amerika nach New York zu folgen, Ehefrau und Mutter zu werden, die klaffende Lücke in ihrem Leben mit einer eigenen Familie zu füllen.
Sie schaffte es bis New York, wenn auch nicht wie ursprünglich gedacht bis Manhattan. Jetzt wohnt sie mit Linden in Co-op City, einem Wohnkomplex in der Bronx, und zwar in einer Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung, die sie sich mit ihren Einkünften als Schweißer beziehungsweise Bedienung mit knapper Not leisten können.
Drei Jahre sind vergangen, seit sie der Westküste, der Familie und allen alten Bekannten und Freunden den Rücken kehrte, um den Mann zu heiraten, den sie schon fest als Ehepartner eingeplant hatte, als sie ihn noch gar nicht von Angesicht zu Angesicht kannte.
Derry und Linden haben sich zwar in einem Internetforum für Rock-Klassiker kennengelernt, aber der Rest – Liebeswerben, Lebensart, Zukunftspläne – entsprach seitdem althergebrachten Gepflogenheiten.
Dass sie und Linden auf etwas so Selbstverständliches wie ein Kind verzichten müssten, wäre Derry nicht im Traum eingefallen.
Etwas, worüber ganz viele gar nicht groß nachdenken.
Eine schreiende Ungerechtigkeit. Derry muss heftig schlucken, weil ihr die Kehle wie zugeschnürt ist. Dabei laufen jede Menge schwangere Frauen herum, die Nachwuchs weder wollen noch verdienen! Manche treiben gar ab oder schmeißen ihr Kind auf den Müll. Zum Kotzen!
Die Hände auf den Leib gepresst, als könne sie so irgendwie das dumpfe, quälende Sehnen mildern, kann Derry nur an eines denken: Für ein Baby würde sie alles tun.
Egal, was.
Als Peyton am selben Abend ihr Bürogebäude verlässt und hinaustritt auf die 21. Straße, stellt sie fest, dass das angenehme Wetter vom Nachmittag einem böigen Schneeregen gewichen ist. Brr! Wer hätte das gedacht?
Vermutlich jeder, der nicht durch Gedanken an Babys zu abgelenkt war, um auf die Wettervorhersage zu achten.
Mit einem Seufzer langt sie in ihre Handtasche und tastet nach dem kleinen Regenschirm, den sie für Notfälle immer dabeihat. Hoffentlich hat sie ihn nicht in der ganzen Aufregung um die Schwangerschaft aus lauter Schusseligkeit herausgenommen! Während sie in den Tiefen der Tasche kramt, lässt sie den Blick durchs nasskalte Dunkel schweifen. Taxis noch und noch sausen die 3rd Avenue hinauf – samt und sonders besetzt, wie nicht anders zu erwarten bei dem Dreckwetter an diesem Abend.
Ihre Wohnung liegt in Chelsea – ein Fußmarsch von gut zehn bis fünfzehn Minuten, den sie an den meisten Tagen hin und zurück bewältigt. Die U-Bahn oder den Bus zu nehmen würde mehrmaliges Umsteigen bedeuten, denn von ihrem Arbeitsplatz aus besteht keine Direktverbindung. Bei schlechtem Wetter sind beide Verkehrsmittel sowieso zu voll.
Nach einigem Hin und Her verzichtet sie auf den öffentlichen Nahverkehr, zumal sie den Regenschirm gefunden hat. Seit ihrem Umzug in die City hat sie gemerkt, dass man zu Fuß nicht nur am schnellsten vorwärtskommt, sondern dass Gehen zugleich auch das logische Denkvermögen fördert.
Zu allem Überfluss befindet sich um die Ecke auch noch ein Umstandsmodengeschäft mit entzückenden Frühjahrskleidern im Fenster.
Mistwetter hin oder her: Nach der spannenden Nachricht von heute Mittag und einem wie üblich hektischen Bürotag wäre ein kleiner Schaufensterbummel nicht zu verachten, denkt Peyton. Außerdem könnte man wunderbar seinen Gedanken nachhängen.
Sie spannt den Minischirm auf und tritt hinaus auf den regennassen Gehsteig. Warum hat sie nur keine Gummistiefel dabei oder zumindest Turnschuhe, die sie auf dem Heimweg tragen könnte! Ihre Strümpfe sowie die Füße in den teuren Schuhen sind im Nu klatschnass.
Na, super. Und wenn sie sich einen Schnupfen holt?
Normalerweise würde sie sich durch so etwas nicht beirren lassen. Aber sie darf jetzt nicht mehr nur an ihre eigene Gesundheit denken.
Wenn sie krank wird, könnte das Baby Schaden nehmen.
Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen?, fragt eine innere Stimme vorwurfsvoll. An einem Schnupfen ist noch keiner gestorben.
Oder doch?
Inzwischen ziemlich verunsichert, fragt sie sich, ob sie jetzt wohl so wird wie jene Mütter, die sich über jede Kleinigkeit aufregen – über jedes Schniefen, jeden Niednagel, jedes Kullern im Bauch oder ausbleibende Verdauung. Von allen möglichen Ängsten geplagte Frauen wie ihre eigene Mutter, die ihr einziges Kind allein großzog und sich bei jeder mütterlichen Entscheidung selbst infrage stellte. Dass Peyton unter diesen Umständen nicht zu einer quengeligen, überängstlichen Zimperliese heranwuchs, grenzt an ein Wunder.
Nein, sie ist das genaue Gegenteil.
Ihre Mutter hasste das Alleinsein und fand es schlimm, dass sie sich auf niemanden stützen konnte. Gerade deshalb hatte sie sich ja so an Douglas geklammert – und nach seinem Tod an ihre Tochter. Auch nach jahrzehntelangem Witwendasein bekümmerte es Beth Somerset zutiefst, dass ihre Tochter fortziehen wollte, zumal noch quer durch halb Amerika.
»Und wenn du mich mal brauchst, was dann?«, fragte sie andauernd. Peyton wusste genau, was sie damit in Wirklichkeit meinte: Und wenn ich dich mal brauche?
»Ich komme schon klar, Mom«, sagte Peyton dann immer.
Und du wirst ebenfalls zurechtkommen.
Tut sie inzwischen auch. Meistens jedenfalls. Es hatte allerdings seine Zeit gedauert, bis sie sich daran gewöhnte, selbst für sich zu sorgen.
Dabei fällt Peyton ein … sie nimmt sich vor, ihre Mutter gleich nach dem Nachhausekommen anzurufen und ihr zu sagen, dass sie ein Baby erwartet. Als Beth damals hörte, dass ihre Tochter sich künstlich befruchten lassen und alleinerziehende Mutter werden will, war sie zwar wenig begeistert. Diese Nachricht wird sie aber mit Entzücken aufnehmen. Das ginge doch jeder kinderlieben angehenden Großmutter so!
Vor dem girlandengeschmückten Schaufenster des Umstandsmodenladens bleibt Peyton stehen und betrachtet sehnsüchtig die ausgestellten Waren. Dabei malt sie sich aus, wie sie wohl beim Frühlingsfest der Firma in dem entzückenden blauen Kleid mit der Empiretaille aussähe.
Hinge nicht das Schild mit der Aufschrift GESCHLOSSEN an der Ladentür, wäre Peyton versucht gewesen, hineinzugehen und das Kleid anzuprobieren. Vielleicht morgen, nimmt sie sich vor, während der Mittagspause.
Andererseits geriete sie dann in Versuchung, es zu kaufen. Es wäre wenig klug, mit Einkaufstüten aus einem Umstandsmodengeschäft ins Büro zu schlendern. Da müsste sie wohl erst offiziell Meldung machen.
Trotz aller Verzückung über die bestätigte Schwangerschaft hätte sie ihrer Chefin oder den Kolleginnen selbst dann nichts verraten können, wenn sie’s gewollt hätte. Die waren schlicht und einfach zu sehr mit einer Kundenpräsentation beschäftigt – sie, Peyton, natürlich eingeschlossen. Man hatte ja nicht mal Zeit für eine Unterhaltung oder um ans Telefon zu gehen oder sich auch nur einen Kaffee oder einen Happen zu essen zu holen.
Das geht so nicht weiter!, mahnt Peyton sich streng, wobei sich plötzlich ihr leerer Magen meldet. Allmählich muss sie auch regelmäßiger essen, was sie jahrelang nicht getan hat. Sie muss mehr auf sich achtgeben.
Keine Angst, Kleines!, gurrt sie stumm dem Kind in ihrem Leib zu. Von jetzt an kommst du an erster Stelle.
Sie wendet sich vom Schaufenster ab und geht in westlicher Richtung weiter, vorbei an dem in der eiskalten Regenflut verlassen daliegenden Madison Square Park. Sie ist vertieft in all das, was sie bei der Kindererziehung anders machen wird als ihre Mutter.
Das widrige, nasskalte Wetter nimmt sie gar nicht mehr wahr. Auch nicht die Gestalt, die sich aus dem Dunkel löst und ihr den ganzen Heimweg über wie ein Schatten folgt.
Verglichen mit der letzten, einige Jahre zuvor und der im vorherigen Monat ausgesuchten Spenderin wird es mit dieser neuen geradezu ein Kinderspiel sein.
Sie lebt allein und außerdem nicht mal in einem dieser schnieken Wohnblocks mit Pförtner, wie man’s eigentlich annehmen sollte.
Nein, sie ist in einem vierstöckigen braunen Backsteingebäude verschwunden. Nach den nur Augenblicke später aufflammenden Lichtern zu urteilen, wohnt sie im Parterre.
Im Erdgeschoss! Und das in dieser Gegend!
Versteht sie etwa nicht, dass eine alleinstehende Frau, die offenbar die Kohle hat für einen Designermantel nebst Markenschuhen und Handtasche, sich nicht einer solchen Gefahr aussetzen dürfte?
Klar, die auf Straßenhöhe liegenden Fenster sind vergittert, aber das ist kein Hindernis, wenn’s ernst wird. Damit kann man leicht fertig werden. Erheblich leichter als mit einem Vorortpförtner.
Im Übrigen lässt sich jedes Hindernis umgehen. Man muss nur kreativ sein. Einfallsreich und geduldig.
Geduld wird in diesem Falle bestimmt erforderlich sein. Sieben oder acht Monate lang Geduld.
Das wiederum sorgt für ausreichend Zeit, um alles Notwendige in die Wege zu leiten, damit beim Rest des Plans ein Rädchen ins andere greift. Es gibt eben viel zu tun, jetzt, wo endlich alles wie geschmiert läuft.
Es ist zwar ein Weilchen her, aber doch nicht so lange, dass man vergäße, welche sorgfältigen Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Nun, da eine zweite zukünftige Spenderin ausgemacht ist, steht als Nächstes wieder die Wahl einer würdigen Empfängerin auf der Tagesordnung.
Einer, die sich nach dem verzehrt, was jenes Weibsbild dort auf so unverdiente Weise bekommen soll.
Einer mit liebendem Herzen und leeren Armen … und einem Mann.
Zweiter Monat
März
2. Kapitel
Nach Brooklyn zieht es Peyton angesichts des abendlichen Schneetreibens beim besten Willen nicht. Nein, viel lieber wäre sie jetzt zu Hause, vorzugsweise im Bett.
Doch Nancy, Dr. Lombardos zuvorkommende Arzthelferin, die hat ihr dringend empfohlen, sich der von der Praxis organisierten neuen Selbsthilfegruppe für schwangere Ledige anzuschließen. Um ihr den Termin mitzuteilen, hat Nancy ihr sogar eine E-Mail ins Büro geschickt, was Peyton ziemlich in Verlegenheit brachte. Sie hat ja in der Firma noch keiner Menschenseele verraten, dass sie schwanger ist. Es empfahl sich allerdings, das tunlichst bald zu erledigen, ehe jemand von selbst darauf kommt.
Egal, jedenfalls steht sie nun hier im Windfang eines viereckigen Backsteingebäudes im Stadtteil Carroll Gardens. Direkt im Anschluss an einen knochenharten Arbeitstag.
Während sie sich ein Gähnen verkneift, drückt sie den Klingelknopf für Apartment 3F, der sich neben dem Schild mit dem Namen »J. Cooke« befindet. Sekunden später ertönt das Schnarren des Summers, der das Sicherheitsschloss entriegelt. Peyton tritt ins Treppenhaus und starrt schon bestürzt auf die steilen Treppenfluchten, ehe sie merkt, dass es auch einen Aufzug gibt. Ein Glück! Nach dem Treppensteigen aus der U-Bahn-Station und einem Marsch über drei Blocks bis hierher ist sie fix und fertig.
Während sie im Lift den Knopf mit dem aufwärts zeigenden Pfeil betätigt, muss sie schon wieder ein Gähnen unterdrücken und sehnt sich nach ihrem kuscheligen Bett. Im ganzen Leben war sie noch nicht so schachmatt. Mittlerweile kann sie nachts zehn Stunden am Stück schlafen und fühlt sich trotzdem nie richtig ausgeruht; nachmittags möchte sie am liebsten ihre Bürotür schließen und auf dem Fußboden ein Nickerchen machen.
Und erst die Träume! Ein so verrücktes Zeug hat sie sich im Leben noch nicht zusammengesponnen. Einmal brachte sie statt eines Babys einen Salamander zur Welt. Dann dieser erotische Traum, in dem Dr. Lombardo vorkam … Schockierend!
Schon der Gedanke daran treibt ihr die Schamesröte ins Gesicht. Wie kommt es bloß, dass ihr Unterbewusstsein solch aufreizende Bilder von einem verheirateten Mann erzeugt? Der obendrein auch noch ihr Gynäkologe ist?
Tja, wenn man’s genau nahm, hatte er sie ja sozusagen geschwängert. Offenbar wünscht sie sich unbewusst, er hätte es auf die konventionelle Weise gemacht.
Ein Jahr unfreiwilliger Keuschheit kann einem ganz schön zusetzen. Bedauerlicherweise wird sich an diesem Zustand vorläufig nichts ändern, erst recht nicht angesichts Peytons augenblicklicher körperlicher Verfassung. In den letzten Tagen ist sie alles andere als eine geeignete Kandidatin für zwanglose Rendezvous.
Also: Enthaltsamkeit auf unbestimmte Zeit, völlige Erschöpfung, schmerzende Brüste, kneifende Taillenbündchen, morgendliche, manchmal rund um die Uhr anhaltende Übelkeit – ob das alles die Sache wert ist?
Peyton redet sich permanent ein, dass es sich lohnen wird. Ja, wenn sie erst ihr eigenes Baby in den Armen hält, wird sie sich rückblickend fragen, wie sie das überhaupt anzweifeln konnte.
Zumindest hofft sie es.
Von irgendwo oben im Aufzugschacht dringt ein Ächzen, der Lift setzt sich in Bewegung und fährt abwärts. In dem Moment summt der Türöffner im Windfang ein zweites Mal. Als Peyton sich umdreht, tritt eine hochschwangere Frau ins Treppenhaus.
Sie fällt beim Gehen sichtlich ins Kreuz und bewegt sich auffällig watschelnd mit ihrer melonenförmigen Wölbung unter den Knöpfen des langen roten Wintermantels. Sie hat einen wuscheligen, tintenschwarzen Krauskopf, trägt eine Hornbrille und knabbert vernehmlich an einem Schokoriegel.
Noch eine Woche zuvor, mitten in ihrer Heißhungerphase auf alles Schokoladige, wäre Peyton versucht gewesen, sich danebenzubenehmen und einen Happen zu schnorren. Quasi über Nacht hat sie jedoch anscheinend eine Aversion entwickelt gegenüber den Riegeln, die sie zuvor massenweise hatte verputzen können.
Schokolade, Kaffee, Meeresfrüchte, Spaghetti …
Die Liste ihrer Abneigungen ist so lang wie die mit ihren augenblicklichen Leib- und Magenspeisen. In manchen Nächten wagt sie sich allen Ernstes aus dem warmen Bett, um sich Nusseis, Dosenpfirsiche, Salamibrote und gelben Senf zu Gemüte zu fuhren.
Wassermelone!, durchzuckt es sie plötzlich bei einem verstohlenen Blick auf die Unbekannte. Für ein Stück Wassermelone würde ich jetzt alles geben!
»Hi«, grüßt der Neuankömmling und bleibt schwer atmend vor dem Aufzug stehen.
»Hallo.«
Den Schokoladenriegel zwischen die Zähne geklemmt, zieht die Frau sich die Handschuhe aus. Peyton reicht ein kurzer Blick auf die ringlosen Finger. Kühner geworden fragt sie: »Auch zu dem Treffen für schwangere Ledige?«
»Woran hast du das denn gemerkt?« Die Neue lacht ungezwungen und verputzt den Rest des Schokoriegels mit einem einzigen Biss. Inzwischen ist der Lift endlich im Erdgeschoss angelangt. »Du auch?«
»Ja.«
»Erstes Schwangerschaftsdrittel?«
»Ja«, sagt Peyton noch einmal, während beide die Kabine betreten.
»Ich heiße Allison Garcia.«
»Peyton Somerset.«
»Freut mich. Ich würde dir ja die Hand geben, aber ich hab noch geschmolzene Schokolade an den Fingern.« Sie leckt sich die Fingerspitzen ab.
Peyton wird schon ganz übel. Bereits der Geruch schlägt ihr auf den Magen. Sie wendet sich ab, derweil der Aufzug mit einem Ruck losfährt.
»Wann hast du Termin, Peyton?«
»Oktober.« Höflichkeitshalber fügt sie hinzu: »Und du?« Dabei beantwortet sich die Frage eigentlich von selbst.
»Juni.«
»Juni?«, echot Peyton, der vor Bestürzung der Mund offen stehen bleibt. Als sie merkt, wie taktlos das wirken muss, klappt sie ihn mit Gewalt wieder zu und wendet den Blick von Allisons gewaltigem Bauch ab. Nach dem zu urteilen, hätte sie gewettet, dass die Niederkunft unmittelbar bevorsteht.
Allison lacht. »Ist bereits das Dritte!«, näselt sie in einem unüberhörbar spanisch eingefärbten New Yorker Akzent, der so breit ist wie ihre Hüften. »Bei mir merkte man’s schon, kaum dass es gefunkt hatte. Ungelogen!«
Peyton hat zwar Fragen über Fragen, ist aber zu höflich, auch nur eine davon zu stellen. Noch. Wenn sie Allison etwas näher kennt, dann vielleicht …
Falls es überhaupt zu einem näheren Kennenlernen kommt. Noch ist sie längst nicht überzeugt, dass diese Selbsthilfegruppe auch ihr Fall ist. Ihr Privatleben in sämtlichen Einzelheiten vor einem Trupp wildfremder Frauen auszubreiten, das ist in etwa so verlockend wie …
Na ja, wie die Aussicht, auf eigene Faust mit Schwangerschaft und Niederkunft fertig zu werden.
Aber Nancy hatte wegen dieser Gruppe nicht lockergelassen. Sie hat eine forsche, schnörkellose Art an sich – die Mutter der Kompanie, wie Dr. Lombardo gern augenzwinkernd flachst. Nancy nimmt sowieso großen Anteil an den Patientinnen, doch die Ledigen liegen ihr besonders am Herzen.
Peyton ist zwar dankbar für die Unterstützung, nur …
»Wie bist du denn schwanger geworden?«, fragt Allison unvermittelt.
Peyton merkt, wie ihr die Brauen hoch bis unter den Pony schießen. Sie ringt nach einer Antwort, die weniger direkt ist als die unverblümte Frage selbst. Als sie feststellt, dass sie keine findet, gibt sie es achselzuckend zu. »Künstliche Befruchtung.«
»Samenspende?«
»Ja.«
»Bei mir dasselbe. Meine Mutter hält mich für verrückt, dass ich von ’nem Wildfremden schwanger werde. Aber ich hab ihr gesagt: Würde ich einen netten Kerl gut genug kennen, um ihn um ’ne Samenspende zu bitten, könnte ich doch gleich mit ihm ins Bett steigen, nicht? Als ich das sagte, hat sie natürlich beinahe ’nen Herzinfarkt gekriegt und mich postwendend zur Beichte geschickt.«
Unwillkürlich muss Peyton lachen. Allisons flapsige Art hat etwas Sympathisches.
Bei näherer Bekanntschaft würde sie ihr vielleicht erzählen, was Beth Somerset sagte, als sie von Peyton telefonisch über die Schwangerschaft informiert wurde: »Na, wenn du jetzt so weit bist, dass du dich niederlässt und eine Familie gründen willst, findest du doch auch sicher ’nen lieben Mann zum Heiraten.«
Ja, Pustekuchen. Als ob es auf den Straßen von New York nur so wimmeln würde von netten Kerlen, die auf ledige Schwangere aus sind!
Im dritten Stock angekommen, übernimmt Allison die Führung. Sie watschelt über den Gang bis zur hintersten Tür, die einen Spaltbreit offen steht. Ein weißer Joggingschuh klemmt zwischen Türblatt und Pfosten.
»Guten Abend allerseits!«, ruft Allison und tritt, ohne anzuklopfen, in die Wohnung.
Peyton zögert einen Moment, ehe sie ihr folgt.
In einem winzigen Wohnzimmer hocken drei Frauen, alle in unterschiedlichen Stadien der Schwangerschaft. Aus der Stereoanlage dudelt Musik von Norah Jones; Kerzen flackern, und auf dem Couchtisch steht eine große Schüssel mit Kartoffelchips.
»Mädels, das hier ist Peyton«, verkündet Allison, die ihren Mantel bereits über einen Sessel gelegt hat und in die Schüssel langt.
Man stellt sich gegenseitig vor. Wie sich erweist, ist dies zwar erst die zweite Sitzung der Selbsthilfegruppe, aber trotzdem kommt Peyton sich unwillkürlich vor wie eine Außenseiterin. Die anderen gehen offenbar schon ausgesprochen leger miteinander um.
Julie Bernard ist die Gastgeberin. Langes, blondes Kraushaar, Nickelbrille à la John Lennon, kein Make-up, im siebten Monat schwanger.
Wanda Jones, eine sagenhaft attraktive, bildschöne Schwarze, ist auch schon mindestens im vierten Monat, was man ihr aber kaum ansieht.
Die etwas distanzierte, rothaarige Kate Dunham wird andauernd von Scheinwehen geplagt, behauptet aber, nach Auskunft der Hebamme bleibe ihr noch gut eine Woche bis zur Niederkunft.
Alle drei sind ledig, wenngleich Kate mit ihrem Freund zusammenwohnt und einen Verlobungsring mit Diamant trägt. Einzig Allison verfugt über Erfahrung mit Heirat und hat zu Hause zwei halbwüchsige Töchter – Ergebnis einer verfrühten, katastrophalen Ehe.
Trotz ihrer Vorbehalte fühlt Peyton sich zunehmend einbezogen in die Diskussion, die einen Bogen schlägt von Periduralanästhesie über Stilleinlagen bis zu Hausgeburt.