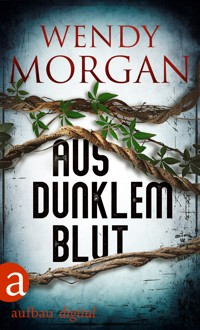8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wendy Morgan Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
In der amerikanischen Kleinstadt Lily Dale lauert etwas, das den Tod bringt ...
Lily Dale ist keine gewöhnliche Stadt, denn hier wohnen zahlreiche Menschen, die die Zukunft vorhersagen oder als Medium arbeiten. Ein verschlafener Urlaubsort, in dem Julia und Kristin zusammen aufwuchsen und beste Freundinnen wurden. Bis zu dem Tag, als Kristin in einer Halloweennacht etwas sah, das sie bis zu ihrem tragischen Tod verfolgen sollte. Als Kristins blinde, sechsjährige Tochter nach Lily Dale kommt, kümmert sich Julia um sie. Und bald stellt sie fest, dass das kleine Mädchen etwas 'sieht', das andere nicht wahrnehmen können. Ist es dieselbe mörderische Kraft, die schon früher ihre Opfer forderte? Und vor allem: Wird es neue Opfer geben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Ähnliche
Über Wendy Morgan
Wendy Morgan hat englische Literatur mit dem Schwerpunkt kreatives Schreiben studiert. Nach ihrem Studium hat sie zunächst als Lektorin und Journalistin gearbeitet, um sich dann ganz ihrem Traumberuf der Schriftstellerin zu widmen. Wendy Morgan lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in New York.
Informationen zum Buch
In der amerikanischen Kleinstadt Lily Dale lauert etwas, das den Tod bringt. Lily Dale ist keine gewöhnliche Stadt, denn hier wohnen zahlreiche Menschen, die die Zukunft vorhersagen oder als Medium arbeiten. Ein verschlafener Urlaubsort, in dem Julia und Kristin zusammen aufwuchsen und beste Freundinnen wurden. Bis zu dem Tag, als Kristin in einer Halloweennacht etwas sah, das sie bis zu ihrem tragischen Tod sollte. Als Kristins blinde, sechsjährige Tochter nach Lily Dale kommt, kümmert sich Julia um sie. Und bald stellt sie fest, dass das kleine Mädchen etwas 'sieht', das andere nicht wahrnehmen können. Ist es dieselbe mörderische Kraft, die schon früher ihre Opfer forderte? Und vor allem – wird es neue Opfer geben?
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wendy Morgan
Was dunicht weißt
Ins Deutsche übertragen vonMartin Hillebrand
Inhaltsübersicht
Über Wendy Morgan
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Epilog
Nachwort
Dank
Impressum
WIDMUNG
Meiner Freundin Suzanne Muldowney Schmidt,
die vom ersten Kindergartentag an meine Freundin war
und es auf immer und ewig bleiben wird, für »Wendell«
in liebevollem Andenken – und natürlich wie immer
meinen drei Männern: Mark, Morgan und Brody.
PROLOG
Halloween, Abend des 31. Oktober vor fünfzehn Jahren
Lily Dale, US-Bundesstaat New York
Okay, ein Haus noch, und dann ist Feierabend!« Mit staksigen Schritten stöckelt Julia Garrity über den nassen Rasen des schmalen Vorgartens. Ihre Absätze sinken gefährlich tief in den feuchten Boden ein.
»Noch drei!«, korrigiert Kristin Shuttleworth, bereits einige Schritte voraus. »Bis jetzt hab ich nicht mal diese köstlichen Schokoriegel gekriegt. Dabei mag ich die am liebsten!«
»Eins!« Julia bleibt eisern. »Im Ernst, Kristin! Für mich ist Schluss! Du kannst ja weitermachen, wenn du willst!«
»Das sah doch bescheuert aus! Ohne dich macht mein Kostüm ja keinen Sinn! Ich brauch dich! Bitte!«
Betteln beherrscht Kristin aus dem Effeff. In der Regel kann sie ihre Freundin zu so ziemlich allem überreden, doch an diesem Abend wehrt Julia kopfschüttelnd ab. Ihr reicht das Spektakel.
Zum einen kommt sie sich mit vierzehn allmählich zu alt vor zum Sammeln von Süßigkeiten, auch wenn es sie umsonst gibt, zum anderen schmerzen ihre Füße wie verrückt in den von ihrer Mutter geborgten alten Samtpumps. Sie kann es kaum erwarten, die Verkleidung wieder gegen Turnschuhe und Jeans einzutauschen und sich diese eklige Schminke aus dem Gesicht zu waschen.
Mann, warum hab ich mich nur von Kristin bequatschen lassen, mich als weiblicher Teil von ’nem Hochzeitspaar zu kostümieren?, denkt sie genervt.
Kristin als Bräutigam darf den alten Frack von ihrem Vater und dazu ein Paar flache, bequeme schwarze Schuhe tragen. Auf dem langen, hochgesteckten blonden Haar sitzt ein Zylinder, und ihr hübsches Gesicht wird lediglich von einem angeklebten Schnauzbart verunziert.
Julia hingegen, als Braut herausgeputzt, trägt ein langes weißes Brautkleid, über dessen Schleppe sie ständig stolpert, die Sicht ohnehin eingeschränkt durch doppelte und dreifache Tüllschichten. Der Brautschleier steckt an einem Diadem, und das wiederum thront auf einer toupierten brünetten Perücke, unter der Julias jungenhafter brauner Schöpf gänzlich verschwindet. Haarteil sowie Kriegsbemalung beruhen auf Kristins Idee und sollen Julia femininer erscheinen lassen.
»Wenn ich so maskulin wirke, wieso darf ich dann nicht den Bräutigam spielen?«, hatte Julia beim Ankleiden genörgelt.
»Weil meine Mutter kein passendes Brautkleid für mich hat!«, war Kristins gereizte Antwort. »Die trug so ’n verrücktes Hippie-Minikleidchen, so ’nen psychedelischen Fummel, damals, als sie meinen Vater geheiratet hat. War auch so ’ne ausgeflippte Flower-Power-Zeremonie!«
Stimmt. Nicht etwa, dass Julias Mutter ein Brautkleid besäße! Wo sie doch Julias Vater, wer immer und wo immer der sein mochte, nie geheiratet hatte!
»Und deine Grandma«, fährt Kristin fort, »die macht ohnehin schon ’nen Heidenaufstand wegen ihres Brautkleids! Die hätte schwer was dagegen, wenn ich darin rumliefe!«
Wieder richtig. Julias Großmutter hat nicht gerade einen Narren an Kristin gefressen. Und Julias Mutter, die es mit der Erziehung sonst eher locker angehen lässt, kann Kristin nicht ausstehen und glaubt, die bringe ihre Tochter nur auf dumme Gedanken.
Julia kann es ihr nicht verdenken. Ein Mädchen wie die eigenwillige Kristin, die rauchte und fluchte und nie büffelte, war bei Eltern nicht gern gesehen. Aber eine zuverlässige Freundin war sie allemal, und man hatte jede Menge Spaß mit ihr.
Julia ist vorsichtig, Kristin hingegen draufgängerisch, im Gegensatz zur distanzierten Julia geht Kristin mehr aus sich heraus. Ein Lehrer hatte mal gesagt, der größte Unterschied zwischen beiden liege darin, dass Julia lieber die Wogen glätte, während für Kristin die Wellen gar nicht hoch genug schlagen können.
Mag sein, dass das der auffälligste Kontrast ist, doch es ist bei weitem nicht der einzige!
Oft viel jünger eingeschätzt als vierzehn, ist Julia ein zwar sportlicher, jedoch zierlicher, sommersprossiger Wildfang in Jeans – nicht unattraktiv, allerdings kein Kopfverdreher wie die schlanke, langbeinige Kristin.
Auch ohne Make-up ist Kristin ein Hingucker mit ihren weit auseinander stehenden Augen, den hohen Wangenknochen und den vollen Lippen, und schon seit sie zwölf ist, läuft sie ausschließlich aufgestylt in der Öffentlichkeit herum. Natürlich findet sie das echt spitze, wenn sie für einige Jahre älter gehalten wird. Seit kurzem verabredet sie sich gar mit College Studenten von der Uni in Fredonia, ein paar Kilometer entfernt. Die glauben alle, sie sei schon achtzehn oder neunzehn.
Die Eltern haben natürlich keine Ahnung von den Eskapaden ihrer Tochter. Julia wird das Gefühl nicht los, dass ihre selbstbewusste Freundin sich eines schönen Tages dabei in die Nesseln setzt, aber offenbar macht sie sich nicht die geringsten Gedanken und marschiert unbekümmert und leichtsinnig durchs Leben.
Kristin ist eben in punkto Temperament und Auftreten das genaue Gegenteil von Julia, und sogar Julia selbst kann es zuweilen kaum fassen, dass sie immer noch dermaßen eng befreundet sind. Allerdings gibt es in einer kleinen Ortschaft wie Lily Dale, in der nur eine Hand voll Familien das ganze Jahr über wohnt, nur wenige gleichaltrige Mädchen. Im Grunde hocken sie schon seit Kleinkindertagen zusammen, und ungeachtet aller Macken, die Kristin aufweist, liebt Julia ihre Freundin wie die kleine Schwester, die sie nie hatte und wohl auch nie bekommen wird, jedenfalls nicht bei dem Männerverschleiß ihrer Mutter. Es sieht nicht danach aus, als würde die mal zur Ruhe kommen und einen finden, der ihr auf längere Sicht gefiel.
»Los, Jul, auf geht’s!« Ihren orangefarbenen Plastikkürbis schwingend, stolziert Kristin die schmale Summer Street hinauf. »Sieht aus, als wären die Biddles daheim!«
Zögernd wirft Julia einen Blick auf das vor ihnen liegende zweigeschossige Cottage im viktorianischen Stil. »Zu denen gehen wir besser nicht hin.«
»Wieso nicht?« Kristin lässt sich nicht einmal aus dem Rhythmus bringen. »So ’ne große Auswahl bleibt uns doch gar nicht!«
Da ist etwas dran. Um diese Zeit sind die meisten Häuser in Lily Dale verwaist, die Fenster mit Sperrholzplatten gesichert, die Eigentümer weit weg von den rauen Winden und Schneefällen, die den Westen des Bundesstaates von Oktober bis April heimsuchen.
Wie die Familien von Julia und Kristin auch, sind Rupert und Nanette Biddle allerdings immer in Lily Dale geblieben. Obwohl eher zurückhaltend, wirken sie doch, trifft Julia mal bei Versammlungen oder Veranstaltungen der »Lily Dale Assembly« auf sie, recht umgänglich, wenn auch auf etwas reservierte Art.
»Die Außenleuchte brennt nicht«, stellt Julia fest. »Und hier waren wir sowieso noch nie zum Sammeln.«
»Für alles gibt’s ein erstes Mal!«, kontert Kristin schlagfertig, schon auf halber Höhe der Treppe.
Seufzend folgt Julia ihrer Freundin, während der Wind vom nahe gelegenen Cassadaga-See her auffrischt. Welke Blätter wirbeln über den Kiesweg, und in der Brise bimmelt ein Windspiel seinen melancholischen, vielstimmigen Singsang. Die eine Hand an der gerafften Schleppe, die andere fest am Handlauf des Holzgeländers, stakst Julia unsicher in ihren Stöckelschuhen die Stufen hinauf, wobei ihr das Brautkleid beängstigend um die Knöchel flattert. Über ihrem Kopf schaukelt im Wind ein hölzernes Schild, angebracht an einem kunstvoll gedrechselten Haken, ganz im Stil des verschnörkelten Schnitzwerks an der Vordachtraufe.
RUPERT BIDDLE, EXAMINIERTES MEDIUM.
Eine Holzdiele knarrt unter ihrem Gewicht, als Julia über die Veranda auf Kristin zugeht, deren Hand sich bereits nach der antiquierten Türglocke streckt.
Wie die Mehrzahl der Häuser in Lily Dale, so ist auch dieses Cottage vermutlich schon über einhundert Jahre alt. Rupert Biddle allerdings zählt zu den erfolgreicheren Medien in der Spiritistischen Vereinigung, und sein Heim gehört zu den wenigen, die rundum renoviert wieder im ursprünglichen Glanz erstrahlen. Kein abblätternder Anstrich, keine fehlenden Dachschindeln, keine schief hängenden Fensterläden.
Beim Domizil der Familie Shuttleworth, ein paar Häuserzeilen weiter, gibt es so etwas allerdings ebenfalls nicht. Anson Shuttleworth, Kristins Vater, ist ein prominenter Spiritist, dessen Bekanntheitsgrad beträchtlich gestiegen war, als er der Polizei in Buffalo dazu verholfen hatte, die Leichen mehrerer, vor etwa einem Jahr von einem Serienmörder umgebrachter Kinder aufzufinden. Er hatte gerade ein Buch über diese Begebenheit publiziert.
Kristin redet jedoch nicht gern darüber – sowohl über das Buch als auch über ihren Vater im Allgemeinen.
Sie äußert sich zudem nur selten und ungern über ihren älteren Halbbruder Edward, der bei seiner Mutter, Ansons erster Frau, unten in Jamestown wohnt. Julia weiß noch, wie der früher, als sie kleiner waren, öfter zu Besuch auftauchte, doch damit ist nun Schluss. Kristin hat mal ganz nebenbei erwähnt, er habe sich böse mit ihrer Mutter Iris überworfen. Zuweilen vergisst Julia, dass es ihn überhaupt gibt; man könnte tatsächlich meinen, Kristin sei Einzelkind, so wird sie von ihren Eltern verhätschelt.
Julia ist zwar ebenfalls Einzelkind, doch ihre Mutter ist viel zu beschäftigt und hat viel zu viel mit sich selbst zu tun, um ihre Tochter zu verwöhnen, und über die Umstände von Julias Geburt schweigt sie sich eisern aus. Selbst die mit im Haus wohnende Großmutter verrät nicht, wer Julias Vater ist – falls sie es überhaupt weiß, was Julia eher bezweifelt. Und fragt sie ihre Grandma mal nach ihm, dann rät die ihr immer, sie solle sich darüber nicht den Kopf zerbrechen, sondern vielmehr froh und glücklich darüber sein, dass sie eine Mutter und eine Großmutter habe, die sie lieben.
Nicht, dass Julia sich für einen Glückspilz hält, aber …
Von jenseits der hohen Haustür mit der ovalen, facettierten Milchglasscheibe sind Schritte zu hören. Beim Öffnen flammt, im Hausinneren eingeschaltet, die über dem Eingang angebrachte Außenleuchte auf und taucht die Veranda in helles Licht.
Nanette Biddle, eine attraktive Dame mittleren Alters, steht mit verblüffter Miene auf der Schwelle, das blonde Haar wie immer im Nacken zu einem Knoten gesteckt.
»Was Süßes oder ’n Streich!«, verkündet Kristin fröhlich, den Kunststoffkürbis vorgestreckt.
»Ach, wir haben ja Halloween!«, ruft Mrs. Biddle, als hätte sie das soeben erst gemerkt. »Ihr seht ja entzückend aus, ihr zwei! Aber tut mir Leid, Mädels, ich hab gerade gar nichts zur Hand …«
Julia würde die Sache am liebsten abblasen. Als Kristin allerdings erwartungsvoll verharrt, folgt sie wie üblich ihrem Beispiel.
»Ihr könnt gern reinkommen«, schlägt Mrs. Biddle vor. »Rupert ist zwar nicht da, aber ich meine, er hätte neulich erst ein paar Schokoriegel gekauft. Mal sehen, ob ich sie finde. Bei der tollen Kostümierung habt ihr euch wirklich ’ne Kleinigkeit verdient! Das müsste man ja fotografieren!«
Sie hält den beiden die Tür auf.
Julia tritt über die Schwelle und schaut sich um, während Mrs. Biddle die Haustür hinter ihnen schließt. »Es zieht sonst!«, bemerkt sie dabei. »Kühl draußen heute Abend, nicht?«
Julia murmelt eine höfliche Bestätigung. Kristin sagt keinen Ton, wie üblich wenig erpicht auf Smalltalk mit Erwachsenen.
»Bin gleich zurück, Mädels!«, verspricht Mrs. Biddle und verschwindet im hinteren Hausbereich.
Neugierig lässt Julia den Blick schweifen, hat sie doch immer schon gern wissen wollen, ob das Haus innen genauso hübsch aussieht wie außen.
Sie stehen in einem Treppenhaus mit hoher Decke. Unmittelbar rechts des Eingangs befindet sich eine geschlossene Flügeltür mit Glasscheiben. Links daneben, flankiert von zwei massiven gedrechselten Antrittspfosten, führen drei breite Bogenstufen auf einen Treppenabsatz, von dem aus eine lange Treppe hinauf zum Obergeschoss strebt, zur offenen Seite hin durch ein Sprossengeländer gesichert, die Wandseite dunkel vertäfelt.
Direkt linker Hand von der Haustür schaut man durch einen Torbogen in ein abgedunkeltes Esszimmer. Der kurze Korridor geradeaus an der Treppe vorbei muss wohl in die Küche führen, denn Julia hört, wie Mrs. Biddle dort Schränke öffnet und schließt.
Die Treppenhauswände sind in einem goldbraunen Streifenmuster tapeziert. Ein antiker, bauchiger Leuchter aus bernsteinfarbenem Milchglas hängt an drei Ketten, die in der Mitte eines gewölbten Gipsovals unter der Decke zusammenlaufen. Eine Kristallvase mit weißen Blumen thront auf dem Telefontischchen neben der Treppe, und überall finden sich üppig gedeihende Topfblumen. Das Parkett glänzt. Jede Franse des Orientteppichs ist akkurat ausgerichtet, fast wie gekämmt.
»Hübsch, was, Kristin?«, raunt Julia angesichts des unübersehbaren Kontrastes zu dem beengten, windschiefen Landhäuschen unten am Seeufer, das sie mit Mutter und Großmutter teilt.
Ihre Freundin gibt keine Antwort.
Als Julia sich zu ihr umdreht, sieht sie, dass Kristin ein Stück zurückgewichen ist, den Rücken an die geschlossene Haustür gepresst. Ihr hübsches Gesicht wirkt eigenartig verzerrt.
»Kristin! Was ist?«
Julia merkt, dass ihre Freundin sie offenbar nicht einmal hört. Kristins große blaue Augen fixieren starr über Julias Schultern hinweg einen Punkt auf der Treppe.
Rasch fährt Julia herum und schaut in die Richtung.
Auf der Treppe ist nichts zu sehen.
»Jul …« Kristin fasst sie beim Arm, umklammert ihn regelrecht, die Stimme ein ersticktes Flüstern.
»Was ist denn, Kristin? Was hast du?«
»Siehst du sie, Julia?«
»Wen?« In der Annahme, Mrs. Biddle sei gemeint, blickt Julia sich um.
Mrs. Biddle aber ist nach wie vor in der Küche.
Kristin starrt immer noch die Treppe an.
Dort ist weiterhin nichts zu erkennen.
»Wen soll ich sehen?«, fragt Julia, der nun allmählich unheimlich wird.
Die Augen geweitet, schüttelt Kristin langsam den Kopf und lässt Julias Arm los.
»Ich kann die Schokoriegel nicht finden, Mädels!« Mrs. Biddle ist wieder aufgetaucht. »Aber ein paar schöne Sandwichkekse mit Füllung, die hatte ich noch, die stecke ich euch in Frischhaltetüten, für jede …«
Unvermittelt bricht sie ab. Im gleichen Moment spürt Julia plötzlich einen kalten Luftzug am Hals.
Instinktiv wendet sie den Kopf. Kristin hat die Haustür aufgerissen und jagt die Treppe hinunter, als renne sie um ihr Leben.
»Gütiger Himmel, was ist denn in deine Freundin gefahren?«, ruft Mrs. Biddle aus.
»Keine Ahnung!«, erwidert Julia. Ihr Herz klopft, als würde es jeden Moment zerspringen. »Mal sehen, ob ich’s aus ihr rauskriege.«
Aber dazu kommt sie nicht.
Als Julia ihre Freundin schließlich drei Häuserzeilen weiter auf der Treppe vor deren Elternhaus einholt, verhält Kristin sich merkwürdig still und verweigert jede Aussage über das, was ihr bei den Biddles widerfahren ist.
In den nachfolgenden Wochen zieht Kristin sich zunehmend zurück. Anders als sonst hat sie keine Lust, Julia zu Thanksgiving beim Backen von Kürbispasteten zu helfen, und sie lehnt auch die seltene Einladung ab, mit Julia und deren Großmutter in Buffalos Einkaufstempel Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Nach jedem Schultag will sie nur eins: nach Hause, und zwar allein.
Als das Buch ihres Vaters über Nacht zum Bestseller wird und er daraufhin beschließt, mit der gesamten Familie den Rest des Winters in Florida zu verbringen, ist Kristin offensichtlich heilfroh, Lily Dale den Rücken kehren zu können.
Ja, sie wirkt sogar erleichtert, als sie Julia ein letztes Mal umarmt, um sodann in der schwarzen, überlangen Limousine zu verschwinden, die sie und ihre Eltern zum Flughafen fährt.
Mit dem Erlös des Buchverkaufs und dem Honorar aus Ansons anschließenden Fernsehauftritten erwerben Kristins Eltern kurz darauf ein geräumiges Haus am Strand unweit von Boca Raton. In Zukunft, so haben sie es geplant, werden sie nur noch den Sommer über in Lily Dale wohnen. Julia und Kristin werden ihre Freundschaft in jedem Juli erneuern müssen, um sich im August dann wieder Adieu zu sagen.
Nie wieder wird die Sprache auf das kommen, was Kristin – nicht aber Julia – am Halloween-Abend im Hause der Biddles sah.
Im Laufe der Zeit wird Julias Erinnerung an jenen Abend verblassen. Etliche Jahre später jedoch wird sie schlagartig wieder aufblitzen, als Julia erfährt, dass Rupert und Nanette Biddle ihr Haus verkauft haben, und zwar an Kristins Mutter, die verwitwete Iris Shuttleworth.
Mittlerweile längst aus Julias Leben verschwunden und zu dem Zeitpunkt mit ihrem Lebensgefährten sowie ihrer kleinen Tochter an der Westküste beheimatet, wird Kristin einen letzten Abstecher nach Lily Dale unternehmen, um ihrer Mutter beim Umzug ins neue Heim zu helfen.
Bei ihrer Ankunft ist sie so unbekümmert und attraktiv wie eh und je. Sie wird bei ihrer Mutter in dem viktorianischen Haus wohnen, Summer Street Nr. 10. Während die Tage vergehen, wird sie zunehmend deprimiert und sichtlich bekümmert aussehen.
Eines Tages wird sie abreisen – in einem Sarg.
1. KAPITEL
Gegenwart
Long Beach, US-Bundesstaat Kalifornien
»Daddy!«
Von schrillem Kreischen aus dem Schlaf geschreckt, fährt Paine Landry im Bett auf. War das ein Schrei?
Das Zimmer liegt im Schein des bläulich flimmernden Fernsehschirms und des durchs geöffnete Fenster fallenden Mondlichts. Schlicht weiße Stores bauschen sich sanft in der Brise.
Irgendwo tropft ein Wasserhahn.
Palmwedel rauschen im lauen Sommerwind.
In einem Werbespot preist gerade ein abgehalftertes Sitcom-Sternchen quietschvergnügt ein sagenhaft kompliziertes Kunststoffsystem zur Aufbewahrung von Lebensmitteln an.
Paine tastet nach der auf der zerwühlten Bettdecke liegenden Fernbedienung. Ein Knopfdruck lässt die Stimme verstummen und taucht das Schlafzimmer in Dunkelheit.
Alarmiert spitzt er die Ohren, fast sicher, etwas gehört zu haben, es sei denn …
»Daddy!«
Dulcie!
Mit einem Satz ist er aus dem Bett, hastet quer durch das halbdunkle Zimmer hinein in den kurzen Korridor und reißt die Tür zum Kinderzimmer seiner Tochter auf. Durch die herabgelassenen Rollos sickert gerade genug Mondlicht, dass er Dulcie erkennen kann, unter der Decke verkrochen, die Armchen um die angewinkelten Knie geschlungen.
»Was ist?« Mit wenigen Schritten ist er am Bett und schließt sein Töchterchen in die Arme. »Schlecht geträumt?«
Dulcie zittert am ganzen Körper. »Nein …«
»Was denn dann?«
»Grandma ist hier!«
Es dauert ein Weilchen, bis Paine den Satz begreift. Dann lacht er erleichtert auf. »Du hast geträumt, Dulcie! Grandma ist nicht hier! Sie ist wieder abgereist in Richtung Osten! Es ist mitten in der Nacht!«
»Doch! Sie ist hier!«
»Es war ein Traum«, wiederholt Paine, dem erneut das stetige Tropfen des Wasserhahns drüben im Badezimmer auffällt. Dauernd vergisst er, dem Vermieter Bescheid zu sagen, aber gleich am nächsten Morgen wird er ihn sicher anrufen.
»Daddy!« Die Kleine fuchtelt flehentlich mit den Händen und klammert sich an Paines T-Shirt. »Ich lüge nicht, Daddy! Ich hab sie gesehen!«
Ihr letzter Satz ist kaum zu hören.
Paine läuft es eiskalt über den Rücken. »Gesehen?«
Dulcie nickt, die blicklosen Augen auf einen Punkt oberhalb Paines Schulter gerichtet. »Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich war im Bett, und dann bin ich von einem Geräusch aufgewacht. Erst hab ich gedacht, es ist der Wind, aber es war mehr wie ein Flüstern! Und dann hab ich Grandmas Gesicht gesehen. Sie hat sich über mich gebeugt und gelächelt!«
Es kann nur ein Traum gewesen sein!, redet Paine sich ein, nervös an der Unterlippe nagend. Nur ein Traum! Mit Kristin hat das nichts zu tun …
Oder mit dem, was vor drei Jahren geschah.
»Und das war alles? Gelächelt hat sie?«, fragt Paine seine Tochter sanft, die Stimme bewusst unaufgeregt. Er streichelt Dulcies zerzaustes Blondhaar, lässt seine Finger zärtlich durch die Locken gleiten, löst die verknoteten Strähnen.
»Mit mir gesprochen auch!«
»Und was hat sie gesagt?«
»Dass sie mich lieb hat. Dulcinea hat sie mich genannt, wie immer. Und dann hat sie gesagt, sie muss gehen!«
Reflexartig zieht Paine seine Hand aus dem Wirrwarr zurück.
»Aua!«
»Entschuldige, Schätzchen!«, murmelt er mit klopfendem Herzen. »Und sonst hat sie nichts gesagt?«
»Nee. Und dann war sie weg! Wie ist sie wohl hergekommen, Daddy? Wo ist sie hin?«
»Ich weiß es nicht«, ist Paines ehrliche Antwort auf Dulcies erste Frage.
Die zweite allerdings …
Mag sein, dass er auch da die Antwort kennt. Doch er hofft inständig, dass er sich irrt.
Zur Abwechslung scheint mal die Sonne auf Lily Dale, als Julia zügigen Schrittes die Summer Street hinaufeilt, in der Hand einen Strauß tiefvioletter holländischer Iris, frisch gepflückt vom kärglichen Blumenbeet an der Hintertür ihres Hauses, ein paar Häuserzeilen entfernt. Nach einem verregneten Mai und einem ungewöhnlich kühlen Junibeginn hatte sie beinahe die Hoffnung auf ein der Jahreszeit entsprechendes Wetter begraben. Endlich ist es so weit!
Später, so ihr Vorsatz, wird sie nach Hause gehen und ihre Shorts anziehen, ist es ihr mittlerweile doch unangenehm warm in Jeans und Sweatshirt – in den vergangenen neun Monaten ihre nahezu tägliche Einheitskleidung. Ihr dichtes braunes Kurzhaar ist am Ansatz in Stirn und Nacken bereits schweißfeucht.
»Hi, Julia!«
Aufgeschreckt von dem Ruf, fährt sie herum und sieht Pilar Velazquez heraneilen, quer über den kleinen Vorgartenrasen vor dem adretten blauweißen Haus in der Summer Street Nr. 8.
»Pilar! Hast du die Sonne aus Alabama mitgebracht?« Julia muss sich strecken, um die Umarmung der erheblich größer gewachsenen Pilar zu erwidern. »Wie war der Winter?«
»Wunderbar! Im September hab ich meinen Sohn in Japan besucht. Hab ich dir überhaupt erzählt, dass Peter jetzt dort stationiert ist?«
»Nein. War sicher eine faszinierende Reise!«
»Und ob! Hab sogar Sushi probiert. Schmeckte nicht übel!«
»Nun, unser Cassadoga-See soll ja sehr reich an Fischen sein«, konstatiert Julia schmunzelnd. »Guten Appetit!«
Pilar verzieht das Gesicht. »Verzichte! Aber, stell dir vor, Julia, als ich im Oktober unten in Mobile ankam, hatten Christina und Tom eine Überraschung für mich: eine Wohnung über der Garage! Die haben sie während des Sommers extra für mich bauen lassen! Jetzt brauche ich nicht mehr neun Monate im Gästezimmer zu kampieren!«
»Das ist wunderbar!« Julia weiß, dass Pilar eine schlimme Phase durchstanden hat. Vor einigen Jahren verlor sie Raul, ihren Mann, infolge eines Krebsleidens. Nach dem Verkauf des Eigenheims in ihrem Heimatort in Ohio verbringt sie nun die Winter stets bei Tochter und Schwiegersohn in Alabama.
»Ich war mir nicht sicher, ob ich dich überhaupt diesen Sommer Wiedersehen würde«, erzählt Julia ihr. »Ich dachte schon, du würdest vielleicht endgültig dort unten im Süden bleiben.« Genau so verfuhr nämlich zurzeit ihre Mutter, sodass Julia das ganze Jahr ihr Elternhaus für sich allein hatte.
»Ach, zur Saison werde ich wohl weiter kommen – zumindest noch für ein paar Sommer«, versichert Pilar ihr. »Offenbar bin ich nicht die Einzige«, fügt sie noch hinzu, als ein Miettransporter vorbeirumpelt.
Und in der Tat: Unter dem Willkommensblau des Himmels erwacht der kleine Weiler an diesem Morgen zum Leben. Nach Monaten einsamer Stille rollen nun Autos durch das Labyrinth aus schmalen Kieswegen, die wohltuend vom dicht belaubten Geäst uralter Baumriesen beschattet werden. Erfreut, die vertrauten Gesichter wiederzusehen, rufen die Menschen sich Grüße zu. Aus den Fenstern der um die Jahrhundertwende erbauten Cottages verschwinden die Sperrholzplatten. Hunde bellen, Kinder spielen.
»Und du? Wohin des Weges?«, fragt Pilar mit einem Blick auf Julias Strauß violetter Iris.
»Ich wollte Iris die Blumen hier bringen.«
»Ist sie denn schon aus Florida zurück?«
»Seit letzter Woche«, bestätigt Julia nickend. »Erst neulich meinte sie, es sei doch eigentlich fatal, dass sie nicht mal die Blume kenne, nach der sie benannt wurde. Ich hab ihr versprochen, ich bringe ihr welche aus meinem Garten, jetzt, da sie voll erblüht sind, damit sie weiß, wie eine Iris aussieht.«
»Mit Gartenarbeit hat Iris nichts am Hut«, bemerkt Pilar lachend und bückt sich, um ihre schnurrende Katze auf den Arm zu nehmen. »Ich wette«, fährt sie fort, während sie dem Stubentiger übers Fell streichelt, »Nan Biddle traut sich überhaupt nicht an ihrem ehemaligen Haus vorbei, um nicht mit ansehen zu müssen, wie ihre schönen winterharten Stauden jetzt von Unkraut überwuchert werden. Iris macht sich ja nicht mal die Mühe, Sommerblumen zu pflanzen!«
Julias Lächeln erlischt. »Nan hat man in diesem Frühjahr kaum zu Gesicht bekommen, Pilar.«
»Oh nein! Sag nur, es geht ihr schlechter!«
»Nach allem, was man hört, ja. Laut Myra Nixon hat sie’s nicht mal zu den jüngsten Heilsitzungen geschafft.« Obwohl Nan nun schon jahrelang gegen Metastasen infolge ihres Brustkrebses ankämpft, hat Julia sie doch oft getroffen, meist mit einem Turban oder Hut auf dem Kopf und in letzter Zeit zunehmend auf den Arm ihres Mannes gestützt. Seit kurz vor Ostern allerdings hat sie sie überhaupt nicht mehr gesehen, und was man seit neuestem über sie erfährt, ist nicht ermutigend.
Gemäß der Aussage von Lorraine Kingsley, einer Bekannten von Julia und Nachbarin der Biddles, sieht man Rupert immer häufiger ganz allein im Garten, wo er in Gedanken verloren in einem Sessel sitzt. Jedermann in Lily Dale weiß, dass Rupert und Nan sich geradezu abgöttisch lieben. Die Vorstellung, er könne einmal allein dastehen, bricht einem das Herz.
»Ich rufe Rupert mal an, sobald ich mich wieder eingewöhnt habe«, sagt Pilar, die dunklen Augen voller Traurigkeit. »Der arme Kerl! Ich kann ihm nachfühlen, wie ihm zu Mute ist! Und Nan ist nicht viel älter als Raul bei seinem Tod!«
Tröstend legt Julia ihr die Hand auf den Arm. »Rupert wird die Unterstützung gewiss gern annehmen. Ich persönlich kenne die Biddles ja nicht besonders gut und möchte nicht aufdringlich wirken. Wenn ich deiner Meinung nach aber irgendwas tun kann, dann sag mir Bescheid!«
»Gern. Und bestell Iris, ich lasse mich später zum Kaffee sehen. Wir haben uns viel zu erzählen.«
»Viel Spaß beim Auspacken!« Julia verabschiedet sich von Pilar, die gedankenverloren ihre Katze streichelt, und nimmt die Abkürzung quer über den schmalen Vorgartenrasen hin zu dem Haus, das für sie vermutlich immer das der Biddles bleiben wird, obwohl es mittlerweile drei Jahre her ist, seit Rupert und Nan es an Iris verkauft haben.
Während sie die Treppe hinaufgeht, stellt sie fest, dass die Stufen gewaltig absacken und im Verandageländer eine Verstrebung fehlt. Falls Rupert Biddle bei der Sorge um den sich verschlechternden Gesundheitszustand seiner Frau überhaupt noch Augen für andere Dinge hat, dann muss es ihn schier entsetzen, wie Iris nicht nur den Garten, sondern auch das Haus selbst verkommen lässt.
Ja, wäre alles anders gekommen, dann vielleicht …
Doch selbst wenn Iris ihre Kristin nicht innerhalb weniger Tage nach dem Einzug in dieses Haus auf tragische Weise verloren hätte – für Äußerlichkeiten verschwendet sie auch so wenig Zeit, weder auf ihr eigenes Äußeres noch auf das des Hauses. Was andere Leute denken, ist ihr egal.
Sonderbar eigentlich, denn Kristin war stets das genaue Gegenteil und sich ihrer Schönheit wohl bewusst. Sie ähnelte ihrer Mutter sehr, besaß deren Knochenbau und dieselben blauen Augen. Während allerdings die bodenständige Iris sich niemals mit Make-up, ja nicht einmal mit einem Fön abgab, verwandte Kristin viel Zeit auf ihr Aussehen. Schon in der Mittelstufe auf eine Laufbahn als Model fixiert, änderte sie ihr Ziel bei Eintritt in die Oberstufe zu Gunsten einer Karriere als Schauspielerin. Kurz vor ihrem Tod hatte sie ihr Vorhaben fast umgesetzt, wenn auch lediglich mit Auftritten in Theaterstücken für die Sommersaison sowie einer Hand voll TV-Werbespots in Los Angeles. Nach Julias Ansicht war das aber erst der Anfang, und Kristin hatte genauso gedacht.
Zu Lebzeiten ihrer Freundin war Julias Verhältnis zu deren Mutter nie ein sonderlich enges gewesen. Kristins Eltern hielten sogar meist beide sorgsam auf Distanz zu ihr. Nach Julias Einschätzung vergötterten sie zwar ihre Tochter, interessierten sich aber einfach nicht sonderlich für andere Kinder. Das galt insbesondere für Kristins Vater, der sich, war Julia im Haus, stets relativ rar machte und sich in seinem Arbeitszimmer verkroch. Jahre später, in den Tagen nach Kristins Verschwinden und vor dem Auffinden ihrer Leiche, hatte Julia sich verpflichtet gefühlt, rund um die Uhr bei Iris zu bleiben. Es war ja sonst niemand da. Die meisten Bekannten der Familie Shuttleworth lebten in Florida, und obwohl Iris wiederholt versucht hatte, sich mit Kristins nach wie vor in Jamestown wohnenden Halbbruder in Verbindung zu setzen, tauchte Edward erst zur Beerdigung auf.
Als dann Iris’ schlimmste Befürchtungen sich bewahrheiteten, da war es Julia, die telefonisch Paine Landry benachrichtigte, Kristins Lebensgefährten, mit dem sie damals in Kalifornien zusammenlebte. Es war Julia, die sich um die Trauerfeierlichkeiten kümmerte, und es war wiederum Julia, die Kristins dreijähriges Töchterchen tröstete, weil sowohl Iris als auch Paine in den düsteren Tagen nach Kristins Beerdigung von ihrem Schmerz zu sehr mitgenommen waren.
In den vergangenen paar Jahren ist Julia zu einer Art »Sommertochter« geworden, wie Iris es liebevoll nennt. Im Winter, wenn Iris wieder in Florida weilt, halten die zwei telefonisch Kontakt. Ist Iris fort, dann fehlt sie Julia, mehr als die eigene Mutter sogar, wenn man’s recht bedenkt.
Nun, als Julia die Klingel betätigt, regt sich in ihr die Erinnerung an einen kühlen Halloween-Abend fünfzehn Jahre zuvor.
In den wenigen Augenblicken, in denen Kristin sich in diesem Haus aufgehalten hatte, musste irgendetwas mit ihr geschehen sein.
Wie ein Echo hallen Julia noch Kristins Worte im Ohr.
Siehst du sie, Julia?
Wen, Kristin? Wen hast du gesehen? Was hat dich an jenem Abend derart verändert?
Eventuell war es auch gar nicht jener Abend gewesen, der diese Veränderung in ihrer Freundin hervorgerufen hatte. Möglicherweise war der Umzug nach Florida der Grund, und Julia bringt das nur unbewusst mit den Vorgängen damals an Halloween durcheinander. Sie ist sich nicht mehr sicher.
Aber dass Kristin damals vor fünfzehn Jahren in diesem Haus etwas gesehen hat, das steht für sie fest!
Auch, dass ihre Freundin dann bei ihrer Rückkehr, um der Mutter beim Einzug zu helfen, vermutlich erneut etwas sah. Anders kann man sich Kristins sonderbaren Persönlichkeitswandel nicht erklären. Schließlich hat Julia sie doch nach dem Flug von L. A. nach Buffalo vom Flughafen abgeholt und mehrere Stunden mit ihr verbracht, ehe sie sie vor dem Haus in der Summer Street absetzte!
Während der Zeit hatte Kristin sich so unbekümmert wie eh und je verhalten, sah man einmal von dem Gespräch über Dulcie ab, bei dem sie sehr niedergedrückt wirkte. Ihr Töchterchen hatte infolge einer Krankheit ihr Augenlicht eingebüßt. Wahrscheinlich, so damals Julias Vermutung, galt Kristins Rückkehr in den Osten Amerikas gar nicht in erster Linie der Unterstützung ihrer Mutter beim Umzug. Vielmehr stellte der Besuch den Versuch dar, der plötzlichen Belastung durch ein behindertes Kind zu entfliehen, und sei es nur für kurze Zeit. Dass man sich Sorgen machte um sein Kind und mal eine Atempause benötigte, das war normal.
Ganz und gar nicht normal fand Julia allerdings den gehetzten Blick in Kristins Augen, als die beiden tags darauf wieder zusammentrafen. Dieser Ausdruck hielt nicht etwa nur kurzfristig an, wie beispielsweise die Sorge um Dulcie. Nein, hier handelte es sich um ein deutlich spürbares Grauen, das tief aus Kristins Innerem herausbrach – dasselbe Entsetzen, das Julia damals im Treppenhaus der Biddles empfunden hatte.
Kurz nach ihrer Ankunft in Lily Dale, nur wenige Tage, nachdem sich diese Aura drohenden Unheils in ihren wunderschönen blauen Augen dauerhaft eingenistet hatte, war Kristin tot.
Als offizielle Todesursache wurde Unfalltod durch Ertrinken festgestellt. Größtenteils glaubt Julia das auch.
Meistens jedenfalls.
Wo bleibt Iris nur?, fragt sie sich nun mit einiger Verzögerung, erfolglos bemüht, durch das Oval aus Milchglas zu spähen. Normalerweise macht Iris umgehend auf, wenn jemand klingelt.
Ein Blick auf ihre Armbanduhr verrät Julia, dass es noch nicht mal acht Uhr ist – zu früh, als dass Iris schon ausgegangen sein könnte. Die offizielle Saison hat noch nicht begonnen, und die wenigen Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen in Lily Dale – eine kleine Cafeteria, die Bibliothek und ein paar Läden – öffnen erst später am Morgen.
Weggefahren sein kann Iris wiederum auch nicht, denn der betagte VW Käfer, den sie in Lily Dale fährt, steht in der kiesbestreuten Einfahrt neben dem Haus.
In Julias anfängliche Skepsis über den Verbleib ihrer Freundin mischen sich erste Anzeichen von Besorgnis.
Sie lässt den Blumenstrauß von der rechten Hand in die linke wandern und pocht hörbar an die Haustür.
Womöglich macht sie einen Spaziergang, spekuliert sie, verwirft diese Vorstellung indes postwendend. Doch nicht die gehfaule, übergewichtige Iris, die oft heiter behauptete, sie lebe nach der Devise »Besser schlecht gefahren als gut gelaufen«! Die bewegte sich doch höchstens, wenn Pilar sie hinter sich herzerrt!
Na schön, dann sitzt sie eventuell gerade in der Badewanne, denkt Julia.
Baden aber zählt eigentlich zu Iris’ abendlichen Ritualen. Iris ist ein Gewohnheitstier. Sie hat Julia mal erzählt, ein Bad vor dem Schlafengehen sorge bei ihr für Entspannung. Also widerspräche es der Logik, direkt früh am Morgen zu baden. Und unter der Dusche kann sie ebenfalls nicht stehen. Über der alten, auf Klauenfüßen ruhenden Badewanne gibt es nämlich keinen Duschkopf.
»Iris?« Da sich auch nach weiterem Warten nichts rührt, kommt Julia das Ganze allmählich unheimlich vor, obwohl ihr klar wird, dass Iris sie bei den geschlossenen Fenstern gar nicht hören kann.
Aber hätte Iris diese nicht normalerweise schon längst geöffnet?
Hätte sie nicht längst die Rollos heraufgezogen?
»Iris?« Ohnehin schon schriller als sonst, nimmt Julias Stimme nun einen an Panik grenzenden Unterton an.
Nach wie vor keine Antwort.
Die Hand vor dem Mund verharrt Julia zögernd und überdenkt die Lage. Ein Blick hinüber zum Haus der älteren Pilar gleich nebenan verrät ihr, dass diese nirgendwo zu sehen ist.
Was mach ich nur? Ich kann doch nicht einfach wieder gehen! Da stimmt doch was nicht! Das hab ich im Gefühl!, schießt es Julia durch den Kopf.
Inzwischen mehr als besorgt, bückt sie sich hinunter zu der vor ihr liegenden Gummifußmatte und zieht einen Schlüssel darunter hervor.
Paine steigt gerade aus der Dusche, als das Telefon läutet. Während er über den Flur ins Schlafzimmer eilt, wo der Apparat steht, rubbelt er sich mit einem hastig geschnappten Handtuch ab. Mit einem Blick zum Wecker auf dem Nachttischchen greift er zum Hörer. Neun Uhr erst! Wer mochte um diese frühe Morgenstunde anrufen?
»Hallo?«
»Spreche ich mit Paine Landry?«
»Ja …«
Die Frauenstimme am anderen Ende kommt ihm vage bekannt vor. Es dauert zwar einen Moment, aber als er sie dann zuordnet, stockt ihm der Atem.
Bis zu diesem Moment hat er verdrängt, dass er wegen Dulde mitten in der Nacht aufgewacht ist. Nun allerdings kommt ihm dieser beunruhigende Vorfall schlagartig wieder zu Bewusstsein, und zwar gleichzeitig mit der beklemmenden Erinnerung an einen anderen Anruf drei Jahre zuvor – einen Anruf, der genauso begann wie dieser jetzt.
»Julia Garrity hier! Aus Lily Dale …«
»Ich weiß, wo Sie wohnen«, sagt er gepresst, lässt sich dabei auf dem zerwühlten Bett nieder und das Handtuch achtlos zu Boden gleiten.
Ich weiß, von wo Sie anrufen … und auch warum!
»Ich … wie soll ich es Ihnen nur sagen … Es tut mir so Leid, dass ausgerechnet ich …«
Er wartet.
Er wappnet sich innerlich. Er ahnt, was nun kommt, und doch: Als er die Worte vernimmt, verliert er dermaßen die Fassung, dass es ihm einen Moment den Atem und die Sprache verschlägt.
»Paine, ich rufe an wegen Iris! Ich habe sie heute Morgen gefunden. Sie ist tot!«
Julia steht in Iris’ kleinem Arbeitszimmer im Obergeschoss des Hauses. Fast versagen ihr die Beine den Dienst, als sie sich zitternd in den neben dem Schreibtisch stehenden Sessel sinken lässt, das verweinte Gesicht in die Hände gelegt.
Ob sie will oder nicht, durchlebt sie die vergangene Stunde immer wieder aufs Neue und ist mittlerweile völlig mit den Nerven am Ende. Auch ihr förmliches Gespräch mit Paine Landry gerade eben hat nichts zu ihrer Beruhigung beigetragen.
Erneut erscheint vor ihrem geistigen Auge die grausige Szene, die sich ihr drüben im Badezimmer geboten hatte.
Iris, kopfüber in der gefüllten Wanne, das Gesicht unter Wasser, der nackte Körper über dem Wannenrand, die Beine gespreizt und nach hinten ausgestreckt.
Schon bevor sie das starre Fleisch anfasste, wusste Julia instinktiv, dass sie tot war.
Ein selten abstruser Unfall, so hatten die Rettungssanitäter bemerkt. Als sie in die Wanne steigen wollte, musste sie auf den glatten Kacheln ausgerutscht, nach vorn gestürzt und mit dem Kopf auf dem Wannenrand aufgeschlagen sein, sodass sie bewusstlos kopfüber ins Badewasser gekippt und ertrunken war.
Ein selten unglücklicher Unfall!
Ertrunken!
Beides genau wie bei Kristin!
Julia zuckt zusammen. Sie zittert am ganzen Körper. Iris’ unvorstellbar entsetzlicher Tod hat sie zutiefst schockiert, doch genauso schockiert sie die Erinnerung an Kristins tödlichen Unfall drei Jahre zuvor.
Ihr Atem geht flach und stoßweise – das einzige Geräusch im Zimmer, im ganzen Haus, außer dem vernehmlichen Ticken der antiken Uhr in der Wohnstube unten am Fuß der Treppe.
Nach der Hektik, die ausbrach, als Julia kreischend auf die Straße stürzte, ist nun Ruhe im Haus eingekehrt.
Es war Pilar, die per Telefon den Rettungsdienst angefordert und Iris – genauer gesagt, deren Leiche – während des Abtransports begleitet hatte. Irgendjemand musste ja mitfahren, aber einer musste auch bleiben, um Paine zu verständigen und ihm mitzuteilen, dass die Großmutter seiner Tochter gestorben war.
Natürlich bot Julia sich dafür an. Schließlich ist Pilar für die beiden eine wildfremde Person.
Eigentlich gilt das für Julia gleichermaßen, ist sie den beiden doch nur ein einziges Mal begegnet, damals, anlässlich Kristins Beerdigung. Nur hatten sie allesamt in der Woche von Paines und Dulcies Besuch so mit Trauer und Schmerz zu kämpfen, dass Julia sich kaum erinnert, ein Wort mit Paine gewechselt zu haben. Still und abweisend, hatte er sich überwiegend in seinem Kummer vergraben.
Dulcie jedoch …
Mit Dulcie hatte Julia sich etwas angefreundet in jenen grauen, bleiernen Augusttagen.
Beim Gedanken an Kristins hübsches Töchterchen, das schon ganz früh durch eine qualvolle Hirnhautentzündung das Augenlicht verlor, krampft sich ihr das Herz zusammen.
Welch Ausmaß an Tragik in einer einzigen Familie!
Und nun dies!
Der Anruf hatte sich erwartungsgemäß als schwer erwiesen. Mit bewegter Stimme hatte Paine zugesagt, gemeinsam mit Dulcie so bald wie möglich anzureisen. Auf seine Frage nach den Bestattungsformalitäten wies Julia ihn darauf hin, dass das vermutlich seine Aufgabe sein würde. Schließlich war Dulcie der einzige Nachkömmling von Iris, sah man von ihrem Stiefsohn Edward einmal ab. Soweit Julia bekannt ist, hat Iris Edward drei Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen – seit damals, als er abweisend und mit versteinerter Miene zu Kristins Beerdigung auftauchte.
Die Augen geschlossen, lässt Julia erschöpft den Kopf gegen die hohe, gepolsterte Sessellehne sinken.
Und dann spürt sie es.
Erschrocken zuckt sie hoch und erstarrt, angespannt horchend.
Sie ist nicht allein im Haus!
Kein Laut ist zu hören, kein Geräusch, kein verzerrtes Stimmengemurmel.
Doch sie kann sie spüren, die Präsenz um sich herum, fast mit Händen zu greifen.
Die Augen weiterhin fest geschlossen, konzentriert sie sich, angestrengt um Kontakt bemüht.
Wer bist du?
Iris?
Kristin?
Wer ist da? Wer?
So schnell, wie sich die Energie bemerkbar gemacht hat, ist sie wieder entschwunden.
Bestürzt stemmt Julia sich aus dem Sessel hoch, eilt die Treppe hinunter und zur Haustür hinaus, instinktiv die Flucht ergreifend – bevor es sie noch einmal überkommt.
2. KAPITEL
Sind wir bald da, Daddy?«
Paine wirft einen Blick nach hinten, wo Dulcie sich in den Rücksitz des Mietwagens kuschelt, ein in Blindenschrift verfasstes Märchenbuch aufgeschlagen auf dem Schoß. Ihre Zöpfchen, so fällt ihm auf, sind unterschiedlich lang. Er hat zwar versucht, sie so zu flechten, wie es die Babysitterin zu Hause immer macht, doch es ist ihm scheinbar nicht gelungen.
»Nur ein paar Meilen noch, glaube ich.« Gerade haben sie auf der Route 60, einer viel befahrenen Staatsstraße, Fredonia passiert, ein Universitätsstädtchen ganz im südwestlichen Zipfel des Bundesstaates New York gelegen. Hier sind sie an der Ausfahrt 59 von der Autobahn abgefahren. Nach hunderten von Kilometern auf der Interstate 90 stellt die Ortsdurchfahrt eine willkommene Abwechslung dar, selbst im Schneckentempo.
Allerdings, so fällt Paine bei der Gelegenheit ein, heißt die Autobahn hier im Osten der USA nicht Interstate. Erst gestern haben ihn sowohl ein Tankwart als auch die Angestellte an der Motelrezeption entsprechend korrigiert. Hier sagt man »Thruway«.
»Okay, beschreib mal, was du siehst, Daddy!«
Dulcies gewohnter Kommandoton lässt ihn schmunzeln – die wohl von ihrer Mutter geerbte fast schon herrische Art, der unstillbare Wissensdurst, der alles umfasst, was um sie herum vorgeht, lässt Paines Herz höher schlagen.
Als Dulcie noch jünger war, hatte sie sich mit generellen Darstellungen zufrieden gegeben, beispielsweise »Da steht eine rote Scheune« oder »Der Himmel ist blau mit ein paar weißen Wolken«. Jetzt allerdings, mit sechs, verlangte sie verbale Bilder, und zwar möglichst detailgetreu. »Wie groß ist die Scheune? Hat sie Fenster? Wie viele denn? Sind Pferde oder Kühe in der Nähe? Wie viele Wolken, Daddy? Welche Formen haben sie?«
Ist er mal ohne sie unterwegs, ertappt er sich dabei, dass ihm selbst an alltäglichen Dingen die kleinsten Einzelheiten auffallen, wie er es sonst nur erlebt, wenn er für Dulcie sieht. Mitunter gar merkt er, dass er wildfremde Menschen mustert, etwa unbewusst die Ringe an den Fingern einer Frau zählt oder bei einem Mann die Farbe der Krawatte taxiert.
»Daddy?«
Lächelnd räuspert er sich. »Also, bisher waren wir auf so ’ner Art Schnellimbissstrecke mit lauter Fastfood-Ketten wie McDonald’s, Wendy und so weiter. Wir lassen gerade die letzte größere Kreuzung hinter uns und fahren nun in Richtung Süden.«
»War da auch ein Wal-Mart?«
»Woher wusstest du das?«
»Weil’s immer überall Wal-Marts gibt! In jeder Stadt, in der wir gehalten haben und wo’s die anderen Läden gibt, da gibt’s auch Wal-Mart.«
Dulcies Aufmerksamkeit entgeht nichts, absolut nichts. Die Kleine ist unglaublich, denkt Paine wie immer und schmunzelt. Ganz wie ihre Mutter!
Ach, Kristin! Wenn du sie nur sehen könntest …
Könnte er es nur glauben, dass sie Dulcie sieht! Dass ihr Leben nicht an jenem traumatischen Tag vor drei Jahren endete, sondern dass das Wesen der Frau, die er so liebte, irgendwo weiterexistierte! Dass sie bei ihm und ihrer gemeinsamen Tochter ist und es immer sein wird!
Das aber ist religiöser Unsinn, den Kristin nie für bare Münze genommen hat, und er tut es auch nicht. Wenn es nach ihm geht: Wer tot ist, ist tot. Nicht mehr da. Begraben. Unwiderruflich.
»Mach weiter, Daddy!« Im Rückspiegel sieht er, wie Dulcie sich zurücklehnt, das Gesicht zur Seitenscheibe gewandt, als schaue sie hindurch.
Er würgt die bittere, tief aus dem Bauch aufsteigende Trauer hinunter und ringt sich einen gezwungen heiteren Tonfall ab. »Jetzt ist die Fahrbahn nicht mehr vierspurig, sondern verengt sich auf zwei Spuren; die Landschaft wird offener. Voraus erkenne ich Hügel, es geht etwas bergan. Ringsum Felder – jede Menge Mais, hoch wie ein Elefantenauge …«
»Was sagst du da?«
»Ach, nichts, Dulc!« Versonnen lächelt Paine in sich hinein.
The corn is as high as an elephant’s eye …
Eine Zeile aus einem Song des Musicals Oklahoma von Rodgers and Hammerstein, in dem Paine in einer Sommeraufführung der Theaterakademie in Chautauqua auftrat, damals, als er Kristin erstmals begegnete. Ganze zehn Jahre ist das nun her. Er spielte den Curly, sie die Ado Annie.
»Wieso muss ich immer das Biest spielen?«, hatte sie zu dem Zeitpunkt den Regisseur gefragt, beileibe nicht nur im Spaß, da sie zuvor schon die Aldonza in Der Mann aus La Mancha und die Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar dargestellt hatte.
»Was sonst noch, Daddy?«
Dulcies Stimme versetzt ihn mit einem Schlag in die Gegenwart zurück.
»Weingärten«, sein Blick schwenkt von links nach rechts, »und Verkaufsstände mit Obst und Gemüse und zweigeschossige Fachwerkhäuser, einige davon mit Scheunen.«
»Schöne Häuser?«
»Manche ja«, sagt er, bremst dabei etwas ab und sieht sich um. »Einige haben hübsche Vorgärten mit bepflanzten Holztrögen und Flaggen und Picknicktischen. Aber ein paar wirken auch irgendwie heruntergekommen, mit rostigen Schrotthaufen allenthalben.«
»Warum fahren wir langsamer?«
»Weil wir einen Sattelschlepper vor uns haben, der mit fünfzig Stundenkilometern vor uns herkriecht. Und an der Steigung hier darf ich ihn nicht überholen, da ich nicht weit genug sehen kann.«
Er ist ein umsichtiger Fahrer, anders als Kristin. Fuhr man bei Dulcies Mutter als Beifahrer mit, kam man sich vor wie früher im Autoskooter auf der Kirmes. Man schloss die Augen und klammerte sich in Todesangst fest, während man hin und her geschleudert wurde – und Kristin saß völlig unbekümmert am Steuer. Sie hatte eine so unglaublich halsbrecherische Fahrweise, dass er sich stets auf das Schlimmste gefasst machte, wenn sie sich mal nach ihrer Abendschicht als Kellnerin in Santa Monica verspätete. Wahre Horrorvisionen schössen ihm durch den Kopf, beispielsweise die Vorstellung, ein Polizist erscheine mit ernster Miene vor der Haustür, um ihm mitzuteilen, dass sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.
Wie viele Male mochte er sich ihren Verlust wohl als Schicksalsschlag ausgemalt haben, bevor er tatsächlich eintrat?
Als es dann aber so weit war, Wochen nur nach ihrem sechsundzwanzigsten Geburtstag, da war es kein Autounfall. Das zu begreifen, bedeutete für ihn genauso einen Schock wie ihr Tod selbst.
Dass sie ertrinken könne, hätte er nie für möglich gehalten.
Selbst heute, drei Jahre später, kann er das noch nicht ganz akzeptieren. Sobald vor seinem geistigen Auge die verhassten, abscheulichen Fantasien auftauchen – Kristin, die panisch mit den Armen um sich schlägt und versinkt, die nach Luft schnappt, aber nur Wasser einatmet, keine Luft, sondern Wasser, immer nur Wasser, bis sie erstickt –, verdrängt er sie. Die einzige Möglichkeit, das Geschehene zu verarbeiten, besteht für ihn darin, dass er sich auf das große Ganze konzentriert – Kristin ist für immer fort – und die Einzelheiten ignoriert.
Einzelheiten.
Zurück zu Dulcie.
»Überall um uns herum stehen Bäume, Dulc, zu beiden Straßenseiten«, fährt er fort, bemüht, die verschwommen vorbeihuschende Landschaft möglichst detailliert zu beschreiben, während der Sattelschlepper vor ihm nach Erreichen der Höhe allmählich beschleunigt. Paine gibt ebenfalls Gas und wirft einen Blick in den Rückspiegel. Keine Fahrzeuge hinter ihm. So eine Fahrt ist er nicht gewohnt – zweispurige Landstraßen, ländliche Umgebung, keine verstopften Stadtautobahnen … Ein wahres Vergnügen nach so vielen Jahren auf den hektischen Freeways von Los Angeles!
Paine streckt sich ein wenig und erhascht im Rückspiegel einen flüchtigen Blick auf sein Spiegelbild. Er erkennt sich kaum wieder. Sein widerspenstiges dunkles Haar braucht unbedingt einen Schnitt. Die kleinen Fältchen in den Augenwinkeln stammen beileibe nicht vom Lachen. Ränder unter den blauen Augen sowie ein beträchtlicher Bartschatten verdüstern sein »hübsches Jungengesicht«, wie Kristin es früher immer nannte.
In den zehn Tagen seit dem Anruf von Julia Garrity hat er sich nicht mehr rasiert. Möglicherweise lässt er es bis zur Abreise bleiben, mit seinem Bartwuchs hatte er sowieso immer seine Probleme gehabt. Damit hatte es nie so recht geklappt. Einmal, damals im College, als er den Tevye aus Anatevka spielte, hatte er einen Versuch gestartet. Die unregelmäßig sprießenden Zotteln sahen aber so lächerlich aus, dass er den Bart auf Geheiß des Regisseurs vor versammelter Besetzung abrasieren musste. Laut Regieanweisung sollte Paine dann eigentlich einen falschen Bart tragen, trat aber aus lauter Trotz und Verärgerung über die Demütigung bewusst als glatt rasierter Tevye auf.
Wieder unterbricht Dulcies Stimme seine Grübeleien. »Was für Bäume sind es denn, Daddy? Palmen?«
Er lächelt. Sie ist ein echtes Kind des kalifornischen Südens, das sonnengebleichte lange Haar und die bronzene Haut Zeugnis langer am Strand verbrachter Tage. Diese Zeit allerdings ist jetzt für ein Weilchen vorbei.
Die Kleine fröstelt schon, seit sie die brütende Hitze im Herzen des Kontinents hinter sich ließen und heute Morgen die Grenze nach Pennsylvania überquerten.
Paine ist in Kalifornien aufgewachsen, doch er erinnert sich sehr gut an jenen einen Sommer damals an der Theaterakademie im nahe gelegenen Chautauqua und erwartet somit nicht, dass der Westen von New York State ihn mit milden Temperaturen und blauem Himmel willkommen heißt. Allerdings erstaunt es ihn, dass im östlichen Gebiet der Großen Seen Ende Juni eher ein Wetter herrscht wie im April oder auch Mai. Dichte, graue Wolken hängen bleischwer am Himmel, und wärmer als zwölf, dreizehn Grad ist es bestimmt nicht.
»Palmen auf keinen Fall«, erklärt er Dulcie. »Ahorn und Ulmen und Kiefern und was weiß ich, was sonst noch für welche. Mit Bäumen kenne ich mich nicht so aus.«
Sie grinst. »Mit Blumen auch nicht. Nicht so wie Margaret.«
Margaret ist ihre Kinderfrau daheim in L. A., die Babysitterin, die auf Dulcie aufpasst, wenn Paine in einem seiner drei Jobs beschäftigt ist. Falls er nicht gerade Vorsprechtermine hat, kellnert er für einen Partyservice in Beverley Hills, akquiriert Kleinanzeigen für das in L. A. erscheinende Stadtmagazin Weekly und gibt Kurse an der Volkshochschule, wo er Leuten Schauspielunterricht erteilt, die in die Fernsehwerbung möchten. Ach ja, und alle Jubeljahre kriegt er auch selbst ein Engagement als Darsteller. Manchmal. Aber nur in TV-Werbespots und Werbevideos. Erstmals hatte er auf sich aufmerksam gemacht, als er ein paar Wochen lang für Ben Affleck einspringen durfte, damals, gleich nach Dulcies Geburt.
Ständig knapp bei Kasse, kann er zuweilen nicht mal das Honorar für die Babysitterin aufbringen, die das allerdings nie sonderlich übel nimmt. Ihr ältester Sohn, gleichfalls Schauspieler, war auch nicht immer so erfolgreich gewesen wie jetzt als Nebendarsteller in einem neuen Broadway-Musical.
Wieder wirft er im Rückspiegel einen Blick auf Dulcie, deren Grinsen einer wehmütigen Miene gewichen ist.
»Musst du an Margaret denken?«, fragt er.
»Ich hab schon Heimweh nach ihr. Sie wollte doch auch nach New York! Warum konnte sie nicht mit uns fahren statt zu fliegen?«
»Zum einen wäre so eine Autofahrt sicher unbequem für sie, wegen ihres Rheumas. Und zum anderen reist sie doch zum entgegengesetzten Ende von New York State!«
Das hat er ihr schon einmal erklärt und es ihr sogar auf der Karte gezeigt – das winzige Lily Dale ganz unten in der linken Ecke des Bundesstaates, dagegen das riesengroße New York City ganz rechts unten, und dazwischen eine Entfernung von über sechshundert Kilometern, jedenfalls laut Maßstab.
»Margaret besucht für ein paar Wochen ihren Sohn und ihre Enkelkinder«, fährt er geduldig fort. »Wenn die Beerdigung vorbei ist und wir alles mit Grandmas Haus geregelt haben, dann fahren wir wieder heim, genau wie Margaret.«
»Versprichst du mir das?«
»Versprochen!« Er hat nicht vor, länger als nötig zu bleiben, auch wenn sein Schauspielkurs erst Ende August wieder beginnt und der Partyservice wie auch die Weekly-Redaktion in punkto Urlaub flexibel sind.
»Klopfzeichen, Daddy!«
Er grinst, heilfroh, dass das Thema ad acta gelegt ist. Seit neuestem hat Dulcie sich auf ein witziges, für Paine manchmal nervendes Spiel verlegt, ein Rate- und Sprachspiel, bei dem man auf möglichst originelle Weise Namen oder andere Begriffe erraten lassen muss. Obgleich er Dulcies Versionen allesamt zigfach gehört hat, rafft er sich doch stets zum munteren Mitmachen auf. Nicht umsonst ist er Schauspieler! »Wer da?«
»Hatschi!«
»Wie? Hatschi?«
»Gesundheit!«
Beide brechen sie in Gelächter aus.
»Was meinst du mit ›Grandmas Haus geregelt‹, Daddy?«, will Dulcie dann wissen.
Paine spitzt die Lippen, erleichtert, dass sie sein Gesicht nicht sehen kann. »Weiß ich nicht genau, Dulcie. Laut ihrem Rechtsanwalt hat sie dir das Haus hinterlassen. Aber wohnen können wir da nicht.«
»Will ich auch gar nicht!«, bemerkt sie, um nach kurzer Pause zu fragen: »Und warum geht das nicht?«
Er holt tief Luft. »Schwer zu erklären.«
Er weiß, Dulcie erinnert sich nicht mehr an die Reise nach Lily Dale, damals, zur Beerdigung ihrer Mutter. Dass dieses Lily Dale kein gewöhnlicher Ort ist – wie soll man das einer Sechsjährigen erklären, ohne sie gleich zu Tode zu erschrecken? Also lässt man es lieber ganz. Vorerst zumindest.
»Hoppla, da vorn steht ein Schild!«, ruft er stattdessen. »Nach Lily Dale die Nächste rechts. Fast am Ziel! Du bist froh, dass du aus dem Auto rauskannst, was?«
»Hm-hm!«
Ein Blick über die Schulter verrät ihm, dass Dulcies Unterlippe bebt. »Was ist, Dulcie?«
»Ich will nach Hause!«
»Dulc …«
»Ich möchte wieder nach Hause fahren, Daddy! Bitte!«
»Tun wir ja auch! Sobald wir …«
»Ich will nicht dahin! Da ist Mommy gestorben! Und Grandma auch! Da ist es böse, Daddy! Bitte! Ich hab Angst!«
Mit einem dumpfen Gefühl im Magen lässt Paine den Wagen auf dem Randstreifen ausrollen und schiebt den Automatikhebel in Parkposition, um sich dann nach hinten zu wenden und seine Tochter in die Arme zu schließen.
»Ist nicht so schlimm, Dulcie! Vielleicht fühlst du dich ja näher bei Mommy, wenn du hier bist. Und bei Grandma auch! Die sind hier nicht nur gestorben – die haben hier auch gelebt!«
Dulcie sagt keinen Ton. Ihr zierlicher kleiner Körper zittert nur in Paines Armen.
»Du, Dulcie, hier hat Mommy als junges Mädchen immer den Sommer verbracht. Und früher hat sie erzählt, wie wunderschön es hier ist!«
Jetzt übertreibt er. Der Ausdruck »wunderschön« kam in Kristins Beschreibung von Lily Dale nicht vor.
Er redet weiter. »Du warst damals noch zu klein und kannst dich an deinen letzten Besuch hier nicht erinnern.«
Ihm selbst ist auch nicht mehr allzu viel von dem Aufenthalt gegenwärtig, war er doch damals zu gelähmt vom Schmerz, um überhaupt etwas bewusst mitzubekommen. Das ist dieses Mal anders. Er hat Iris zwar ehrlich gemocht, doch ihr plötzlicher Tod hat ihm weder das Herz aus dem Leibe gerissen noch wird er in seinem Leben eine klaffende Lücke hinterlassen. Anders als beim vorigen Mal fühlt er sich der Lage gewachsen.
»Wir müssen das durchstehen«, beschwört er sie leise. »Wir beide zusammen, du und ich. Für Grandma! Und für Mommy!«
Sie gibt keine Antwort, reckt nur trotzig das Kinn.
Paine lenkt den Mietwagen auf den Highway zurück. Wenig später, kurz hinter dem Ortseingangsschild von Cassadaga, einem heruntergekommenen Agrarstädtchen, biegt er rechts ab in den Dale Drive. Dort steht nochmals ein Hinweis.
LILY DALE 1 MEILE.
Prima. Sie sind fast da. Dann wird alles besser laufen.
Immerhin haben sie eine schier endlose Fahrt hinter sich. Vor sieben Tagen sind sie aufgebrochen, eine geschlagene Woche unterwegs also. Da der alte Honda schon an die 200.000 km auf dem Tacho aufweist, hat Paine sich den Luxus eines Mietwagens gegönnt. Eventuell wird er die Mittelklasselimousine vor der Rückfahrt gegen einen Kleinlaster eintauschen, vorausgesetzt, aus Iris’ Haus lässt sich überhaupt etwas Brauchbares mitnehmen. Soweit er sich erinnert, muss man das bezweifeln. Laut eigener Aussage zählte Iris zu diesen Leuten, die nichts wegwerfen, alles hamstern und bunkern, mit Vorliebe alte Schätzchen.
Für derlei Dinge hat Paine nichts übrig, und eine Truckladung Trödel quer durch die Prärie zu karren, das hätte ihm gerade noch gefehlt. Aber man wusste ja nie. Vielleicht finden sich ein paar wertvolle Antiquitäten, oder Dulcie will womöglich irgendetwas behalten, denkt Paine. Sie ist zwar noch klein, aber streng genommen gehört es ja zu ihrer Erbschaft – das letzte Band zu Mutter und Großmutter.
Dabei fällt ihm ein Gespräch mit Iris ein, in dem es um ihren Nachlass nach Ansons Tod ging. Offenbar hatte ihr Mann in seinen Jahren als erfolgreiches Medium schlecht investiert und einen erheblich höheren Schuldenberg angehäuft, als Iris bewusst gewesen war. Große Reichtümer hatte sie nicht geerbt. Nachdem sie alle finanziellen Angelegenheiten geregelt hatte, war ihr letztendlich nichts außer dem Haus sowie die aus dem Verkauf seiner Bücher resultierenden spärlichen Tantiemen, die nach wie vor zweimal jährlich aufs Konto tröpfeln, verblieben.
Iris zufolge war das aber kein Malheur. Schließlich hatte sie Anson nicht in erster Linie des Geldes wegen geheiratet, von dem er seinerzeit ohnedies nicht viel besaß. Sie und Anson, so Iris, hatten sich unsterblich ineinander verliebt, ausgerechnet in einer Phase, als er gerade eine üble erste Ehe hinter sich hatte und die einsame Iris sich allmählich fragte, ob sie wohl überhaupt noch den Richtigen finden würde. Ferner erwähnte sie, sie habe die Ehe mit Anson nie bereut, deutete indes an, dass die ersten Jahre zu zweit wohl nicht immer harmonisch verlaufen waren.
»Aber wir sind zusammengeblieben«, sagte Iris damals zufrieden. »Dazu heiratet man ja schließlich. Bis zuletzt haben wir durchgehalten – bis dass der Tod uns schied!«
Nunmehr gehört Dulcie Ansons und Iris’ gesamter Besitz – beileibe kein Vermögen, aber hilfreich allemal, das steht fest. Die Tantiemen sowie den Erlös aus dem Hausverkauf gedenkt Paine für Dulcies College-Ausbildung fest anzulegen. Er hat sich sowieso schon Gedanken gemacht, wie er ihr Studium später einmal finanzieren soll.
Danke, Iris!, sagt er stumm.
Die Straße windet sich an einigen Häuschen vorbei. Linker Hand kommt der winzige Cassadaga-See in Sicht, dessen bewegte graue Wellen ans grasbewachsene Ufer schwappen, Meter nur von der Fahrbahn entfernt.
Hier ist Kristin ertrunken.
Kristin, die nicht schwimmen konnte.
Kristin, die zwar in vielerlei Hinsicht Kopf und Kragen riskierte, stets aber ihre Grenzen kannte und Angst vorm Wasser hatte.
Was, zum Teufel, hatte sie dann mitten in der Nacht auf dem See verloren? Mutterseelenallein in einem Ruderboot, obendrein auch noch ohne Schwimmweste?
Paine wird es nie erfahren.
Damals, bei seinem ersten Aufenthalt, stand er noch zu sehr unter Schock, um sich den Kopf über die Umstände ihres Todes zu zerbrechen. In den vergangenen drei Jahren jedoch und mit abklingender Trauer hat er indes des Öfteren darüber nachgedacht.
Jetzt, da sein Blick über die Wasserfläche schweift, drohen sich Verwirrung und ernsthafte Zweifel in ihm festzubeißen. Er verscheucht die beklemmenden Anwandlungen, die auf ihn einstürmen. Alles der Reihe nach! Ein Sterbefall nach dem anderen! Jetzt ist erst Iris an der Reihe.
Düster setzt er die Fahrt fort, dankbar für Dulcies Schweigen.
Sie passieren ein malerisches Landrestaurant namens »Lazzaroni’s Lakeside«, am rechten Wegesrand gelegen, während zur Linken ein breiter, mit Holzschindeln verkleideter Bau auftaucht, ausgestattet mit einer langen Veranda, an der ein Schild befestigt ist. LEOLYN HOTEL steht darauf. Direkt gegenüber mündet die Straße abrupt in einen breiten Platz vor dem Eingangstor zum Dorf.
Als Paine den Fuß vom Gas nimmt und bremst, überfällt ihn plötzlich wieder der überwältigende Schmerz seiner ersten Reise nach Lily Dale.
»Sind wir da, Daddy?«
»Ja.« Seine Stimme klingt belegt.
Oh, Kristin! Was ist nur hier mit dir geschehen?
»Was siehst du, Daddy?«
Er räuspert sich. »Ein weißes Torhäuschen mit einem Jungen darin.«
»Einem kleinen?« Überrascht hört sie sich an, plötzlich ganz voller Hoffnung! Ob es wohl Kinder hier gibt? Spielgefährten, die nett sind zu einem kleinen blinden Mädchen ohne Mutter?
»Es ist eigentlich schon ein Teenager, Dulcie.«
»Ach so …« Und dann: »Was tut der denn?«
»Ich hab dir doch erzählt, dass das hier eine private Gemeinde ist, weißt du noch? Deshalb muss man durch dieses Tor, um hinein- und hinauszugelangen. Und der Junge hat die Aufgabe, uns hereinzulassen.«
»Und was siehst du sonst noch?«
Er möchte es ihr nicht sagen. Noch nicht.
Er blickt nur auf das Schild mit der Aufschrift WILLKOMMEN IN LILY DALE, DEM WELTGRÖSSTEN ZENTRUM FÜR SPIRITUALISMUS.
»Rupert!«
Kräftig wie schon seit Tagen nicht schallt Nans Stimme eindringlich aus dem kleinen weißen Empfänger auf dem Sekretär, an dem Rupert gerade sitzt. Das Babyfon war Pilars Idee. Ursprünglich hatte die ehemalige Nachbarin es sich gekauft, als ihre kleinen Enkelkinder zu Besuch weilten, es dann aber, da Nan jetzt buchstäblich ans Krankenbett gefesselt ist, Rupert leihweise zur Verfügung gestellt. So ist er nie außer Hörweite, falls sie ihn braucht, was in jüngster Zeit immer öfter der Fall ist.
»Ich komme!«, ruft er und erhebt sich aus seinem lederbezogenen Drehstuhl. Er fährt sich mit der Hand durch den weißen Haarschopf. Hastig legt er sein Scheckbuch und den Stapel monatlicher Rechnungen beiseite und wirft einen Blick zur Uhr. Fast halb sechs; Zeit, dass er das Abendessen in Angriff nimmt – natürlich erst, nachdem Nan versorgt ist.
Durch das stille, sauber aufgeräumte Haus begibt er sich zu dem kleinen Schlafzimmer hinten neben der Küche.
Gegen mehrere Kissen gestützt, liegt dort seine Frau in dem Krankenpflegebett, das er schon vor Monaten für sie gemietet hat, lange bevor es unumgänglich wurde. Obwohl er von morgens bis abends nahezu pausenlos an ihrer Seite ist, nehmen ihn die drastischen Veränderungen, die in jüngster Zeit an ihr sichtbar werden, jedes Mal aufs Neue mit. Irgendwie klammert er sich innerlich immer noch hartnäckig an seine Vorstellung von Nan, wie sie aussah, bevor der Krebs sie heimgesucht und sie fast zürn Skelett hat abmagern lassen, den nahezu kahlen Kopf unter einem Turban verborgen, das Gesicht aufgeschwemmt infolge der Medikamente, die nun nichts mehr ausrichten können.
Zwar hat sich noch keiner getraut, ihm offen und ehrlich zu sagen, wie schlimm es um sie steht, aber ahnen tut er es dennoch.
Nein …
Er weiß es.
»Was brauchst du denn?«, fragt er sanft, während er zu ihr ans Bett tritt und ihren dünnen Arm durch die Decke berührt.
»Zur Toilette!«, erwidert sie kraftlos.
»Nötig?«
Sie nickt.