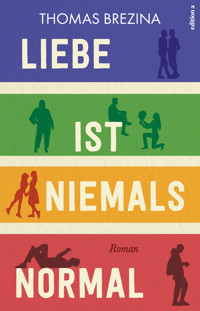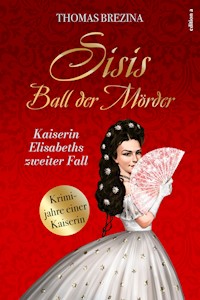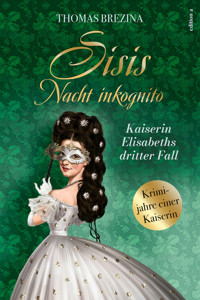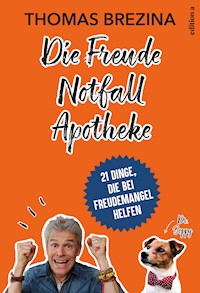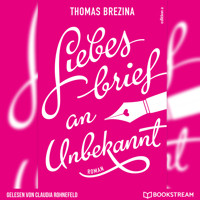Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Während im Jahr 1878 die ganze Welt die Musik von Johann Strauß feiert, kommt es bei seinen Konzerten in Wien zu mysteriösen Todesfällen. Strauß ahnt, die Mordanschläge gelten ihm. Aber wer trachtet ihm nach dem Leben? Und wieso? Mehr als ein Jahrhundert später arbeitet die junge Journalistin Allegria an einem Artikel. Eine Musikstudentin ist nach dem Neujahrskonzert spurlos verschwunden. Bald entdeckt Allegria Zusammenhänge mit den Morden von damals. Die Geschichte des Walzerkönigs scheint anders zu sein, als sie bisher dachte. Gekonnt vermischt Thomas Brezina Fakten und Fiktion und das Wien des Kaiserhofs mit dem von heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUS FÜR STRAUSS
Thomas Brezina:
Aus für Strauss
Alle Rechte vorbehalten
© 2024 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover und Satz: Anna-Mariya Rakhmankina
Gesetzt in der Bene
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 27 26 25 24
Isbn: 978-3-99001-769-2
e-Isbn: 978-3-99001-770-8
THOMAS BREZINA
AUS FÜRSTRAUSS
Ein Johann-Strauss-Krimi
Inhalt
2024
1. Januar Neujahrskonzert, Musikverein Wien
1878
April
2024
21. November Donnerstag
1878
Mai
2024
23. November Samstag
1878
Dezember
2024
26. November Dienstag
1879
Juni
2024
29. November Freitag
1883
September
November London
2024
25. November Samstag
1883
Dezember
1884
Februar
September
2024
25. November Samstag
1885
August
2024
25. November Samstag
1885
August
2024
26. November Sonntag
1885
August
2024
28. November Dienstag
333 TAGE ZUVOR 2024
1. Januar Pause beim Neujahrskonzert
1899
Mai
2024
29. November Mittwoch
1902
September
2024
3. Dezember Mittwoch
6. Dezember
11. Dezember
1907
Oktober
2024
31. Dezember
2025
1. Januar
5. Januar
2026
1. Januar
Danksagung
2024
1. JanuarNeujahrskonzert, Musikverein Wien
»Wo bleibt Ihre charmante Begleiterin?«
Das hätte August auch gern gewusst. Dank seiner Größe von einem Meter neunzig konnte er über die Köpfe der Menschen hinwegsehen, die vom Buffet Richtung Mitteleingang des Goldenen Saals drängten.
Eine Mischung aus schweren Parfüms und dem Geruch von Sekt und Champagner hing in der Luft. Das Jahr hatte gerade erst begonnen. Es war halb eins am Nachmittag und die festlich gekleideten Damen und Herren hatten die Pause genutzt, um zum wiederholten Male darauf anzustoßen. Eine blecherne Klingel schrillte, das Publikum sollte die Plätze wieder einnehmen.
Glücklich war, wer eine Karte für das wohl berühmteste Konzert der Welt bekommen hatte. Ein Teil der mehr als 1.700 Sitzplätze war Honoratioren vorbehalten, ein Teil wurde alljährlich verlost und ein Teil wurde zu horrenden Preisen über Kartenbüros angeboten.
August spürte, wie Margarethe Böhms Blick über ihn wanderte. Als er sich umdrehte, sah er diesen arroganten, spöttischen Zug um ihre Mundwinkel, den er so sehr hasste.
Wieso stand sie immer noch neben ihm und kehrte nicht an ihren Platz zurück? Sie saß drei Reihen vor ihm, wie er mit großer Missbilligung bemerkt hatte. Der Kritikerin einer Tageszeitung, die er nicht einmal mit der Zange angefasst hätte, gebührte kein Platz vor ihm, fand August. Ihr Lebenszweck bestand ausschließlich darin, eine laienhafte Meinung über Konzerte und Theaterveranstaltungen abzugeben, die ohnehin niemanden interessierte. Seine Aufgabe hingegen war die Erforschung des Lebens und des Werkes eines der größten Komponisten der Musikgeschichte.
Ein Platzanweiser in weinroter Jacke trat zu ihnen. Für August gehörte dieser Mann, der zu jeder Jahreszeit gut gebräunt war, zum Musikverein wie die Orgel oder die goldenen Statuen zwischen den Logen, die den Balkon trugen. »Bitte die Plätze einzunehmen. Das Konzert muss in drei Minuten weitergehen.« An August gewandt fügte er hinzu: »Prosit Neujahr, Herr Professor. Dieses Jahr hat man Sie gar nicht zu mir gesetzt.« Damit meinte er eine der drei Logen nahe der Bühne, für die der Platzanweiser verantwortlich war.
August nickte abwesend und ließ seinen Blick schweifen. Wo war sie bloß?
Das Gedränge ebbte ab. Er konnte bis zu den Glasvitrinen des Buffets sehen, wo das Servierpersonal bereits Brötchen und Petit Fours wegräumte, die übrig geblieben waren.
»Wo werden Sie zu Mittag essen?«, wollte die Böhm von ihm wissen.
Er hatte einen Tisch für zwei im Café Imperial reserviert. Eine Überraschung für Helen. Aber das ging diese Frau nichts an.
»Entschuldigen Sie mich«, sagte er hastig und ließ die Böhm einfach stehen. August eilte zu den Toiletten, die sich in einem Gang hinter dem kleinen Pausenraum befanden. Der Gang war leer. Er konnte nicht einfach in die Damentoilette platzen, also wartete er, bis jemand herauskam.
Die Tür blieb geschlossen. Die Glocke schepperte erneut. Mit ein bisschen Fantasie konnte man Ungeduld in ihrem Ton erkennen.
August klopfte an die Toilettentür und öffnete sie dann vorsichtig. An den Waschbecken stand niemand, unter den Kabinentüren waren keine Beine zu sehen. Die Toilette war leer.
Vielleicht hatte er Helen in dem Gedränge doch übersehen und sie war zu ihrem Platz zurückgekehrt? Er rannte zum mittleren Eingang in den Goldenen Saal, wo zwei junge Platzanweiser gerade die hohen Holzflügel der Türen schlossen.
Vom obersten Absatz der Stufen konnte er die Stuhlreihen im Saal überblicken. Parterre, Reihe neun, die Plätze zehn und elf, das waren die ihren. Beide waren leer.
Der Platzanweiser war lautlos neben ihn getreten. Er flüsterte. »Bitte, Herr Professor, setzen. Die zweite Hälfte muss pünktlich beginnen. Sie wissen, die Übertragung.«
Natürlich wusste August, dass das Neujahrskonzert in die halbe Welt übertragen und von Millionen Menschen gesehen wurde. Er eilte vorbei an der fußfreien Reihe zum rechten Block und murmelte Entschuldigungen, als er sich an festlich gekleideten Touristen vorbeizwängte, die bereits saßen und ihm tadelnde Blicke zuwarfen. August ließ sich auf seinen Sitz sinken, erhob sich aber noch einmal halb und blickte zu den Türen. Sie waren bereits geschlossen.
Als er sich wieder setzte, fiel ihm ein Logenplatz auf. Er war leer. August hätte schwören können, dass dort jemand gesessen hatte. Auch der Sitz neben ihm war verwaist. Wer dort gesessen hatte, wusste er nur zu gut.
Sekunden später betrat der Dirigent das Podium und wurde mit frenetischem Jubel begrüßt. Der erste Teil des Programms war von ihm und den Wiener Philharmonikern als Streifzug durch das Werk der drei Strauss-Brüder Johann, Josef und Eduard zusammengestellt worden und hatte großen Anklang gefunden. Zur Polka Schnell von Eduard Strauss, die den Auftakt zum zweiten Teil bildete, hatte August einen besonderen Bezug. Es war ihm gelungen, in einem Archiv eine bisher unbekannte Orchestrierung zu finden, die er den Philharmonikern zur Verfügung gestellt hatte. Im Programmheft wurde deshalb sein Name erwähnt.
Drei Reihen vor ihm drehte sich die Böhm zu ihm um und hob fragend die Augenbrauen. Er tat, als bemerke er sie nicht.
Die Polka Schnell machte der Tempoangabe alle Ehre. Die Geigenbogen sausten nur so auf und nieder. Die Musik wurde von der wunderbaren Akustik des Baus bis in die hinterste Reihe und hinauf zur Galerie getragen.
August hatte sich sehr auf diesen Tag und auf die Aufführung des Werkes gefreut, zu dessen originalem Klang er beigetragen hatte. Nun aber hörte er nicht einmal richtig hin. Seine Gedanken waren bei Helen. Wohin war sie bloß verschwunden?
Ihr Leben.
Musik.
Dieser Ort.
Dieser Tag.
Dieses Konzert.
Alles, wovon sie so lange geträumt hatte.
Ihr Leben.
Ihre Musik.
Ihre Komposition des Todes.
Sie hatte jahrelang die Töne in ihrem Kopf gehört und zu einem Musikstück zusammengefügt. Die ganze Welt hätte es hören sollen.
Das Streichen der Geigen wäre zu einem kläglichen Wimmern geworden, die spitzen Schreie der Klarinetten und die letzten Laute der Blechbläser zu einem armseligen Rülpsen.
Das Werk war in ihren Tagträumen nicht nur erklungen, sie hatte auch die Bilder vor sich gesehen, die an Millionen Menschen in der ganzen Welt hätten übertragen werden sollen.
Ein Strauss-Konzert, das in die Geschichte eingegangen wäre.
Das letzte Strauss-Konzert. Seine Melodien hätten fortan den Hauch des Grauens und des Todes in sich getragen.
Johann Strauss.
Der verehrte Walzerkönig.
Das goldene Denkmal im Wiener Stadtpark.
Der Mann im Frack mit der Geige am Kinn.
Sie lag zusammengekrümmt wie ein Embryo im Dunkel. Die wenige Kraft, die ihr noch blieb, wandte sie auf, um sich gegen die engen Wände zu stemmen, die sie umgaben.
Noch heftigere Schmerzen waren die Folge. Sie bekam keine Luft mehr, konnte nur noch japsen.
Würde sie ersticken?
Das Schicksal hatte sich wieder einmal gegen sie gewandt, wie so oft in ihrem Leben.
Die Musik klang weit entfernt, dabei befand sie sich unweit des Saals. Die Polka Schnell war der Auftakt. Sie wusste es. Sie war bei den Proben dabei gewesen und hatte verfolgt, wie der Dirigent mit den Musikern Feinheiten herausarbeitete.
Wieder wurde sie von einem Husten geschüttelt.
Sie würde sterben.
Ihre Gedanken begannen zu wandern, mehr als 150 Jahre in die Vergangenheit.
Applaus ertönte.
Tränen rannen ihr über die Wangen.
Mitgefühl überwältigte sie für ein Leben, das so lange zurücklag und doch mit ihr eng verbunden war. Sie sank immer tiefer in sich zusammen. Sie fühlte den Samt, mit dem die Wände ausgekleidet waren. Weil es den Schmerz ein wenig erträglicher machte, lehnte sie sich zur Seite.
Alles kippte. Mit einem Knall zerbrach die Welt rund um sie.
1878
April
Elf tiefe Glockenschläge und ein hoher erklangen von der Pfarrkirche Hietzing, als Johann Strauss das Casino Dommayer verließ. Obwohl nur ein kurzer Heimweg vor ihm lag, rückte er seinen Seidenschal zurecht und schloss den obersten Knopf seines dicken Mantels.
Die Frühlingsluft dieser Nacht war eisig und er konnte sich keine Erkältung leisten. Die Woche hatte gerade erst begonnen und er musste jeden Tag nutzen, um an seiner neuen Operette weiterzuarbeiten. Blinde Kuh hieß das Libretto. Die Arbeit ging ihm nicht leicht von der Hand.
Hinter ihm wurde die Tür des Tanzlokals geöffnet. Die Musik der kleinen Kapelle, die an diesem Abend die Gäste unterhielt, drang in die Nacht hinaus, vermischt mit einem hohen, lauten Lachen. Strauss wusste, so lachte nur die exaltierte Freundin Vroni der jungen Gräfin von Staning, mit der er den Abend verbracht hatte.
Was für eine charmante Person, die junge Gräfin. Violetta war ihr klangvoller Name. Strauss hatte zuerst nicht verstanden, wieso sich eine so feine Frau, für die er seit einigen Monaten zudem amouröse Gefühle hegte, mit einer so derben Freundin wie dieser Vroni abgab. Violetta hatte ihm verraten, Vroni sei eine Anstandsdame, auf die ihre Eltern bestanden.
Der Nachgeschmack des Champagners lag Johann noch auf der Zunge. Seine Vorfreude auf das heimliche Treffen mit Violetta am übernächsten Tag jagte ein feines Kribbeln durch seinen ganzen Körper.
Violetta hatte seine Einladung zu einem Ausflug nach Baden angenommen, wo er gern in ein Gasthaus mit verschwiegenem Hinterzimmer einkehrte. Es war nicht der erste Besuch der beiden dort. Johann wählte das Gasthaus gern, da Jetty so nichts von seinen Abenteuern erfahren würde.
»Herr Strauss?«
Johann drehte sich um und blickte in ein blasses Gesicht, dessen unteres Drittel von einem dunklen Vollbart verdeckt war. Die Spitzen des Oberlippenbartes hingen links und rechts vom Mund tief herab, was dem Mann eine Traurigkeit verlieh, die ihn nie zu verlassen schien.
»Genée, Sie hier? Ich habe Sie drinnen gar nicht gesehen.«
Richard Genée strich sich nervös mit der flachen Hand über die Haare, die er gescheitelt und quer über den Kopf frisiert hatte. Strauss vermutete darunter eine Glatze.
»Herr Strauss, auf ein Wort.«
»Mein lieber Genée, ich muss heim.«
Genée trat vor ihn und verstellte ihm den Weg. Schweigend blickte er ihn an. Eine eigenartige Stille trat zwischen den beiden ein. Strauss beendete sie. »Ich muss wirklich nach Hause.«
»Ich wollte Sie vorhin nicht stören. Sie waren so sehr ins Gespräch mit der jungen Dame vertieft«, sagte Genée.
Strauss erschrak innerlich, hatte sich aber schnell wieder gefangen. »Die Nichte. Meines Anwalts«, stammelte er. »So ein Zufall, dass ich sie hier getroffen habe.«
Genée war anzusehen, dass er kein Wort glaubte. »Es ist kein Zufall, dass wir zwei uns jetzt und hier treffen.«
»Wie soll ich das verstehen?« Strauss fröstelte. Die Kälte kroch unerbittlich durch den Stoff des Mantels.
»Wollen wir noch auf ein Glas hineingehen?«, fragte Genée.
»Wie oft noch: Ich muss nach Hause.« Strauss wurde langsam wütend. »So sagen Sie schon, was Ihnen am Herzen liegt. Haben Sie vielleicht ein neues Libretto für mich?«
Genée schüttelte den Kopf und atmete tief durch, bevor er seine Frage stellte. »Herr Strauss, stimmt es, was man sagt? Die Fledermaus wird sogar in Australien gespielt?«
Der Stolz, der sich in den vergangenen Jahren in ihm gesammelt hatte, brach aus dem Komponisten heraus. »So ist es, mein lieber Genée. Ich habe es neulich von meinem Verleger erfahren. Er kann die vielen Aufführungsorte gar nicht mehr auswendig aufzählen. Es ist eine Liste, die immer länger und länger wird. In London und Paris und in fast jeder Stadt in Deutschland, die ein Theater hat, wird die Fledermaus aufgeführt. Sie können sich freuen, Genée.«
Der Mann, der etwas kleiner war als Strauss, blickte zu Boden und zeichnete mit der Schuhspitze Kreise.
Nach einer weiteren kurzen Pause schaffte er es, den Kopf zu heben. Seine Augen funkelten.
»Wissen Sie, dass nur Sie Tantiemen erhalten, Herr Strauss? Nur Sie profitieren vom Erfolg unserer Operette.«
Strauss sah ihn irritiert an. »Von Ihnen stammt doch das Libretto.«
»Sie erinnern sich an unsere Zusammenarbeit. Sie wissen, wie viel Arbeit ich in jedes Lied gesteckt habe. Nicht nur in die Worte, auch in die Musik, die Sie haben wollten.«
»Die Worte sind die Ihren. Die Musik ist die meine«, verbesserte ihn Strauss mit strengem Unterton.
»Ich bin damals im kontraktlichen Verhältnis zum Direktor des Theaters an der Wien gestanden, Maximilian Steiner«, fuhr Genée fort. »Und ich hatte als Kapellmeister jede Bearbeitung, die mir von der Direktion übertragen wurde, gegen ein fixes Honorar von hundert Gulden pro Akt auszuführen. Somit erhielt ich für das Libretto der Fledermaus ein für alle Mal dreihundert Gulden. Seit vier Jahren sehe ich zu, wie die Operette landauf und landab gespielt wird und ich habe nichts davon.« Genée klang verbittert.
»Mein lieber Freund, das müssen Sie sich mit dem Steiner ausmachen.« Es war Strauss anzusehen, wie unangenehm ihm die Situation war. »Aber bitte lassen Sie mich jetzt gehen. Die Kälte ist meiner Gesundheit nicht zuträglich.«
»Können Sie oder die werte Gemahlin nicht bei Steiner ein Wort einlegen?«, sagte Genée. Er packte Strauss am Ärmel seines Mantels, als dieser an ihm vorbeieilen wollte. Im nächsten Moment schien er es zu bereuen, denn Genée ließ ihn los und trat einen Schritt zurück. »Die Frau Gemahlin hat doch so ein gutes Einverständnis mit ihm. Sie wird mein Anliegen sicherlich verstehen. Vielleicht könnte ich bei ihr vorsprechen?«
»Ich werde es ihr bei Gelegenheit sagen«, versprach Strauss. Er lüftete grüßend den Hut und ging an dem Librettisten vorbei.
»Sie müssen sich nicht sorgen«, rief ihm Genée nach. »Ich werde nichts davon erwähnen, was man sich in Wien hinter vorgehaltener Hand erzählt.«
Abrupt blieb Strauss stehen und wandte sich Genée zu. »Was wollen Sie damit andeuten?«
Wortlos zeigte Genée mit der Hand zurück zum Eingang des Casinos Dommayer. »Ich bin sicher, es ist um Ihre Ehe besser bestellt, als so mancher vermutet.«
Ein Hauch von Feindseligkeit schlich sich zwischen die beiden Männer. Strauss zwang sich zu einem kleinen Lächeln und betonter Freundlichkeit in der Stimme.
»Mein lieber Genée, gleich morgen werde ich meiner Frau von unserer Begegnung berichten. So lange kann es doch noch warten. Oder wollen Sie, dass ich sie dafür vielleicht aufwecke?«
»Nein, nein.« Genée nickte einen kurzen Gruß, drehte sich um und verschwand in der Nacht.
Mit energischem Gang legte Strauss das letzte Stück des Weges zum Haus zurück, das er mit Jetty bewohnte. Hinter den Fenstern des Salons brannte kein Licht, also war seine Frau schon zu Bett gegangen.
Als er sich dem dunkelgrün gestrichenen Haustor näherte, wurde es von innen geöffnet. Sein Hausdiener Max musste auf ihn gewartet haben. Mit einer Petroleumlampe in der Hand stand er im Eingang und neigte den Kopf.
»Guten Abend, Max«, grüßte Strauss und reichte ihm seinen Hut. Max half ihm aus dem Mantel und begleitete ihn zum Aufgang in das Obergeschoß.
»Die gnädige Frau hat sich heute früh zurückgezogen. Sie hat über eine leichte Übelkeit geklagt.«
»Das Essen bekommt ihr in letzter Zeit nicht gut«, meinte Strauss. Er nahm die Petroleumlampe und stieg ächzend die Stufen hinauf.
Die Dielen des Holzbodens im ersten Stock knarrten unter seinen Schuhen. Bevor er in sein Nachthemd schlüpfte, wollte Strauss nach Jetty sehen. Mit Vorsicht öffnete er die Tür des Schlafzimmers und trat ein.
Das breite Bett aus Eichenholz stand rechts an der Wand. Strauss hob die Petroleumlampe und leuchtete über das Fußteil.
Unter der Decke zeichnete sich die füllige Gestalt seiner Frau ab. Jetty hatte den Kopf zur Seite gedreht. Sie lag regungslos da. Eine hohe Falte der Decke verbarg ihr Gesicht.
Etwas kam Strauss anders vor als sonst. Im Schlafzimmer herrschte eine unheimliche Stille.
Sein Herz begann zu hämmern. Er eilte zur anderen Seite des Bettes, wo er normalerweise schlief, drückte den Stoff der Decke nieder und beugte sich über Jettys Gesicht. Das Licht der Petroleumlampe tanzte über ihren Mund und die offenen Augen. Ihr Blick war starr.
»Jetty!« Strauss klopfte auf die Matratze.
Aus dem halb offenen Mund von Jetty troff Speichel.
Auf allen vieren kroch Strauss über das breite Bett zu ihr und fasste sie an der Schulter. Er schüttelte sie. Sie reagierte nicht. Strauss griff nach ihrem Handgelenk. Es fühlte sich kühl an. Als er den Arm leicht anhob und wieder ausließ, fiel er schlaff zurück.
Panisch sprang Strauss aus dem Bett.
Hals über Kopf stürzte Strauss auf den Flur hinaus. Er lief die Treppe hinunter in die Halle, die Petroleumlampe noch immer in der Hand. Sein Mantel und sein Hut hingen auf einem Kleiderständer nahe der Tür. Strauss riss beides an sich und fand sich kurz darauf auf der Straße wieder.
Der trübe Schein der Gaslaternen zeigte ihm den Weg zur Kirche. Sein Gang war steif, seine Beine bewegten sich wie von allein. Beim Vordach am Eingang des Casinos Dommayer wartete wie üblich ein Fiaker auf Gäste, die zurück nach Wien fahren wollten.
Torkelnd lief Strauss auf das Gebäude zu, das im selben Gelb verputzt war wie das nahe Schloss Schönbrunn.
Ein Pferd wieherte. Strauss riss die straßenseitige Tür der gedeckten Kutsche auf.
»Öh ha, der Herr«, rief der rotwangige Kutscher von seinem hohen Sitz.
»Zum Hirschenhaus, fahren Sie mich zum Hirschenhaus!«, rief ihm Strauss zu.
»Kenn i net.«
»Zum Goldenen Hirschen, in die Leopoldstadt.«
»Wos? Des ist doch des Haus, wo die Familie Strauss wohnt?« Der Kutscher kratzte sich am Kopf. »Was wollen’S dort?«
»Sie sollen fahren!«
»Erst sagen’S mir den Grund. Sind so viele Bsoffene hier in der Nacht.«
Strauss riss die Arme in die Höhe. »In Gottes Namen, fahren Sie mich in mein Elternhaus!«
»Jössas, der Herr Schani … der Herr Strauss.« Vor Schreck über die unerwartete Begegnung gab der Kutscher den Pferden das Zeichen, loszugehen. Im letzten Moment fiel ihm ein, dass sein Fahrgast noch gar nicht eingestiegen war, doch Strauss war bereits mit einem Sprung in die Kutsche gehechtet.
Die nächste Stunde hörte Strauss nur das Klappern der Hufe. Der Frost des Winters hatte tiefe Schlaglöcher in den Straßen hinterlassen. Der Komponist wurde in der Kutsche heftig durchgerüttelt, fühlte aber nichts. Die Zeit war für ihn stehen geblieben.
Tot.
Tot.
Tot.
Das Wort spukte durch seinen Kopf und ließ sich nicht verscheuchen.
Jettys Gesicht.
Sie hatte in den vergangenen Jahren an Leibesumfang zugenommen und war aufgedunsen. Sie hatte versucht, ihre Haut mit viel Schminke frisch wirken zu lassen, was aber nicht geglückt war.
Nun waren die Wangen eingefallen, die Haut weiß.
Tot.
Sie war …
Strauss versuchte das Wort aus seinem Kopf zu verdrängen, aber es schien nur noch lauter zu werden und alle anderen Gedanken zu übertönen. Vor dem langgestreckten dreistöckigen Eckhaus, in dem er aufgewachsen war, brannten Gaslaternen. In seiner Kindheit hatte es sie noch nicht gegeben, da hatte die Nacht schwarz gegen die Fenster gedrückt. Das einzige Licht auf der Straße war die Laterne des Nachtwächters gewesen, der alle paar Stunden seine Runde ging. Die Glocke der Karmeliterkirche schlug halb zwei.
Strauss kramte beim Aussteigen ein paar Münzen aus der Manteltasche und drückte sie dem Kutscher, der ihm die Tür aufhielt, in die Hand. Er hatte Mühe zu atmen, weil sich seine Brust wie von einem unsichtbaren Panzer eingeengt anfühlte. Strauss taumelte und musste sich an der Kutsche abstützen.
»Herr Strauss, ist Ihnen nicht wohl?«, erkundigte sich der Kutscher besorgt.
»Geht schon.« Um keine weiteren Fragen gestellt zu bekommen, stürzte Strauss auf das Haustor zu und stemmte sich dagegen. Es war nicht abgesperrt und ließ sich leicht öffnen.
Im Hirschenhaus befanden sich zahlreiche Wohnungen, von denen drei von seinem Bruder Eduard benutzt wurden: In zweien wohnte er mit seiner Frau und den beiden Söhnen, in der dritten komponierte und probte er mit den Musikern, wie einst ihr Vater.
Erinnerungen hagelten auf Johann nieder, als er die Steintreppe hochstieg.
Tot.
Auch hier schwebte in der Luft ein Todeshauch, der Strauss den Atem raubte.
Die Mutter war in diesem Haus vor acht Jahren gestorben. Die Mutter, die ihrem Schani die Geigenstunden bezahlt hatte, weil der Vater vom Talent seines ältesten Sohnes nichts wissen wollte. Der mittlere Bruder Josef war bei ihr gewesen, nicht ahnend, dass ihn schon bald dasselbe Schicksal ereilen sollte. Johann klopfte an die Tür seines Bruders Eduard. Als niemand öffnete, klopfte er stärker. Um diese Zeit schliefen längst alle. Schließlich schlug Strauss mit der Faust gegen das Holz.
»Wer da?«, fragte jemand von drinnen. An der Stimme erkannte er seine Schwägerin Maria.
»Ich bin’s, der Schani. Mach auf, mach auf.«
Der Schlüssel wurde im Schloss gedreht. Maria, mit Nachthaube und in einem bodenlangen weißen Leinennachthemd, hielt ihm eine Kerze vors Gesicht.
»Schani, was willst du hier? Um diese Zeit?«
Hinter ihr tauchte Eduard auf, ebenfalls mit einer Kerze in der Hand. Um seine sorgfältig frisierten Haare und den Mittelscheitel in Form zu halten, trug er beim Schlafen ein Netz. Sein gezwirbelter Oberlippenbart wurde mithilfe einer Bartbinde in einen ordentlichen Zustand gepresst.
»Schani? Ist was geschehen?«, wollte er wissen.
»Edi … die Jetty … sie rührt sich nicht mehr.«
»Was redest du da? Ich habe sie doch vorgestern erst im Musikverein getroffen.«
»Komm herein, Schani. Komm.« Weil er sich nicht bewegte, zog ihn Maria am Mantelärmel in die Wohnung. Johann versagte die Stimme. Nur flüsternd konnte er berichten, was er bei seiner Heimkehr in Hietzing vorgefunden hatte. Das Hausmädchen wurde geweckt und angewiesen, im Esszimmer Licht zu machen und Milch zu wärmen. Maria hatte entschieden, dass Johann Milch mit Honig brauchte. Eduard führte seinen Bruder in das Zimmer mit dem ovalen Holztisch, an dem acht Leute Platz hatten. Kraftlos ließ sich Johann auf einen Sessel sinken.
»Schani, hast du den Arzt rufen lassen?«, wollte Eduard wissen. Weil die Bartbinde ihn beim Sprechen hinderte, nahm er sie ab. Stumm schüttelte Johann den Kopf.
»Sie ist vielleicht nur bewusstlos«, versuchte Eduard schwach, seinen Bruder zu beruhigen.
»Ihr müsst nach Hietzing, auf der Stelle«, sagte Maria.
»Nein.« Nach seinem aufgeregten Gestammel brachte Johann diese Worte ruhig und bestimmt hervor. »Ich geh dort nicht rein. Nie wieder.«
»Schani, was redest du da?« Eduard blickte seinen Bruder an, als wäre er verrückt geworden. Vielleicht stand er unter Schock?
»Ich geh nie wieder ins Haus nach Hietzing«, wiederholte Johann.
Eduard hatte Mühe, den Zorn zu unterdrücken, den er für seinen älteren Bruder empfand. Als er die Wohnung betrat und ihn im Wohnzimmer antraf, hätte er ihn am liebsten angeschrien.
Johann stand am Fenster und blickte auf das rege Leben der Straße hinab.
»Wie kannst du nur …«, begann Eduard.
Ohne sich umzudrehen, fragte Johann: »Waren viele Menschen?«
»Man hat nicht verstanden, wieso du dem Begräbnis deiner eigenen Frau fernbleibst.«
»Du hast sicher einen guten Grund genannt.«
Eduard atmete tief ein und kam auf seinen Bruder zu.
»Ich habe gelogen, sagte, du stündest noch unter Schock.« Bissig fügte er hinzu: »Kein Doktor hat damit gerechnet, dass Jettys Herz so plötzlich versagt und dass sie stirbt, während du dich im Dommayer vergnügst.«
Empört wandte sich Johann um. »Ich brauch keine Vorwürfe von dir. Es ist so schon alles schlimm genug.«
»Unsere Mutter hast du auf ihrem letzten Weg nicht begleitet, unseren Bruder auch nicht. Und jetzt hast du mich wieder alles machen lassen. Ich hab die Jetty aus dem Haus holen lassen müssen. Ich hab das Begräbnis ausmachen müssen. Und heute bin ich hinter dem Sarg gegangen. Mit der Maria. Und wo warst du? Ihr Ehemann?« Mit jedem Satz war Eduard lauter geworden, bis er schließlich fast brüllte.
»Du weißt, ich vertrag das nicht. Ich kann das nicht.« Johann seufzte. »Und jetzt hör auf, darüber zu reden.«
»Schani, hast du kein Herz?«
Statt einer Antwort wandte sich der Komponist wieder dem Fenster zu. »Hast du mir Gewand gebracht? Ich brauche Hemden und einen frischen Anzug.«
»Geh doch nach Hause!«, schrie Eduard. »Dort findest du alles. Geh endlich wieder heim!«
Sein Bruder antwortete nüchtern: »Ich geh nie wieder in das Haus. Schau, dass es verkauft wird.«
»Schau doch selbst«, giftete ihn Eduard an. »Und schau, wo du wohnen wirst. Hier jedenfalls nicht mehr länger.«
Johann sah ihn mit steinerner Miene an. »Was bist du für ein Bruder?«
»Was bist du für ein Mensch?«, gab Eduard zurück.
Wortlos verließ Johann den Salon. Das Abendessen, gekochtes Rindfleisch mit Semmelkren, ließ er sich in sein Zimmer bringen. Maria und Eduard saßen allein am Esstisch. Ihre Söhne hatten schon früher gegessen und mussten noch für den nächsten Schultag lernen.
Stumm löffelte das Ehepaar Strauss die Rindsuppe mit Grießnockerln. Eduard war bedacht, seinen Bart nicht zu benetzen. Vorsichtig tupfte er ihn immer wieder mit der weißen Stoffserviette ab und prüfte mit den Fingern, ob die Spitzen noch aufgedreht waren und zusammenklebten.
»Dein Konzert … dein nächstes?«, begann seine Frau.
»Am Samstag. Im Sperl. Die Karten sind alle verkauft. Ich kann nicht absagen.«
»Die Wiener wollen tanzen«, sagte Maria bitter. »Auch wenn es grad eine schöne Leich gegeben hat.«
Eduard quälten Zweifel. »Wir haben ihr doch alle Ehre erwiesen, der Jetty?«
»Mehr hättest du nicht tun können. Das haben auch die Trauergäste zu mir gesagt.«
»Was wird der Schani ohne die Jetty machen? Sie war doch alles für ihn.«
»Er wird lernen müssen, sich ohne sie zurechtzufinden«, antwortete Maria kalt. »Du hast schon genug mit dem Orchester zu tun. Also komm nicht auf die Idee, dass du ihm helfen musst.«
Eduard seufzte. Johann Strauss, der Walzerkönig, von der halben Welt bewundert und verehrt. Was würden die begeisterten Menschen wohl denken, wenn sie Schani so kennen würden, wie Eduard ihn kannte?
»Es war wirklich tout Vienne heute beim Begräbnis«, hörte er seine Frau sagen. Sie zählte auf, an wen sie sich aller erinnern konnte. »Graf und Gräfin Staning haben mir auch kondoliert. Ihre Tochter hat nach dem Schani gefragt und wieso er nicht hier sei.«
»Eine Frage, die sich bestimmt viele gestellt haben«, bemerkte Eduard mit Bitterkeit.
»Die junge Gräfin benahm sich seltsam.« Maria Strauss tupfte sich den Mund mit der Serviette ab. »Ihre Eltern waren schon weitergegangen, sie aber hat sich nicht vom Fleck bewegt. Ist vor mir gestanden und hat noch ein zweites Mal nach dem Schani gefragt. Ich solle ihm sagen, dass sie dagewesen sei.«
»Beim Begräbnis?«
»Das muss sie doch gemeint haben, oder?« Maria runzelte die Stirn.
»Die junge Gräfin Staning? Und der Schani?« Eduard seufzte erneut. »Was die Jetty wohl von seinen Gspusis gewusst hatte?«
Schweigend saß das Ehepaar eine Weile da und hing seinen Gedanken nach.
»Hast du den jungen Mann gesehen?«, fragte Eduard nach einer Weile. »Mit so einer kleinen runden Brille und einem speckigen Mantel. Sein Gesicht hat nicht besonders gesund ausgesehen.«
»Er hat kondoliert«, erinnerte sich Maria. »Auch er hat gefragt, wo sich Johann aufhält.«
Eduard zwirbelte die rechte Spitze seines Bartes mit den Fingern. »Er hat auch mir kondoliert. Er hat allerdings einen sehr verwirrten Eindruck gemacht.«
»Was meinst du mit verwirrt?«, fragte Maria.
Das Hausmädchen trat ein und servierte die Suppentassen ab. Erst nachdem sie das Zimmer verlassen hatte, redete Eduard weiter. »Er hat was von ›Mutter‹ gesagt und ›Erbe‹.«
»Mutter?«, fragte Maria zweifelnd.
Die Worte einmal laut ausgesprochen, traf Eduar die Erkenntnis wie ein Schlag. Er sprang auf und lief aus dem Wohnzimmer.
»Was ist denn, Edi?«, rief Maria ihm hinterher.
Ohne Erklärung eilte Eduard in seine andere Wohnung, die er einen Stock höher zum Arbeiten benutzte. Auf seinem Schreibtisch türmte sich Notenpapier. Ausgebreitet lagen mehrere Seiten einer neuen Komposition, einer Polka Schnell für ein Konzert im nächsten Monat.
In einer Seitenlade hatte Eduard allerhand Papiere von Jetty verstaut, die er aus Hietzing mitgebracht hatte. Obenauf lag ein zerdrücktes Briefkuvert. Es sah aus, als hätte es jemand ein wenig zu fest in der Hand gehalten. Edi strich es auf der Lederunterlage des Schreibtisches glatt.
Er blickte auf den Umschlag. Adressiert war er an Jetty Strauss, Hetzendorfer Straße, Hietzing. Eduard hatte das Kuvert neben Jettys Bett vor dem Nachttisch auf dem Boden gefunden, es nur kurz angesehen und dann zu den anderen Unterlagen gelegt. Eigentlich wäre es die Aufgabe seines Bruders gewesen, diese Papiere zu ordnen. Aber da Johann mit alldem nichts zu tun haben wollte, hatte es Eduard aufbewahrt und über die Vorbereitung des Begräbnisses vergessen. Behutsam zog er einen Brief heraus.
Die Schrift war wackelig, die Tinte schwarz.
Wusste Schani davon? Hatte er den Brief gesehen?
Der Brief war am 8. April verfasst und vermutlich auch zugestellt worden. Es war Jettys Todestag.
2024
21. NovemberDonnerstag
Es war einer dieser Novembertage, die im Wetterbericht als viel zu warm für die Jahreszeit bezeichnet wurden. Am Ende der Auhofstraße in Hietzing gab es sogar einen Kastanienbaum, der noch einmal zu blühen begonnen hatte. Selbst die Bäume waren von der Klimaveränderung verwirrt.
Allegria parkte ihre Vespa in der Kurzparkzone vor dem Café Dommayer, zog ihren Helm vom Kopf und befestigte ihn mit einer speziellen Schließvorrichtung am Sattel.
Sie schwitzte unter ihrer Lederjacke. Nachdem sie das Kaffeehaus betreten hatte, führte ihr erster Weg zur Toilette, um sich ein bisschen frisch zu machen. Nana hielt viel von »gepflegtem Auftreten« und sie wollte sie nicht gleich beim Begrüßen verärgern.
Aus dem Spiegel über dem Waschbecken blickte ihr ein müdes Gesicht entgegen. Das Piercing im Nasenflügel und die drei Ringe im linken Ohr glänzten im Licht der Lampe. Allegrias pechschwarz gefärbtes, kurzes Haar klebte feucht am Kopf. Mit ein wenig Wasser versuchte sie es zu einer Frisur zu bändigen.
Sie zog ein paar Papiertücher aus dem Spender, machte sie nass und wusch sich hastig unter den Achseln und im Nacken. Nana reagierte allergisch auf Körpergeruch.
Als sie mit dem Ergebnis ihrer notdürftigen Körperpflege zufrieden war, zupfte sie T-Shirt und Jacke zurecht, streifte die engen Hosenbeine ihrer Jeans hinunter und schnitt sich eine Grimasse im Spiegel.
In diesem Moment ging hinter ihr die Tür auf und eine Dame in Kaschmirpulli und mit dicker Perlenkette um den Hals trat ein. Als sie Allegrias Grimasse sah, wich sie zurück, als könnte das Gesicht aus dem Spiegel springen.
Allegria lächelte und wünschte der Dame beim Umdrehen eine »angenehme Verrichtung«.
»Frechheit«, hörte sie, als sie die Toilette verließ.
Nana saß wie immer in der letzten Fensterloge an ihrem Stammplatz. Die zarte Frau war über ein Kreuzworträtsel in der Zeitung gebeugt, das als das Schwierigste im deutschen Sprachraum galt. Zum Lesen verwendete sie eine Lupe, die sie über die Hinweise schwenkte, die neben dem Rätsel standen.
»Hallo, Nana!«
Die alte Frau hob den Kopf. Sie trug einen türkisen Topfhut einer noblen Luxusmarke und hatte sich, wie jeden Tag, sorgfältig geschminkt. Die Farbe des Lippenstifts nicht zu grell, Lidschatten und Lidstrich dezent. »Was haben eine Liebschaft und ein Land gemeinsam?«
»Wie viele Buchstaben?«
»Sieben.«
»Lass mich nachdenken.«
»Herr Ludwig!« Nana winkte einen stämmigen Kellner herbei, der gerade ein Tablett voll schmutziger Tassen und Teller fortbringen wollte. Gehorsam machte er kehrt und trat an den schmalen Tisch.
»Ja, bitte, Frau Direktor.«
»Direktorin. Nicht Direktor«, verbesserte sie ihn sogleich. »Für mich noch einen doppelten Espresso. Für meine Urenkelin?« Sie machte eine fragende Geste in Allegrias Richtung.
»Für mich frischen Pfefferminztee und eine Apfel-Mohn-Torte, bitte.«
»Wir haben nur Beuteltee«, leierte der Kellner. Allegria wusste das, hatte aber ihren Spaß daran, ihn immer wieder zu reizen und sein typisch wienerisches Granteln zu beobachten.
»Keine frischen Minzblätter? Nur Getrocknete? Nein, dann einen Latte.«
»Wir haben nur Melange.«
Auch das wusste Allegria, aber sie liebte die Abscheu im Gesicht des Kellners, wenn er das Wort »Latte« hörte.
»Dann doch nur einen kleinen Espresso und ein großes Glas Leitungswasser.«
Wortlos verschwand der Kellner Richtung Küche.
»Du wirst ihm noch ein Magengeschwür bescheren mit deinen Bosheiten«, warf ihr die Urgroßmutter vor.
»Ach, das hält er schon aus. Übrigens Grüße von Mama.«
»Von wo?«
»Noch immer Jamaika.«
»Schön.«
»Und Großmutter geht wieder ohne Krücken.«
»Freut mich.«
»Nana, bitte.«
»Was?« Die Urgroßmutter betrachtete wieder das Kreuzworträtsel durch die Lupe. »Ich habe ›schön‹ und ›freut mich‹ gesagt. Was willst du von mir? Soll ich auf dem Tisch tanzen?«
»Sonst alles gut bei dir?«, erkundigte sich Allegria.
»Fit wie ein Turnschuh, das kannst du allen sagen, die auf die Erbschaft warten. Ich arbeite jeden Tag bis in die Nacht, aber das kümmert ja niemanden.«
»Nana, du hast Mama und Oma aus der Firma geworfen«, sagte Allegria sanft. »Sie wollten gern übernehmen.«
»Der Betrieb wäre bankrott, wenn ich die beiden rangelassen hätte.«
Es war zwecklos, über dieses Thema zu reden.
Ohne aufzublicken, stellte die Urgroßmutter die nächste Frage. »Und du? Hast du wenigstens einen Skandal aufgedeckt? Davon gibt’s ja derzeit mehr als genug.«
»Ich bin nicht im Polit-Ressort, das weißt du. Ich darf nur Lokales schreiben.«
»Und da gibt es keine Skandale?«
»Grausamkeiten jede Menge. Morde, Diebstahl, Streit. Alles widerlich.« Allegria seufzte. »Dafür bin ich nicht Journalistin geworden.«
»Häng den Beruf an den Nagel. Zeitungen lesen nur Dinosaurier wie ich.«
»Gedruckte vielleicht. Online wird aber viel geteilt.«
»Ach was. Komm zu mir in die Firma. Dir traue ich zu, dass du einen guten Job machst.«
»Nana, danke.« Allegria winkte ab. »Aber ich kann das Zeug nicht einmal riechen.«
»Brauchst du auch nicht. Du musst es nur erzeugen und verkaufen.«
»Können wir das Thema beenden?«
Der Kellner kehrte zurück.
»Ein großer Schwarzer, ein kleiner Schwarzer und eine Mohn-Apfel-Torte«, verkündete er beim Abstellen.
»Und ein Glas Leitungswasser«, erinnerte ihn Allegria mit freundlichem Lächeln.
Mit gerümpfter Nase zog der Kellner ab.
»Will immer sein Mineralwasser verkaufen«, schimpfte ihre Urgroßmutter. »Dabei braucht das keiner in Wien. Unser Hochquellwasser ist besser.«
»Dein wievielter Kaffee ist das heute?«
»Ich zähle nur Geld«, bekam Allegria als Antwort.
Es war sinnlos, mit ihrer Urgroßmutter über die Gesundheit zu reden. Sie war der Meinung, dass ein Schnapsglas des Magenbitters, den ihr Vater vor 98 Jahren erfunden hatte, gegen alle Krankheiten half. Da sie am 6. Januar ihren 93. Geburtstag feierte und der Ururgroßvater knapp über hundert geworden war, schien sie recht zu haben.
Jede Woche freute sich Allegria auf das Treffen mit ihrer Urgroßmutter. Es war ein Fixpunkt in ihrem Leben und davon gab es nicht viele. Nana war eine der wenigen Frauen, die aufmerksam zuhörten. Als Teenager hatte Allegria gegen ihre Urgroßmutter mehr rebelliert als gegen ihre Mutter. Aber selbst ein Zungenpiercing konnte Nana nicht aus der Ruhe bringen.
Allegria erzählte von den wenig spektakulären Ereignissen ihrer vergangenen Woche, von ihrer Wut auf Fabrizio, der sie ghostete, und ihren Kochversuchen mit einer Heißluftfritteuse, die im üblichen Desaster geendet hatten.
Die Urgroßmutter, die auch im Café ihren Mantel nie ablegte, saß schweigend da und lächelte. Als Allegria ihren Bericht schließlich beendet hatte und die Torte zu essen begann, bekam sie mehrere Kommentare von ihrer Urgroßmutter, die sie den Themen zuordnen musste.
»Du fandest diesen Fabrizio doch recht nett. Fett ist ein Killer, genau wie Zucker. Fisch nicht im falschen Teich. Mach mehr Kniebeugen in der Früh.«
Allegria nickte grinsend.
»Danke, ich werde mich daran halten.«
»Dieser Fabrizio ist eine Enttäuschung«, meinte Nana.
»Das kannst du laut sagen.«
»Ihr habt euch doch gut verstanden.«
»Ja. Sehr gut sogar, finde ich.«
»Zeig mir noch einmal das Foto von ihm«, bat Nana.
Allegria suchte kurz am Handy. »Das ist das Einzige, das ich je von ihm gemacht habe. Er mag keine Selfies.«
»Gut aussehender Bursche.« Nana nickte. »Wäre ich ein paar Jahre jünger ...«
»Nana!« Allegria steckte das Handy wieder weg und schüttelte den Kopf. »Sollte ich so alt werden wie du, habe ich hoffentlich auch noch so viel Humor.«
»Das wirst du. Liegt in der Familie. Aber es muss doch einen Grund geben, wieso er auf einmal verschwunden ist, dein Fabrizio.« Nana schien Allegrias letzter Fang nicht aus dem Kopf zu gehen.
»Das ist das Problem beim Ghosting.«
»Ghost-was?«
»Ghosting«, wiederholte Allegria. »Wenn jemand, den du magst, auf einmal verschwindet, als wäre er ein Geist. Von einem Tag auf den anderen. Kein Anruf, keine Nachricht, nichts. Er schickt nichts, er reagiert nicht und hebt nicht ab.«
»Er hat dich doch auch gemocht. Ihr habt viel miteinander unternommen.«
Allegria stutzte. »Woher willst du wissen, dass er mich gemocht hat?«
»Muss so gewesen sein«, erwiderte Nana bloß, als wäre das eine Selbstverständlichkeit.
»Vielleicht. Aber ich bin mir nicht mal selbst sicher. Wieso dann du?«
»Lebenserfahrung.«
»Woher dein plötzliches Interesse für Fabrizio?«, bohrte Allegria nach. »Dir sind meine Freunde doch sonst nicht so wichtig.«
»Du hast mir viel von ihm erzählt«, meinte Nana bloß, ohne den Blick vom Kreuzworträtsel zu heben.
Auf irgendeine Weise erschien die Urgroßmutter Allegria eigenartig. War sie verlegen? Diesen Zustand kannte Allegria nicht von ihr. Oder wusste sie mehr, als sie sagen wollte? Doch noch ehe sie weiter darüber nachdenken konnte, riss Nanas nächste Frage sie aus ihren Gedanken.
»Willst du mit mir ins Neujahrskonzert gehen?«
»Wie bitte?«
Geduldig wiederholte die Urgroßmutter die Frage und betonte dabei jedes Wort. »Willst – du – mit – mir – ins – Neujahrskonzert – gehen?«
»Ins Neujahrskonzert? Dieses Konzert mit Walzern und so?«
»Im Musikverein. Im Goldenen Saal. Am Ersten des Neuen Jahres um elf Uhr am Vormittag.«
»Ich? Zu so etwas gehen? Wie kommst du darauf?« Allegria schien allein der Gedanke daran die Haare aufzustellen.
»Ich habe zwei Karten. Beste Kategorie. Und alle, die mich begleiten könnten, sind entweder tot, krank, langweilig oder hässlich. Vor allem zu dick. Das kann ich nicht ausstehen.«
»Wenn du es dir wünschst, dann komme ich mit. Aber was soll ich anziehen?« Allegria deutete an sich hinab. »Mein übliches Outfit wird wohl nicht reichen.«
»Anzug oder Kleid? Was ist dir lieber?«
»Anzug klingt gut.«
»Dann kaufst du dir einen. In Schwarz. Schick. Ich will stolz auf dich sein.«
»Was wirst du tragen?«
»Mein rotes Kleid. Mit den Pailletten.« Nana kicherte. »Dann zerreißen sich alle das Maul, dass man so etwas in meinem Alter nicht mehr anziehen darf.« Allein der Gedanke daran ließ die alte Dame breit und zufrieden grinsen. »Du errätst nie, von wem ich die Karten habe.«
»Von wem?«
»Von der ersten Liebe deiner Großmutter. War mit ihr in der Schule. August Schöller. Professor August Schöller. Aber der Professor ist nicht echt. Das ist so ein geschenkter Titel, wie man ihn in Österreich bekommen kann.«
»Wieso bist du mit Omas erster Liebe in Kontakt?«, fragte Allegria. »Das muss doch fünfzig Jahre her sein, wenn nicht länger.«
»Er wohnt in der Nebengasse. Ich bin ihm beim Spazierengehen begegnet. Er bekommt Karten, will aber nicht gehen.«
»Dann gehen eben wir beide«, sagte Allegria und lächelte.
»Daran hatte ich keinen Zweifel«, erwiderte ihre Urgroßmutter. »Ist übrigens ein komischer Vogel, dieser Schöller. Er hat einen Walzer oder eine Polka oder so etwas ähnliches neu entdeckt. Von Strauss.«
»Wie kann man ein Werk von Strauss ›neu‹ entdecken?«
Die Urgroßmutter zuckte mit den Achseln. »Musst du ihn fragen. Er war schon damals in der Schule ein Spinner. Keine Ahnung, was deine Großmutter an ihm fand.«
Nana faltete ihre Zeitung zusammen und ließ sie in ihrer übergroßen Schultertasche verschwinden. Es war Zeit, aufzubrechen. Nachdem die Urgroßmutter bezahlt hatte, verließ sie, auf einen Stock gestützt, der als Regenschirm getarnt war, mit Allegria das Kaffeehaus.
Ein dunkelgrüner Jaguar fuhr vor und ein Chauffeur in Jeansjacke sprang heraus. Er öffnete den hinteren Wagenschlag und wartete.
Nachdem Allegria Nana auf die Wange geküsst hatte, ließ sich die alte Dame vom Chauffeur in den Wagen helfen. Er wollte schon die Tür schließen, als Allegria etwas einfiel.
»Ich weiß es jetzt!«, rief sie.
»Wovon sprichst du?«, fragte die Urgroßmutter aus dem Halbdunkel des Wagens.
»Was ein Land und eine Liebschaft gemeinsam haben. Mit sieben Buchstaben.«
»Sag!«
»Man kann beide EROBERN.«
Die Urgroßmutter zählte mit den Fingern nach.
»Ich trag es ein und sag dir dann, ob es gestimmt hat.«
Allegria winkte, als der Jaguar abfuhr. Aus Höflichkeit gegenüber Nana hatte sie ihr Handy bei den Treffen immer auf lautlos geschaltet. Als sie es nun herauszog und einen Blick darauf warf, erschrak sie: elf verpasste Anrufe und sieben WhatsApp-Nachrichten. Die Anrufe waren alle von Fe, ihrer Kollegin bei der Zeitung, die wie Allegria probeweise für drei Monate angestellt worden war.
Die Nachrichten lauteten:
Wo bleibst du?
Die Natter fragt ständig nach dir.
Sie hat wieder keinen Sex gehabt.
Komm jetzt nicht mehr.
Ich habe gesagt, du bist wegen einer Story unterwegs.
Allegria rief Fe an.
»Ich hab dir alles geschrieben«, flüsterte sie. »Kann nicht sprechen.«
»Wo krieg ich eine Story her?«
»Du musst eine bringen.«
Danach legte Fe auf. Der Wind fegte durch die Auhofstraße und wirbelte im Rinnsal braune Kastanienblätter vor sich her. Allegria löste den Sturzhelm aus der Verankerung. Sie konnte nicht ohne Idee für einen Artikel in die Redaktion zurückkehren. Eigentlich hatte sie sich bei der Leiterin der Lokalredaktion für die Sitzung entschuldigt, bis zu ihrer Chefin war das aber nicht durchgedrungen. Ida Natter war eine verbitterte Frau, die junge Journalistinnen mit Vorliebe quälte und ihnen ihre Unfähigkeit für den Beruf vor Augen hielt. Die Worte ihrer Urgroßmutter über die Arbeit dieses Professors fielen ihr ein. Was sollte sie sich unter der »Neuentdeckung« eines Werkes von Johann Strauss vorstellen? Das Wort »neu« war allerdings immer gut, weil es das Potenzial für einen Bericht in sich trug. Am Smartphone googelte Allegria den Namen August Schöller. Es gab eine Menge Eintragungen, die meisten waren Titel von Musikstücken. An dritter Stelle stand ein Artikel, der in der Zeitung erschienen war, für die sie arbeitete. Verfasst hatte ihn Margarethe Böhm, die Kulturkritikerin. Die Schlagzeile passte irgendwie gar nicht auf die Kulturseite:
VERSCHWUNDEN AM NEUJAHRSTAG
Im Bericht ging es um eine Studentin aus London, die mit dem Professor das Neujahrskonzert besucht hatte und in der Pause verschwunden war. Einen Monat später gab es noch immer keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Professor Schöller wollte keinen Kommentar dazu abgeben.
Was sollte dieser Artikel bedeuten? Eigentlich handelte es sich nur um eine überlange Meldung, die nicht einmal mit einem Foto versehen war. Wenn sie ihr in der Redaktion begegnete, wollte Allegria Margarethe Böhm dazu befragen.
Ihr Interesse an August Schöller war jedenfalls größer geworden. Er musste in der Nähe wohnen, wenn ihm Nana beim Spazieren auf der Straße begegnet war. Allegria fand seine Homepage, auf der eine Adresse angegeben war. Wie sie schon vermutet hatte, lag sie nur ein paar Minuten mit der Vespa entfernt.
Die Adresse war eine dieser Straßen Hietzings, wo sich eine Villa an die andere reihte. Allegria parkte die Vespa neben einem der hohen Kastanienbäume, die links und rechts eine lange Allee bildeten. Hinter einem Gitterzaun erhob sich eine dreistöckige Villa, die vom Boden bis zur Dachrinne mit Efeu überwachsen war. Sie sah nach altem Geld aus. Neben dem Gartentor fand sie ein Klingelbrett aus Messing mit drei Knöpfen. PROF. AUGUST SCHÖLLER war neben dem mittleren eingraviert. Neben dem Unteren stand nichts, neben dem Oberen BÜRO.
Allegria klingelte bei Schöller. Sekunden verstrichen, wurden zu einer Minute, aber es meldete sich niemand. Sie wollte schon gehen, als es in der Gegensprechanlage knackste.
»Ja, bitte?«
Es war eine Männerstimme mit energischem Unterton.
»Ich hätte gern Professor Schöller gesprochen.«
»Sie sprechen mit ihm.«
»Allegria Boran. Ich bin die Urenkelin von Nathalie Umeg.«
»A-ha.«
»Meine Urgroßmutter hat mir von den Karten erzählt, die Sie ihr geschenkt haben. Ich werde sie begleiten. Zum Neujahrskonzert.«
»Nett, dass Sie sich bedanken kommen.«
Bedanken? Daran hatte Allegria noch gar nicht gedacht.
»Ja … danke … Ich wollte fragen, ob ich Sie kurz sprechen kann?«
»Ich bin noch im Morgenmantel und unrasiert, also nicht auf Besucherinnen vorbereitet.«
»Das macht mir gar nichts. Ich störe Sie bestimmt nur kurz. Ich interessiere mich für Ihre Arbeit …«
Schöller klang sofort freundlicher. »Wie gesagt, ich bin nicht präsentabel. Aber wenn es nur kurz ist …«
Der Türöffner summte und Allegria drückte das Gartentor auf. Das Treppenhaus war schmucklos und kahl. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend lief sie in den ersten Stock hinauf. Die Wohnungstür stand einen Spaltbreit offen. Allegria klopfte höflich.
»Kommen Sie herein. Möchten Sie Tee oder Kaffee?«
»Nur Wasser, bitte.«
Das Vorzimmer war quadratisch, die Wände bis zur Decke mit gerahmten Fotos vollgepflastert. Alle zeigten ernst blickende Männer und Frauen, manche geschminkt und in Kostümen. Auf jedem Foto prangte eine Unterschrift, auf einigen auch eine Widmung an »August« oder »Professor Schöller«.
In der Luft hing ein eigenartiger Geruch. Allegria versuchte zu erkennen, woran er sie erinnerte.
Aus einer Tür trat ein hagerer Mann in einem altmodischen roten Morgenmantel aus Seide mit einem breiten Schalkragen aus Samt. Als Gürtel diente eine dicke goldene Kordel, die Schöller fester zuzog. Prüfend betrachtete er Allegria durch die Gläser einer großen Brille, die weit vorn auf der Nase saß.
»Ich bin ein großer Bewunderer der Opernwelt«, erklärte er und deutete auf die Fotos. »Einige der größten Sängerinnen und Sänger der Welt darf ich zu meinem Freundeskreis zählen.«
Allegria wusste mit einem Mal, woran sie der Geruch erinnerte: Es war ein Rasierwasser, das ihr Großvater immer verwendet hatte. Wenn er zu viel davon nahm, hatte sie als Mädchen niesen müssen.
Schöller verschwand in der Küche und kam mit einer kleinen Karaffe Wasser und zwei Gläsern wieder.
»Ich darf vorgehen?« Er führte sie in einen Salon, der sich über die ganze Seite der Villa erstreckte. Die Fenster gingen in einen Garten hinaus, wo sich die kahlen Äste der Bäume im Wind bewegten.
Schöller deutete auf eine altmodische Sitzgruppe aus braunem Holz mit dunkelrosa Bezügen, die abgewetzt wirkten. Allegria nahm auf dem Sofa Platz und blickte von dort zur Wand, die der Fensterfront gegenüberlag. Auf einem langen Sims über dem Türrahmen standen die Büsten ernst blickender Männer. Beethoven, Schubert, Strauss, Mahler, Mozart, Schumann, Brahms und andere Namen waren in goldenen Buchstaben auf den Sockeln zu lesen.
»Meine Bewunderung und Liebe gehört seit meiner Kindheit der Musik und ihren Komponisten«, erklärte Schöller, während er die Gläser mit Wasser füllte.
Auffällig waren seine fliehende Stirn und die Art, wie er sein graues Haar straff nach hinten frisiert im Nacken zu einem kunstvollen Knoten gebunden hatte. Die Frisur konnte die Tatsache nicht verbergen, dass sein Hinterkopf recht kahl war, gab ihm aber das Aussehen eines Künstlers.
»Wie kann ich mir Ihre Art der Forschung vorstellen?«, fragte Allegria.
»Ich forsche über das Leben großer Komponisten«, erklärte Schöller. Seine Haltung zeigte Allegria, dass er gern über sich und seine Arbeit sprach. »Die Familie Strauss würde ich als mein Spezialgebiet nennen.«
»Gibt es da noch was zu erforschen? Ich meine, man kennt doch jeden Walzer.«
Schöller lachte auf. »Das mag Laien so erscheinen, doch in der Tat ist es anders. Tatsächlich gibt es noch einige weiße Flecken in den Leben von Vater Strauss und seinen drei Söhnen.«
»Vater und drei Söhne? Ich dachte, es gibt nur Johann Strauss.«
Schöller hob seinen Zeigefinger. »Es gab Johann Strauss Vater, der den Radetzkymarsch komponierte. Dann Johann Strauss Sohn, den man Walzerkönig nennt, und seine beiden jüngeren Brüder Josef und Eduard, die beide ebenfalls komponierten.«
Allegria hob staunend die Augenbrauen. »Interessant. Das war mir so nicht bewusst.«
»Meine Forschung gilt zu einem großen Teil der originalen Orchestrierung der Werke.«
»Ist es sehr ungebildet, wenn ich nicht genau weiß, was Sie damit meinen?«, fragte Allegria und versuchte dabei, so charmant wie möglich zu klingen.
Schöller lächelte nachsichtig. »Die Komposition ist eine Sache, die Aufteilung auf die verschiedenen Instrumente des Orchesters eine andere. Man nennt das die Orchestrierung. Natürlich besteht