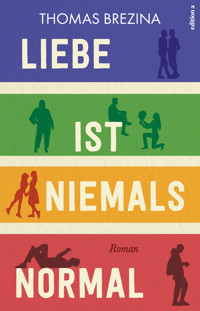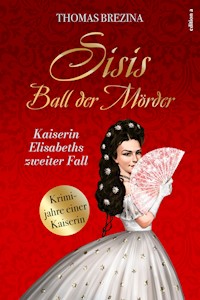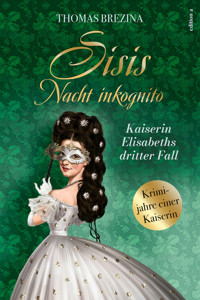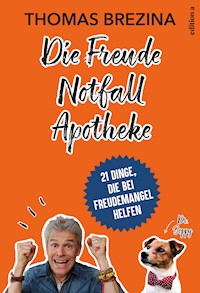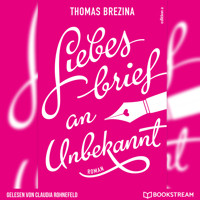Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Auf der griechischen Insel Korfu kann Sisi die kaiserlichen Pflichten vergessen und ganz sie selbst sein. Eine Frau, die als Medium mit der Totenwelt in Kontakt steht, erzählt Sisi, dass ihr Leben von dem "Gift aus Griechenland" bedroht wird. Doch kann sie der Frau vertrauen? Und was steckt hinter diesem geheimnisvollen Gift? Als ihre rebellische Schwester Marie zu Besuch kommt und einen mysteriösen britischen Gentleman kennenlernt, überschlagen sich die Ereignisse: Der Mann wird tot aufgefunden und Marie kann sich an nichts mehr erinnern. Um den Fall zu klären und ihrer Schwester zu helfen, reist Sisi mit ihrem Gatten Kaiser Franz Joseph nach London, zu einem Besuch bei Queen Victoria. In England kommt sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur … Bald schon ist klar, dass es eine ganz besondere Frau wie Sisi benötigt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Mit seiner Sisi hat Thomas Brezina eine Kult-Ermittlerin geschaffen. Der vierte Fall der Kaiserin führt ins adelige Ferienparadies Korfu und an den englischen Königshof.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SISIS GIFT AUS GRIECHENLAND
Thomas Brezina:
Sisis Gift aus Griechenland
Alle Rechte vorbehalten
© 2024 edition a, Wien
www.edition-a.at
Lektorat: Maximilian Hauptmann
Covergestaltung: Bastian Welzer
Coverillustration: Bernd Ertl
Satz: Bastian Welzer
Gesetzt in der Benne
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 27 26 25 24
ISBN 978-3-99001-749-4
eISBN 978-3-99001-750-0
THOMAS BREZINA
Sisis Gift aus Griechenland
Kaiserin Elisabeths vierter Fall
edition a
Inhalt
Donnerstag 5. September 1867
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Samstag 7. September 1867
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Sonntag 8. September 1867
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Dienstag 10. September 1867
Kapitel 18
Kapitel 19
Donnerstag 12. September 1867
Kapitel 20
Kapitel 21
Freitag 13. September 1867
Kapitel 22
Kapitel 23
Samstag 14. September 1867
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Montag 16. September 1867
Kapitel 28
Kapitel 29
Mittwoch 18. September 1867
Kapitel 30
Kapitel 31
Freitag 20. September 1867
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Samstag 21. September 1867
Kapitel 36
Kapitel 37
Dienstag 24. September 1867
Kapitel 38
Kapitel 39
Montag 30. September 1867
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Dienstag 1. Oktober 1867
Kapitel 46
Mittwoch 2. Oktober 1867
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Freitag 4. Oktober 1867
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Mittwoch 9. Oktober 1867
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Donnerstag 10. Oktober 1867
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Freitag 11. Oktober 1867
Kapitel 70
Kapitel 71
Dienstag 14. Oktober 1867
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Danksagung
Donnerstag5.September1867
1
»Wer kann hier mit den Toten sprechen?«
Mit diesen Worten begrüßte Elisabeth, Kaiserin von Österreich, ihre Hofdame Ida.
Für die Antwort auf die seltsame Frage war Ida seit den frühen Morgenstunden in der Hauptstadt Korfus unterwegs gewesen. Sie spannte ihren kleinen Sonnenschirm ab und schlüpfte unter den Sonnenschutz aus Leinen, der am Strand für die Kaiserin errichtet worden war.
»Ich glaube, ich habe gefunden, was du suchst«, sagte Ida. Sie schwitzte und war froh, durch das Stoffdach vor der Sonne geschützt zu sein. Obwohl sich der Sommer dem Ende zuneigte, hatte diese noch immer viel Kraft.
»Erzähl! Wer ist es?«
Elisabeth saß in einem breiten Holzsessel mit einer Sitzfläche aus Strohgeflecht und einer offenen Rückenlehne. Ihr Blick war auf das Meer gerichtet.
Aus dem Stoffbeutel, den Ida immer am Handgelenk baumeln hatte, holte sie ein kleines Büchlein und begann darin zu blättern. »Ich habe mir alles aufgeschrieben, was ich in Erfahrung bringen konnte, damit ich es dir wortgetreu wiedergeben kann.«
Energisch klappte Elisabeth mit einer schnellen Handbewegung ihren Fächer auf, um sich Kühlung zu verschaffen. »Es muss ein Mensch sein, der die Fähigkeit besitzt, eine Brücke zwischen dem Hier und dem Jenseits zu bauen. Die Schatten der Verstorbenen sind bereit, mit uns zu sprechen, wenn wir eine Verbindung schaffen«, sagte Elisabeth ernst.
Ida nickte und begann mit ihrem Bericht. »In der Stadt gibt es ein kleines Lokal, wo Gäste Bier, Wein und Likör trinken können. Alles zu niedrigen Preisen. Dort bin ich …«
»Komm zur Sache, Ida!«, unterbrach Elisabeth sie ungeduldig.
Die Hofdame, die sich zu den engsten Vertrauten der Kaiserin zählen durfte, war ein wenig beleidigt. »Es ist wichtig, dass ich die Reihenfolge einhalte.«
Elisabeth deutete ihr fortzufahren.
»In der Bar, die den Namen Byron trägt …«
»Byron? Wie der Lord, der große englische Dichter, der in Griechenland verstorben ist?«
»Es hängt ein Portrait eines gutaussehenden Mannes an einer Wand«, sagte Ida, die, im Gegensatz zur belesenen Elisabeth, nicht wusste, wer Lord Byron war.
»Dann ist die Bar nach ihm benannt.«
Geduldig nahm Ida den Faden wieder auf. »In dieser Bar sind Hausdiener, Zofen und andere höhere Hausangestellte der Engländer zu finden. Es ist ein Treffpunkt, wo sie ihr Heimweh stillen. Morgens wird griechischer Mokka serviert. Mit kleinen klebrigen Kuchen.«
Eine leichte Brise kam vom Meer geweht und brachte willkommene Frische.
»Ich habe im Byron den Haushaltsvorstand von Lord und Lady Seymour kennengelernt.«
»Du besuchst dieses Lokal also?« Elisabeth klang amüsiert.
Ida senkte verlegen den Blick. »Manchmal. Wenn ich für dich Besorgungen in der Stadt mache und ein paar Minuten Zeit ist.«
»Schon gut, kein Grund, dich zu schämen.«
Schnell sprach Ida weiter. »Der Haushaltsvorstand der Engländer wird Butler genannt. Der Butler der Seymours hat mir berichtet, bei Lord und Lady Seymour fände an jedem ersten und dritten Samstag des Monats eine …«, Ida sprach das Wort aus, wie sie es notiert hatte, »… eine Seanze statt.«
»Du meinst Séance«, korrigierte Elisabeth sie. »Das Wort kommt aus dem Französischen, und es bedeutet die Verbindung mit den Toten.«
»Ja, genau so hat es geklungen«, bestätigte Ida. Sie las kurz nach und setzte dann den Bericht fort. »Es würden andere adelige Herrschaften eingeladen, aber auch Fabrikbesitzer, die auf Korfu eine Villa bewohnen. Insgesamt wären es immer sechs Personen und dazu eine Frau aus Bournemouth, die hier die Sommermonate verbringt und behauptet, ein …« Wieder musste Ida einen Blick in das Notizbuch werfen. „Ein Me-di-um zu sein.“
»Die wichtigste Person«, erklärte Elisabeth. »Sie kann den Kontakt zu Verstorbenen herstellen.«
»Wie soll das funktionieren?« Ida packte den Block zurück in ihren Beutel.
»Ich kenne nur Berichte, selbst habe ich noch nie an einer Séance teilgenommen«, antwortete Elisabeth. »Man sitzt um einen runden Tisch. Der Raum ist dunkel. Höchstens eine Kerze brennt. Die Teilnehmer strecken die Hände zur Seite und berühren sich an den Fingern.«
Ida fand die Sache immer faszinierender.
»Das Medium, das den Kreis schließt, stellt die Fragen, die beantwortet werden sollen«, erzählte Elisabeth weiter. »Die Toten geben Zeichen, indem sie den Tisch zum Schweben bringen oder Gegenstände bewegen.«
»Wie soll das möglich sein?«
Die Kaiserin seufzte. »Ida, es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns träumen lassen. Die Gier nach Erklärbarkeit hat die Menschen abgestumpft und gefühllos werden lassen. Die neue Zeit mit den stampfenden Maschinen gibt vor, die einzige Wahrheit zu sein. Aber sie ist es nicht.« Die Kaiserin griff nach einem Glas mit Limonade. Sie nahm einen Schluck und verzog das Gesicht.
»Warm und schal.«
»Soll ich dir eine frische Limonade bringen lassen?«, bot Ida sofort an.
»Erst sag mir, wer das Medium ist, die Frau aus Bournemouth. Ich hoffe, du hast dir ihren Aufenthaltsort auf Korfu geben lassen.«
»Natürlich.« Ida war stolz, die Wünsche der Kaiserin erraten zu haben, noch bevor diese sie geäußert hatte. »Sie wohnt in einem Hotel in Paleokastritsa, auf der Westseite der Insel. Der Butler kennt sie nur als Madame Astra, aber das kann nicht ihr richtiger Name sein.«
»Finde sie und hol sie her. Sag ihr aber unter keinen Umständen, wer ich bin«, wies Elisabeth ihre Hofdame an.
»Elisabeth, die ganze Insel weiß, dass in Schloss Mon Repos die Kaiserin von Österreich logiert«, gab Ida zu bedenken.
»Dann sag dem Obersthofmeister, er soll nach einer Villa suchen, die mir kurzzeitig zur Verfügung gestellt werden kann.«
»Ich kann das tun. Aber …«
»Ida, kein aber. Tu es einfach.«
»Elisabeth …«
»Schluss jetzt. Worauf wartest du noch? Nimm eine Kutsche und fahr nach Paleokastritsa.«
Die Kaiserin erhob sich, trat unter dem Schattendach hervor und spannte ihren kleinen Sonnenschirm auf. Sie schien einen Spaziergang am Strand unternehmen zu wollen. Es war Idas Pflicht, sie dabei zu begleiten.
Wie ein kleiner Hund lief sie neben der zornig stapfenden Elisabeth her. Sie war seit geraumer Zeit launisch und schnell aufbrausend.
»Bitte, Elisabeth, hör mich an.«
Ohne Zweifel marschierte die Kaiserin absichtlich so knapp an der Wasserlinie, dass die Wellen manchmal ihre Schuhspitzen überrollten.
»Was gibt es noch?«
»Du weißt, ich will immer dein Bestes.«
Elisabeth schlug einen versöhnlichen Ton an. »Das weiß ich, Ida, sei beruhigt.«
»Die Zofe der Lady Seymour war heute auch im Byron anwesend. Als sie hörte, wonach ich suchte, verriet sie mir etwas.«
»Was?«
»Bei der letzten Séance vor zwei Wochen haben die Stimmen Madame Astra gewarnt.« Ida suchte nach den richtigen Worten. »Es waren die Stimmen zweier Verstorbener, deren Herzen noch immer mit der Insel verbunden sind.«
Elisabeth blieb stehen.
»Und weiter?«
Ida schlug die letzte Seite des Notizbuchs auf und las laut vor. »Die Warnung betrifft einen Mann, noch keine dreißig Jahre, der nichtsahnend und unverschuldet hier den Tod finden kann. Sein Blick erweckt eine Mordlust in anderen.«
Eine besonders hohe Welle kam angerollt, und Ida zog Elisabeth am Ärmel vom Wasser fort. Nachdenklich beobachtete Elisabeth die Blasen des Schaums, die im Sand zerplatzten.
»Soll ich Madame Astra noch immer für dich holen?« Ida hoffte, die Kaiserin hätte es sich anders überlegt. Doch sie wurde enttäuscht.
»Mehr denn je«, antwortete Elisabeth.
Ida hätte es wissen müssen.
2
»Wie lange noch?«
»Der Kapitän kann es nicht genau sagen. Er hofft, dass wir vor heute Abend auslaufen können.«
»Abend? Es ist Mittag!«
»Majestät, es wurden für Sie Zimmer im Palazzo …«
Marie unterbrach die Hofdame Lore mit einer energischen Handbewegung. »Ich will mich nicht in einem Zimmer verkriechen.«
»Majestät, es ist ein Appartement im schönsten Hotel …«
»Auch dort nicht.« Marie wartete bereits drei Stunden in einem Pavillon am Hafen von Triest, um an Bord der K.u.K. Dampfyacht zu gehen, die für sie und ihre Gefolgschaft vom Kaiser von Österreich bereitstand. Schließlich war Marie die Schwester von Kaiserin Elisabeth, von ihrer Mutter Ludovika beauftragt, zu Sisi nach Korfu zu reisen und sie aufzuheitern, da sie wieder unter einem Anfall schwerer Melancholie litt.
»Man erzählt sich Gutes von den Cafés in Triest. Suchen Sie das beste und berühmteste für mich«, befahl Marie.
»Sehr wohl, Majestät.«
»Damit ich dort ja keinen Fuß hineinsetze.«
Lore blickte verwirrt. Die Hofdame war immer leicht nervös und hatte, wie Marie fand, das Gesicht eines Irish Setters.
»Ich verstehe nicht …«
»Und wenn Sie das berühmteste gefunden haben«, fuhr Marie fort, »dann suchen Sie mir ein Café, das bei Künstlern beliebt ist.«
»Sehr wohl.«
Lore knickste und eilte davon.
Marie stand von der Holzbank auf und trat aus dem verglasten Pavillon ins Freie. Die Möwen zogen in der Luft kreischend ihre Runden. In Sichtweite, an der Kaimauer, lag die Segelyacht, die sie nach Korfu bringen sollte.
Die Segel waren eingeholt, aus dem Schornstein stieg kein Rauch.
Selbst Anfang September lag über Triest eine drückende Hitze, die nur eine sanfte Meeresbrise erträglich machte. Marie freute sich auf Korfu, die Insel, die selbst in der Trockenheit der Sommermonate ihre grüne Pracht behielt.
Auf ihre Schwester freute sich Marie weniger. Nach der Krönung zur ungarischen Königin hatte Elisabeths Euphorie nur kurz angehalten und war dann offenbar einer Niedergeschlagenheit gewichen, die sie zu einem weiteren Aufenthalt auf Korfu veranlasst hatte.
Wie sollte Marie dort der Langeweile entfliehen? Sie wollte reiten, sie wollte auf Fuchsjagd, sie wollte endlich das Jagdschloss sehen, das im Westen Englands in ihrem Auftrag gekauft werden sollte.
Lore kehrte geschäftig zurück. »Das Café ist in unmittelbarer Nähe, aber ich muss Sie warnen, es verkehren dort gewöhnliche Leute, die eine Seereise unternehmen wollen.«
»Ganz nach meinem Geschmack«, stellte Marie fest.
Begleitet von zwei Wächtern und ihrer Hofdame suchte sie das Café mit dem klingenden Namen San Marco auf.
Angenehme Kühle empfing sie. Nur ein paar der Marmortische waren besetzt. Für Marie war es hier viel zu ruhig.
Froh, dass ihre Bewacher in Zivil waren und so keine unnötige Aufmerksamkeit erweckten, nahm sie an einem Ecktisch Platz. Lore setzte sich sofort zu ihr und winkte den Kellner herbei.
»Nenn mich nicht Majestät«, zischte Marie warnend.
Lore, die gerade ansetzte, etwas zu sagen, schloss den Mund.
»Kaffee, italienischen Kaffee. Groß«, riss Marie die Hofdame aus ihrer Starre. Sofort übermittelte Lore die Wünsche ihrer Herrin an den Kellner.
Drei Tische weiter fiel Marie ein gutaussehender Mann auf, den sie auf ihr Alter schätzte, oder sogar etwas jünger. Er saß über ein Buch gebeugt, in das er etwas eintrug.
Sie musterte ihn verstohlen aus den Augenwinkeln: aufrechte Haltung, schlanker Körper, feine Gesichtszüge, das Haar nicht zu kurz und nicht zu lang. Sein helles Leinenhemd war oben offen, die Jacke lag auf der Lehne des freien Stuhls neben ihm.
»Der Kaffee kommt gleich«, sagte Lore.
Der Mann schrieb und schrieb. Seine Kaumuskeln zuckten in unregelmäßigen Abständen. Mit der freien Hand strich er eine Haarsträhne zurück.
War er Schriftsteller? Oder Dichter?
»Geh zu dem Mann«, trug sie Lore auf, »lass ihm eine Tasse Kaffee bringen und sag ihm, sie wäre ein Geschenk von mir.«
Marie hoffte, der Mann würde den Anstand haben, sich persönlich bei ihr zu bedanken und dazu an ihren Tisch kommen.
Lore war die eigenartigen Wünsche ihrer Herrin mittlerweile gewohnt und widersprach nicht. Sie wusste, dass es sinnlos war.
Aufmerksam beobachtete Marie, wie Lore zu ihm ging und mit ihm sprach. Er sah zu ihr. Sie senkte schnell den Blick.
»Er bedankt sich«, hörte sie Lore neben sich.
Maria wäre um ein Haar aufgebraust, weil der Mann nicht persönlich gekommen war, hatte sich aber schnell wieder unter Kontrolle. Sie musste ihm wohl etwas auf die Sprünge helfen.
»Bestell ihm, dass ich zu einer Unterhaltung einlade. Da ich mich, wie er, für das Schreiben interessiere.«
Widerstrebend ging Lore zurück. Marie konnte nicht hören, was sie sagte. Sie redete auf ihn ein, bis der Mann das Buch zuklappte, die Schreibfeder in einem Etui verstaute und beides in eine Ledertasche steckte. Dann stand er auf und kam zu ihrem Tisch.
Er verneigte sich.
»Mylady.«
Marie lächelte. Hätte er gewusst, wer vor ihm saß, hätte er sie mit »Your Majesty« ansprechen müssen. Schließlich hatte er es mit der Königin von Neapel zu tun, aber das musste er nicht wissen. Sie grüßte ihn auf Englisch und bot ihm an, sich zu setzen.
Der Mann war überrascht.
»Wie kommt es, dass Sie so gut Englisch sprechen?«
»Seit ich ein Kind war, wurde ich darin unterrichtet«, sagte sie. »Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen?«
»Percy.«
»Percy?« Sie dehnte die letzten Buchstaben zu einer langen Frage, damit er ihr auch seinen Familiennamen verriet, aber er ging nicht darauf ein.
»Ihre Begleiterin hat mir verraten, Sie interessieren sich für das Schreiben«, sagte der Mann stattdessen.
»So ist es. Allerdings bin ich blutige Anfängerin. Sie scheinen darin sehr geübt.«
Er lachte geschmeichelt. »Ich muss Sie enttäuschen. Meine Leidenschaft liegt woanders.«
»Ach, worin?«
»Habe ich ihn überhört oder hatte ich noch nicht die Ehre, Ihren Namen zu erfahren?«, fragte er, statt eine Antwort zu geben.
Marie gefiel er immer besser. Er hatte etwas Unerschrockenes, fast Respektloses.
»Marie.«
»Sehr erfreut, Marie.« Die Hand auf der Brust neigte er seinen Oberkörper leicht nach vorn.
»Sind Sie länger in Triest oder reisen Sie weiter?«, wollte Marie wissen.
»Mein Ziel ist die Insel Korfu.«
Marie zog eine Augenbraue in die Höhe. »Was für ein Zufall, meines auch.«
»Nehmen Sie das Schiff, das in einer Stunde ausläuft?«, fragte der Mann. »Ich kann Sie zum Hafen begleiten.«
»Nein, danke«, lehnte Marie schnell ab. »Sehr freundlich, aber …«
Sie konnte ihm nicht verraten, dass die kaiserlich-königliche Dampfyacht für sie und ihren Hofstaat bereitstand. Dann hätte er sofort gewusst, mit wem er hier so ungeniert sprach.
»Aber?« Er sah sie fragend an. »Sie haben den Satz nicht vollendet.«
Die Uhr einer nahen Kirche schlug zwei Uhr.
»Schon zwei? Ich dachte, es wäre erst halb eins.« Er fuhr in die Höhe. »Gerne hätte ich das Gespräch fortgesetzt. Vielleicht ergibt sich ein anderes Mal eine Gelegenheit. Vielleicht auf Korfu.«
»Vielleicht.«
»Es wäre mir ein großes Vergnügen.«
Nachdem er sich abermals verneigt hatte, verließ er fluchtartig das Kaffeehaus. Durch die hohe Scheibe sah Marie, wie er mit großen Schritten Richtung Hafen rannte.
»Die Tasche«, rief Lore. Sie hielt die Ledertasche am Gurt hoch.
Percy hatte sie vorhin auf der Bank stehengelassen, als er zu Marie an den Tisch gekommen war.
Lore eilte zum Ausgang des Cafés, wo einer der Männer des Geheimdiensts stand und Wache hielt. »Suchen Sie den Mann, geben Sie ihm seine Tasche.«
»Er will zum Schiff nach Korfu«, rief Marie.
Eine Stunde später kehrte der Mann zurück, die Tasche noch immer bei sich. Marie hatte bereits ihren zweiten Kaffee getrunken, die Bilder im San Marco betrachtet und sich zu langweilen begonnen.
»Er war nicht zu finden. Weder am Kai noch auf dem Schiff.«
»Dann geben Sie mir die Tasche«, verlangte Marie. »Ich werde sie verwahren.«
Die Chancen standen gut, dass es in Korfu unterhaltsamer werden würde, als Marie gedacht hatte.
3
Den Sonnenschirm auf der Schulter schritt Elisabeth über den Weg zwischen Zypressen und Pinien des Parks von Schloss Mon Repos. Ida hatte ihre Anweisung befolgt und war aufgebrochen, um Madame Astra zu suchen. Elisabeth wollte sich in die Kühle des Schlosses zurückziehen. Sie empfand den Tag als drückend heiß.
Zikaden zirpten in den Bäumen und der Duft von Lorbeer schwebte durch die Luft. Das Geräusch einer Gartenschere machte Elisabeth auf einen Gärtner aufmerksam, der dabei war, einen Lorbeerbaum in Fasson zu schneiden. In der Wärme der Sonne verströmten die Blätter ihr Aroma. Sisi blieb stehen und atmete den würzigen Geruch tief ein.
Die Hofdamen, die hinter ihr herliefen, erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der Kaiserin. »Mir geht es gut, wenn Sie nicht meine Nerven strapazieren«, brauste Elisabeth auf. Erschrocken zogen sich die Hofdamen zurück. Aus dem Haus kam ihr ein Bediensteter entgegengeeilt.
»Wir haben zwei Briefe für Majestät erhalten. Ich dachte, vielleicht wollen Sie sie im Schatten des Gartens lesen.«
»Von wem sind sie?«, fragte Elisabeth, mehr genervt als erfreut.
»Einer von Seiner Majestät dem Kaiser und der andere von Graf Andrássy.«
»Geben Sie her.«
Elisabeth riss ihm fast die Umschläge aus der Hand. Sie sah sich nach einer Sitzgelegenheit um.
»Vielleicht dort, Majestät?«, schlug eine der Hofdamen vor und zeigte auf eine bemooste Steinbank unter einer uralten Pinie.
»Ich habe sie selbst gesehen«, sagte Elisabeth, was gelogen war. »Und jetzt will ich in Ruhe gelassen werden. Ich brauche keine Begleitung.«
Die Hofdamen knicksten und entfernten sich.
Nachdem sie sich niedergelassen hatte, warf Elisabeth einen prüfenden Blick um sich. Niemand sollte sie beobachten, wenn sie das Schreiben des Grafen öffnete und las. Falls ihr eine Gefühlsregung unterlief, so war das niemandes Angelegenheit.
Sie wollte die Neugier und Spannung auf den Inhalt des Briefs ein wenig auskosten und öffnete deshalb zuerst den Umschlag, der das Siegel des Kaisers trug. Er enthielt nicht nur einen Brief, sondern auch ein Schulheft, das dem Kronprinzen gehörte.
Meine geliebte Sisi,
wie ich hoffe, haben die Seeluft und das Klima Korfus die heilende Wirkung, die die Ärzte versprochen haben. Du fehlst hier am Hof, und Mama schickt dir ihre Grüße.
Elisabeth wusste, wie sehr Franz Josef sie vermisste, auf die Grüße von Erzherzogin Sophie aber konnte sie verzichten. Dieser war ein wandelnder Vorwurf, wenn Sisi sich in Wien aufhielt, und die ewig tadelnden Blicke und spitzen Bemerkungen waren einer der Gründe, wieso sie die Flucht ergriffen hatte.
Heute hat mir Graf Latour, dem du die Erziehung unseres Sohnes übertragen hast, ein Schulheft des Kronprinzen zukommen lassen. Er beschreibt darin unsere Krönung in Ungarn, und ich dachte, seine kindlichen Zeilen könnten dich ein wenig aufheitern.
Rudolf und Gisela fragen oft nach dir und wann du denn wiederkommst. Kann man ihnen schon ein Datum nennen?
Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, den Kronprinzen aus den Händen des Folterknechts von Lehrer zu befreien, den der Kaiser für ihn gewählt hatte, dachte Elisabeth. Der arme Rudolf war mit eiskaltem Wasser übergossen worden. Während er schlief, wurden neben seinem Bett Schüsse abgefeuert. Allein wurde er im Lainzer Tiergarten ausgesetzt, und alles nur, um ihn »abzuhärten«.
Elisabeth hatte dem Kaiser ein Ultimatum gesetzt: Entweder sie bekam die alleinige Verantwortung über Rudolfs Erziehung oder sie würde den Kaiser verlassen. Er hatte eingewilligt. In ganz Europa war diese Entscheidung Gesprächsstoff an Königshöfen gewesen, war Elisabeth doch die erste Frau, die eine solche Aufgabe übernommen hatte.
Sie wollte den Herbst auf Korfu verbringen und dann nach Venedig reisen. So konnte sie dem Hof und den quälenden, altmodischen Protokollen fernbleiben.
Geliebte Sisi, im Monat Oktober hat uns Queen Victoria, die Königin Englands, zu einem Besuch in Osborne House auf der Isle of Wight eingeladen, zu dem du mich begleiten sollst. Du hast keine Ahnung, wie sehr du mich unterstützen könntest, ist der Besuch doch von staatspolitischer Bedeutung. Zudem hat Queen Victoria den ausdrücklichen Wunsch geäußert, dich kennenzulernen.
Nie im Leben, dachte Elisabeth. Der Kaiser würde die Reise allein antreten müssen.
Du bist sehr gut, mein Engel, ich liebe dich unendlich, und die Sehnsucht nach dir ist enorm. Lass mich nicht lange sehnen, komm so schnell wie möglich zu mir.
Sorgfältig faltete Sisi den Brief wieder zusammen und steckte ihn in den Umschlag zurück. Mit den Fingerspitzen strich sie über den Einband des Schulhefts. Sie schlug es auf.
In Rudolfs ein wenig unbeholfener Handschrift standen darin seine Erinnerungen an die Krönungszeremonie in der Matthiaskirche in Budapest. Am 8. Juni 1867 waren Franz Josef und Elisabeth vom Primas der katholischen Kirche und im Beisein des ungarischen Ministerpräsidenten Graf Andrássy mit der Stephanskrone zum König und zur Königin von Ungarn gekrönt worden.
In der Kirche waren viele Magnaten und Offiziere, dann fing die Musik an und der Primas und viele katholische und griechische Bischöfe und sehr viele andere Priester waren da. Dann kam Papa und Mama. Mama setzte sich auf eine Art von Tron und Papa gieng zum Altar, wo viel Lateinisch gelehsen wurde. Nachher ertönten die Pauken und Andrássy und der Primas setzten dem Papa die Krone auf. Dann bekam Papa den Reichsapfel und das Szepter in die Hand.
Elisabeth war fast ein wenig beleidigt, wie gering Rudolf ihre Rolle bei der Krönung würdigte. Am wichtigsten erschien ihm sein Vater, weil er nicht wissen konnte, wie sehr sich Elisabeth für einen Kompromiss mit Ungarn und mehr Eigenständigkeit des Landes in der Doppelmonarchie eingesetzt hatte.
Ihre Verbindung zu Graf Andrássy hatte dabei eine bedeutende Rolle gespielt. Natürlich waren der Kaiserin die Gerüchte zugetragen worden, die nicht nur in Wien die Runde machten: Die Beziehung zum Grafen ginge über politische Grenzen hinaus, sogar eine Affäre wurde ihr angedichtet.
Was waren die adeligen Herrschaften doch für Tratschmäuler. Allein deswegen fand Elisabeth es nur recht, sich so weit wie möglich von Wien fernzuhalten. Ihre Kinder waren in guten Händen, sie bekamen Unterricht von Lehrern, die sie selbst ausgewählt hatte. Also würden sie ihre Mutter entbehren können, die sich um ihre Gesundheit kümmern musste.
Noch immer hielt sie Andrássys Brief ungeöffnet zwischen ihren Fingern. Sie hatte es sich anders überlegt und wollte ihn erst am Abend lesen, wenn sie allein in ihrem Zimmer war. Seine Worte würden ihr helfen, Ruhe zu finden.
Wäre sie dem Grafen doch begegnet, bevor sie Franz Josef kennengelernt hatte! Mit ihm hätte sie die wahre Verbindung der Herzen und Seelen erleben können und den Einklang der Gedanken und Ideen.
Seit der Krönung hatte ihr Leben an Sinn verloren. Es war erreicht, was ihr wichtig erschien und wofür sie beim Kaiser gekämpft hatte. Nun empfand sie Leere, die sie melancholisch und gereizt machte.
Sie hoffte, Ida würde noch heute oder spätestens morgen mit der Nachricht zurückkehren, Madame Astra, das Medium, wäre zu einem Treffen mit Elisabeth bereit. Mit ihrer Hilfe würde sie vielleicht Verbindung mit dem großen Seelenverwandten aufnehmen können, in dessen Gedichten sie in diesen Tagen Trost fand.
4
Sein Name war Gilbert, aber im Laufe der Jahre hatte er ihn fast vergessen. Seine Mutter war die Letzte gewesen, die ihn so in ihren Briefen angesprochen hatte.
Seit er im Dienst der Familie Seymour stand, war er immer Hudson gewesen. Zuerst als Bursche unter dem früheren Butler. Dann als Kammerdiener des Lords. Und seit fast zehn Jahren als Haushaltsvorstand und Butler. Alle Mitglieder der Seymours – Eltern, Söhne und Tochter, genauso wie die ältere Generation – riefen ihn Hudson. Für die anderen Dienstboten war er Mister Hudson.
Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte er seinen Taufnamen ausgesprochen, als er ihn der bezaubernden Dame verriet, die ihm schon einige Male im Byron aufgefallen war. Sie hatte ihm daraufhin verraten, dass sie Ida hieß, aber nichts darüber erzählt, bei wem und in welcher Position sie in Stellung war.
Sie sprach Ungarisch, Deutsch und Englisch, was Gilbert entgegenkam, beherrschte er selbst doch nur seine Muttersprache und ein paar Brocken Französisch. Sie hatte erwähnt, in Wien zu leben. Für Gilbert war Österreich-Ungarn ein großes Land und er wusste über die Unterschiede und Besonderheiten wenig Bescheid. Wien, so hatte er bloß gehört, sei eine schöne Stadt.
Leider war Seine Lordschaft nicht reisefreudig. Spätherbst und Winter verbrachte die Familie in London, wo sie nahe dem neuerbauten Buckingham Palace ihr Stadthaus hatten. Im Frühling und im Herbst übersiedelten die Seymours auf ihre Landgüter, wo sie einen kleinen Palast besaßen, die Sommermonate aber lebten sie auf Korfu, in einer nicht minder prächtigen Villa nahe der Hauptstadt.
Seit geraumer Zeit hatte Gilbert ein bisher unbekanntes Gefühl beschlichen. Er fühlte sich zu Ida hingezogen, was ihn verunsicherte. Als er mit ihr im Byron den starken griechischen Mokka getrunken hatte, waren ein paar Krümel des Kaffeepulvers an seiner Oberlippe kleben geblieben, und Ida hatte verschämt mit dem Finger auf die Stelle gedeutet, die er sich mit der Serviette hatte abwischen müssen.
Er würde es nie zugeben und sich schon gar nicht anmerken lassen, aber sein Herz hatte schneller zu schlagen begonnen. Um ein Haar hätte er die stete Ruhe verloren, die er sich antrainiert hatte. Aber er hatte sich schnell wieder unter Kontrolle gebracht.
Besonders interessiert schien Ida an Madame Astra. Hudson wusste nicht recht, warum. Er selbst fand das Medium seltsam und konnte sich nicht recht vorstellen, dass sie eine Verbindung zu den Toten aufbauen konnte. Für den Samstag hatte Lady Seymour wieder zwei befreundete Ehepaare zur Séance geladen. Die Beschwörung der Verstorbenen fand immer vor dem Dinner statt.
In der Küche im Untergeschoß, deren Fenster nur halb über den Boden ragten, saß er an diesem Donnerstagabend mit Florence, der Köchin, um das Menü zu besprechen, das nach der Séance serviert werden sollte.
»Die Herrschaften sind immer so aufgeregt, dass es fast egal ist, was man ihnen serviert«, beschwerte sich Florence. Sie war eine resolute Frau, die nie ein Blatt vor den Mund nahm. »Das meiste wird nur gekostet, die Teller kommen fast voll zurück. An meinen Kochkünsten liegt das nicht.«
Florence war so alt wie Gilberts Mutter und hatte für das Personal eine Mutterrolle übernommen. Zu ihr kam man, um sich an ihrem großen Busen auszuweinen, ihr beichtete man Vergehen, im Haushalt oder außerhalb, und ihr vertraute man Geheimnisse an.
»Ihre Kochkünste werden auf das Höchste geschätzt, liebe Florence«, versicherte Gilbert. »Das Erlebte hat für die Gäste und die Herrschaft einfach größere Bedeutung an einem solchen Abend.«
Die Erklärung konnte Florence annehmen, was aber nicht hieß, dass sie ihr gefiel. Sie griff nach der Whiskeyflasche und hielt sie hoch. Außer einem kleinen Rest Bodensatz befand sich nichts mehr von der goldgelben Flüssigkeit darin.
»Scheint zu verdampfen«, murmelte sie und schenkte Gilbert und sich die letzten Tropfen ein. Danach war die Flasche leer.
»Cheers!« Er nahm einen Schluck, genoss das angenehme Brennen auf der Zunge und den rauchigen Geschmack. Florence schluckte und schüttelte sich. Das war ihre Angewohnheit beim Whiskeytrinken. »Mir ist diese Madame Astra nicht geheuer«, sagte Florence.
»Ich kann verstehen, was Sie meinen, Florence.« Madame Astra war eine exotische Erscheinung in ihren wallenden, orientalischen Gewändern, dem Turban, der stets aus demselben Stoff genäht war wie ihr Kleid, und den vielen klirrenden Ketten, die sie um den Hals trug.
»Was denken Sie?«, fragte Florence. »Gelingt es ihr tatsächlich, Verbindung mit den Toten aufzunehmen?«
Gilbert nippte wieder am Whiskey. »Sie ist voll Energie und Erregung, wenn ich sie an der Tür empfange. Nach der Sitzung, wenn sie uns verlässt, macht sie einen erschöpften Eindruck.«
»Haben Sie etwas von dieser Warnung gehört, von der Hilda ständig spricht?«
Hilda war die Zofe der Lady und eine recht geschwätzige Person, wie Gilbert fand.
»Sobald die Herrschaften Platz genommen haben, verlasse ich den Salon. Aber später, als ich den Wein servierte, war die Warnung Gesprächsthema.«
»Die Madame soll Tische zum Schweben bringen. Ist das auch bei uns schon vorgekommen?« Mochte Madame Astra der Köchin auch nicht geheuer sein, so übte sie doch eine Faszination auf sie aus. So ging es wohl den meisten Menschen mit ihr, dachte Gilbert.
»Davon habe ich nie etwas gehört. Madame Astra soll in einen Zustand der Trance fallen.«
Florence verzog fragend das pausbäckige Gesicht. »Was soll das denn sein?«
»Sie ist wach, aber geistig nicht anwesend«, erklärte Gilbert. »Sie spricht dann in verschiedenen Stimmen. Manchmal erkennen Teilnehmer der Séance, welchen ihrer verstorbenen Verwandten diese gehören.«
»Ach, was soll man glauben und was nicht?« Florence schob die leere Flasche über den Tisch zu Gilbert. »Ich glaube, was ich mit eigenen Augen sehe, und hier sehe ich eine leere Flasche, die ersetzt werden möchte.«
»Wenn ich in die Stadt fahre, gehe ich zum Weinhändler. Morris macht mir sicherlich einen guten Preis.«
Gilbert erhob sich, zog Hose und Jacke zurecht.
»Sie sind zu dünn. Sie essen zu wenig«, tadelte ihn Florence.
Aus Erfahrung wusste Gilbert, dass fast jeder Mensch aus ihrer Sicht »zu dünn« war.
»Würden Sie mit verstorbenen Mitgliedern Ihrer Familie reden wollen?«, fragte Florence, bevor Gilbert die Küche verließ.
Der Butler zögerte für einen Moment. »Auch wenn ich selbst kein abergläubischer Mensch bin und ein Anhänger der erklärbaren Naturwissenschaften, so würde ich doch gerne über Madame Astra Kontakt mit meiner verstorbenen Mutter aufnehmen. Und Sie, verehrte Florence?«
»Ich will einen Blick in die Zukunft machen können und sehen, was sie bringt.«
Keine schlechte Idee, dachte Gilbert bei sich. Könnte er in die Zukunft blicken, so hätte er gerne mehr über Ida und sich gewusst.
5
Der Sturm war unerwartet aufgezogen. Marie wollte dem Beispiel ihrer Schwester Sisi folgen.
»Ich will ihm ausgesetzt sein wie Odysseus, der sich an den Hauptmast anbinden ließ!«
Sisi hatte an Deck des Schiffs einen Glaspavillon für sich errichten lassen. Sie wollte nicht in einer stickigen Kabine sitzen, auch nicht in einem plüschigen Salon, sondern mit den Elementen verbunden sein.
Die Armstützen des gepolsterten Sessels im Pavillon waren mit Haltegriffen versehen, die Bediensteten schlangen ein Seil um Maries Mitte und banden sie damit fest. Bei hohem Wellengang wurde das Schiff auf- und niedergeworfen. Dabei sollte sie nicht in Verletzungsgefahr geraten.
Lore flehte sie an, den trockenen Platz unter Deck zu wählen, aber Marie schickte sie fort. Ihr war nach Abenteuer zumute.
In den schweren, dunkelgrauen Wolken über der Dampfyacht leuchteten die Blitze. Der Sturm heulte und der Regen prasselte in taubeneigroßen Tropfen herab.
Was für ein Erlebnis! Marie wollte Elisabeth nach der Ankunft ein Kompliment für den Pavillon aussprechen. Was für eine Idee!
So schnell, wie es gekommen war, legte sich das Unwetter wieder. Die untergehende Sonne ließ den Himmel in Flammen stehen.
Marie dachte an Percy. Ihm hätte dieser Platz an Deck gefallen. Er hätte den Elementen ins Gesicht gelacht! Was für ein charmanter und verschmitzter Bursche, sportlich und feinsinnig zugleich. Eine Kombination, die nicht häufig anzutreffen war.
Vom Unterdeck kam Lore durch die Luke herauf, um nach Marie zu sehen. »Majestät, sind Sie wohlauf?«
»Es könnte mir nicht besser gehen. Ich glaube, es ist Zeit für ein Zigarillo.«
Es bereitete Marie immer wieder Genuss, sich an Lores Empörung zu weiden. Lore brachte ein Kästchen, in dem Marie ihre Zigarillos aufbewahrte, dazu eine handgroße Dose mit Verzierungen aus Emaille, die Hephaistos, den Gott des Feuers, darstellten. Marie betätigte einen kleinen Hebel, woraufhin es zischte und eine Flamme aus einem Loch des Messingdeckels kam. Daran entzündete sie ihr Zigarillo. Den Rauch blies sie in Lores Richtung, woraufhin sich die Hofdame empört abwandte.
Als Nächstes ließ sich Marie Percys Tasche bringen. Das gleichmäßige Stampfen der Schaufelräder hatte eine beruhigende Wirkung. Das lange Schiff wurde kraftvoll durch das Wasser geschoben. Marie zog sich in den Pavillon zurück, stellte die Tasche auf ihre Knie und öffnete den Verschluss.
Das Buch, in das Percy geschrieben hatte, war in Leder gebunden und mit einer Lederschnur umwickelt. Sie löste die Schnur und schlug das Buch auf.
Was sie sah, ließ ihr einen wohligen Schauer über Arme und Rücken kriechen. Ihre Neugier an dem englischen Gentleman wurde noch größer. Marie musste ihn wiedersehen. Sie würde auf Korfu nach Percy suchen lassen. Wozu wurde sie von so vielen Sicherheitsleuten begleitet? Sollten sie doch einmal ordentliche Arbeit leisten.
6
Elisabeth hatte von ihrem Balkon verfolgt, wie die untergehende Sonne den Himmel im Westen karminrot färbte. Das Rot veränderte sich in Kupferfarben und schließlich in ein helles Gelb. Vom Osten kam die Dämmerung.
»Ich will ungestört sein«, trug Elisabeth ihrer Hofdame auf. Ida nickte und schloss die Terrassentüren.
Der Augenblick erschien Elisabeth richtig, den Brief des Grafen Andrássy zu öffnen. Sie hatte den ganzen Tag sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet.
Ein wenig nervös zog sie das Blatt heraus und faltete es auf.
Die Schrift des Grafen erkannte sie sofort an den langen Schlingen nach oben und dem senkrechten Stand der Buchstaben. Sie begann lächelnd zu lesen. Als sie fertig war, faltete sie den Brief wieder zusammen und steckte ihn zurück in den Umschlag.
Die Worte waren förmlich, der Inhalt eine Nachricht über das Wohlergehen seiner Familie. Er war verheiratet und hatte drei Kinder, was Elisabeth wusste, aber stets zu verdrängen versucht hatte.
Sehr förmlich erkundigte er sich nach ihrem Zustand, nachdem er von ihrem Aufenthalt auf Korfu erfahren hatte.
Hauptgrund des Schreibens war eine Schenkung der Ungarn an ihren König und ihre Königin: das Schloss Gödöllo, das nicht weit von Budapest entfernt lag. Elisabeth hatte es mit dem Grafen gemeinsam besucht und bemerkt, dass es ein Ort war, an dem sie sich wohlfühlen konnte.
Nun gehörte Schloss Gödöllo ihr. Und dem Kaiser, der kaum die Zeit finden würde, sich dort aufzuhalten.
Elisabeth wollte sich später beim Grafen bedanken, wenn sie ihre Enttäuschung über seinen distanzierten Ton überwunden hatte. Das Schloss war weit weg von Schönbrunn und der Hofburg, wo ihr das strenge Zeremoniell die Luft zum Atmen nahm. Außerdem gab es große Stallungen, in denen sie schon ihre Pferde stehen sah, auf denen sie ausreiten würde.
Im Herrensattel, wie sie es liebte. Doch wer würde an ihrer Seite reiten?
Samstag7.September1867
7
Bereits zum zweiten Mal in zwei Tagen näherte sich Ida mit der Kutsche Paleokastritsa. Im Westen, auf einem kegelförmigen Berg, sah sie die Ruinen der Festung Angelokastro, zu Deutsch »Engelsburg«, die jahrhundertelang, wie Gilbert Ida erzählt hatte, wichtig für die Abwehr nahender Feinde gewesen war. Heute waren nur noch verfallene Mauern von ihr übrig, ihre Bedeutung hatte sie verloren.
Die Engländer hatten eine Straße quer über die Insel gebaut, die Korfus Hauptstadt mit dem Dorf verband und die Anreise leichter machte. Der Kutscher zog die Bremse, damit die Kutsche beim Herabrollen vom Hügel nicht zu viel Fahrt aufnahm.
Hoffentlich hatte sie heute Glück, dachte Ida. Die Kaiserin war ärgerlich gewesen, als sie ihr am Freitag sagen musste, Madame Astra noch nicht gefunden zu haben. Elisabeth wünschte umgehend ihren Besuch. Geduld war nie ihre Stärke gewesen, und derzeit besaß sie davon noch weniger als sonst.
Wie ein Hufeisen erstreckte sich vor Ida die Bucht von Paleokastritsa, zu beiden Seiten von Olivenhainen gesäumt. Das Meer leuchtete azurblau. Als sie sich dem Strand näherten, sah sie ein paar Fischerboote auf dem Wasser schaukeln. Jedes hatte eine andere Farbe.
Hätte sie es nicht so eilig gehabt, wäre sie ein wenig am Wasser entlangspaziert und hätte sich vielleicht sogar getraut, sich in einer Taverne ein Glas dieses griechischen Weins zu gönnen, der hier so beliebt war und Retsina hieß.
Trotz ihrer guten Erscheinung, ihrer feinen Kleidung und der tadellosen Frisur hatte sie in den drei größten Hotels nur Ablehnung erfahren. Die Häuser lagen weit voneinander entfernt in den Hügeln, eines gut versteckt hinter einem Zypressenhain.
Der Kutscher kam, wie alle Bediensteten der Kaiserin, aus Österreich. Nur mit großer Mühe hatte er im Dorf die Namen der drei Hotels erfragen können. Er sprach kaum Englisch, und daher hatte Ida in den Hotels selbst das Fragen übernommen.
Erst im dritten hatte sie begriffen, wieso sie so abweisend behandelt wurde: Sie war keine Engländerin, wie offenbar alle anderen Gäste und das Personal der Häuser. Ihr Akzent, der Gilbert gefiel, machte sie hier zur Außenseiterin. Die Frage nach einer Madame Astra stieß zusätzlich auf Argwohn und Ablehnung.
Ida wusste nun zumindest, wonach sie suchen musste. Wie ihr Gilbert bei einem ihrer Treffen im Byron verraten hatte, wohnte Madame Astra nicht in einem Hotel, sondern in einem Gästehaus mit dem Namen Albert. So hatte auch der geliebte Prinzgemahl von Queen Victoria geheißen, der viel zu früh verstorben war. Seit diesem Tag trug die Königin nur noch schwarz. Ida fand diese Geste romantisch. Was Gilbert wohl dazu sagen würde? Ida hatte sich nicht zu fragen getraut.
Ausgestattet mit dem Namen von Madame Astras Gästehaus, hoffte Ida heute mehr Glück zu haben.
Auf dem Platz mit der Pferdetränke stieg sie aus der Kutsche, spannte den Sonnenschirm auf und machte sich auf die Suche. Ein paar Kinder kamen ihr entgegen, schmutzig, in zerschlissenen kurzen Hosen. Sie lachten und stießen einander übermütig.
Ida sprach sie auf Englisch an. Die Kinder verstummten und schnitten ihr dann Grimassen. Davon ließ sich Ida nicht aus der Ruhe bringen. Aus ihrem kleinen Beutel holte sie eine Münze. Die Kinder bekamen große, gierige Augen.
»Albert?«, fragte Ida. »Wo ist das Guesthouse Albert?«
Ein Mädchen beugte sich vor und schwang die Arme. Ein Junge rief mit verstellter, tiefer Stimme: »Bang bom, Bang bom.« Die anderen deuteten zur zweiten, etwas höher gelegenen Häuserreihe.
Sie meinten wohl den Glockenturm, der sich dort erhob. Er bestand aus sechs Bogen, die pyramidenförmig aufgebaut worden waren. In jedem hing eine dunkle Glocke, die einzeln mit einem Seilzug von unten betätigt werden konnte.
»Dort?« Ida deutete zum Glockenturm.
Die Kinderschar lief voraus und Ida folgte. Es war nicht einfach, Schritt zu halten. Die Kinder führten sie durch eine enge Gasse zu einer breiteren Quergasse, durch die der Glockenturm zu sehen war. Davor erhob sich ein weißes Gebäude mit mehreren Stockwerken, Balkonen und dunkelblauen Fensterläden, die alle geschlossen waren.
ALBERT stand auf einem Holzschild, das schief neben der Eingangstür an der Wand montiert war. Drei schwarze Katzen räkelten sich auf den Stufen.
Gleichzeitig streckten alle Kinder ihr die Hand hin. Wem sollte sie die Münze geben? Die Kinder redeten lautstark auf sie ein, wurden immer lauter und drängender. Weil sie sich keinen anderen Rat wusste, warf Ida die Münze in hohem Bogen die Gasse hinunter, woraufhin die Kinder ihr nachstürzten und sich darum balgten.
Ida trat vor die Eingangstür, die im selben Blauton lackiert war wie die Fensterläden. Mit Missfallen betrachtete sie die schwarzen Katzen, die mit erhobenen Schwänzen um ihren Reifrock streiften. Maunzend rieben sie ihre Köpfe am Stoff.
»Weg«, zischte ihnen Ida zu. Sie wackelte mit den Hüften, um den Rock schwingen zu lassen, in der Hoffnung, die Bewegung würde die Katzen vertreiben.
Das Gegenteil war der Fall. Die kleinste von ihnen schlüpfte darunter, und Ida spürte sie an ihren Waden. Vor Schreck stieß sie einen spitzen Schrei aus.
Über ihr wurden Fensterläden geöffnet. Sie hob den Kopf zu einem schmalen Balkon. Eine Frau trat heraus und blickte zu ihr herunter.
Ida wusste sofort, dass sie richtig war: Dort oben stand Madame Astra. Ihr Schmuck war billig, manche Ketten bestanden aus Holzkugeln und Muscheln. Jede Bewegung wurde von Klappern und Klirren begleitet.
Bevor Ida noch etwas sagen konnte, sprach die Frau sie auf Englisch an.
»Ich habe Sie schon erwartet. Kommen Sie herauf.«
Meinte sie Ida? Das war doch unmöglich, wie sollte sie von ihrem Kommen gewusst haben? Prüfend sah Ida sich um.
Außer ihr war niemand in der Gasse zu sehen. Von weit unten kam nur das Gekreisch der Kinder, die noch immer um die Münze kämpften.