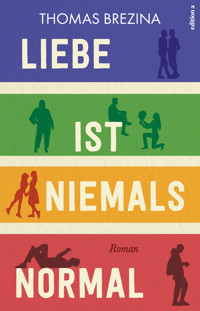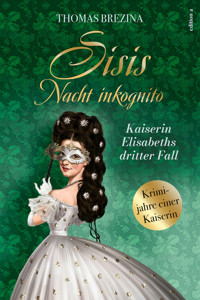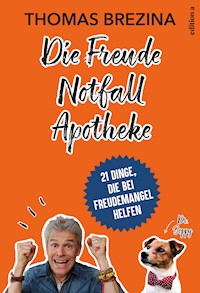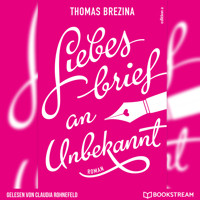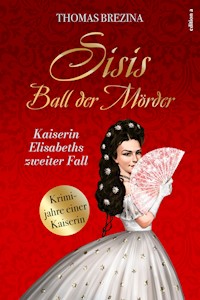
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Elisabeths Erzfeindin, Fürstin Paula von Mayenberg, hält sich mit Kritik an der Kaiserin nicht zurück. Als sie vor Elisabeths Augen auf einem Ball zusammenbricht und stirbt, quält Sisi die Frage, ob ihre bösen Gedanken daran schuld sein könnten. Einige Tage später entdeckt Sisis Hofdame Ida eine Karte, die ihr bereits vor dem Ball heimlich zugesteckt wurde. Auf ihr wird der Tod der Fürstin angekündigt. Und sie soll nicht das einzige Opfer bleiben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Brezina:Sisis Ball der Mörder
Alle Rechte vorbehalten
© 2022 edition a, Wienwww.edition-a.at
Lektorat: Maximilian HauptmannCovergestaltung: Bastian WelzerCoverillustration: Bernd ErtlSatz: Lucas Reisigl
Gesetzt in der GaramondGedruckt in Deutschland
4 5 6 7 8 — 26 25 24 23 22
ISBN 978-3-99001-607-7
eISBN 978-3-99001-608-4
THOMAS BREZINA
SisisBall der Mörder
Kaiserin Elisabethszweiter Fall
Inhalt
Sonntag, 09. September 1866
Kapitel 01
Montag, 10. September 1866
Kapitel 02
Dienstag, 11. September 1866
Kapitel 03
Kapitel 04
Kapitel 05
Kapitel 06
Kapitel 07
Kapitel 08
Kapitel 09
Mittwoch, 12. September 1866
Kapitel 10
Kapitel 11
Freitag, 14. September 1866
Kapitel 12
Samstag, 15. September 1866
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Sonntag, 16. September 1866
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Mittwoch, 19. September 1866
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Freitag, 21. September 1866
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Samstag, 22. September 1866
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Sonntag, 23. September 1866
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Montag, 24. September 1866
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Mittwoch, 26. September 1866
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Sonntag, 30. September 1866
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Dienstag, 02. Oktober 1866
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Mittwoch, 03. Oktober 1866
Kapitel 68
Freitag, 05. Oktober 1866
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Samstag, 06. Oktober 1866
Kapitel 72
Kapitel 73
Sonntag, 07. Oktober 1866
Kapitel 74
Dienstag, 16. Oktober 1866
Kapitel 75
Sonntag, 11. November 1866
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Montag, 12. November 1866
Kapitel 81
April 1849
Kapitel 82
Montag, 12. November 1866
Kapitel 83
Sonntag, 25. November 1866
Kapitel 84
Kapitel 85
Die Entstehung des Sisi-Krimis und großer Dank
Sonntag,09.September1866
01
»Ich möchte sie am liebsten ermorden!« Elisabeth, Kaiserin von Österreich, sprach den Gedanken gerade laut genug aus, dass ihr Tischnachbar ihn hören konnte.
»Solche Worte aus deinem Mund, verehrte Schwägerin?« Ludwig Viktor, der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef, schüttelte tadelnd den Kopf und widmete sich dann wieder seiner Grießnockerlsuppe.
Elisabeth hatte Mühe, ihren Zorn zu beherrschen. Sie war nicht nur wütend auf Fürstin von Mayenberg, sondern genauso auf ihren Schwager. Sie wusste mittlerweile, dass er beim sonntäglichen Diner der Familie nicht zufällig neben ihr an der Tafel saß. Er hatte diesen Platz gewählt, weil er seine Neuigkeiten unbedingt loswerden wollte. Und Sisi sollte keines seiner Worte entgehen.
Franz Josef war mit der Suppe fertig und legte den Löffel geräuschvoll ab. Augenblicklich begannen die Lakaien, die Suppentassen abzuräumen.
Während der Rest der kaiserlichen Familie sofort nach Franz Josef zu essen aufgehört hatte, löffelte Ludwig Viktor weiter. Ein junger Lakai, dem der Schweiß auf Stirn und Oberlippe stand, versuchte, nach Ludwig Viktors Tasse zu greifen, und bekam dafür einen Schlag mit dem Löffel auf die Hand. Erschrocken zog er sie zurück, ratlos, was er nun tun sollte. Die anderen Lakaien verschwanden mit dem Geschirr bereits durch die Tapetentür.
Es entging Elisabeth nicht, wie ihr Schwager sich an der Unsicherheit des Dieners weidete, seelenruhig noch einen letzten Löffel von der Suppe nahm und erst dann bereit war, sie abservieren zu lassen.
Was für ein Scheusal er doch war, dachte Elisabeth. Sein Spitzname »Luziwuzi« hatte sie immer schon an Luzifer, den Höllenfürsten, erinnert. In einem ihrer Gedichte über die kaiserliche Familie war ihr als bester Reim auf »Ludwig Viktor, des Kaisers Bruder« das Wort »Luder« erschienen.
Sisi verachtete alles an ihm: sein äffisches Grinsen, seine fahle Haut und den schlaffen Körper. Ganz besonders aber verabscheute sie seine Arroganz, die sich jedem Winkel seines Gesichts eingeschrieben hatte.
Als am anderen Ende des Tisches mit dem Auftragen des nächsten Ganges begonnen wurde, wandte er sich ihr wieder zu.
»Gräfin Petrovitz hat dich verteidigt und gesagt, es wäre doch keine Schande, Kleider zu tragen, die in der vorvorigen Saison in Paris schon aus der Mode waren.« Ludwig Viktor lächelte herablassend. »Es zeugte nur von deiner Bescheidenheit, nicht jede Modetorheit mitzumachen und auch ältere Stücke deiner Garderobe zu zeigen.«
Elisabeth umklammerte mit der Hand den Griff des Fleischmessers, das in der Reihenfolge des Bestecks als Nächstes dran war. Ihre Finger schmerzten, so fest drückte sie zu. Sisi konnte die Venen unter ihrer zarten Haut erkennen, die über ihren Knöcheln zu zerreißen drohte.
Ihr Schwager redete munter weiter, als befänden sie sich in einer vergnüglichen Konversation: »Die Mayenberg meinte, du hättest eben stärkere Verbindungen in deine Heimat Bayern oder zu deinen Schwestern nach Italien als nach Paris. Womit sie nicht ganz unrecht hat.«
Sisi hatte gute Lust, aufzustehen und das Diner zu verlassen. Weil ihr Schwager das aber womöglich als Sieg empfunden hätte, blieb sie sitzen und begann, mit dem Messergriff auf die Tischplatte zu trommeln.
»Paula von Mayenberg kennt natürlich auch nach ihrer Rückkehr nach Wien noch immer die besten Adressen in Paris, nicht nur, was Mode betrifft«, plapperte Ludwig Viktor. »In den Jahren, die ihr Gatte dort Militärattaché war, wurden ihre Bälle und Wohltätigkeitsveranstaltungen von Napoleon und Eugénie sehr geschätzt. Richard Wagner hat bei einem solchen Anlass die Ouvertüre seiner neuen Oper vorgespielt. Du magst doch Wagner, nicht wahr?«
Alles, was er sagte, war Elisabeth gut bekannt. Fürstin von Mayenberg ließ keine Gelegenheit aus, damit zu prahlen.
Ein junger Lakai servierte ihr einen Teller, auf dem drei kleine Brotscheiben lagen. Sie waren mit einer gelblichen Parmesancreme bestrichen. Der Geruch verursachte Sisi Übelkeit. Sie lehnte Parmesan grundsätzlich ab, da er ihr wie ein Stein im Magen lag und sich außerdem schlecht auf ihr Gewicht auswirkte, über das sie streng wachte. Sisi hatte mit Sorge beim morgendlichen Wiegen verfolgt, wie sie in der letzten Woche fast ein Kilogramm zugenommen hatte.
»Tut die Teufel, was sie will?«, sagte Sisi halblaut. Sie hatte Theresia Teufel, der Hofköchin, ausdrücklich aufgetragen, die Parmesancreme auf Toast vom sonntäglichen Menu zu streichen. Stattdessen hätte es Austern geben sollen, beträufelt mit etwas Zitronensaft.
»Hast du vorhin tatsächlich von Mord an der Mayenberg gesprochen?«, fragte Ludwig Viktor in einem Ton, den Sisi kannte. Mit dieser hinterhältigen Frage wollte er sie in eine Falle locken.
Ich hätte nichts dagegen, wenn sie tot umfiele, dachte Sisi, war aber diesmal beherrscht genug, diesen Wunsch nicht laut auszusprechen.
»Würdest du sie vergiften wollen? Oder denkst du an einen Messerstich?«, bohrte Luziwuzi weiter.
»Ach ja, Maula von Payenberg«, sagte Elisabeth bloß. Ihr Blick ruhte auf dem goldenen Tischaufsatz in der Mitte, in dem Früchte kunstvoll arrangiert worden waren.
Ludwig Viktor vergaß, zu schlucken, öffnete den Mund und ließ beim Ausatmen seinen Parmesanatem in Sisis Richtung wehen.
»Wie hast du sie genannt?«
»In ihrem erlesenen Kreis an Künstlern muss es welche geben, die ihr die Farben borgen, mit denen sie ihr Gesicht bemalt«, sagte Sisi, ohne auf die Frage ihres Schwagers einzugehen.
»Hast du sie Maula genannt?« Ludwig Viktor hatte den halb zerkauten Toast noch immer nicht geschluckt und spuckte ein wenig davon auf das steife, weiße Tischtuch.
Sisi starrte voll Abscheu auf den Fleck und lenkte den Blick dann vorwurfsvoll zu ihrem Schwager. Er machte einen verlegenen Eindruck, was sehr selten vorkam. Hastig schloss er den Mund und putzte mit der Serviette das gelbe Häufchen weg.
Vom Tischende hörte Sisi bereits wieder das Klappern von Besteck und Geschirr, das eingesammelt wurde.
Ludwig Viktor leistete diesmal keinen Widerstand, als der junge Lakai nach seinem Teller griff.
Elisabeth beschloss, ihn für den Rest des Diners zu ignorieren. Sie nahm aus den Augenwinkeln wahr, wie Ludwig Viktor mehrmals ansetzte, um das Gespräch fortzusetzen, aber sie widmete sich nur noch ihrem Tischherrn auf der anderen Seite.
Er war ein Cousin zweiten Grades des Kaisers, der mit seiner Familie in Wien weilte und dessen Schwärmereien über die musikalische Begabung seiner beiden fettleibigen Töchter Sisi entsetzlich langweilten. Sie verstand nicht, wie es Eltern zulassen konnten, dass ihre Töchter dermaßen dick wurden.
Während Elisabeth von Zeit zu Zeit höflich nickte, um den Eindruck zu erwecken, sie würde zuhören, wanderten ihre Gedanken zu ihrer Erzfeindin, die man angeblich sogar als ihre »Rivalin« bezeichnete. Doch das traf in keinem Fall zu. Eine Fürstin würde sich niemals mit einer Kaiserin messen können.
Was aber zutraf, war die Tatsache, dass Paula von Mayenberg alles tat, um in Wien zu zeigen, dass Elisabeth ihren Verpflichtungen als Kaiserin mehr schlecht als recht nachkam. Die Fürstin sprang in ihrer großzügigen Art überall dort ein, wo Elisabeth Lücken ließ. Ihr spielte in die Hände, dass Sisi vom steifen Hofzeremoniell wenig hielt und nur ungern auf großen Festen mit wichtigen Persönlichkeiten verkehrte.
Nein, umbringen wollte Sisi sie nicht. Sie war weder Lady Macbeth noch Lucrezia Borgia. Insgeheim aber gestand sie sich ein, dass ihr die Vorstellung der toten Fürstin eine gewisse Genugtuung bereitete. Zu oft hatte die Maula Sisi schon auf ihre subtile Art gedemütigt.
Das Diner endete mit einem üppigen Dessert aus dunkler Schokolade, Himbeeren und kandierten Orangen. Sisi pickte die Himbeeren mit der Gabel heraus und ließ den Rest unberührt.
Als sich der Kaiser erhob, standen sofort alle an der Tafel auf. Einige Mitglieder der kaiserlichen Familie gingen in den angrenzenden Salon des Alexander-Appartements, um dort den Kaffee einzunehmen. Elisabeth hatte keine Lust, an ihrer Unterhaltung teilzunehmen, und wollte in ihr Turnzimmer, um dort Übungen zur körperlichen Ertüchtigung zu machen.
Am Ausgang des Saales sah sie Franz Josef mit seinem kleinen Bruder stehen.
»Sisi«, rief sie Franz Josef, als sie sich unauffällig an den beiden vorbeistehlen wollte.
»Ja, bitte?«
»Ludwig Viktor gibt nächste Woche einen Ball zum Herbstbeginn, zu dem der König von Griechenland erwartet wird. Wir werden dem Ball unsere Ehre erweisen.« Franz Josef versuchte, seine Stimme überzeugend klingen zu lassen.
»Ach?« Mehr sagte Elisabeth dazu nicht.
»Du magst doch Griechenland so sehr«, sagte der Kaiser, diesmal schon sanfter. Ein Versuch, ihr den öffentlichen Auftritt zu versüßen.
»Der König ist ein dänischer Prinz, nicht wahr?«, fragte Elisabeth.
»Prinz Wilhelm von Dänemark«, mischte sich Ludwig Viktor ein. »Gekrönt als König Georg I. von Griechenland.«
Elisabeth wollte endlich in ihr Appartement zurück. Sie blieb dem Kaiser eine Antwort schuldig, nickte zum Gruß und ging weiter.
»Du kannst mit uns beiden rechnen«, hörte sie Franz Josef eine Zusage machen. Als sie sich umwandte, um zu protestieren, sprach bereits ihr Schwager: »Fürstin Mayenberg hat mir vorgeschlagen, den Ball als Wohltätigkeitsveranstaltung zu betiteln. Das Geld soll der Errichtung eines neuen Waisenhauses zukommen. Ich habe zugestimmt. Es erscheint mir als guter und wichtiger Zweck.«
Sisi wandte sich ab. Wieder einmal würde Paula von Mayenberg nicht nur alle Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch noch für ihre Wohltaten gelobt werden, obwohl alle anderen dafür bezahlten.
Die Wut, die in Elisabeth aufstieg, erweckte in ihr das Bedürfnis, tief durchzuatmen. Die eng geschnürte Taille ließ es nicht zu. So stürmte sie aus dem Saal, durch die Salons des Alexander-Appartements bis in ihr Toilettezimmer. Dort warf sie sich auf den Sessel vor dem Frisierspiegel.
»Elisabeth, mein Gott, was ist mit dir?«
Sisis Hofdame Ida trat neben die Kaiserin und blickte sie im Spiegel besorgt an.
»Ich werde dieser entsetzlichen Person nicht mehr die Bühne überlassen. Dieser Ball wird meine Revanche werden«, kündigte die Kaiserin an. »Man möge mir ein Reisbad vorbereiten. Morgen und an allen folgenden Tagen, bis zum Ball.«
Ida nahm die Glocke vom Tisch und schüttelte sie. Sekunden später trat eine junge Kammerdienerin ein, die Augen zu Boden gerichtet.
»Ihre Majestät wünscht, ein Reisbad zu nehmen.«
Die Dienerin nickte.
»Kennen Sie die Zutaten?«, fragte Ida prüfend.
Die schüchterne Frau murmelte vor sich hin und vermied jeden Blickkontakt mit Ida: »Man lässt Reiskörner für sechs Stunden im Wasser quellen und seiht den Reis danach ab.«
Weil sie so langsam sprach, setzte Ida selbst ungeduldig fort: »Dazu wird eine Essenz aus Erdbeerblättern gemischt. Das Bad macht die Haut weich und strafft sie zugleich. Orangenblütenessenz darf nicht fehlen, um dem Bad die richtige Duftnote zu verleihen.«
Die Kammerfrau zog den Kopf tief zwischen die Schultern und nickte.
»Was stehen Sie noch herum? Machen Sie sich an die Arbeit!«, herrschte Elisabeth sie an.
Montag,10.September1866
02
Heinrich Brettschmidt fühlte sich trotz seiner 44 Jahre wie ein Schuljunge, der im Begriff war, etwas Verbotenes zu tun. Doch der Brief ließ ihm keine andere Wahl.
Im Schein einer Petroleumlampe nahm er, seines Zeichens Schneidermeister und Inhaber eines der feinsten und auch teuersten Modesalons in Wien, ein Schnürmieder vom Haken. Es war in hellem Bordeauxrot gehalten und hing neben einem Kleid aus Samt und Seide in dunklen Rottönen, für das es angefertigt worden war.
Die Glocke der Michaelerkirche hatte zur Abendandacht gerufen. Brettschmidt ließ einige Minuten verstreichen, wickelte das Mieder dann in seinen Mantel und verließ die Räumlichkeiten im ersten Stock. Sein Herz hämmerte laut.
Als er auf den Kohlmarkt trat, blickte er prüfend um sich. Der Anzünder der Gaslaternen war unterwegs, hatte aber das Ende der Straße fast erreicht. Heinrich wartete noch einen Moment im Hausbogen, bevor er losging.
Es hatte zu nieseln begonnen. Er zog den Kopf ein und schritt, so schnell es mit seinen kurzen Beinen möglich war, Richtung Michaelerkirche. Die nächtliche Dunkelheit senkte sich über die Stadt. Auf dem kurzen Weg kamen ihm keine Leute entgegen.
Als Heinrich das schwere Tor öffnete, mussten sich seine Augen an das Halbdunkel der Kirche gewöhnen.
In der Luft lag der Geruch von Weihrauch. Kerzen brannten zu beiden Seiten des Altars, einige weitere in den Haltern an den Seitenwänden. Die singende Stimme des Pfarrers erfüllte das Kirchenschiff. Heinrich sah vereinzelt ein paar Leute in den Bänken sitzen.
Der Pfarrer der Michaelerkirche war Heinrich zuwider. Er trug ständig ein gütiges Lächeln vor sich her, das Heinrich aufgesetzt und scheinheilig erschien. Der Pfarrer sprach gerne dem Wein zu, wurde erzählt. Seine Vorliebe fürs Essen bewies die Rundung, die sich unter der Soutane abzeichnete.
Heinrich schloss das Tor, so leise er konnte, und tauchte in den Schatten des Seitenschiffes ein. Da ihn seine Mutter als Kind fast jeden Tag gezwungen hatte, mit ihr die Messe zu besuchen, verabscheute er Kirchen ebenso sehr wie Geistliche.
Und jetzt? Im Brief war gestanden, er solle das Mieder zum Beichtstuhl der Michaelerkirche bringen. Sollte er es vor den Beichtstuhl legen? Oder in jene Kammer, in der die Gläubigen knieten, wenn sie ihr Gewissen erleichterten? Unentschlossen stand Heinrich da und wartete.
Der Pfarrer stimmte einen Singsang an, der sich nach einem Gebet anhörte.
Heinrich ging langsam auf den Beichtstuhl zu. Neben dem schrankartigen Gebilde aus Holz flackerte eine hohe Kerze. Ihr Schein fiel auf den Samtvorhang vor dem schmalen Raum für die Büßer. Der Vorhang war halb geöffnet. Der Beichtstuhl war leer.
Heinrich bemerkte eine Bewegung neben sich. Jemand erhob sich von der Kniebank vor der Pieta, die in der Seitenkapelle stand. Er kannte das Innere der Michaelerkirche von den zahlreichen Messbesuchen mit seiner Mutter auswendig. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte er damals begonnen, sich jedes Detail einzuprägen. Er sah die Skulptur in der Seitenkapelle vor seinem geistigen Auge: Maria, die den Leichnam Jesu auf dem Schoß hielt, umgeben von langen Strahlen aus vergoldetem Metall, das im Schein von Kerzen glänzte.
Die Betende war eine Nonne mit Flügelhaube. Den Kopf gesenkt, die Hände in den Ärmeln der Kutte gefaltet kam sie auf ihn zu. Neben ihm blieb sie stehen. Wortlos streckte sie eine Hand aus.
Wollte sie eine Münze?
Als Heinrich zögerte, fasste die Nonne einen Zipfel des Mieders, der unter dem Mantel vorragte, und zog daran. Heinrich war überrascht, leistete aber keinen Widerstand. Er ließ zu, dass sie das Mieder an sich zog und in den weiten Ärmeln der Kutte verschwinden ließ. Die Nonne deutete ihm, zu warten, und ging mit ruhigen Schritten zum Ausgang der Kirche.
Heinrich konnte nicht glauben, dass ihm eine Nonne den Brief geschickt hatte. Verunsichert blickte er ihr nach. Wie lange sollte er noch hier stehen? Er zählte bis zehn, dann lief er zum Tor und trat auf den Michaelerplatz hinaus.
Die hohen Gaslaternen spendeten einen gelblichen Lichtschein. Zu seiner Linken erhob sich die grüne Kuppel des Michaelertors der Hofburg, zu seiner Rechten schritt ein Herr mit Zylinderhut eilig den Kohlmarkt hinunter. Die Nonne aber war nicht mehr zu sehen.
Als Heinrich in seinen Modesalon zurückkehrte, fühlte er sich erschöpft. Sein Anzug war durchnässt und er fror, obwohl es gar nicht so kalt war.
Was sollte er tun? Er konnte niemandem berichten, was er gerade getan hatte. Vor allem war es nicht möglich, bis morgen ein neues Mieder anzufertigen, wenn er das Kleid der Fürstin zur Anprobe bringen sollte.
Vielleicht schaffte er es, sie mit einem Gespräch über die kommende Mode abzulenken, damit sie die Anprobe vergaß oder deren Verschiebung gelassen hinnahm. Doch Heinrich hatte wenig Hoffnung. Er wusste, wie wichtig der Fürstin ihre Garderobe war. Immerhin wollte sie sich mit der schönsten Frau Wiens messen.
Dienstag,11.September1866
03
»Erdtöne. Ich will veredelte Erdtöne sehen. Ein Orange wie frisch gebrannter Lehm. Oder Terracotta wie die Fliesen in einem italienischen Palazzo. Dazu ein tiefes Grün wie das Grün der Blätter nach einem Sommerregen.«
Während sie ihren kleinen Farbvortrag hielt, schritt Paula in ihrem Boudoir auf und ab. Der Raum konnte mit den kleineren Salons des Palais mithalten.
Auf der Kante der Récamiere mit ihren geschnitzten, vergoldeten Füßen und dem taubenblauen Überzug saß Heinrich Brettschmidt mit einem in Leder gebundenen Notizbuch auf den Knien, in dem er eifrig notierte, was seine beste Kundin vortrug.
Brettschmidt wusste, dass Paula von Mayenberg für ihn und seinen Salon das beste Aushängeschild war. Was sie zu öffentlichen Anlässen trug, wollten andere Damen danach auch haben. Auf diese Weise war der Salon immer mehr gewachsen und beschäftigte mittlerweile fast vierzig Näherinnen.
Die Fürstin holte einige Fotos von ihrem kleinen Damenschreibtisch und zeigte sie ihm. »Solche Kleider werden diesen Herbst in Paris getragen. Meine teure Freundin Charlotte hat mir die Bilder geschickt. Sie können sie als Vorbild verwenden. Außer mir weiß niemand, dass die Ideen zu den Kleidern aus Paris stammen.«
Brettschmidt drückte sich einen Zwicker auf die Nase, weil seine Sehkraft in letzter Zeit etwas nachgelassen hatte, und studierte ein Bild nach dem anderen durch die kleinen runden Gläser.
»Die Stoffe sind vor allem schwere Seide«, erklärte Paula. »In Paris tragen Damen nicht mehr nur ein Tageskleid. In Mode sind besonders Nachmittagskleider, in denen man Besuche macht oder Besucher empfängt.«
Brettschmidt studierte die Form der Krinolinen. Sie waren vorne eher flach, verlagerten Weite und Fülle nach hinten und boten den Schleppen auf diese Weise einen eleganten Fall.
»Besonders bemerkenswert finde ich die Promenadenkleider.« Die Fürstin deutete auf das Foto, das er in der Hand hielt. »Keine Schleppe und ein kürzerer Rock, der sogar über dem Fuß enden darf. Perfekt für Spaziergänge oder zum Schlendern durch die Einkaufsstraßen.«
Dem Schneidermeister stachen die breiten Goldborten und Bänder aus geklöppelter Spitze ins Auge. Sie waren in Kontrastfarben gehalten und streckten die Silhouette der Trägerin. Alles Ideen, die in der Wiener Gesellschaft Anklang finden würden.
Jemand klopfte an die halb offene Tür. Der Fürst betrat das Boudoir, steif und aufrecht wie immer. Das hellgraue Haar war kurz geschnitten, der Scheitel wie mit dem Lineal gezogen. An Pomade hatte Ludwig von Mayenberg sichtlich nicht gespart.
Brettschmidt verneigte sich. Sein Gruß wurde nicht erwidert.
»Ich wollte mich verabschieden«, sagte der Fürst.
»Viel Glück beim Würfeln«, wünschte ihm Paula.
»Danke, Liebes.«
»Ich muss doch nicht fürchten, dass du ein Vermögen verspielst wie der bedauernswerte Friedrich«, scherzte seine Frau.
»Friedrich ist ein Dummkopf. Er dachte, man kann das Glück erzwingen. Er war immer schon viel zu leichtgläubig.«
»Verstand ist ein Geschenk der Götter, das von Sterblichen nicht um viel Geld erworben werden kann«, entgegnete ihm die Fürstin.
»So scheint es zu sein. Warte nicht auf mich. Es kann spät werden.« Die Fürstin streckte ihren rechten Arm vor, den Handrücken zu ihm geneigt. Ihr Mann trat näher, ergriff die Hand und beugte sich darüber, ohne sie mit seinen Lippen zu berühren. Nach diesem förmlichen, aber gekonnten Handkuss verließ er den Raum auf dieselbe energische Art, wie er ihn betreten hatte.
»Frönen Sie auch der Spielleidenschaft?«, wollte Paula von ihrem Schneider wissen.
Heinrich lächelte bescheiden. »Manchmal dem Würfelspiel. Mit sehr kleinem Einsatz allerdings.«
»Der wöchentliche Würfelabend ist die Verbindung zu seinen alten Offizierskameraden«, erklärte Paula.
Der Schneider nickte, als wäre ihm ein solches Verhalten vertraut. Er hatte in Wirklichkeit aber keinerlei Beziehungen zur Welt der kaiserlichen Armee.
Paula von Mayenberg sah sich suchend um. »Wo ist eigentlich das Kleid für den Ball beim Erzherzog? Ich dachte, Sie bringen es heute zur Anprobe mit.«
Die Fürstin erschien Heinrich, dessen Beine aufgrund einer Wachstumsstörung zu kurz geblieben waren, noch größer als sonst.
»Durchlaucht«, begann Heinrich zaghaft, »ich muss mit großem Bedauern mitteilen, dass wir die Raffinessen des Entwurfs noch nicht fertig haben. Es wäre von großer Wichtigkeit, dass die Schneiderinnen, die daran arbeiten, die Anprobe leiten und allfällige Änderungen auf der Stelle vornehmen könnten. Darf ich Sie bitten, dazu in meinen Salon zu kommen?«
Die Fürstin seufzte, als wäre diese Mitteilung ein schwerer Schicksalsschlag. »Ich würde eine Anprobe hier bevorzugen. Aber Sie lassen mir wohl keine andere Wahl.«
»Ich bedanke mich und bitte um Verständnis, dass es vor allem im Sinne der Passform des Kleides ist.«
Wieder wurde geklopft. Diesmal war es Leopold, ein Diener, der Heinrich so alt erschien, dass er Fürst von Mayenbergs Vater hätte sein können. Angeblich hatte er schon für dessen Eltern gedient, die beide bereits lange tot waren.
»Durchlaucht, Contessa Elisa ist eingetroffen.«
»Ist es schon fünf Uhr?«
»Schlag fünf Uhr, Durchlaucht.«
»Ich habe die Zeit übersehen. Bringen Sie die Contessa in den kleinen Salon. Servieren Sie Tee und den Zwetschenkuchen, den die Köchin gebacken hat.«
»Sehr wohl.« Mit einer Verbeugung verschwand Leopold und schloss die Tür hinter sich.
04
Die Verabschiedung der Fürstin war eilig ausgefallen. Als Termin für die Anprobe hatte sie Freitagnachmittag genannt, ohne sich auf eine bestimmte Zeit festzulegen. Wenn Paula von Mayenberg kam, musste Heinrich zur Verfügung stehen, egal welche Kundinnen sonst warteten.
Brettschmidt verließ das Palais, das als eine der ersten Adressen der Wiener Gesellschaft galt. Einladungen zu den Cercles und Festen der Fürstin waren begehrt, die Themen ihrer Bälle wurden stets heftig diskutiert.
»Alles in Weiß« war das Motto im vergangenen Sommer gewesen. Angeblich, so hatte Brettschmidt von Leopold erfahren, plante sie bereits das nächste Fest unter dem Titel »Reise zum Mars«. Inspiriert hatte sie der eben erschienene Roman des französischen Schriftstellers Jules Verne, der eine Reise zum Mond beschrieb.
Für Brettschmidt waren solche Informationen wichtig, da er sich rechtzeitig Stoffe, Accessoires und Entwürfe für Abendroben überlegen konnte, die jenen Damen gefallen würden, die zu einem dieser Feste geladen waren. Leopold bekam deshalb regelmäßig Trinkgeld von Heinrich, das er mit seinen knochigen Fingern schnell in der Hosentasche verschwinden ließ.
Ein Fiaker brachte Brettschmidt zurück in die Wiener Innenstadt. Der Bau der Ringstraße schien kein Ende zu nehmen, von der zukünftigen Pracht war außer Dreck und Staub noch nichts zu sehen. Der Kutscher musste aufgrund neuer Absperrungen einen Umweg fahren.
Der Salon der Schneiderei Brettschmidt nahm den gesamten ersten Stock eines Hauses neben der k.k. Hofzuckerbäckerei Demel ein und war über ein elegantes Treppenhaus mit Marmorwänden und kunstvoll geschmiedeten Geländern zu erreichen.
Die Räume zum Kohlmarkt hin besaßen hohe Fenster, die selbst im Winter viel Licht hereinließen. Die Salons waren durch Doppelflügeltüren verbunden, mit Stuckdecken und weißgoldenen Wandverzierungen ausgestattet. Für das Umkleiden konnten sich die Damen hinter Paravents zurückziehen, wo ihnen Mädchen der Schneiderei beim Ablegen und Anlegen der Kleidungsstücke behilflich waren.
Zwischen den Fenstern waren Spiegel bis zur Decke angebracht, damit die Damen im einfallenden Tageslicht ihre neuen Roben betrachten konnten. Brettschmidt hatte die Spiegel mit einer merkbaren Wölbung nach innen versehen lassen, gerade so viel, wie das Glas zuließ. Auf diese Weise wurde das Spiegelbild der Betrachterinnen leicht in die Länge verzerrt, was Damen mit üppigerem Leibesumfang schlanker erscheinen ließ.
Als Heinrich die Eingangstür des Salons öffnete, eilte ihm seine erste Schneiderin, Nora Schmorr, entgegen.
»Ihre Frau Mutter möchte Sie sofort sprechen! Sie hat schon viele Male nach Ihnen gefragt.«
Am leidenden Gesichtsausdruck von Nora konnte Heinrich Brettschmidt erkennen, wie groß der Unmut seiner Mutter bereits war.
»Ich gehe später zu ihr«, sagte er.
»Im grünen Salon wartet …«
»Ich weiß, wer zur Anprobe hier ist«, unterbrach Heinrich die beginnende Anklage über seine Verspätung. »Bringen Sie der Gräfin schon das Kleid, ich komme in Kürze. Servieren Sie ihr das Konfekt vom Demel, das sie so gerne isst. Schokolade hat eine beruhigende Wirkung auf sie.«
Nora blickte missbilligend. Wie üblich. Sie war mit kaum etwas einverstanden, was Heinrich entschied oder tat. Das war wohl der Grund, warum sie sich so gut mit seiner Mutter verstand, die den Salon mit seinem seligen Vater begründet hatte.
Heinrichs Büro befand sich vor dem weitläufigen Raum, in dem die Näherinnen an Tischen und den Nähmaschinen arbeiteten. An trüben Tagen mussten hier selbst im Sommer Petroleumlampen eingesetzt werden.
Heinrich trug den Schlüssel seines Büros an einer kleinen Kette in einer Innentasche an seinem Hosenbund. Er hatte sich diese Tasche in alle Hosen einnähen lassen. Mit einem Finger fischte er nach der Kette und zog den Schlüssel heraus. Er schloss auf und betrat den engen Raum. Ein hohes Regal war gefüllt mit Auftrags- und Kontobüchern. In den Fächern der anderen Regale türmten sich Stoffmuster, Kartons mit Knöpfen, Borten und Bändern und Mappen mit Entwürfen. Heinrich malte sie in Aquarell. Sein Einfallsreichtum gepaart mit ein wenig Talent als Maler hatten großen Anteil an dem Erfolg seines Salons.
An diesem Tag sperrte Heinrich die Tür von innen wieder ab. Er wollte von niemandem überrascht werden. Er trat an ein Regal, ging in die Knie und ließ die Hand suchend über die Unterseite des tiefsten Faches gleiten. Schnell hatte er den Umschlag ertastet, den er dort angebracht hatte. Seine Beine schmerzten beim Aufstehen, da seine Gelenke sich nie vollständig entwickelt hatten.
Mit zwei Briefbögen in der Hand kehrte er an seinen Schreibtisch zurück. Mit dem Arm schob er Malfarben, Pinsel, Mappen, Tintenfass und mehrere Federn an den Rand des Tisches und legte die Seiten vor sich hin. Beide waren mit schwarzer Tinte in großen Buchstaben beschrieben.
MÖRDER!BLUT AN DEINEN HÄNDEN.FLECKEN AUF SEELE UND KLEIDERN.ICH WEISS VON VALERIA.
Die erste Nachricht war am Freitagmorgen in einem Umschlag vor der Tür des Salons gelegen. Es hatte nur sein Name darauf gestanden.
Heinrich konnte von Glück reden, dass er an diesem Tag als Erster den Salon aufgesperrt hatte. Die Näherinnen benutzten den Eingang durch den Hof. Aber seine Mutter oder Nora hätten den Brief finden können. Es hätte Fragen ohne Ende gegeben, wer einen Brief für ihn vor der Tür hinterließ und was der Inhalt war.
VALERIA
Wenn er den Namen las, begann sein Herz zu rasen.
Außer ihm wusste doch niemand von ihr. Er war sich sicher, dass alles ein Geheimnis zwischen ihnen beiden geblieben war. Ein Geheimnis, das sie in den Tod mitgenommen hatte.
Das zweite Blatt war mit der gleichen schwarzen Tinte beschrieben. Die Feder hatte, genau wie in der ersten Nachricht, bei den Schlingen nach unten gekleckst.
Den Umschlag, in dem der Brief gekommen war, hatte er Montagfrüh an derselben Stelle vor der Eingangstür des Salons vorgefunden.
DAS MIEDER DER NEUEN BALLROBEFÜR FÜRSTIN P MMONTAG, ERSTER BEICHTSTUHLRECHTS MICHAELERKIRCHEWÄHREND DER ABENDANDACHT
Heinrich musste ausführen, was von ihm verlangt wurde. Wer auch immer ihn erpresste, kannte ein Geheimnis, das ihn und damit auch den Salon ruinieren konnte, wenn es an die Öffentlichkeit gelangte. So hatte er das Mieder aus der Werkstatt geholt, wo es neben dem fast fertigen Kleid hing, in seinen Mantel geschlagen und in die Michaelerkirche gebracht, wo es ihm die rätselhafte Nonne abgenommen hatte.
Heute Morgen war eine dritte Nachricht eingetroffen. Wieder war es nur eine Seite, mit wenigen Worten beschrieben:
ABHOLUNGBEICHTSTUHLHEUTE WÄHREND DER ABENDANDACHT
Heinrich hatte den Brief in die Jackentasche gesteckt und sich den ganzen Tag den Kopf zermartert, wozu jemand von ihm ein Mieder als Schweigegeld verlangte und es dann zurückgab.
Wer hatte die drei Umschläge vor die Eingangstür des Salons gelegt? Das Haustor wurde um elf Uhr nachts abgesperrt und um fünf Uhr wieder geöffnet. Heinrichs Vermutung war, dass jemand die Briefe sehr spät oder sehr früh gebracht haben musste.
»Herr Brettschmidt, lassen Sie Ihre Mutter nicht länger warten.« Nora klopfte mit ihren harten Knöcheln von außen an die Tür. »Die gnädige Frau ist bereits sehr ungehalten.«
»Sagen Sie ihr, ich müsse mich um nicht aufschiebbare Geschäfte kümmern.« Heinrich versteckte die drei Briefe wieder unter dem Regalbrett. Bis zur Abendandacht waren es noch drei Stunden.
05
Fanny Feifalik stand hinter Elisabeth und zog die Bürste mit langsamen, sanften Bewegungen durch deren offenes Haar. Die langen Strähnen fielen hinter der Lehne bis zum Boden herab.
»Du musst dir etwas Besonderes einfallen lassen. Dazu habe ich dich eingestellt«, herrschte Elisabeth sie an.
Die Friseuse zuckte zusammen, erschrocken über die grobe Anrede, setzte ihre Arbeit aber sogleich unbeirrt fort. »Ich werde Vorschläge bringen, Majestät.«
»Keine Steckbrieffrisur wie üblich.«
»Sehr wohl, Majestät.«
»Die Frisur darf nicht frivol sein und ich will unter keinen Umständen aussehen, als hätte ich umgedrehte Schüsseln auf dem Kopf wie die Mayenberg.«
Elisabeth meinte damit eine Frisur, mit der Paula auf einem Gemälde aus ihren Jugendjahren zu sehen war.
»Mich hat das immer an dicke Hörner erinnert«, ereiferte sich die Kaiserin.
»Verlassen Sie sich auf mich, Majestät. Ihre Frisur wird das Gesprächsthema des Abends sein.«
»Nicht nur die Frisur«, verbesserte Sisi. »Mein Kleid auch. Ich werde der Mayenberg zeigen, wer in Wien, wer in Österreich an höchster Stelle steht.«
Fanny nahm ein Fläschchen aus geschliffenem Kristallglas und zog den Verschluss heraus.
Sie trat nach vorn und hielt der Kaiserin die Öffnung unter die Nase.
»Orangenöl, Majestät. Es ist zur Pflege der Haare besonders geeignet, weil es Glanz und dennoch Leichtigkeit verleiht. Darf ich es anwenden?«
Elisabeth schnupperte an der Flasche. »Der Duft erinnert mich an Madeira. Die frischen Orangen im Herbst, die beim Aufschneiden diesen Geruch verströmt haben. Ich habe nie wieder so schmackhafte Früchte bekommen.«
Elisabeth war bis heute davon überzeugt, dass ihr die zwei Jahre fern vom Kaiserhof das Leben gerettet hatten. Die Luft der Blumeninsel hatte nicht nur ihrer kranken Lunge gutgetan, sie hatte für Elisabeth Freiheit bedeutet. Auf Madeira hatte sie innere Ruhe und Festigkeit finden können. Sie war vom Mädchen zur jungen Frau gereift.
Fanny Feifalik träufelte ein paar Tropfen des Öls auf ihre Handflächen, rieb sie leicht aneinander und fuhr dann mit gespreizten Fingern durch Elisabeths Haar, um das Öl zu verteilen.
Als die Friseuse damit fertig war, begann sie, die Haare kunstvoll zu drehen und zu flechten und anschließend Strähne für Strähne aufzustecken. Zum Befestigen verwendete sie dunkle Haarklammern, die in der Frisur nicht zu sehen waren.
»Au, pass doch auf!«, schimpfte Elisabeth. »Du hast mich gestochen.«
Fanny hob entschuldigend die Hände. »Verzeihung, Majestät.«
»Bei dieser Gelegenheit will ich dir gleich sagen, dass die Kämme, die du neulich zum Stecken und Halten verwendet hast, ebenfalls gekratzt und gestochen haben. Ich will sie nicht mehr auf meinem Kopf haben.«
»Sehr wohl, Majestät.« Fanny klang ein wenig beleidigt.
»Hast du mir heute gar nichts zu berichten?«, fragte die Kaiserin versöhnlich. »Du kennst doch sonst immer den neuesten Klatsch.«
»Nun ja, Majestät …«
Elisabeth bemerkte ein Zögern bei ihrer Friseuse, die sonst gerne drauflosplapperte. »Rede! Was ist es, das du gehört hast?«
»Ich wage nicht, auszusprechen, was der Kämmerer Ihres Schwagers erzählt«, begann Fanny vorsichtig.
»Der Paul?« Elisabeth hob die schlanke Hand. »Lass mich raten. Du antwortest nur mit richtig oder falsch.«
»Wie Sie wünschen.«
»Es geht um einen neuen Fehltritt von Luziwuzi.«
Die Friseuse atmete etwas tiefer ein als gewöhnlich.
»Also was nun? Richtig oder falsch? Ich bin sicher, dass es wieder um etwas geht, das Ludwig Viktor im betrunkenen Zustand angerichtet hat.«
»Falsch.«
Elisabeth war überrascht. »Falsch? Aber es hat mit dem Bruder des Kaisers zu tun?«
»Eigentlich nicht.«
»Also falsch. Du sollst nur mit den beiden Begriffen antworten!«
»Sehr wohl … richtig …«, stotterte Fanny.
»Was jetzt? Ist es falsch oder richtig?«
»Majestät lag richtig mit falsch.«
Elisabeth stöhnte auf. »Zum Kuckuck, Feifalik, erlauben Sie sich einen Scherz?«
»Nein, niemals, Majestät«, gab Fanny erschrocken zurück.
»Verbreitet mein Schwager wieder Unwahrheiten über mich?«, fragte Elisabeth.
»Richtig.«
»Kann dieser Widerling nicht endlich sein widerwärtiges Mundwerk halten und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern?«
Darauf konnte Fanny nichts erwidern.
»Also, was ist es? Raus damit, Feifalik.«
Die Friseuse zögerte erneut.
»Feifalik, ich befehle Ihnen, zu sprechen.« Der Ton von Elisabeth war scharf geworden.
»Ihr Herr Schwager soll tatsächlich dem Wein zugesprochen haben. Als er in der Nacht heimgekommen ist, hat ihn sein Kämmerer zu Bett gebracht.«
»Der gute Paul, der sich stets so treu sorgend um Luziwuzi kümmert«, bemerkte Elisabeth spitz. Man munkelte, dass Paul weit mehr als bloß ein Kämmerer für ihren Schwager war. »Erzähle weiter!«
»Ihr Herr Schwager hat davon gesprochen – seine Zunge war vom Alkohol gewiss sehr gelöst –, dass man fürchten muss, Sie bei Nacht anzutreffen, da Sie Mordgelüste hätten. Sie hätten es ihm beim Diner in der Hofburg anvertraut. Ihr Opfer soll Fürstin von Mayenberg werden.«
Auch wenn sie in diesem Moment der Feifalik am liebsten den Kamm aus der Hand gerissen und ihn voller Wut durch das Toilettezimmer der Hofburg geschleudert hätte, zwang sich Elisabeth zur Ruhe.
»Ich werde ihn zur Rede stellen«, kündigte Elisabeth an.
Es wurde geklopft. Ohne ein »Herein!« abzuwarten, ging die Türe auf. Ida trat ein.
Sie trug noch die Jacke über dem Kleid und auf ihrem Arm hing ein Regenschirm. Idas Atem ging schnell und stoßweise.
»Was hast du herausgefunden?«, wollte Elisabeth sofort von ihr wissen.
Nach Luft ringend deutete Ida ihr, dass sie noch einen Moment brauchte, bis sie ihren Bericht abgeben konnte.
Elisabeth nahm die Glocke, die vor ihr auf dem Frisiertisch stand, und schüttelte sie. Gleich darauf trat eine Zofe ein und erkundigte sich leise nach dem Begehr der Kaiserin.
»Ist das Meersalzbad bereit?«
»In einer Stunde, wie von Majestät gewünscht.«
»Ich will es früher.«
»Sehr wohl, Majestät.« Die Zofe knickste.
»Und mischen Sie die richtige Menge Salz ins Wasser«, fügte Elisabeth hinzu.
»Es sind vier Kilogramm, Majestät, wie immer.«
»Falsch«, rief Sisi. »Nehmen Sie die Hälfte, sonst wird meine Haut ausgetrocknet.«
»Wie Majestät wünschen!«
06
Ida tat die junge Zofe leid. Ihr Name war Grete und sie wurde von den älteren Zofen stets geschulmeistert und eingeschüchtert. Grete war anzusehen, dass sie Elisabeths Auftrag überforderte. Vielleicht konnte ihr Ida später ein wenig helfen, zuerst aber musste sie Elisabeth die gewünschten Informationen überbringen. Die Kaiserin war äußerst gereizt und ihre Geduld aufgebraucht.
»Elisabeth«, begann Ida.
Erst jetzt fiel ihr die Anwesenheit der Friseuse auf. Sie hätte eigentlich schon am Morgen die Frisur der Kaiserin stecken sollen, aber Elisabeth war von Kopfschmerzen geplagt worden und hatte das Frisieren auf den Nachmittag verschieben lassen. Für den Abend stand ein Besuch der Hofoper an, wo »Tristan und Isolde« von Richard Wagner aufgeführt wurde.
»Majestät«, verbesserte sich Ida schnell. »Ich konnte nicht nur mehr über das Kleid erfahren, sondern auch über den Schmuck, den Fürstin von Mayenberg tragen wird.«
»Sag schon«, drängte Elisabeth.
»Ihre Kleider kommen aus dem Salon von Berta Brettschmidt am Kohlmarkt. Die alte Frau Brettschmidt ist immer noch jeden Tag dort und hat ihre Augen und Finger überall, obwohl ihr Sohn die Geschäfte leitet.«
»Das klingt wie meine Schwiegermutter«, stellte Elisabeth trocken fest.
Jeder wusste von der angespannten, geradezu feindseligen Beziehung zwischen Erzherzogin Sophie und der Kaiserin. Hatte Elisabeth sich auch eine Vormachtstellung erkämpft, sparte die Erzherzogin doch nicht mit Sticheleien und spitzen Bemerkungen, die am Hof sofort die Runde machten.
»Ich habe Berta Brettschmidt aufgesucht, als ihr Sohn auswärts beschäftigt war. Er ist es, der die Kleider der Fürstin entwirft, aber seine Mutter weiß über jedes Bescheid.« Ida musste Luft holen, bevor sie weitersprechen konnte. »Oberst Latour war mir sehr behilflich, das alles in Erfahrung zu bringen.«
Josef Latour war der Erzieher des Kronprinzen, den die Kaiserin gegen den Willen ihres Mannes eingesetzt hatte.
»Der Herr Oberst besucht manchmal das Wirtshaus nahe meiner Wohnung in Schönbrunn«, fuhr Ida fort.
Das Wirtshaus war für die zahlreichen Bediensteten des Schlosses eingerichtet worden und befand sich in einem Nebentrakt. Frequentiert wurde es nicht nur von Angestellten des Kaiserhofs, sondern auch von Kutschenfahrern und den Bediensteten so mancher feinen Herrschaft Wiens.
»Im Wirtshaus gibt es immer einiges zu erfahren«, erklärte Ida.
»Der Herr Oberst klatscht?«, entfuhr es Fanny.
»Still«, befahl Elisabeth. Die Friseuse schloss den Mund.
Ida bereitete die Zurechtweisung der Feifalik Genugtuung. Sie bewunderte die Qualitäten ihrer Frisierkunst zwar, doch empfand sie Fanny oft als vorlaut.
»Oberst Latour schätzt den Schweinsbraten mit Knödel und Sauerkraut, den es jeden Sonntag im Wirtshaus gibt. Er sagt, der Braten wäre nirgendwo saftiger, die Schwarte nicht knuspriger«, erklärte Ida.
»Ida, komm zur Sache«, ermahnte sie die Kaiserin.
Die Hofdame bemerkte, wie die Mundwinkel der Feifalik triumphierend zuckten.
»Sache ist«, setzte sie betont ruhig fort, »dass der Herr Oberst den Kutscher der Fürstin angetroffen hat, der sich mit ihrer Zofe gut versteht. So konnte er einiges über die Herkunft der Garderobe der Fürstin erfragen. Außerdem ist Berta Brettschmidt dem Herrn Oberst nicht unbekannt, da eine seiner Tanten sich mit ihr von Zeit zu Zeit beim Demel auf ein Stück Torte trifft und Neuigkeiten austauscht. Bei ihr hat sich Frau Brettschmidt mehrfach über ihren Sohn beschwert, der sie aus dem Tagesgeschäft ausschließt und sie am liebsten schon auf dem Friedhof sehen würde, wie sie es ausdrückt.«
»Du warst also bei ihr und sie hat dir das Kleid gezeigt?«, drängte Elisabeth, zu erfahren.
»Ich habe dem Anselm, dem Hundsbuben, den Auftrag gegeben, Ihren Hund Shadow beim Kohlmarkt spazieren zu führen. Er sollte sofort zurückkommen und mich wissen lassen, wenn Brettschmidt den Salon verlässt.«
Elisabeth gab einen erleichterten Laut von sich. »Deshalb war der Shadow so lange fort. Ich war schon in Sorge, weil er auf meine Rufe nicht reagiert hat.«
»Als ich die Meldung erhalten habe, Brettschmidt wäre mit dem Fiaker zum Palais der Fürstin gefahren, bin ich in den Salon gegangen und habe verlangt, mit der alten Brettschmidt zu sprechen. Sie war hocherfreut, dass ich zu ihr und nicht zu ihrem Sohn kommen wollte«, erzählte Ida.
»Du hast aber nicht verraten, dass du von mir kommst?«, fragte Elisabeth besorgt.
»Keine Angst. Sie weiß nicht, für wen ich arbeite. Ich habe es vage gehalten. Ich habe ihr vom Demel eine Schachtel Katzenzungen gebracht und sie hat mir dafür das Kleid beschrieben, das die Fürstin zum Ball bei Ludwig Viktor tragen wird. Frau Brettschmidt hat mir auch verraten, dass die Fürstin von ihrem Mann neuen Schmuck speziell für diesen Anlass bekommen wird. Es sei wohl ein Geschenk zu ihrem Geburtstag. Laut Brettschmidts Sohn werden die Stücke soeben erst fertiggestellt.«
»Der Name des Juweliers?«, verlangte Elisabeth, zu erfahren.
»Ballarin. Giuseppe Ballarin aus Venedig. Er hat seine Werkstatt in der Vorstadt, in der Schottenfeldgasse. Laut Frau Brettschmidt erfreue er sich großer Beliebtheit bei den Damen von Wien. Dazu trage die Fürstin sehr bei, die ihn empfehlen soll.«
»Such den Juwelier auf, Ida«, sagte die Kaiserin. »Auch wenn kein Schmuckstück mit dem Schmuck konkurrieren kann, den mir der Kaiser geschenkt hat, kann es nicht schaden, zu wissen, was die Mayenberg tragen wird.«
07
Fürst Ludwig von Mayenberg trank seinen Kaffee schwarz und ohne Zucker. Sein Gegenüber, Graf Wenzel von Grünau, bevorzugte den Einspänner: schwarzer Kaffee im Glas mit etwas heißem Wasser verdünnt und einer Portion Schlagobers obenauf.
Die beiden Herren saßen am Fenster des Café Frauenhuber in der Himmelpfortgasse und vertrieben sich die Zeit mit einer Partie Schach.
»Wie fühlt man sich als Generalmajor?«, erkundigte sich der Graf.
»Geh, hör mir auf.« Fürst von Mayenberg schnaubte kurz durch die Nase. »Du weißt genauso gut wie ich, dass der Titel nur ein Abschiedsgeschenk war. Männer meines Alters sind nicht mehr erwünscht, also hat man mich möglichst schnell in Pension geschickt, wo ich mich Generalmajor nennen darf.«
»Mit Titel und Charakter«, fügte der Graf mit einem Lächeln hinzu. »Sei nicht undankbar.«
Er deutete auf sein Bein, das seitlich unter dem Tisch vorragte. »Besser, als nach einer schweren Verwundung und mit einem steifen Bein in den Ruhestand gehen zu müssen.«
»Wie schreitet die Heilung voran?«
»Es geht.« Der Graf warf einen Blick auf seine Taschenuhr. »In einer Stunde brechen wir auf. Willst du noch einen frischen Kaffee?«
»Nein. Einer ist mir genug.«
Der Graf winkte dem Kellner. »Gustav, bringen Sie mir das Gleiche noch einmal.« Gustav quittierte die Bestellung mit einem Nicken und verschwand Richtung Theke.
»Was bildet sich dieser Ballarin eigentlich ein?«, empörte sich der Fürst, zog mit dem weißen Rössel vor und kassierte einen schwarzen Bauern.
»Was sehen unsere Frauen in ihm, sollten wir uns fragen«, meinte Graf von Grünau. »Oder anders ausgedrückt: Was hat er an sich, das unsere Frauen dermaßen bezirzt? Sie sind ihm – könnte man glauben – verfallen.«
»Die Meinige lehnt jeden anderen Schmuck ab.« Fürst von Mayenberg überlegte seinen nächsten Zug, doch erst war der Graf an der Reihe. »Ich habe ihr beim Köcher ein Collier mit Smaragden gezeigt, dass die Kaiserin vor Neid erblassen lassen hätte, aber sie wollte es nicht. Zu ihrem 36. Geburtstag wollte sie bloß Stücke von diesem Italiener.«
Graf von Grünau sah auf. »Du hast Glück, eine so junge Frau zu haben.«
Das sah Ludwig genauso. Er war kein Mann, der viel lächelte. Wenn er aber an Paula dachte, spürte er jedes Mal, wie seine Mundwinkel nach oben zuckten. Sie war ein spätes Glück in seinem Leben, für das er große Dankbarkeit empfand.
»Wie alt ist die Deinige?«, fragte er seinen Schachpartner.
»Ein Jahr älter als ich. 57.«
Der Graf ließ den schwarzen Läufer schräg über die Felder des Schachbretts gleiten und stellte ihn nahe dem weißen König ab.
»Du hältst das für einen guten Zug, nicht wahr?« Der Fürst hatte gehofft, sein Spielpartner möge die Gefahr übersehen, die er mit sich brachte. Nun ließ er ihn ein wenig zappeln, bevor er ihm zeigte, dass er die Partie nicht mehr gewinnen konnte. »Schade, dass du nicht das Geld eingesetzt hast, das du bei dir trägst, Herr Oberstleutnant. Sonst hätte mir das einen guten Zuschuss für Paulas Halsschmuck und den Kamm gebracht.«
Wenzel bekam seinen Kaffee und löffelte das Schlagobers. »Es ist unerhört, dass wir den bestellten Schmuck nur zu einer bestimmten Uhrzeit abholen dürfen und ihn sofort bezahlen müssen. Der Köcher würde das niemals verlangen und die Rechnung zustellen lassen. Wenn man dann ein wenig in Verzug gerät mit dem Bezahlen, nimmt er das auch nicht so schwer.«
Langsam näherte sich die Hand des Fürsten der Spielfigur, die er als Nächstes zu bewegen plante.
Der Graf lehnte sich zurück und klopfte auf die Tischplatte. »Ludwig, du weißt, ich halte nicht viel von Tratsch.«
»Tatsächlich?« Spott schwang in der Stimme des Fürsten mit. Sein ehemaliger Hauptmann, der unter ihm in der Armee des Königs beider Sizilien gedient hatte, war bekannt für sein loses Mundwerk, auch wenn er selbst das naturgemäß völlig anders sah.
»Ich wünschte, meine Gattin wäre auf irgendetwas so versessen wie auf Tratsch. Wenn sie sich mit ihren Freundinnen getroffen hat, höre ich mindestens drei Abende beim Essen nichts anderes als die neuesten Gerüchte aus der Wiener Gesellschaft. Manche sogar zwei- und dreimal«, klagte Graf von Grünau.
»Wieso erwähnst du das jetzt?«
»Weil es auch ein Gerücht über den Juwelier gibt. Allerdings nicht von den Damen, sondern von anderer Seite.«
»Was meinst du mit ›anderer Seite‹?«
»Mein Schneider hat etwas erwähnt.«
»Drück dich klar aus oder behalte es für dich«, verlangte der Fürst.
»Mein Schneider bezieht Stoffe aus Venedig«, flüsterte der Graf. Er hatte sich über das Schachbrett gebeugt und blickte Fürst von Mayenberg verschwörerisch an. »Und dort hat angeblich niemand den Namen Giuseppe Ballarin je gehört.«
Wenzel von Grünau lehnte sich wieder zurück. »Allerdings ist mein Schneider ein Cousin vom Juwelier Köcher und der könnte dieses Gerücht in die Welt gesetzt haben, weil ihm Ballarin viel Geschäft wegnimmt.«
»Eben.« Ludwig von Mayenberg zögerte den Zug genüsslich hinaus. Es war der vorletzte, bevor er seinen alten Kameraden schachmatt setzen würde.
»Ballarin ist ein frecher, arroganter und widerlicher Kerl, das kann ich aus den Erfahrungen, die ich mit ihm persönlich gemacht habe, bestätigen.« Der Fürst nahm den letzten Schluck seines Kaffees, der längst kalt geworden war.