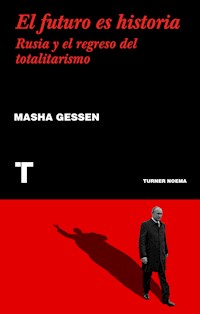15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nicht nur Russland, Ungarn oder die Türkei sind autokratische Staaten. In den USA werden täglich demokratische Prozesse missachtet, korrodieren Rechtsystem und kulturelle Normen, verfallen Bürger dem Versprechen radikaler Einfachheit, der Aufteilung der Welt in »Us« und »Them«. Vor dem Hintergrund einer im postsowjetischen Russland verbrachten Jugend beschreibt Masha Gessen das Versagen von Institutionen, Medien und Opposition und das Ende der Würde in der US-amerikanischen Politik. Das Buch ist eine messerscharfe und schonungslose Analyse, wie Autokratien entstehen, eine Anleitung zum Widerstand – und ein Handbuch für den Wiederaufbau der Zivilgesellschaft in einem Land, das auch nach einer Abwahl Trumps nicht zur Tagesordnung übergehen kann.
Masha Gessen erhält 2023 den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken.
»Kaum jemand hat die subversive Kraft antidemokratischer und autoritärer Ideologien und Regime so präzise analysiert wie Masha Gessen.« Carolin Emcke.
»Eine unverzichtbare Stimme in der heutigen Zeit.« Timothy Snyder, Autor von »Über Tyrannei. 20 Lektionen für den Widerstand«.
»Masha Gessens Überlegungen zu den weltweit grassierenden autokratischen Regierungsformen sollten Pflichtlektüre für jeden denkenden Menschen sein.« Daniel Schreiber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Kaum jemand hat die subversive Kraft antidemokratischer und autoritärer Ideologien und Regime so präzise analysiert wie Masha Gessen.«
Carolin Emcke
»Eine unverzichtbare Stimme in der heutigen Zeit.«
Timothy Snyder, Autor von »Über Tyrannei. 20 Lektionen für den Widerstand«
»Masha Gessens Überlegungen zu den weltweit grassierenden autokratischen Regierungsformen sollten Pflichtlektüre für jeden denkenden Menschen sein.«
Daniel Schreiber
Nicht nur Russland, Ungarn oder die Türkei sind autokratische Staaten. In den USA werden täglich demokratische Prozesse missachtet, korrodieren Rechtsystem und kulturelle Normen, verfallen Bürger dem Versprechen radikaler Einfachheit, der Aufteilung der Welt in »Us« und »Them«.
Vor dem Hintergrund einer im postsowjetischen Russland verbrachten Jugend beschreibt Masha Gessen das Versagen von Institutionen, Medien und Opposition und das Ende der Würde in der US-amerikanischen Politik. Das Buch ist eine messerscharfe und schonungslose Analyse, wie Autokratien entstehen, eine Anleitung zum Widerstand – und ein Handbuch für den Wiederaufbau der Zivilgesellschaft in einem Land, das auch nach einer Abwahl Trumps nicht zur Tagesordnung übergehen kann.
Über Masha Gessen
Masha Gessen, geboren 1967 in Moskau, wurde mit Büchern wie »Der Mann ohne Gesicht: Wladimir Putin. Eine Enthüllung« (2012) und »Der Beweis des Jahrhunderts. Die faszinierende Geschichte des Mathematikers Grigori Perelman« (2013) bekannt. »Die Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und verlor« wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem National Book Award 2017 und dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2019. Gessen schreibt für das Magazin The New Yorker. Masha Gessen lebt in New York.
Henning Dedekind, geboren 1968, übersetzt aus dem Englischen. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören Ronan Farrow, Masha Gessen, David Graeber, Evgeny Morozov und Bob Woodward.
Dr. Karlheinz Dürr, geboren 1947, übersetzt politische und historische Sachbücher aus dem Englischen. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören Noam Chomsky, Henry Kissinger und Michael Moore.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Masha Gessen
Autokratie überwinden
Aus dem Amerikanischen von Henning Dedekind und Karlheinz Dürr
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil 1: Ein autokratischer Versuch
1. Wie sollen wir es nennen?
2. Warten auf den Reichstagsbrand
3. Der Styropor-Präsident
4. Wir könnten es eine »Kakistokratie« nennen
5. Wir könnten es als »Korruption« bezeichnen
6. Wir könnten es »autokratische Ambition« nennen
7. Wir könnten »destruktive Herrschaft« dazu sagen
8. Das Ende der Würde
9. Mueller konnte uns nicht retten
10. Die Institutionen konnten uns nicht retten
Teil 2: Herrscher über die Realität
11. Worte und Wortsinn
12. Die Machtlüge
13. Die Twitter-Falle
14. Eine Normalisierung ist (fast) unvermeidlich
15. Widerstand in Trumps Krieg gegen die Medien
16. Wie die Politik stirbt
Teil 3: Wer ist »Wir«?
17. Trumps Präsidentschaft: weiß, männlich, rassistisch
18. »Werft die Maske der Heuchelei ab«
19. Die Antipolitik der Furcht
20. Konfrontation mit der Zivilgesellschaft
21. Die Macht der moralischen Autorität
22. Wer ist »wir«? Und wer sind wir?
Epilog
Danksagung
Anmerkungen
Impressum
Prolog
Die gesamte Bandbreite von Donald Trumps Repertoire war den Amerikanern sattsam bekannt, als er am Abend des 11. März 2020 endlich beschloss, sich an die Nation zu wenden und über die Corona-Pandemie zu sprechen:1 Regieren durch Gesten, Verschleierung und Lügen, Eigenlob, gezielt geschürte Angst und Drohungen. Wiederholt hatte er das Coronavirus als milde Grippe und sogar als Schwindel abgetan; er hatte vorhergesagt, dass es auf wundersame Weise wieder verschwinden werde. Es war nun zwei Monate her, seit China, wo die Krankheit erstmals aufgetreten war, den Gencode des Virus öffentlich zugänglich gemacht hatte.2 Die Vereinigten Staaten hatten diese Zeit größtenteils verschwendet.3 Krankenhäuser wurden nicht ausgestattet, um mit der drohenden Flut neuer Patienten fertigzuwerden. Schutzkleidung und -materialien waren knapp. Wichtige Informationen wurden vom Weißen Haus unter Verschluss gehalten.4 Es gab keine Tests. Nun, da sich das Virus im Land ausbreitete, war es zu spät für eine Prävention, und niemand hatte einen Plan, wie man die Epidemie abschwächen oder verlangsamen könnte. Im Staate Washington, wo die ersten Corona-Toten zu beklagen waren, machte sich Panik breit,5 dann in Kalifornien, New York und anderswo. Schließlich trat Trump im Fernsehen auf.
Er spulte also sein gesamtes Repertoire ab: Er verkündete ein Einreiseverbot für Reisende aus Europa – das war seine große Geste. Er rühmte sich, »äußerst rasch und professionell« zu reagieren, versprach flächendeckende Tests und wirksame antivirale Therapien und beruhigte seine Zuhörer, dass die Krankenversicherungen sämtliche anfallenden Kosten dafür übernähmen; das war seine Verschleierungs- und Lügentaktik. Solche Beteuerungen vermischten sich nahtlos mit Eigenlob, wozu auch gehörte, die amerikanischen Maßnahmen als »äußerst aggressiv und umfassend« zu bezeichnen, zu behaupten, man gehe mit der Epidemie besser als die europäischen Länder um, und die Versicherung, dass die Vereinigten Staaten bestens vorbereitet seien. Nichts davon war wahr. Schließlich folgte noch die Panikmache, als Trump COVID-19 ein »ausländisches Virus« nannte und mit dem Finger auf Europa zeigte. Bald darauf verfiel er auf einen noch besseren Namen – »China-Virus« –, was zu einem Anstieg der Hasskriminalität gegen Amerikaner asiatischer Herkunft führte.
An jenem Abend las Trump offenbar von einem Teleprompter ab. Er klang sehr ernst. Mit anderen Worten: Dies war eine jener Gelegenheiten, bei denen er für manche Menschen präsidial war, weil er nicht völlig derangiert klang. So verteidigte der ehemalige Gouverneur von Ohio, der Republikaner John Kasich, Trump auf CNN mit den Worten, er habe »seine Sache gut gemacht«6 – zum Teil, weil er von einem Skript abgelesen hatte. Aber genau deshalb, weil der Präsident an jenem Abend keinen Totalaussetzer hatte, sondern nur die Fakten verschleierte und sich selbst erhöhte, wie man es von ihm gewohnt war, war das, was wir in dieser Ausnahmesituation von ihm hörten, typisch Trump.
Über die nächsten paar Wochen wies Trump jede Verantwortung für die Krise von sich und sagte einmal, als man ihn auf die Verfügbarkeit von Tests ansprach, sogar wörtlich: »Nein, ich übernehme überhaupt keine Verantwortung.«7 Den Gouverneuren riet er, sich selbst um die Beschaffung von entsprechenden Gütern und Dienstleistungen zu kümmern, hatte aber keinerlei politische Richtlinien dafür parat.8 Bei den fast täglichen Pressekonferenzen im Weißen Haus betrat er das Podium, verkündete falsche medizinische Ratschläge, indem er etwa die Wirksamkeit nicht getesteter Medikamente pries,9 die manche Menschen dann prompt einnahmen.10 Lange weigerte er sich, den Defense Production Act anzuwenden,11 aufgrund dessen Unternehmen gezwungen werden können, essenzielle Güter herzustellen – offensichtlich, weil er befürchtete, dadurch die Profite seiner Kumpane in der Industrie zu schmälern.
Die ganze Zeit lobte er seine eigene Intelligenz und sein Vorgehen. Die Fernsehanstalten übertrugen diese Auftritte live; die Zeitungen berichteten darüber, ebenso wie über Trumps andere Verkündungen zum Thema Coronavirus, als wären es Positionen, Prinzipien und eine Strategie. Das Resultat: Selbst als die Krankenhäuser im ganzen Land überfüllt waren, Menschen starben und es mit der Wirtschaft bergab ging, behauptete mehr als die Hälfte aller Amerikaner, dass sie mit Trumps Reaktion auf die Pandemie zufrieden seien.12
Manche Menschen verglichen die Trump’sche Antwort auf COVID-19 mit der Reaktion der Sowjetregierung auf die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl im Jahre 1986. Ausnahmsweise war ein solcher Vergleich nicht weit hergeholt. Den Menschen, die dem größten Risiko ausgesetzt waren, wurden notwendige, potenziell lebenswichtige Informationen vorenthalten, worin ein Versagen der Regierung zu suchen war; auf der einen Seite gab es Gerüchte und Ängste, auf der anderen gefährliche Unwissenheit. Und natürlich kam es auch zu unschönen, vermeidbaren Tragödien. Um es klar zu sagen: Im Jahre 2020 hatten die Amerikaner einen weitaus besseren Zugang zu Informationen als die Sowjetbürger im Jahre 1986. In zwei Schlüsselpunkten jedoch glichen sich die Regierung Trump und die ehemalige Sowjetregierung: in der totalen Missachtung menschlichen Lebens und der monomanischen Fokussierung darauf, den Führer zu erfreuen, ihn unfehlbar und allmächtig erscheinen zu lassen.
Dies sind die Wesensmerkmale einer autokratischen Führung. In den drei Jahren seiner Präsidentschaft, sogar noch vor der Corona-Pandemie, kam Trump auf seinem Weg zu einer autokratischen Herrschaft weiter, als es die meisten Menschen für möglich gehalten hätten. Das vorliegende Buch ist ein Buch über diesen Wandel – und über die Hoffnung, die wir dennoch haben, die Autokratie des Trumpismus zu überwinden.
Teil 1 Ein autokratischer Versuch
1. Wie sollen wir es nennen?
Man kann fast jede beliebige Woche der Präsidentschaft Donald Trumps herausgreifen – eine Woche, in der er fast allem widersprach, was die Experten seiner eigenen Regierung über die Corona-Pandemie sagten, oder eine Woche, in der er auf die Richter des Obersten Gerichtshofs schimpfte, oder eine Woche, in der er die Mitglieder seines eigenen Kabinetts öffentlich bloßstellte. Oder nehmen wir eine Woche im Oktober 2019, einen Monat nach Beginn der Ermittlungen im Amtsenthebungsverfahren und etwas mehr als tausend Tage nach seinem Amtsantritt. Der amtierende Botschafter in der Ukraine, William B. Taylor Jr., sagte als Zeuge im Impeachment-Verfahren aus.1 Darüber, wie aussichtslos es war, gegen Trump und seine Leute eine außenpolitische Agenda zu verfolgen, die mit der Regierungspraxis kompatibel war. Republikanische Abgeordnete stürmten eine geschlossene Anhörung zum Amtsenthebungsverfahren: eine bizarre Aktion von Kongressmitgliedern, die sich gegen ein reguläres Kongressverfahren richtete.2 Trumps persönlicher Anwalt William Consovoy argumentierte vor Gericht, sein Klient genieße Immunität von jeglicher Strafverfolgung – selbst dann, wenn er, rein hypothetisch, jemanden mitten auf der Fifth Avenue erschießen würde –, solange er nur Präsident sei.3 Und am Freitagmorgen platzierte die New York Times zwei Schlagzeilen auf der linken Seite ihrer Website. Die obere Meldung lautete: Das Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung seiner eigenen Ermittlungen zur russischen Einmischung in den Wahlkampf von 2016 eingeleitet.4 Direkt darunter verkündete die zweite Schlagzeile, die Bildungsministerin Betsy DeVos habe sich über eine gerichtliche Verfügung hinweggesetzt, weil sie – in direktem Widerspruch zu richterlichen Entscheidungen – weiterhin von ehemaligen Studenten in Konkurs gegangener Colleges die Rückzahlung ihrer Studienkredite eingefordert habe.5 In der Summe wirkte das so, als würde die Regierung an verschiedensten Fronten Krieg gegen sich selbst führen.
Nachrichten über Trump mögen uns zwar noch schockieren, aber überraschen kann uns das alles kaum noch. Jedes der genannten Ereignisse war, für sich genommen, erschütternd: jedes ein Angriff auf unsere Empfindungen und unser mentales Begriffsvermögen. Aber in ihrer Gesamtschau waren sie nur wieder eine weitere Steigerung dessen, was alltäglich geworden war. Trump hat die Regierung, die Medien und das Grundverständnis von Politik so beschädigt, dass sie kaum noch wiederzuerkennen sind. Teilweise aus Gewohnheit, teilweise auch aus Notwendigkeit machen wir mit unserer Berichterstattung weiter und konsumieren die Nachrichten – Trumps Präsidentschaft hat mehr Schlagzeilen hervorgebracht als jede andere vor ihr –, aber nach den ersten tausend Tagen seiner Amtszeit sind wir bei dem Versuch zu begreifen, was mit uns geschieht, keinen Schritt weitergekommen.
Die Schwierigkeit, die Nachrichten zu begreifen, liegt teilweise in den Wörtern, die wir benutzen – sie haben es an sich, dass sie das Ungeheuerliche gewöhnlich erscheinen lassen. Der Bildungsministerin wird Missachtung des Gerichts vorgeworfen, aber über dieses erstaunliche Ereignis wird in völlig alltäglicher Zeitungsprosa berichtet. Selbst die schärfste Beschreibung bezeichnete die Tatsache, dass die Ministerin der Missachtung des Gerichts angeklagt worden war, nur als »außerordentlich seltene richterliche Rüge eines Kabinettmitglieds«.6 Das beschrieb nicht einmal annähernd das eigentliche Drama: Ein Kabinettmitglied weigert sich, den Zugriff der eigenen Behörde auf Menschen zu unterbinden, die es nach richterlichem Urteil hätte in Ruhe lassen müssen – es ging immerhin um 16000 Personen. Und selbst wenn wir Worte finden könnten, mit denen sich der außergewöhnliche, kaum noch vorstellbare Gehalt dieser Art von »Trump-Stories« (DeVos war Ministerin von seinen Gnaden) erfassen ließe, würden wir ihrer wahren Dimension nicht gerecht. Wie kann man über eine Serie fast unvorstellbarer Ereignisse reden, die Routine geworden sind? Wie beschreibt man die Konfrontation unserer staatlichen Institutionen mit einem Präsidentschaftsapparat, der darauf aus ist, genau diese Institutionen zu zerstören?
Mögliche Antworten fand ich in den Arbeiten des ungarischen Soziologen Bálint Magyar (*1952). Bei dem Versuch, begrifflich zu erfassen und zu beschreiben, was in seinem eigenen Land in den drei Jahrzehnten nach dem Zusammenbruch des Ostblocks geschehen war, gelangte Magyar zu der Erkenntnis, dass weder die Sprache der Medien noch die der Wissenschaft dieser Aufgabe gewachsen sei. Nach 1989 hätten sowohl die ungarischen als auch die westlichen Kommentatoren versucht, die Ereignisse in der Region in der Sprache der liberalen Demokratie zu beschreiben. Sie hätten über Wahlen und Legitimität, Rechtsstaatlichkeit und öffentliche Meinung gesprochen. In ihrer Sprache spiegelten sich ihre Annahmen und deren Grenzen wider, dass nämlich ihre jeweiligen Länder sich zu liberalen Demokratien wandeln würden, was damals das unvermeidliche Ergebnis des Kalten Krieges zu sein schien. Und sie hatten ohnehin keine andere Sprache zur Verfügung. Wenn wir jedoch die falsche Sprache benutzen, können wir nicht vermitteln, was wir sehen. Mit einer Sprache, die entwickelt wurde, um einen Fisch zu beschreiben, können wir kaum begreifen, was einen Elefanten ausmacht – Wörter wie »Kiemen«, »Schuppen« oder »Flossen« würden uns nicht viel nützen.
Als sich einige post-sowjetische Staaten nicht wie erwartet entwickelten, behinderte die Sprache unsere Fähigkeit, die Vorgänge zu verstehen. So fragten wir beispielsweise, ob sie eine freie Presse hätten oder freie und faire Wahlen. Aber Magyar zufolge ist die Feststellung, dass das nicht der Fall sei, dasselbe wie zu erklären, dass der Elefant weder schwimmen noch fliegen könne: es sagt uns nichts darüber, was der Elefant ist. Und genau das ereignete sich nun in den Vereinigten Staaten: Wir benutzten die Sprache der politischen Auseinandersetzung, juristischer Verfahrensweisen oder des parteipolitischen Streits, um etwas zu beschreiben, das ein System zerstörte, für dessen Beschreibung genau diese Terminologie erfunden worden war.
Magyar beschäftigte sich ein Jahrzehnt lang mit der Entwicklung eines neuen Modells und einer neuen Sprache, um das beschreiben zu können, was in seinem eigenen Land vor sich ging. Er prägte den Begriff »Mafia-Staat«, den er als ein spezifisches, clan-ähnliches System beschrieb, in dem ein Mann Geld und Macht an alle anderen Mitglieder verteilt. Daraus entwickelte er das Konzept der autokratischen Transformation, die in drei Stadien verläuft: autokratischer Versuch, autokratischer Durchbruch und autokratische Konsolidierung.7 Mir scheint, dass die amerikanische politische Kultur diese Wörter jetzt ausleihen könne, gewissermaßen in einer symbolischen Umkehrung von 1989 – denn Magyars Begriffe beschreiben die US-amerikanische Realität besser als alle anderen Begrifflichkeiten aus dem politischen Standardlexikon. Magyar analysierte die Anzeichen und Umstände dieses Prozesses in den post-kommunistischen Ländern und schlug eine detaillierte Taxonomie vor. Wie genau die autokratische Ermächtigung in den Vereinigten Staaten verlaufen könnte, ist jedoch noch unerforschtes Gebiet.
2. Warten auf den Reichstagsbrand
Unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl im November 2016 schien sich die besiegte Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, die Hillary Clinton gewählt hatten, in zwei Lager zu spalten, die sich nur durch den Grad ihrer Panik unterschieden. Als Repräsentant des einen, weniger panischen Lagers konnte der bisherige Präsident Barack Obama gelten, der die Amerikaner in den Tagen nach der Wahl mit dem Hinweis, dass das Leben weitergehe, zu beruhigen versuchte. Am 9. November hielt er eine kurze, würdevolle Ansprache, in der er drei Punkte hervorhob – der denkwürdigste war, dass die Sonne auch an diesem Morgen aufgegangen sei.1
Bevor gestern die Stimmen ausgezählt waren, nahm ich ein Video auf, das manche von Ihnen vielleicht schon gesehen haben. Darin sagte ich dem amerikanischen Volk, egal, welcher Seite ihr eure Stimme gegeben habt, egal, ob euer Kandidat gewonnen oder verloren hat – auch morgen wird die Sonne wieder aufgehen.
Und das ist endlich mal eine Vorhersage, die tatsächlich eingetroffen ist. Die Sonne ist aufgegangen.
Obama gab zu, dass zwischen ihm und Trump »wesentliche Meinungsunterschiede« bestünden, dass er aber nach einem Telefonat mit dem gewählten Präsidenten in den frühen Morgenstunden die Gewissheit habe, dass Demokraten und Republikaner, und auch er und Trump, gemeinsame Ziele verfolgten.
Wir alle wollen das Beste für unser Land. Das entnahm ich Mr Trumps Aussagen gestern Abend. Das war es, was ich auch im direkten Gespräch mit ihm hörte. Und das hat mich ermutigt. Das ist es, was dieses Land braucht – ein Gefühl der Einheit und der Zugehörigkeit, die Achtung vor unseren Institutionen, vor unserer Lebensart, vor dem Rechtsstaat, und die gegenseitige Achtung der Menschen.
Obama beendete die Ansprache in optimistischem Ton.
Das Wichtigste ist, dass wir vorangehen, dass wir Vertrauen in unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger haben, denn das ist die entscheidende Voraussetzung für eine lebendige und funktionierende Demokratie. Das hat dieses Land über zweihundert Jahre vorangebracht. So haben wir unsere Grenzen erweitert und Freiheit in alle Welt gebracht. So haben wir die Rechte unserer Staatsgründung auf alle Bürgerinnen und Bürger ausgedehnt. Und nur so konnten wir so weit kommen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass diese unglaubliche Reise, auf der wir als Amerikaner unterwegs sind, weitergehen wird.
Jeder Präsident ist ein großer Geschichtenerzähler. Die Obama-Story, die auf den Geschichten seiner Vorgänger aufbauen konnte, handelte von einer amerikanischen Gesellschaft, die sich auf einem unaufhaltsamen Marsch zu einer besseren, freieren, faireren Welt befand. Sie mochte mitunter ins Stolpern geraten, aber sie richtete sich immer wieder auf. Das war die Bedeutung, die Obama seinem Lieblingszitat von Martin Luther King Jr. verlieh: »Der Bogen des moralischen Universums ist weit, aber er neigt sich zur Gerechtigkeit.« Und es ist auch die Prämisse, auf der der Glaube an den amerikanischen Exzeptionalismus beruht oder an das, was der Soziologe Robert N. Bellah und der Rechtsgelehrte Sanford Levison als »amerikanische Zivilreligion« bezeichneten: dass die US-Verfassung eine nahezu perfekte Blaupause für die Politik darstelle, auf ewig.2
Als sich Trump 2016 an die Spitze der Kandidaten für die republikanische Nominierung setzte, trösteten sich viele Amerikaner mit der Gewissheit, dass sich die amerikanischen Institutionen stärker als irgendein Kandidat erweisen würden, und sogar stärker als dieser oder jener Präsident.
Aber nach der Wahl klang diese vermeintliche Gewissheit nur noch hohl. Am selben Tag, an dem Obama den planungsgemäßen Aufgang der Sonne feierte, veröffentlichte ich im New York Review of Books einen Artikel, in dem ich die Leserschaft warnte, »die Institutionen werden euch nicht retten«. Ich stützte mich dabei auf meine Erfahrungen als Journalist*in in Russland, Ungarn und Israel – drei Länder, die sich völlig von den Vereinigten Staaten unterschieden und natürlich auch untereinander verschieden waren. Ihre Institutionen waren jedoch auf bemerkenswert ähnliche Weise zusammengebrochen. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass amerikanische Institutionen in vergleichbarer Weise versagen würden, aber ich wusste genug, um behaupten zu können, dass absolutes Vertrauen in Institutionen nicht angebracht sein würde. Viele Menschen teilten diese Intuition. Sie gehörten zum stärker zur Panik neigenden Lager. Eine gemeinsame Erwartungshaltung machte sich unter ihnen breit: die Erwartung eines neuen Reichstagsbrands.
Der historische Brand im deutschen Reichstag ereignete sich in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933. Vier Wochen zuvor war Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden und hatte sich sofort darangemacht, die Pressefreiheit einzuschränken und die Polizeigewalt auszuweiten. Aber es war dieser Brand, der in der Erinnerung als das Ereignis haften geblieben ist, nach dem nichts mehr so war wie zuvor, weder in Deutschland noch in der Welt. Am Tag nach dem Brand erließ die Regierung eine Verordnung, die die Polizei ermächtigte, als vorbeugende Maßnahme Menschen ohne Anklage in die sogenannte »Schutzhaft« zu nehmen. Hitlers paramilitärische Gruppen, die SA und die SS, griffen Aktivisten als »staatsfeindliche Elemente« auf und verbrachten sie in Lager. Weniger als einen Monat später verabschiedete das Parlament das »Ermächtigungsgesetz«, durch das Hitler fortan durch Verordnungen regieren konnte und auch die gesetzgebende Gewalt faktisch auf die Regierung überging. Gleichzeitig wurde der Notstand verhängt, der bis zum Ende der NS-Diktatur bestehen blieb.
Der Reichstagsbrand wurde genutzt, um einen »Ausnahmezustand« zu schaffen, wie es Carl Schmitt, Hitlers bevorzugter Rechtsgelehrter, ausdrückte. Nach Schmitts Auffassung entsteht ein Ausnahmezustand, wenn eine Notlage, ein einzigartiges Ereignis, die etablierte Ordnung erschüttert. Dann muss der Souverän auftreten und neue, außerrechtliche Regeln einführen. Der Ausnahmezustand ermöglicht einen Quantensprung: Hat sich der Staat erst einmal genug Macht verschafft, um ihn verhängen zu können, kann er sich nun durch diesen Akt noch weit umfassendere, unkontrollierte Machtbefugnisse anmaßen. Das ist es, was diese Veränderung unumkehrbar und den Ausnahmezustand zum Dauerzustand macht.
Jedes große, umwälzende Ereignis der letzten 80 Jahre wurde mit dem Reichstagsbrand verglichen. Am 1. Dezember 1934 wurde der Erste Sekretär der Leningrader Parteiorganisation, Sergei Kirow, von einem Einzeltäter durch Kopfschuss ermordet. Das Attentat gilt als Vorwand für die Verhängung des Ausnahmezustands in der Sowjetunion. Schauprozesse und Massenverhaftungen folgten, wodurch sich der Gulag mit Gefangenen füllte, die als Verräter, Spione und terroristische Verschwörer beschuldigt wurden. Um die schiere Masse der Anklagen bewältigen zu können, schuf der Kreml die sogenannten Troikas – dreiköpfige Ausschüsse, die Urteile verkündeten, ohne die Fälle zu untersuchen oder eine Verteidigung anzuhören.
In jüngerer Zeit nahm Wladimir Putin eine Serie von katastrophalen Ereignissen zum Anlass, unumkehrbare Ausnahmeregelungen zu verhängen. 1999 kam es zu einer Reihe von Bombenanschlägen auf Wohnhäuser in Moskau und weiteren Städten, bei denen Hunderte Menschen umkamen. Das ermöglichte es Putin zu verkünden, dass er alle, die für »Terroristen« zu halten seien, summarisch hinrichten lassen könne. Und die Ereignisse wurden auch zum Vorwand für einen neuen Krieg in Tschetschenien. Im Jahr 2002 diente die dreitägige Belagerung eines von tschetschenischen Terroristen besetzten Theaters in Moskau dazu, das Prinzip der summarischen Exekution real vorzuführen: Russische Spezialeinheiten pumpten eine unbekannte gasförmige Chemikalie in das Ventilationssystem, stürmten das Gebäude und erschossen die bewusstlosen Geiselnehmer. Der Kreml nutzte die Theaterbesetzung auch als Vorwand, um die bereits gefügig gemachten Medien davon abzuhalten, über Antiterror-Operationen zu berichten. Zwei Jahre später starben über 300 Menschen, größtenteils Kinder, nach einem Angriff russischer Spezialtruppen auf eine Schule in Beslan in der zur Russischen Föderation gehörenden Republik Nordossetien. Putin nutzte dieses Ereignis als Begründung, die Wahl eines Bezirksgouverneurs abzusagen, womit er die föderale Struktur des Landes praktisch aufhob.
Die Geisteshaltung, die es ermöglicht, Tragödien in repressive Maßnahmen umzumünzen, ist auch in den Vereinigten Staaten nicht unbekannt. Im Jahre 1798 verabschiedete der Kongress die Alien and Sedition Acts, die unter anderem die Privilegien des Präsidenten gegenüber Ausländern erweiterten und die Veröffentlichung »falscher, skandalträchtiger oder boshafter Schriften« gegen Amtsträger unter Strafe stellten. Der Vorgang verursachte eine politische Krise, in der sich die Federalists und die oppositionellen Republikaner gegenseitig als Verräter beschimpften, sich mangelnde Wachsamkeit vorwarfen oder einander als jakobinische Marionetten anprangerten. Die Gerichte verloren keine Zeit und schlossen die der Opposition nahestehenden Zeitungen. Ein halbes Jahrhundert später setzte Präsident Abraham Lincoln das Habeas-Corpus-Recht aus, sodass nun eine Gefangennahme auch ohne richterliche Haftprüfung erfolgen konnte. Lincoln wollte damit erreichen, im Sezessionskrieg Rebellen und Südstaatensoldaten auch ohne Nachweis konkreter Gewaltakte auf unbestimmte Zeit festsetzen zu können: Personen, die er als Gefahr für die Union ansah, welche aber »die nach gewöhnlichen Regeln urteilenden Gerichte«, wie er sagte, »wieder freilassen« würden. Erst 1866 hob der Oberste Gerichtshof diese Praxis als verfassungswidrig auf.
Der nächste große Krieg war der Erste Weltkrieg. Nun konnte man für Reden, die als kritisch oder schädlich für die amerikanischen Kriegsanstrengungen gehalten wurden, mit Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren bestraft werden. Der Historiker Geoffrey Stone bezeichnete Woodrow Wilsons Sedition Act von 1918 als »die repressivste Gesetzgebung in der Geschichte der Vereinigten Staaten«.3 Tausende wurden verhaftet – viele ohne konkreten Haftanlass – und 249 anarchistische und kommunistische Aktivisten wurden in die Sowjetunion abgeschoben. Erst später trugen die Obersten Bundesrichter Oliver Wendell Holmes, Jr. und Louis Brandeis mit einer Reihe von Minderheitsvoten dazu bei, dass die Schutzmechanismen der freien Meinungsäußerung letztlich geklärt und wiederhergestellt wurden.
Während der Weltwirtschaftskrise wirkten die Gerichte, die Legislative und die Vollstreckungsgewalten – mit der stillschweigenden Billigung der Bundesregierung – bei der Ausbürgerung und Deportation Hunderttausender mexikanischer Amerikaner mit, obwohl sie nach dem Geburtsortsprinzip mehrheitlich Staatsbürger waren.
Auch während des Zweiten Weltkriegs ereignete sich ein präsidentieller Angriff auf die Verfassung: die Internierung von mehr als hunderttausend Amerikanern japanischer Abstammung. Es folgte die McCarthy-Ära, in der sich die Regierung daranmachte, den inneren Feind auszuspionieren und zahlreiche Verratsvorwürfe erhob, ob sie nun von Beweisen gestützt waren oder nicht, und damit ein Leben nach dem anderen zerstörte. Die nächste Generation der Amerikaner musste die Heimlichtuerei, den Verrat und die Paranoia während des Vietnamkriegs erdulden, die ihren Höhepunkt in einem Präsidenten fanden, der seine politischen Gegner anklagen und abhören ließ.
Im 21. Jahrhundert stattete der Kongress die Nachrichtendienste und die nationalen Vollzugsbehörden mit weitreichenden Observationsvollmachten aus. George W. Bushs Administration belog die Welt, um einen Krieg gegen den Irak lostreten zu können, und entwickelte kunstvolle juristische Mechanismen, um Folter zu ermöglichen. Obamas Administration fuhr fort, mehr Machtbefugnisse in der Exekutive zu konzentrieren, verabschiedete Präsidentenverfügungen und weitete die Grenzen der durch Bundesbehörden getroffenen politischen Entscheidungen immer weiter aus. Gleichzeitig wurde »Whistleblowing« unterdrückt und die Medien auf Distanz gehalten.
Mit anderen Worten: Jede Generation von Amerikanern konnte beobachten, wie ihre Regierung außerordentliche Machtbefugnisse für repressive und ungerechte Zwecke beanspruchte. Diese zeitweiligen Ausnahmezustände beruhen auf einem grundlegenden strukturellen Ausnahmezustand, von dem weiße Männer ihre Macht über alle anderen ableiten. So gesehen ist Trump keine Ausnahmeerscheinung, sondern der logische nächste Schritt. Er konnte auf eine 400-jährige Geschichte weißer Vorherrschaft bauen, und auf eine 15-jährige Mobilisierung der amerikanischen Gesellschaft gegen Muslime, Immigranten und »die Anderen«. Ein künftiger Historiker des 21. Jahrhunderts wird vielleicht den 11. September 2001 als den Reichstagsbrand der Vereinigten Staaten bezeichnen.
Allerdings war der historische Reichstagsbrand nicht das, was wir uns darunter vorstellen – ein einzigartiges Ereignis, das den Lauf der Geschichte ein für alle Mal veränderte. Der Reichstag brannte fünf Jahre vor dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und acht Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. In den dazwischenliegenden Jahren reihten sich unzählige kleine und große Ereignisse aneinander, und jedes war ein weiterer Schritt, der die dunkelste Zukunft möglich werden ließ. Es mag verführerisch erscheinen sich vorzustellen, dass Trump mit einer theatralischen Geste einen Zustand erschafft, von dem an keine Umkehr mehr möglich wäre. Denn daraufhin würden wir völlig zu Recht jede Hoffnung aufgeben müssen oder, alternativ, aus Verzweiflung zu Helden werden. In Wahrheit ist aber auch Trumps autokratischer Versuch kein großes, singuläres Ereignis, sondern verläuft eher schleichend in einer Serie von Maßnahmen und Aktivitäten, die das Wesen des amerikanischen Regierungssystems und die Politik Schritt für Schritt verändern.
Magyar beschreibt, wie die aufstrebenden post-kommunistischen Führer ihre Autokratien errichten: indem sie die Gewaltenteilung untergraben, dabei vor allem die Justiz einhegen und die Strafverfolgungsbefugnis für sich reklamieren. Natürlich lässt sich dieses Modell nicht einfach über die Realität der Vereinigten Staaten stülpen, nicht zuletzt deshalb, weil die formale Gewaltenteilung zwischen den verschiedenen Bereichen des Regierungssystems schon seit geraumer Zeit teilweise geschwächt ist. Das Justizministerium zum Beispiel, eigentlich die Institution mit der ultimativen Strafverfolgungsbefugnis, ist Teil der Exekutive, und seine funktionale Unabhängigkeit wird durch Tradition determiniert. Ein Monopol auf die politische Macht, das Magyar als einen wichtigen Risikofaktor identifiziert, ist in den Vereinigten Staaten nicht ungewöhnlich. Trump konnte dieses Monopol in seinen beiden ersten Amtsjahren genießen, als beide Häuser des Kongresses von den Republikanern beherrscht wurden, aber auch einige seiner Vorgänger hatten günstige Mehrheitsverhältnisse im Kongress zu nutzen gewusst. Es ist klar, dass Trumps Präsidentschaft anders ist als vorhergehende Administrationen.
Die Amerikaner reden viel häufiger über Institutionen als über einen anderen Faktor, den Obama in seiner beruhigenden Rede nach Trumps Wahl erwähnte: die Mutmaßung, dass alle von guten Absichten geleitet würden. Es stimmt, dass trotz weiterhin bestehender Ungerechtigkeiten die Rechte und der Schutz der Staatsbürgerschaft einer wachsenden Anzahl von Amerikanern gewährt wurden, und zwar von unterschiedlichen Arten von Amerikanern. Betrachtet man die amerikanische Geschichte über einen hinreichend langen Zeitraum und mit genügend Wohlwollen, lässt sie sich als kontinuierlichen Fortschritt zu mehr Gerechtigkeit interpretieren. Die ausgeklügelte Struktur der Institutionen ist einer der Gründe dafür. Der andere Grund ist, dass die amerikanischen Bürger und die Staatsbediensteten meistens nach Treu und Glauben handeln. Natürlich wird auch gelogen und betrogen, und manche versuchen, das System für eigene Ziele zurechtzubiegen, aber im Großen und Ganzen handeln die Bürgerinnen und Bürger in Übereinstimmung mit festgefügten Überzeugungen und einem kohärenten Wertesystem. Wenn sie ihre Macht missbrauchen, beschränken sie sich gewöhnlich auf bestimmte, oft diskrete, oft auch ideologisch definierte Bereiche. Und das bedeutet: Selbst wenn das System der Gewaltenteilung versagt, kann eine nachfolgende Administration den Schaden wieder beheben. (Allerdings ist hier anzumerken, dass es Obama nicht gelang, das Gefangenenlager in Guantánamo zu schließen.) Kein mächtiger politischer Akteur hat sich bisher darangemacht, das amerikanische politische System selbst zu zerstören – bis Trump. Womöglich ist er der erste Parteikandidat, der nicht antrat, um Präsident zu werden, sondern Autokrat. Und er gewann.
3. Der Styropor-Präsident
Einer von Trumps drei Schlachtrufen im Wahlkampf – eine der drei Komponenten, die Amerika angeblich wieder groß machen würden – war, »den Sumpf austrocknen« zu wollen (die beiden anderen Slogans waren »Sperrt sie ein!« und »Baut die Mauer!«). Das mochte wie ein Aufruf zum Kampf gegen die Korruption klingen, war aber in Wahrheit eine Kriegserklärung an das amerikanische Regierungssystem, wie es seinerzeit bestand.
Der Treibstoff der Wahlkampagne Trumps war Verachtung: für Immigranten, Frauen, Behinderte, Farbige, Muslime – mit anderen Worten für jede Person, die kein körperlich gesunder, weißer, heterosexueller, in Amerika geborener Mann war – und für die Eliten, die »die Anderen« verhätschelten. Verachtung für die Regierung und ihre Arbeit ist eine Komponente der Verachtung für die Eliten, und sie ist auch eine rhetorische Redewendung, die von allen derzeitigen antipolitischen Staatsführern dieser Welt benutzt wird, von Wladimir Putin bis hin zum brasilianischen Staatspräsidenten Jair Messias Bolsonaro. Sie stützen ihre Wahlkampagnen auf die Abneigung, die ihre Wähler gegenüber den Eliten empfinden, denen sie vorwerfen, ihr Leben zerstört zu haben. Und auch nach ihrem Amtsantritt nutzen die Führer diese Abneigung weiter aus, als ob jemand anders, irgendein finsterer und offenbar allmächtiger Herrscher noch immer an der Macht sei, und als ob sie selbst immer noch zu den Aufmüpfigen gehörten. Dabei prangern sie doch gerade die staatlichen Institutionen als Feind an, die jetzt ihre eigene Regierung stützen. So macht Trump auch als Präsident die Nachrichtendienste herunter, wütet gegen das Justizministerium und demütigt mit seinen Tweets sogar führende Beamte und Minister seiner eigenen Administration.
Für sein Kabinett wählte Trump Menschen aus, die der Arbeit, und in manchen Fällen sogar der Existenz ausgerechnet jener Behörden, die sie leiten sollten, ablehnend gegenüberstanden. So fiel seine Wahl für die Leitung der Umweltschutzbehörde EPA auf Scott Pruitt, der als Generalstaatsanwalt von Oklahoma genau diese Behörde vierzehnmal verklagt hatte, weil sie nach Auffassung des Staates Oklahoma ihre behördlichen Kompetenzen überschritten habe. Bei der Senatsanhörung zu seiner Nominierung am 18. Januar 2016 leitete Pruitt seine Ausführungen mit der Behauptung ein, es sei nach wie vor strittig, ob sich menschliche Aktivitäten auf den Klimawandel auswirkten und ob wir überhaupt in der Lage seien, diesen Einfluss zu messen.1 Als Minister für Gesundheitspflege und Soziale Dienste nominierte Trump den Kongressabgeordneten Tom Price aus Georgia, der prompt verkündete, er wolle Obamas Krankenversicherungsreform, den Affordable Care Act und Medicaid, wieder abschaffen. Als Generalbundesanwalt, das heißt als Justizminister, fiel Trumps Wahl auf Jeff Sessions, den Senator aus Alabama, der bereits einmal als Richter durchgefallen war und als freimütiger Gegner der Bürgerrechtsgesetze galt. Und als Arbeitsminister wählte Trump Andrew Puzder, einen leitenden Manager eines Fast-Food-Konzerns, der die Arbeitsschutzgesetze ablehnt – allerdings trat Puzder im Februar 2017 von seiner Nominierung zurück,2 weil er sich nicht einmal der Unterstützung durch republikanische Senatoren sicher sein konnte (der Grund dafür war Puzders eher einwanderungsfreundliche Haltung und die Tatsache, dass er die Legalisierung der Arbeitsmigration befürwortete). An seiner Stelle nominierte Trump Alexander Acosta, Dekan einer juristischen Fakultät und ehemaliger Oberstaatsanwalt für den Gerichtsbezirk Südliches Florida. In dieser Eigenschaft hatte Acosta einen anrüchigen Vergleich mit ausgehandelt, der dem wegen Sexualdelikten mit Minderjährigen angeklagten Milliardär Jeffrey Epstein die drohende lebenslange Freiheitsstrafe ersparte. Aber im März 2017 hatten sich die Standards der Trump-Ära bereits so weit etabliert, dass die Medien Acosta generell als »konventionellen Kandidaten« bezeichneten – schließlich verfügte er über Regierungserfahrung, und ein Teil seiner Erfahrung war sogar relevant für den Job.3 Das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung übertrug Trump Ben Carson, einem pensionierten Neurochirurgen, der keinerlei politische Erfahrung und auch keine Expertise für den Wohnungsbau oder überhaupt ein anderes Gebiet der Regierungsarbeit mitbrachte. Trumps Wahl als Energieminister fiel auf den ehemaligen Gouverneur von Texas, Rick Perry, der in den republikanischen Vorwahlen von 2011 versprochen hatte, das Energieministerium abzuschaffen (und auch die Ministerien für Handel und Bildung)4 – anscheinend war ihm nicht bekannt, dass die Hauptaufgabe des Energieministeriums nicht, wie er offenbar glaubte, in der Regulierung der Energiewirtschaft bestand, sondern dass es sich vornehmlich mit Nuklearwaffen befasste. Betsy DeVos, Trumps Wahl als Bildungsministerin, galt als unbeirrbare Gegnerin der staatlich finanzierten Bildung. In ihrem Herkunftsstaat Michigan hatte die milliardenschwere Aktivistin Reformen vorangetrieben, um öffentlichen Schulen die Finanzmittel zu entziehen und diese nahezu unregulierten Schulen freier Trägerschaft zuzuweisen. Sie trug damit wesentlich zum Kollaps des öffentlichen Bildungssystems in Detroit bei. DeVos selbst hatte nie im Bildungssektor gearbeitet, und bei der Anhörung zu ihrer Nominierung bewies sie, dass sie mit diesem Gebiet in keiner Weise vertraut war. Als sie gefragt wurde, ob sich Tests ihrer Meinung nach eher auf den Kompetenzerwerb oder auf den Lernfortschritt fokussieren sollten, geriet sie vollkommen ins Schwimmen, da sie offenbar von dieser Debatte keine Ahnung hatte.5 Und auf die Frage nach der Ausstattung der Schulen mit Waffen antwortete sie, die Waffen könnten ja dann auch gegen »potenzielle Grizzlybären« eingesetzt werden.
Die von Trump nominierten Kandidaten für sein Kabinett logen und schummelten sich durch die Anhörungen im Kongress. Sechs Wochen nach Trumps Amtsantritt stellte ProPublica, eine Stiftung für Investigativen Journalismus, eine Liste der Lügen zusammen, die fünf der Trump-Kandidaten dem Senat aufgetischt hatten: Pruitt, DeVos, der Kandidat für das Finanzministerium Steve Mnuchin, Price und Sessions.6 DeVos scheint außerdem mehrere der schriftlichen Antworten in ihren Fragebögen aus Dokumenten abgekupfert zu haben, die von anderen Beamten verfasst worden und online verfügbar waren.7
Den Kongress zu belügen, ist eine strafbare Handlung. Zu anderen Zeiten wäre es auch eine Schande gewesen. Warum also sollten die Kandidaten für einige der höchsten Ämter des Staates lügen, noch dazu auf eine Weise, die so leicht zu durchschauen und zu dokumentieren war? Oder anders gefragt: Warum sollten sie das nicht tun? Sie äfften ja nur das Verhalten ihres Schutzherrn nach, der lauthals, hartnäckig und unaufhörlich log? Genau wie er bewiesen sie damit nur, dass sie seine Verachtung für das Regierungssystem teilten. Sie belogen ja nur den »Sumpf«. Sie wollten sich mit den Konventionen des Regierungssystems nicht abgeben, weil sie genau dieses Regierungssystem für verachtenswert hielten.
Eng mit der Verachtung für das Regierungssystem verwandt ist die Verachtung für Fachwissen und herausragende Leistungen, die ebenfalls einem Teil des heutigen Führungspersonals gemein ist – ihre antipolitische Politik ist auch ausgesprochen anti-intellektuell. Als designierter Präsident wollte Trump nur einmal wöchentlich an den nachrichtendienstlichen Briefings teilnehmen – und nicht täglich oder fast täglich, wie es bisher Brauch gewesen war.8 Er erklärte auch warum: »Ich bin ein ziemlich schlauer Mensch.« Und wie ein schmollender Hauptschüler, ohne Hauptschüler beleidigen zu wollen, fügte er hinzu: »Man muss mir nicht jeden einzelnen Tag in den nächsten acht Jahren dasselbe in denselben Worten immer wieder erklären.« Sollte sich auf der Welt etwas ändern, sagte er, müssten die Leiter der Nachrichtendienste eben zu ihm, dem Präsidenten, kommen und ihn informieren. Trump war womöglich der erste Präsident, der von der Bürde der Verantwortung, die sein Amt mit sich brachte, völlig unbeeindruckt schien: Er empfand weder Achtung gegenüber seinen Vorgängern noch seinem Amt, und die Anforderungen des Jobs nervten ihn.
Die nachrichtendienstlichen Briefings waren nur eine kleine Komponente im Transformationsprozess, den Trump, zumindest nominell, absolvierte. Nach der Wahl wurde heftig spekuliert, wie wahrscheinlich es sei, dass Trump – der Possenreißer, der Protz, der Rassist – doch noch »präsidentiell« werden würde. Das Wort wurde von verschiedenen Kommentatoren unterschiedlich interpretiert, aber die grundlegende Auffassung war die, dass Trump als Präsident eine gewisse Achtung für das Amt entwickeln würde, das er nun innehatte, und damit auch für das System, an dessen Spitze ihn das Wahlmännerkollegium gestellt hatte. Doch diese Annahme, diese Hoffnung, lief dem Wesen des Trump’schen Projekts völlig zuwider. Am 20. Januar 2017 erkannte die Nation, dass sie einen Präsidenten in sein Amt einsetzte, der anders war als jeder andere Präsident vor ihm: einen Präsidenten, der dem Regierungssystem mit Verachtung gegenübertrat.
Eine Studie moderner Autokraten würde uns vielleicht zeigen, dass ein Reichstagsbrand niemals ein singuläres, richtungsweisendes Ereignis ist, das den Lauf der Geschichte verändert, sondern auch eines, das eine Wahrheit enthüllt, die hinter dem Narrativ des Ereignisses selbst steht: dass Autokraten ihre Absichten schon frühzeitig ankündigen. Nur neigen wir dazu, diese Erklärungen nicht zu glauben oder sie zu unserem eigenen Nachteil zu ignorieren. Putin zum Beispiel legte seine Pläne schon am Ende seines ersten Tages im neuen Amt offen: in einer Reihe knapper Erklärungen und gesetzgeberischer Initiativen sowie durch eine großangelegte Razzia machte er deutlich, dass er sich auf die Remilitarisierung Russlands fokussieren werde, dass er die gewählten Institutionen des Landes beseitigen und hart gegen die Medien vorgehen wolle. Sein autokratischer Versuch bestand darin, die autokratische Macht tatsächlich auszuschöpfen, politische Gegner zu inhaftieren, die Medien unter seine Kontrolle zu bringen und jede politische Macht außerhalb seines eigenen Amtes bedeutungslos zu machen. Das dauerte drei oder vier Jahre, aber die Ziele waren von Anfang an klar.*1 Auch Trump verkündete seine Intentionen schon während des Wahlkampfs und auch am ersten Tag seiner Präsidentschaft.
Volle 24 Stunden lang trampelte Trump auf einigen der heiligsten öffentlichen Rituale der amerikanischen Macht herum – und machte daraus ein Spektakel. Er beschmutzte die Inauguration mit einer Rede, die nicht nur gemein und bedeutungslos, sondern auch noch schlecht formuliert war und sich an die niedrigsten Instinkte richtete. »Wir haben andere Länder bereichert, während sich der Reichtum, die Stärke und das Selbstbewusstsein unseres eigenen Landes über dem Horizont aufgelöst hat«, so fasste Trump das außenpolitische Erbe der Vereinigten Staaten zusammen – als ein Nullsummenspiel, in dem jeder ausgegebene Penny – egal ob für den Marshallplan oder für einen schlecht geplanten Krieg – ein vergeudeter Penny war. Die Arbeit der Männer und Frauen, die vor ihm Macht ausgeübt hatten, beurteilte er so: »Zu lange hat eine kleine Gruppe in der Hauptstadt unseres Landes von der Regierung profitiert, und das Volk hat die Kosten getragen.« Und mit einem Satz erklärte er im Grunde die gesamte politische Geschichte des Landes für beendet: »Dieses Massaker Amerikas endet hier und jetzt.« Danach zeichnete er als seine Vision der Zukunft das Bild einer belagerten Festung: ein Land hinter Mauern, das nur noch auf sich selbst achtet und sowohl alle Konventionen als auch jegliche Rücksicht auf andere in den Wind schlägt.
Auf befremdliche Weise erinnert Trump – mit seiner ganzen Engstirnigkeit, seinem fehlenden Drang nach Höherem – an Putin, obwohl die Wurzeln der kleingeistigen Mittelmäßigkeit dieser beiden Männer unterschiedlicher kaum sein könnten. Das Streben nach Höherem darf nicht mit bloßem Ehrgeiz verwechselt werden – beide Männer sind ehrgeizig in dem Sinne, dass sie immer noch mächtiger und wohlhabender werden wollen, aber keiner will besser