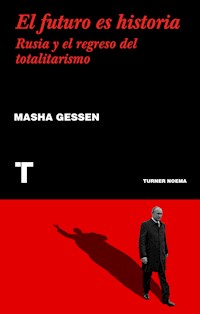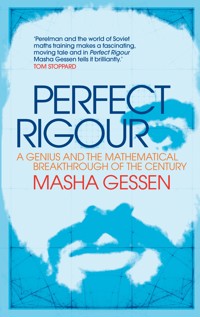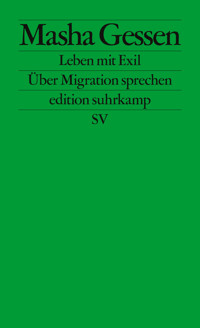
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Migration ist eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Kein Tag vergeht, an dem im Fernsehen oder in den sozialen Medien nicht über Flüchtlinge, Fluchtursachen oder Flüchtlingshilfe diskutiert würde. Häufig gerät dabei in den Hintergrund, welche Konsequenzen Begriffe und Ausdrucksweisen haben. Zu oft bringt schon unsere Sprache die Betroffenen zum Schweigen, etwa wenn aus Menschen »Asylanten«, »Fremde« oder in den Worten von US-Präsident Trump: »Illegale« werden.
In dem Versuch, jenen, die ihre »Sprache verloren« haben (Hannah Arendt), eine Stimme zu leihen, erzählt Masha Gessen Geschichten der Migration. Gessen berichtet von Menschenrechtsaktivisten aus Russland, Homosexuellen aus dem Iran – und aus der eigenen Familiengeschichte. Die Porträts fügen sich zu einem beeindruckenden Plädoyer für die menschliche Würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Masha Gessen
Leben mit Exil
Über Migration sprechen
Drei Vorträge
Aus dem Englischen von Ursel Schäfer
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
I
Wie man die Geschichten von Immigration erzählen sollte
II
58 Geschichten der Migration
III
Geschichten eines Lebens
Textnachweise
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
IWie man die Geschichten von Immigration erzählen sollte
Ich werde oft gefragt, wie es ist, in den Vereinigten Staaten journalistisch zu arbeiten, nachdem ich zuvor in Moskau in diesem Beruf tätig war. Scherzhaft antworte ich dann, dass es wunderbar ist: Ich erhalte kaum noch Morddrohungen und kann für ein großartiges Magazin schreiben. Meine Texte werden gelesen, und ich erfahre Anerkennung. Es ist alles da, wovon Journalisten nur träumen können – Leser, Anerkennung, Respekt.
Beginnen möchte ich mit der Frage, was es heißt, ein Zuhause zu haben. Zuhause ist ein Ort, an dem man in Sicherheit ist und sich geborgen fühlt, ein Ort, an dem man sich gebraucht und geschätzt fühlt, ein Ort, an dem man spürt, dass man etwas Wichtiges beitragen kann, aber auch, dass man hinfallen kann und einem aufgeholfen wird.
Deshalb möchte ich heute über Emigranten, Immigranten, Migranten, Geflüchtete und Asylsuchende sprechen – Menschen, die kein Zuhause haben. Ich spreche in erster Linie als jemand, der journalistisch tätig ist, obwohl ich auch Migrations- und technisch gesehen sogar Fluchterfahrungen habe.
Meine Erfahrung mit Migration war sehr milde – die große russische Dichterin Anna Achmatowa hätte sie wahrscheinlich als »vegetarisch« bezeichnet. Flugzeuge und Züge gehörten dazu – die regulären Abteile von Reisezügen – und nicht nervenaufreibende Klettereien über und Hocken auf Zugdächern. Ich habe nur wenige Tage in Gewahrsam verbracht. Meine Migration erfolgte auf einem klar vorgezeichneten legalen Weg und endete sanft in einer Gemeinschaft von Menschen, die meiner Familie helfen wollten und das nötige Geld dafür hatten. Ich beschreibe hier die Immigration meiner Familie in die Vereinigten Staaten im Jahr 1981. Diese Erfahrung vermittelte mir höchstens ansatzweise den Eindruck, keine Stimme zu haben und in absoluter Unsicherheit gelandet zu sein, aber diesen Eindruck werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und auch das Warten werde ich nicht vergessen, ein Definitionsmerkmal von Machtlosigkeit in der modernen Welt.
Vor mehr als einem halben Jahrhundert beschrieb Hannah Arendt den Zustand, ein Flüchtling zu sein, sowohl als Erfahrung wie als politisches Dilemma. In Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft schrieb sie:
Etwas viel Grundlegenderes als die in der Staatsbürgerschaft gesicherte Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz also steht auf dem Spiel, wenn die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft, in die man hineingeboren ist, nicht mehr selbstverständlich und die Nichtzugehörigkeit zu ihr nicht mehr eine Sache der Wahl ist oder, wenn Menschen in die Situation gebracht werden, wo ihnen, falls sie sich nicht entschließen, Verbrecher zu werden, dauernd Dinge zustoßen, die ganz unabhängig davon sind, was sie tun oder unterlassen. Auch wo ihnen eine noch intakte Zivilisation das Leben sichert, sind sie, politisch gesprochen, lebende Leichname. […] Sie [die Geflüchteten aus Russland in den zwanziger Jahren und die Juden während des Nationalsozialismus; Anmerkung der Übersetzerin] waren politisch […] der Fähigkeit beraubt, Überzeugungen zu haben und zu handeln. Es stellte sich heraus, daß diese Fähigkeiten selbst nur funktionieren können, wenn sie durch ein Recht gesichert sind.[1]
Dieses Dilemma mache uns bewusst, dass es so etwas gibt wie »ein Recht, Rechte zu haben« – wir sagen vielleicht, dass die Menschenrechte uns allen zustehen, weil wir Menschen sind, aber in Wahrheit können nur die Menschen ihre Rechte einfordern, die auch Bürger sind. Wenn Menschenrechte ein Attribut des Menschseins sind, dann müssen wir uns der Tatsache stellen, dass vielen Millionen Heimatlosen ihr Menschsein aberkannt worden ist.
Warum spreche ich hier und jetzt darüber? Manchmal habe ich das Gefühl, über gar nichts anderes sprechen zu können. Aber auch das spielt eine Rolle: Am 10. April 2016 erschien der Boston Globe mit einer fiktiven Titelseite und der Schlagzeile »Abschiebungen beginnen in Kürze«. Es handelte sich um die Überschrift zu einem Leitartikel mit der Aufforderung an die Republikanische Partei, die Nominierung von Donald Trump zu stoppen. Andere Artikel auf der Seite, die laut Redaktion ein Versuch sein sollte, Trump beim Wort zu nehmen, schilderten neben weiteren Akten der Aggression einen Handelskrieg und einen Feldzug gegen die Medien. Die Einzelheiten trafen so nicht ein, aber den Geist von Trumps Politik erfassten die Beiträge gut. Was mir von dieser Seite in Erinnerung blieb, ist, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Tageszeitung mit einer Schlagzeile über Abschiebungen aufmacht, nicht einmal, wenn diese in einem Umfang stattfinden, wie es ihn noch nie gegeben hat. Dafür wäre die Nachricht nicht spektakulär genug.
Eine Meldung über das Vorhaben, 5200 Soldaten an die Grenze zu Mexiko zu entsenden, brachte die New York Times am 30. Oktober 2018 auf Seite A18. Die Platzierung so weit hinten hatte nichts mit Hartherzigkeit der Redaktion zu tun: Drei der vier Schlagzeilen auf der Titelseite oberhalb des Falzes handelten von den Folgen der Schießerei in der Synagoge von Pittsburgh drei Tage zuvor; ein Artikel stellte eine Verbindung zwischen den Schüssen und der hasserfüllten Rhetorik im Zusammenhang mit der sogenannten Migrantenkarawane her, die Ende 2018 die Grenze zwischen Mexiko und den USA erreichte. Im Vergleich zu diesen größeren Geschichten mag die Meldung über die Truppenentsendung zweitrangig erschienen sein. Und dann passierten ja auch noch andere Dinge auf der Welt – ein Flugzeugabsturz in Indonesien, eine Wahl in Brasilien. Es kann schließlich nicht immer nur um Immigration gehen, oder? Die Frage ist ernst gemeint.
Wie ein Großteil der Berichterstattung, aber vielleicht sogar noch mehr als diese, ist das Schreiben über Immigration von dem betroffen, was ich als Trump-Verschiebung bezeichnen möchte. Journalisten verwenden beiläufig Formulierungen wie »illegaler Grenzübertritt«, wenn sie über Asylsuchende schreiben – obwohl es tatsächlich kein Gesetz gibt, das von Geflüchteten verlangt, bestimmte Einreisewege zu nehmen. Sie eignen sich immer mehr den Sprachgebrauch der Immigrationspolitik an, die Menschen daran hindern will, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Auffallend ist die Verwendung von Wörtern wie »Karawane« und »Migranten«, wenn von Menschen die Rede ist, die fliehen, um Sicherheit zu finden.
Diese Verschiebung verengt den Spielraum, um der Politik des Hasses und der Aggression entgegenzutreten. Außerdem erzeugt sie eine Hierarchie der Geschichten, sowohl für die Schreibenden wie für die Lesenden. Dass Kinder von ihren Familien getrennt werden, ist so herzzerreißend, dass kaum noch Platz für gewöhnlichere Geschichten über den Krieg gegen Immigranten bleibt. Denken wir nur an jenen Mexikaner, der zwölf Jahre in San Diego lebte, arbeitete und Steuern zahlte und dann abgeschoben wurde. Er versuchte zurückzukehren, kletterte über die Mauer in Tijuana, stürzte ab und brach sich beide Sprunggelenke. Letzten Sommer habe ich über ihn geschrieben, und fast niemand hat die Story gelesen. Ich verstehe warum.
Und dann sind da noch die Geschichten, die ich nicht geschrieben habe. Ich habe nicht über die Transgenderfrau aus Tschetschenien geschrieben, die von Mexiko aus in die Vereinigten Staaten gelangte und dann in Chicago festgenommen wurde. Verglichen mit dem, was sie in den Jahren zuvor durchgemacht hatte, fühlte sich die Haft geradezu gut an. Dann ist da das Paar aus Russland, beide Akademiker, die von der Geheimpolizei vertrieben wurden, weil sie schwul sind und weil sie sich mit Geschlechterfragen befassen. Sie gelangten in zwei verschiedene Länder, und der eine in so etwas wie ein Gefangenenlager. Es gibt die Geschichte eines Hungerstreiks in einer Hafteinrichtung in Oregon, den ich verfolgt hatte, aber über den ich noch nicht geschrieben hatte, als einer der Hungerstreikenden letzte Woche starb.
Vor zwei Jahren hat an dieser Stelle Martin Baron von der Washington Post gesprochen, der vielleicht größte Zeitungsredakteur meiner Generation. Er sagte, in der Ära Trump gebe es für die Journalisten nur eine Lösung: »Wir müssen einfach unseren Job machen.« Ich denke, das ist eine großartige Lösung. Nur wüsste ich gern genauer, was unser Job ist. Marty sagte, unsere Aufgabe sei es, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Ich denke, diese Definition von Journalismus ist die beste Definition, die ich bislang gehört habe, und sie zeigt die Stoßrichtung unserer Arbeit. Aber es gibt ein Problem dabei. Den Mächtigen auf die Finger zu schauen erfordert Macht und verleiht zugleich Macht. Wir Journalisten müssen jeden Tag, jede Woche, jede Stunde entscheiden, wie wir mit dieser Macht umgehen. Weder unsere Aufnahmefähigkeit noch die unserer Leser ist grenzenlos. Deshalb muss die Macht, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, im Einklang mit einer Hierarchie von Prioritäten ausgeübt werden, die mehr umfasst als nur die Anzahl der Blicke, die ein Artikel auf sich zieht.
Ich habe in meiner journalistischen Tätigkeit Macht erfahren. Bei drei unterschiedlichen Gelegenheiten, als ich über einzelne Immigranten oder Geflüchtete schrieb, schien der Artikel – oder in einem Fall meine Anwesenheit im Gerichtssaal – ihr Schicksal positiv zu beeinflussen. Eine Abschiebung wurde verhindert, Asyl wurde gewährt. Vielleicht waren es glückliche Zufälle, aber wir wissen, dass die Bürokratie sensibel auf Macht reagiert. Der New Yorker hat Macht. Ich habe Macht, weil ich für den New Yorker schreibe.
Diese Macht, über die einzelne Menschen verfügen, ängstigt mich. Wenn ich die Macht habe, durch Schreiben das Leben einer Person zu verändern – das Leben einer Person zu retten –, was ist dann mit den Geschichten, die ich nicht geschrieben habe? Was ist mit den Geschichten, von denen ich nicht einmal weiß? Wie kann ich überhaupt über irgendetwas schreiben? Wie kann das irgendjemand von uns?
Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt das Recht haben, andere Geschichten zu schreiben. Was wäre, wenn nicht? Was wäre, wenn wir eine Woche – oder vielleicht einen Tag – über nichts anderes schreiben würden? Nur Geschichten über Immigration. Ich vermute, unsere Leser wären überfordert. Man kann nur ein bestimmtes Maß an menschlichem Leid an sich heranlassen. Man kann nur in begrenztem Umfang persönliche Geschichten aufnehmen, sonst läuft alles ineinander. Natürlich würde das einen Eindruck von der Größenordnung des Problems vermitteln, aber die journalistische Ökonomie betrachtet Größe selten auf diese Weise. Wir wollen praktisch nie etwas vollständig darstellen, unser Metier sind die repräsentativen Geschichten. Ich erinnere mich nur an eine Ausnahme: als die New York Times die Lebensgeschichten aller Toten des 11. September 2001 veröffentlichte. Nicht die Geschichten all dieser Menschen oder eine Mischung daraus waren die Story, obwohl man so etwas hätte machen können. Die Story war das Unvorstellbare: die Größenordnung.