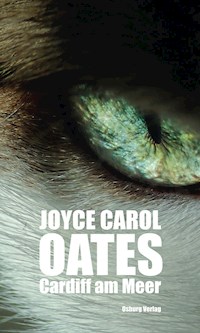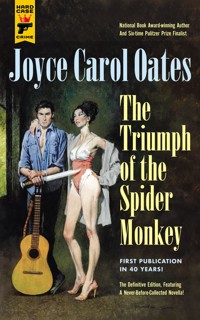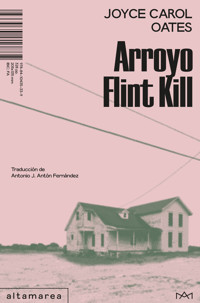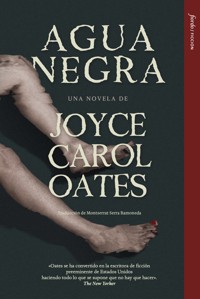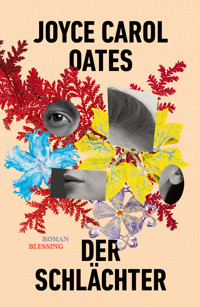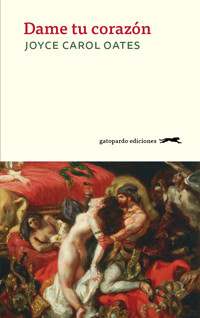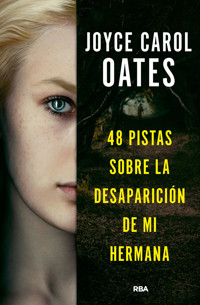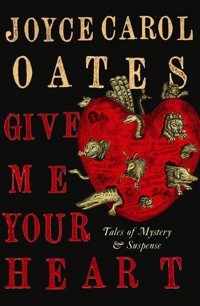16,99 €
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Babysitter« ist ein niederschmetternd beeindruckendes Buch, ein schonungsloses Porträt des Amerikas der oberen Mittelschicht sowie ein entlarvender Blick auf die etablierten Rollen der Frau – als Ehefrau, Mutter oder Sexobjekt. Oates gelingt es, all dies zu einem unglaublichen Pageturner zu formen.
In den späten 1970ern treffen in Detroit und seinen Vorstädten verschiedene Leben aufeinander – mit tragischen Folgen: Hannah, Ehefrau und Mutter, beginnt eine Affäre mit einem geheimnisvollen Fremden; Mikey, der sich mit zwielichtigen Aufträgen durchschlägt, beschließt, sich endlich seiner Vergangenheit in Detroits Waisenhaus zu stellen; und dann ist da dieser Serienkiller, der als Mörder kleiner Kinder unter dem Namen Babysitter Berühmtheit erlangt – eine rätselhafte Figur an der Peripherie der Elite Detroits, der bisher jeglicher Vergeltung entkam. Während Hannah dem Mann, den sie nur unter dem Namen Y. K. kennt, zunehmend verfällt, scheint auch der Babysitter immer näher zu kommen.
»Gewagt und unvergesslich.« The Guardian
»Joyce Carol Oates lässt einem wie immer den Atem stocken.«Mail on Sunday
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Joyce Carol Oates
Babysitter
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Silvia Morawetz
HarperCollins
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Babysitter bei Alfred A. Knopf, New York.
www.eccoverlag.de
© 2022 Joyce Carol Oates This translation is published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC © 2024 für die deutschsprachige Ausgabe Ecco Verlag in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von Ecco Verlag nach einem Gestaltungskonzept von Anzinger und Rasp, München Coverabbildung von Deena So Oteh, https://deenasooteh.com/ E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783753000923www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für Dan Halpern
Dinge geschehen nicht einfach so, es hängt davon ab, wer gerade vorbeikommt.
Paul Bowles
Es gibt nur eine Frage: Wozu bin ich fähig?
Y. K.
I
Sie fragt sich selbst, warum
Weil er sie berührt hat. Nur am Handgelenk.
Mit den Fingern darüber gestrichen. Und dazu ein Blick von der Seite.
Weil er gefragt hat: Was für eine bist du? – was heißen sollte: Die Frau welches Mannes?
Weil die Zeiten und der Ort danach waren, dass eine Frau – (zumindest eine, die aussah wie sie) – Ehefrau sein musste.
BITTENICHTSTÖREN
Im einundsechzigsten Stock des Hotels erwartet er sie.
Kein Name für ihn, bei dem man annehmen kann, dass er stimmt. Sie weiß sehr wenig über ihn, bei dem man annehmen kann, dass es stimmt. Sie weiß: er, ihn. Das genügt.
Sie ist allein im Aufzug, einer eleganten Glaskabine, die lautlos und zügig ins Atrium emporschwebt wie ins Nichts.
Die belebte Hotellobby sinkt unter ihr weg. Neben ihr fliegen offene Etagen und Geländer in die Tiefe.
Eine elegante neue Art des Aufzugfahrens, ganz anders als in den größeren und langsameren, schwerfälligen Aufzügen ihrer Kindheit.
Damals gab es oft uniformierte Liftboys, die weiße Handschuhe trugen. Heute ist man sein eigener Liftboy.
Ein schwacher Geruch hängt in der Kabine. Zigarrenrauch?
Es ist Dezember 1977. Das Rauchen in den öffentlichen Bereichen von Hotels ist noch nicht verboten.
Plötzlich wird ihr schwindlig, ihr wird übel. Zigarrenrauch, so schwach wie eine Erinnerung. Sie schließt die Augen, um sich wieder zu fangen.
Ihre schicke italienische Lederhandtasche, sie trägt sie nicht am Handgelenk wie sonst, sondern fest unter den rechten Arm geklemmt, zusätzlich gestützt von der linken Hand, denn sie ist merklich schwerer als sonst.
Trotzdem hält sie die Handtasche so, dass das glänzende Messinglabel nach außen zeigt – Prada.
Instinktiv, unbewusst eine Eitelkeit sogar an diesem Tag – Prada.
Ist es der letzte Tag ihres Lebens, oder ist es der letzte Tag einesLebens?
Natürlich kennt sie die Nummer: 6183.
Könnte eine Tätowierung auf ihrem Handgelenk sein. Sein Anspruch auf sie.
Anspruch. Schicksal. Sie ist kein Dichter, nicht besonders gut im Umgang mit Worten, doch diese kommen ihr tröstlich vor, wie glatte kühle Steine, die man den Toten auf die geschlossenen Augen legt, um ihnen Frieden zu bringen.
Sein Zimmer. Genau genommen ist es eine Suite, zwei geräumige Zimmer mit Blick auf den Detroit River, in denen er wohnt, wenn er die Stadt besucht.
Es wäre allerdings möglich, dass er verschiedene Räume für verschiedene Besucher hat. Doch davon weiß sie nichts, er hat sich ihr nie anvertraut.
Der Fahrstuhl hält zischend und mit einem leisen Ruck im einundsechzigsten Stock. Die Glastür gleitet auf, ihr bleibt nichts anderes übrig, als hinauszutreten. Etwas ist unwiderruflich entschieden, sie hat keine Wahl.
Die Handtasche fest umklammert unter ihrem Arm. Hat sie keine Wahl?
Ob er sie erwartet, neben dem Fahrstuhl? Ungeduldig, dass sie kommt?
Da ist niemand. In beiden Richtungen kein Mensch.
Noch kannst du umkehren.
Wenn du es jetzt gleich tust, erfährt niemand davon.
Den Aufzügen gegenüber ein Fenster mit Blick auf den Fluss, das Ufer, eine grellweiße Sonne. Perspektivisch verkürzte Sicht auf die Woodward Avenue tief unten, den lautlosen Verkehr.
Warum, ist nicht klar. Warum sie hierhergekommen ist, so viel riskiert.
Frag niemals nach dem Warum. Die Ausführung, das Wie – darauf kommt es an.
Sie geht durch einen fensterlosen Gang, folgt den Zimmernummern: 6133, 6149, 6160 … Die Zahlen steigen so langsam, ihr wird gleich leichter ums Herz; sie wird nie bei 6183 ankommen.
Unter den Füßen ein dicker Plüschteppich, rosig wie das Innere einer Lunge. Das entfernte Ende des Korridors hat sich aufgelöst. Bis zum Horizont geschlossene Türen, die immer kleiner werden, je mehr sie sich der Unendlichkeit nähern.
Es gibt für sie keinen Grund, sich der 6183 zu nähern. Dass die Person, die sie in dem Zimmer erwartet, sie herbestellt hat, bedeutet nicht, dass sie auch hingehen muss. Wenn sie will, kann sie umkehren.
… als wärst du nie hier gewesen.
Gar nicht von zu Hause weggegangen.
Wer würde davon erfahren? Kein Mensch.
Doch sie kehrt nicht um. Es zieht sie unaufhaltsam vorwärts.
Wenn du in einem Rätsel lebst, kannst du es nur lösen, indem du bis zum Ende vordringst.
Wie die elegante Glaskabine aufwärts glitt, zügig und bereitwillig, so geht sie zu der Suite, die seine ist.
Ein schwacher Geruch nach Zigarrenrauch in ihrem Haar, in den Nasenlöchern, die zucken, so übel ist ihr, weit zurückliegend, bloß noch ein Rest, Erinnerung.
Was hat sie an? Ein Kostüm, mit Bedacht gewählt, weißes Leinen ist immer dezent, ein Seidenhemd, ein rotes Seidentuch von Dior, fröhlich um den Hals geschlungen.
Elegante Schuhe mit unpraktisch hohen Absätzen, Saint Laurent, Ziegenleder, die im Teppich versinken. Wenn sie plötzlich umkehren und rennen, um ihr Leben laufen muss, werden die eng sitzenden Schuhe und der Teppich es ihr schwermachen.
Einer jener Träume, in denen sie wieder Kind ist. Sie rennt, rennt. Ihre Füße versinken in etwas wie Sand, das weich aussieht, es aber nicht ist.
Sie kommt nicht vorwärts, nie.
Jedes Mal ist er hinter ihr. Daddys starke Arme drohen sie zu packen, sie an den Rippen hochzuheben …
Der Anspruch eines Mannes, Schicksal.
Die Zimmernummern steigen jetzt schneller an. Es ist eine Tatsache des Lebens, auf die wir uns nie so ganz einstellen: Das Draußen bewegt sich in dem ihm zugewiesenen Tempo, ganz gleich, was wir uns in unserem tiefsten Inneren wünschen.
Als sie die 6183 fast erreicht hat, beginnt sie zu zittern. Es ist immer dasselbe, sie ist schon hier gewesen, es fühlt sich an wie Vibrationen eines Fahrzeugs, das zu schnell gefahren wird, gefährlich rast bei einem Regen, der die Sicht nimmt, durch tiefe Pfützen, die sich erheben wie über die Windschutzscheibe niedergehende Wellen.
Ihr Nacken ruht auf einem kalten Tisch aus Edelstahl, direkt darunter befindet sich ein Abfluss. Ihre offenen Augen starren blicklos. Nur wenn die Augen nicht sehen, erkennst du alles.
Und doch drängt sie vorwärts. In den Saint-Laurent-Stilettos ist es immer noch Dezember 1977, sie hat das Zimmer noch nicht zum letzten Mal betreten. Sie ist entschlossen, dem Rätseln ein Ende zu machen.
Auf dem Messingschild am Türrahmen steht 6183; jedes Mal war es 6183.
Und das Schild, das am Türknauf hängt, in Schönschrift, silberne Buchstaben auf schwarz gelacktem Grund, mit dem immer gleichlautenden Hinweis:
BITTENICHTSTÖREN
Ich bin
Ich bin eine schöne Frau, ich habe ein Recht darauf, geliebt zu werden.
Ich bin eine begehrenswerte Frau, ich habe ein Recht darauf zu begehren.
Als wir starben
Als wir starben, wurden unsere (schönen) (nackten) Körper zu lebloser Materie.
Als wir starben, blieben unsere erstickten letzten Schreie in unserer Kehle gefangen.
(Es hieß immer, legte man sich im Tode neben uns und hielte man das Ohr an unsere Kehlen, hörte man, sofern man würdig war, ein schwaches Echo dieses letzten Schreis.)
Als wir starben, endete unsere Qual. Denn Erbarmen ist uns allen gewiss.
Als wir starben, war von euch, die uns hervorgebracht haben, niemand auch nur in der Nähe.
Als wir starben, starben wir allein, voller Angst. Denn ihr wart nicht in der Nähe, nirgendwo.
Als wir starben, fragt euch selbst, warum ihr Kinder bekamt, wenn ihr uns nicht liebtet.
Fragt, warum.
Doch als wir starben, waren unsere Körper so liebevoll auf den Tod vorbereitet, wie von euch niemand uns vorbereitet hat.
Als wir starben, wurden unsere Körper sorgfältig gebadet, die kleinsten Schmutzpartikel aus sämtlichen Falten des Körpers und unter den (gebrochenen) Fingernägeln entfernt, die Fingernägel mit Nagelscheren geschnitten, rund und ebenmäßig, wie auch unser Haar mit einem milden Shampoo gewaschen, gekämmt und ordentlich gescheitelt wurde, und zwar so, dass klar wurde, derjenige, der uns post mortem so behutsam zurechtmachte, kannte uns »im Leben« nicht.
Als unsere Körper gesäubert und rein waren wie unsere Seelen, wurden wir liebevoll »verewigt«: fotografiert.
Wo das menschliche Auge uns im Stich lässt und uns bald vergisst, verschafft das Auge der Kamera uns Unsterblichkeit.
Nach Tagen in Gefangenschaft (die kürzeste: drei, die längste: elf) wurden unsere Körper vom Ort der Gefangenschaft neben dem nördlichen See in den Kiefernwäldern in den Oakland County, Michigan, transportiert und dort öffentlich präsentiert.
Drei von uns im Schnee. Zwei von uns in der Jahreszeit nach der Schneeschmelze, auf weißen Frotteehandtüchern auf den Boden gelegt.
An unseren »Ruhestätten« wurden wir noch einmal fotografiert: eine (zärtliche) Art und Weise des Abschiednehmens.
Bei flüchtigem Hinsehen hätte man meinen können, es wären große Puppen oder Kinderschaufensterpuppen, die da auf dem Boden lagen, sehr still.
Die Arme wurden uns über der Brust verschränkt, die Beine an den Fesseln übereinandergelegt, wie ein Engel sittsam die Beine kreuzen würde.
Zuletzt wurden uns die Augen geschlossen in dem Frieden, »der höher ist als alle Vernunft«.
(Ein Daumendruck, sacht, aber kraftvoll, auf die Augenlider – mehrmals wiederholt, bis das Lid geschlossen bleibt.)
Man müsse sich schon dicht neben uns legen, hieß es, damit man die blutunterlaufene Ligatur um unseren Hals sehen könne, so fest war uns die Kehle zugeschnürt worden.
Unsere Kleidung war gewaschen und (das war überraschend) sogar gebügelt, ordentlich zusammengefaltet und neben unsere kleinen, noch nackten Körper gelegt worden, als habe sich derjenige, der diese Tätigkeiten verrichtete, als großherzig erweisen, nichts in Besitz behalten wollen, was ihm nicht gehörte.
Denn ihr wart gleichgültig und hattet uns nicht verdient, wir wurden euch weggenommen, und später wurden unsere Körper »zurückgegeben« – solche Tätigkeiten, so sorgfältig ausgeführt, derjenige, der sie verrichtete, wurde nicht gefasst, und ihr wusstet auch keinen anderen Namen für ihn als den törichten, von einem ruhmsüchtigen Zeitungsreporter erfundenen – Babysitter!
Als wir starben, schritten unsere (schönen, nackten) Körper nicht mehr in der Zeit voran – ein Alter wie unseres ändert sich nicht mehr. Der Älteste von uns war für immer dreizehn, der Jüngste zehn.
Und wir gehören immer zu dem einen, der uns so liebte, dass er eine Liebe, erdrückend und erstickend wie eine Lawine oder eine Flut, nicht aushielt. Und unsere Dankbarkeit, dass seine Liebe aus uns, Kindern, auf die es nicht ankam – die keinen kümmerten, keiner betrauerte –, seine Kinder machte.
Nur dieses eine Mal
»Hallo, Ma’am. Willkommen im Renaissance Grand.«
Breites Lächeln, als Ma’am das opulente siebziggeschossige Hotel betritt. Uniformierter Portier, eine Haut wie Sandstein, die außergewöhnlich weißen Zähne entblößt beim Anblick der (weißen) Frau in den schönen Kleidern.
Kennt Hannah, allerdings nicht namentlich, weiß: die Frau eines reichen Mannes aus einem der (weißen) Vororte oder ein Hotelgast.
(Derselbe Portier, der Gesindel verscheucht, obdachloses Detroiter Bettlergesindel gleich welcher Hautfarbe, das im Renaissance Grand und in dessen Umgebung unerwünscht ist.)
Hannah dankt dem Portier liebenswürdig, ohne ihn richtig anzusehen, sie erwidert den Blick von Personen in Livree kaum einmal, weil sie hofft, nicht aus den Augenwinkeln sehen zu müssen, wie das weiß blitzende Lächeln verschwindet, wenn sie vorübergegangen ist, nicht den Spott des Mannes, seine Verachtung zu spüren. Doch das bildet Hannah sich bestimmt nur ein, sie wird sich wohl irren.
Dem Beweggrund für ein Lächeln nicht zu genau nachgehen.
Und – nicht umschauen, um zu sehen, wohin es verschwunden ist.
Hannahs Vater war ein Spaßvogel gewesen und hatte für jede Lebenslage einen Spruch auf Lager gehabt. Auch wenn man nie wusste, ob man bei seinen Worten lachen oder zurückzucken sollte.
Und pass auf, wo du lächelst.
Deshalb nicht einmal ein verstohlener Blick zurück, als Hannah durch einen Korridor mit hell erleuchteten Boutiquen geht, in dem ihre eleganten hohen Absätze klackend auf dem Marmorboden aufschlagen, um die Ecke biegt, im Aufzug zu einer riesigen Hotellobby hinaufschwebt – einem unermesslichen offenen Atrium, dessen oberes Ende außer Sichtweite liegt, keine Decke erkennbar, sofern es überhaupt eine Decke hat, denn womöglich löst sich das Renaissance Grand in den Himmel über Detroit auf, der ständig von leuchtend Grellblau zu traumgleich und dunstig wechselt, überhäuft mit Sturmwolken, die sich über den Großen Seen sammeln wie brütende Gedanken, die an kein Ende kommen … Harfenmusik zieht durch die luftige Weite, eine schwer fassbare irische Melodie, die am Rand des Erkennens taumelt. Terrassen mit stechend süßlich riechenden wachsweißen Lilien, rot geäderten Tulpen, blauen Hyazinthen. Zur Mittagszeit ist die Lobby mäßig belebt. Gäste haben Namensschilder an der Kleidung, eine Zusammenkunft von Computer-Programmierern, eine andere von Haarstylisten. Ein Gewirr von Stimmen wie Publikum in der Theaterpause. Ein Unterton von etwas, das rhythmisch pulsiert und pumpt wie ein Kunstherz. Schon die Luft macht benommen, blendet. Eine schöne Frau in schöner Kleidung ist es so gewohnt, gesehen zu werden, dass es ihre eigene Sehfähigkeit behindert.
Nur möchte Hannah heute nicht gesehen werden. Nicht erkannt. Eine dunkle Designersonnenbrille bedeckt einen Großteil ihres makellosen Gesichts.
Makellos ist seinen Preis wert. Jeden Preis.
Sie schwört es sich.
Ihrem Ehemann untreu, ihren Kindern? Das wird kein zweites Mal geschehen.
Natürlich: Es erfährt ja niemand davon. Nur sie und er.
Durch die Drehtür des Renaissance Grand Hotel, die sich langsam von selbst bewegt, treibt es die Frau ihrem Schicksal entgegen. Ein gewaltiger Mechanismus ist von Jahrtausenden in Gang gesetzt worden, ihr bleibt nichts übrig, als sich zu fügen.
Sie gelangt zum Empfang. Leckt sich die Lippen und spricht einstudierte Worte.
»Entschuldigen Sie. Hier sollte eine Nachricht für ›M.N.‹ hinterlegt sein …«
Der Hotelconcierge schaut mit leerem Blick, verständnislos. Hannah muss ihre Frage in bestimmterem Ton wiederholen.
»… für ›M.N.‹ hinterlegt. Eine Nachricht …«
Hannah sagt es gelassen. Hier zweifelt eine Frau nicht daran, dass sie etwas Besonderes erwarten darf, sie muss nur die richtigen Worte sprechen.
Aufregend für jemanden mit so wenig Übung im Täuschen. Y.K.s Plan ist, eine Nachricht für Hannah an der Rezeption zu hinterlegen, aber nicht an sie, also an H.J., sondern an die (erfundene) M.N. adressiert.
In einigen Vierteln von Detroit kennt man den Namen Jarrett: vermögende Unternehmer, Philanthropen. Die Familie ihres Mannes, Einwohner von Grosse Pointe. Wenig wahrscheinlich, aber doch eine ganz reale Möglichkeit, dass dem Concierge der Name geläufig ist, für eine Ehebrecherin ist Diskretion sehr angeraten.
Seit sie dem Parkwächter des Renaissance Grand ihren Autoschlüssel ausgehändigt hat, füllt Hannah eine Rolle aus, die nicht die ihre ist, mit Initialen, die nicht die ihren sind, und mit einem Drehbuch, das nicht von ihr stammt – aber nur dieses eine Mal. Sagt sie sich.
Was für eine bist du? Sie möchte es zu gern wissen.
Sie hat mit einem verschlossenen Umschlag gerechnet, doch zu ihrer Überraschung, vielleicht Kränkung, überreicht ihr der Concierge nur ein Blatt Hotelschreibpapier, hastig gefaltet.
M.N. mit Bleistift außen auf den Zettel gekritzelt, innen nur die Zahl 6183.
In diesem Moment begreift sie, dass sie einen schweren und (womöglich) nicht wiedergutzumachenden Fehler begeht, der ihr ganzes restliches Leben durcheinanderbringen wird, (vielleicht sogar) das ihrer Familie, doch sie bedankt sich munter und selbstbewusst bei dem Concierge, als hätte sie genau so einen läppischen Zettel erwartet.
»Ich danke Ihnen, Ma’am!«
Gekränktes Abwenden. Wieder das Ma’am!
Als Ma’am sieht Hannah Jarrett sich nicht. Es ist zwar eine angemessen höfliche Anrede, doch dabei denkt man unweigerlich an eine matronenhaft-unelegante Gestalt, eine vollschlanke Frau mittleren Alters, deren romantische Gefühle/sexuelles Verlangen vertrocknet sind, aber doch nicht an sie.
Bei Ma’am denkt man nicht an schickes glänzendes, asymmetrisch geschnittenes glattes Haar, einen eleganten schwarzen Kaschmirmantel und fein genähte Lederschuhe.
Bei Ma’am denkt man nicht an heißes, wild rauschendes Blut.
Von der Rezeption zurücktreten und sich die durchkreuzten Erwartungen auf keinen Fall anmerken lassen. Die Nachricht noch einmal ansehen und prüfen, ob ihr etwas entgangen ist. Doch nein: kein Gruß, kein liebes Wort für Hannah oder gar eine Anweisung, nur das platte Faktum der Zimmernummer, die einzige Information, die sie einstweilen braucht.
Der Mann, der Hannah sechzig Etagen weiter oben erwartet, hat (offensichtlich) keine Bedenken, dass der Portier die (private) Nachricht lesen und nur zu gut verstehen könnte. Aber natürlich ist es gar keine private Nachricht.
Hannah zerknüllt das Blatt Papier in der behandschuhten Hand. Nein, sie ist nicht gekränkt.
Um etwas so Belangloses wie persönliches Empfinden geht es hier nicht.
»Ma’am? Die Aufzüge befinden sich rechter Hand.«
(Woher weiß der Concierge, dass Hannah einen Aufzug benutzen will? – Sie spürt, wie sie vor Empörung errötet.)
Fängt sich aber gleich wieder, es geht ihr gut. So wie Kinder sich von einem plötzlichen Tränenausbruch erholen, von jäh aufwallenden Gefühlen, die sie überwältigen und bald wieder vergehen.
Keine Sünde und nicht einmal ein Fehler. Ein Abenteuer.
Wer bin ich? M.N. Und nur dieses eine Mal.
Ihre hochhackigen Schuhe klacken auf dem Marmorboden, als sie zügig durch die Lobby zu einer Reihe eleganter gläserner Aufzüge, die wie Raumkapseln anmuten, schreitet.
Irische Harfenmusik, die ihren Kopf umschwirrt. Doch wo ist der Harfenspieler?
Sie nimmt eine Gestalt wahr, die neben ihr hergeht, verträumt, schemenhaft, schwerelos – ein Widerschein in einer Reihe schmaler in eine Mosaikwand eingelegter länglicher Spiegel –, genau im gleichen Schritt.
Bis sie verschwindet.
Der Kalender
Vorortleben in Far Hills, Michigan – Tyrannei des Kalenders.
An Werktagen Termine: vormittags, nachmittags.
Zahnarzt, Kieferorthopäde. Kinderarzt, Gynäkologe, Dermatologe, Therapeut. Yoga, Friseur, Fitness-Center, Schönheitsklinik. Forum für nachbarschaftliche Beziehungen, Elternabend, Bürgerentscheid, Leihbücherei. Mittagessen mit Freunden: im Far Hills Country Club, im Bloomfield Hills Golf Club, im Red Fox Inn, im Far Hills Marriott. Versammlungen der Historischen Gesellschaft von Far Hills, des Büchereiverbands von Far Hills, der Freunde des Detroit Institute of Arts.
Dieses Frühjahr wurde Hannah sogar gebeten, den Co-Vorsitz bei der jährlichen Spendengala für das prestigeträchtige Detroiter Kunstmuseum zu übernehmen, eine Ehre, die ihr zu ihrer tiefen Befriedigung zum ersten Mal zuteilwird, auch wenn Hannah natürlich ahnt – so naiv ist sie nicht –, dass das auf eine größere Zuwendung seitens der Investmentfirma, deren Partner Wes Jarrett ist, zurückzuführen ist.
Jetzt werden sie mir Anerkennung zollen. Sie werden einsehen, dass ich eine von ihnen bin.
Vorortleben: ein (summender, wärmender) Bienenstock.
Familienleben: ein schmucker kleiner Bienenstock innerhalb des Bienenstocks.
Hier fühlt Hannah sich geborgen. Sie hat bestimmt, wer sie ist – Ehefrau, Mutter. Sie ist in Sicherheit, wird versorgt. Sie denkt nicht mehr darüber nach, wodurch und warum sie der Mensch ist, der sie ist. Ihre Bienenstock-Identität ist gefestigt.
Außerhalb des Bienenstocks interessiert Hannah nur wenig. »Nachrichten«, die die Bienenstock-Identität nicht berühren, sind ihr gleichgültig.
Sie sieht rasch die Detroiter Zeitung durch, nimmt nationale Nachrichten kaum und internationale gar nicht zur Kenntnis. Die innerstädtische Kriminalität: nein. Ist ja auch kaum etwas Neues. Ein Anstieg der Einbruchsdiebstähle in den wohlhabenden Vororten von Detroit, Umweltprobleme im Zusammenhang mit einer »toxischen« Mülldeponie unweit von Far Hills, die zweifelhaften Verbrechen, die als »häusliche Gewalt« bezeichnet werden – so etwas findet Hannahs Interesse, aber nur flüchtig. (Häusliche Gewalt! Frauen, die gewalttätige Männer heiraten, Frauen, denen der Mut fehlt, diese Männer zu verlassen, törichte Frauen, schwache – da fällt das Verständnis schwer.) Die erschreckendste Nachricht, diejenige, die Hannah am stärksten erschüttert, ist die von einem Kindesentführer, Kindermörder, Pädophilen, der seit Februar 1976 im Oklahoma County als Serientäter in Erscheinung tritt – Hannah wendet den Blick schnell von den Schlagzeilen ab.
Sie ist in Sicherheit. Ihre Kinder.
Keine der Entführungen hat in Far Hills stattgefunden. Keines der entführten Kinder ist Hannah oder ihren Freunden bekannt.
In Hannahs Leben ist kein Platz für Unerwartetes.
Jeder Tag ist ein Kästchen im Kalender. Eine Leerstelle, die gefüllt werden muss. Jede Leerstelle ein vergittertes Fenster: Schieb die Scheibe so hoch hinauf, wie du kannst, und drück das Gesicht an die Stäbe, atme die frische, kühle Luft mit dem Hauch von Sehnsucht, umklammere die Stäbe fest, diese Stäbe, sie schränken zwar ein, schützen aber auch, was für eine Freude, so fest daran zu rütteln, wie du kannst, denn du weißt, sie werden nicht brechen.
Der Tag im Kalender, der 8. April 1977, ist leer geblieben. In einer vollgepackten Woche bleibt der Freitag frei.
Ist das verdächtig?, überlegt Hannah.
Sie bringt es nicht über sich, für den 8. April etwas in den Kalender einzutragen. Nicht mal verschlüsselt.
Nicht weil sie befürchtet, Wes könne einen rätselhaften Eintrag in ihrem Kalender entdecken und Verdacht schöpfen. Nichts ist unwahrscheinlicher, als dass Wes ihren Kalender durchsähe, es sei denn, er durchsuchte auch ihre Schubladen und Schränke. Wes ist ein ordnungsliebender, pingeliger Mensch, der die Privatsphäre seiner Frau ebenso respektiert, wie er von ihr erwartet, dass sie seine respektiert. Hätte Wes Hannah betrogen, eine Eventualität, die sie sich ausgemalt hat, um sich dagegen zu wappnen, wäre er nicht so rücksichtslos, sie das merken zu lassen: Das wäre grausam, schlimmer als die eigentliche Untreue. (So sieht sie es.)
Ihr Stolz, ihre Selbstachtung könnten Schaden nehmen, davor hat sie Angst.
Wenn er nicht zu ihrer Verabredung kommt. Wenn – nichts geschieht.
Demütigung, Zurückweisung trifft sie am stärksten.
Deshalb dieses Datumskästchen lieber leer lassen.
Sogar nach seinem Anruf ist nicht ganz klar, was der Inhalt ihrer Verabredung ist. Trinken Sie zusammen ein, zwei Glas in seinem Hotel? Oder … woanders?
Als legte er Hannah (absichtlich) Steine in den Weg. Bittet sie, sich beim Portier zu melden, sobald sie im Hotel ist.
Warum?, rätselt Hannah.
Seine Beweggründe geben ihr ständig Rätsel auf.
Sie sagt Ismelda, sie werde »den Großteil des Tages« unterwegs sein.
Sie wird nicht weit weg sein, deutet sie damit an, sie bleibt in der Nähe, Mittagessen mit Freundinnen im Far Hills Country Club, vielleicht der Besuch einer Freundin im Beaumont Hospital, eventuell eine kurze Fahrt zur Gateway Mall. Vermutlich ist sie gegen halb sechs wieder zu Hause, das heißt, heute muss Ismelda Conor und Kaya von der Schule abholen.
In der Regel holt Hannah die Kinder ab. Das ist ihr wichtig: Sie fährt die Kinder morgens zur Schule und holt sie nachmittags ab.
Hannah erklärt diese Abweichung vom Programm so sorgfältig, damit die Haushälterin, eine Filipina, die beim Verstehen des Englischen manchmal Mühe hat, alles genau mitbekommt.
Heute, diesen Nachmittag: die Kinder, von der Schule. Ja?
Ismelda nickt ernst. Ja, Missus.
Doch kein Wort über die City zu Ismelda. Zu Ismelda kein Wort, dass sie in die City fährt.
Es ist eine Reise in die City von Detroit. Eine Pilgerfahrt.
Sechzehn Meilen südöstlich auf der dröhnenden Autobahn, keine Fahrt, die eine Ehefrau und Mutter aus Far Hills leichtfertig antritt.
Sie lächelt in sich hinein, über sich selbst erstaunt.
Warum sie das tut, ergründet Hannah nicht. Wie, das ist die Frage.
KARFREITAG1977, DETROIT, MICHIGAN.
Ein kühler Hauch von Spätwinter, wie Säbel aufblitzender Sonnenschein auf dem Fluss, sie ist auf dem Weg zu dem Ort, an den er sie bestellt hat. Der Wind fegt in starken Böen von der kanadischen Küste heran.
Sie fährt mit ihrem Auto, ein Geschenk ihres Mannes: ein glänzender weißer Buick Riviera.
Meilenweit entfernt erhebt sich ihr Ziel am Horizont schillernd vor ihr wie eine Fata Morgana.
Das Renaissance Grand Hotel, Detroit, Woodward Avenue eins.
Siebzig Stockwerke, das höchste Gebäude in Michigan.
Sechzehn Meilen von ihrem Zuhause in Far Hills entfernt.
Sechzehn Meilen von ihren Kindern entfernt, von ihrem Leben. Von dem, was ihr Leben war.
Er hat sie angesehen, sie am Handgelenk berührt. Zwischen ihnen floss so etwas wie elektrischer Strom, sexuell aufgeladen.
Bilde dir nicht ein, dass ich dir schmeichele. All das in deinem Leben, der Schwindel, die Scheinheiligkeit – der Selbstbetrug –, ist nun vorbei.
Laut ausgesprochen hat er diese Worte nicht. Und doch hörte sie sie.
Er berührte sie nur am Handgelenk, umschloss es vielleicht mit seinen starken unachtsamen Fingern. Dennoch hat sie den Stromstoß, die grobe Zärtlichkeit in der Magengrube gespürt.
Schau nicht so überrascht. Das ist Blödsinn.
Eine Seltenheit, dass Hannah Jarrett auf dem I-75 unterwegs ist, dem John-C.-Lodge-Expressway. Nach Süden fährt, in den großen Schlund von Detroit.
Um diese Tageszeit, es geht auf Mittag zu, wohin könnte sie da wollen? Hannah sucht nach plausiblen Erklärungen, doch ihre Gedanken werden weggeblasen wie Schmetterlinge im Wind, die Flügel gebrochen.
Seit einer halben Stunde, seit sie ihr Feldsteinhaus im Kolonialstil in der Cradle Rock Road in Far Hills verlassen hat, klart der dunstige Himmel mehr und mehr auf. Das Kobaltblau am vom Wind freigeräumten Himmel ist so unermesslich tief und hart wie angemaltes Zinn und so strahlend hell, dass es ihr in den Augen wehtun würde, trüge sie nicht die schützende dunkle Designerbrille.
Bei Fahrten in die Stadt säße Wes am Steuer. Aus Sicherheitsgründen nähme Wes den Pontiac Grand Safari, seinen Kombi.
In Far Hills ist Hannah eine souveräne Fahrerin, doch auf der Autobahn schwindet ihre Sicherheit rapide. Motorradfahrer in schwarzem Leder und mit derben jungen Gesichtern, verdeckt von getönten Gläsern, überholen ihr langsam fahrendes Auto unverschämt rechts und scheren mit ohrenbetäubendem Gedröhn, giftige Abgase ausstoßend, wieder vor ihr ein.
Wind! Heftige Böen aus Ontario, die sich winden und ringeln wie unsichtbare Schlangen.
Als Kind hat sie einmal miterlebt, wie Windschlangen auf offenem Feld auf das Fahrzeug ihres Vaters zujagten und es von der Straße fegen wollten. Ihr Vater war beim Fahren oft wütend, Hannahs Mutter auf dem Beifahrersitz sehr still.
Die Windschlangen waren die Strafe. Hannah drückte fest die Augen zu, das Sehen war aber trotzdem nicht zu vermeiden.
Sie quälte sich selbst mit solchen Fantasiebildern. Auch wenn sie wusste, dass sie nicht real waren, vermochten sie sie zu ängstigen.
Jetzt, als Erwachsene, quält sie sich damit, etwas zu sehen, was nicht da ist.
Trotzdem ist da die sehr reale Gefahr der Strafe.
Sturmstärke erreichende Winde gelten als Auslöser für den Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, zu dem es kürzlich auf dem John-C.-Lodge-Expressway kam.
Lastwagen ragen gefährlich dicht hinter dem Buick Riviera auf. Hannah hat den heimatlichen Boden der Vororte verlassen und ist in feindliches Gebiet geraten, wo sie identifiziert und abgelehnt wird: Frau am Steuer, weiße Frau am Steuer, teurer Wagen, für männliche Fahrer ein Affront.
Ein wütend funkelndes Gesicht, verschwommen in dem hohen Führerhaus hinter ihr, ein höhnender Mund.
Reichentussi. Reiche Schlampe.
Wenn es scheint, als könne ein Lastwagen nicht mehr dichter heranfahren, schert er zum Überholen aus. Nicht schnell, sondern unerträglich langsam, wie ein Würger, der sich Zeit für das Erdrosseln seines Opfers nimmt.
Diese Fremden wollen ihr nichts tun, sagt Hannah sich. Hier geht es nicht um etwas Persönliches, sie kennen sie ja nicht.
Das Schicksal der Ehebrecherin. Ihre Strafe, noch bevor sie die Sünde begangen hat.
Sünde! Bild dir nur nichts ein.
Er würde sie auslachen, wenn er wüsste, was ihr durch den Kopf geht.
Beinahe hofft Hannah, dass Y.K. sie auslachen wird – und ihre Befürchtungen abtun. Die Momente im Leben einer Frau, wenn sie so empfindlich ist wie eine offene Wunde, darauf hofft, dass das unbekümmerte Lachen eines Mannes sie tröstet.
Wieso glaubst du, irgendetwas von dem, was wir zusammen tun, sei wichtig? Es ist nicht wichtig.
Es wird keine Katastrophe, außer (vielleicht) für dich.
Er ist ihr Freund. Ein Verbündeter. Das war von Anfang an klar.
Wie sie sich begegnet sind – reiner Zufall. Sie erkannten einander auf Anhieb.
Inmitten der festlichen Kakofonie eines gesellschaftlichen Ereignisses strichen seine Finger über ihr Handgelenk. Als glitte unter Wasser ein Raubfisch in der Nähe vorbei.
Hallo! Kenne ich dich?
Was für eine bist du?
Er war unverschämt, aber auch sehr komisch. Nicht ganz klar, warum Hannah lachen muss, aber die Erinnerung daran ist köstlich.
Nicht köstlich, aber geheim, erschlichen.
Wenn sie hier und jetzt – unterwegs zur Unzeit aus unerklärlichen Gründen auf der I-75 in die City von Detroit – einen Unfall hat, wenn Hannah in dem glänzenden weißen Buick eingeklemmt wird und stirbt, würde man im Kreise derer, die sie kannten oder das zumindest behaupten, protestieren: Aber – wozu ist Hannah Jarrett denn nach Detroit gefahren? Und warum allein? In ihrem Kalender ist nichts eingetragen …
Ismelda wäre sprachlos, verblüfft. Mrs. Jarrett hatte ihr doch umständlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht weit weg von zu Hause sein würde.
Und Wes: erstaunt. Ahnt, dass er betrogen worden war, gedemütigt. So sicher, seine Frau zu kennen, wie er seine Kinder zu kennen glaubt, so gut wie seine Westentasche geradezu. Die war auch nicht rätselhafter.
… dass sie ein Leben im Geheimen hatte, ein unerlaubtes Leben.
… ein Leben, mit dem er nicht gerechnet hat.
Ehebruch – es wäre für sie das erste Mal.
Elf Jahre verheiratet. Ein kleines Leben lang. Doch alles, was heute geschieht oder nicht geschieht, fällt aus der Zeit heraus. Es wird nicht in die Ehezeit eingerechnet.
Zufällig ist es der Freitag vor Ostern: Karfreitag.
Hat sich so ergeben. Zufall. Dass er diese Woche in Detroit ist.
Schuldgefühle steigen in Hannah auf, es fühlt sich an, wie wenn der grobe Stoff eines Kleidungsstückes auf der empfindlichsten Haut scheuert.
Sie hat die Innenstadt von Detroit erreicht, begibt sich auf neues Terrain. Wohnviertel mit kleinen Holzhäusern auf kleinen Grundstücken, Reihenhäusern, verwitterten Mietshäusern und Gewerbebauten, die Mauern mit Graffiti beschmiert. Auf dem Seitenstreifen neben der Fahrbahn zerbrochenes Glas, verrostete Radkappen und Schutzbleche, zerfetzte Reifen.
Es ging langsam abwärts von Far Hills nach Süden in die wild wuchernde Stadt Detroit. Ihr Ziel ist das Luxushotel am Ende der Woodward Avenue, am Detroit River gelegen, der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und dem kanadischen Ontario.
Erstaunlich: Sie wird sich dort, im Renaissance Grand Hotel, mit einem Mann treffen, einem Fremden, der will, dass sie ihn Y.K. nennt.
Er gab die Anweisungen, Hannah wird sie befolgen.
Und sich dabei mit einem Gedanken trösten: Natürlich mache ich das nicht bis zum Ende mit. Wie könnte ich.
Der Leslie-Caron-Ton atemlosen, ernsthaften Bedauerns.
Tut mir leid, ich kann nicht lange bleiben. Höchstens bis …
Wie eine Regisseurin wird sie das Geschehen auf der Bühne steuern. Wird im Voraus festlegen, wie die Szene sich entwickelt.
… werde halb sechs zu Hause erwartet.
Wie er sie ansehen wird, wenn sie ihm das sagt! Die Miene des Mannes, das Verlangen, das sie ungeheuer erregt.
Er wird gekränkt sein, glaubt sie. Und sonnt sich für einen Moment in dieser Gewissheit.
Aber vielleicht ist er auf eine Weise unglücklich, die nicht schmeichelhaft für sie ist, die Möglichkeit muss sie in Betracht ziehen.
Und lacht ihr ins Gesicht. Schlägt ihr die Tür vor der Nase zu.
Nein, er wird gekränkt sein. Davon ist Hannah überzeugt.
Die Frau, eine verheiratete Frau: kommt zu ihm.
Das bedeutet, Hannah ist frei zu gehen, wenn sie das möchte.
Weißt du, ich glaube, ich kann nicht bleiben. Ich glaube – das ist ein Missverständnis.
Sie muss versuchen, ihm zu erklären, dass sie von ihm angezogen ist, das schon, doch dass ihr Leben gerade zu kompliziert ist, um sich auf irgendetwas einlassen zu können.
Eine Böe schüttelt den Wagen durch! An Hannahs Nacken richten sich die Haare auf.
In ihrem Haus in Far Hills pfeift der Wind manchmal in den Schornsteinen, rüttelt an Türen mit einem Geräusch, als wolle etwas ins Innere eindringen. Türen werden vom Wind auf- oder zugeweht. Oh, Mommy! Mommy!, ruft Katya. Das Gespenst.
Sei nicht dumm, Dummerchen! Es gibt keine Gespenster.
Doch Hannah hört das Gespenst auch. Jedenfalls hört sie etwas.
Man möchte sich nicht vorstellen, dass in einem dieser älteren Häuser vielleicht einmal jemand gestorben ist. Dass vielleicht Ehen erloschen sind.
Familien zerbrochen.
Doch Hannah hört die Kinder nach ihr rufen. Die Liebe zu ihnen überwältigt Hannah, sie vergöttern sie so sehr.
Schon hat ihr Geliebter Hannah ausgelacht, sie hat etwas Steifes an sich, eine gewisse Prüderie.
In den Designerkleidern steckt eine ängstliche Frau.
Es tut mir leid. Ich glaube, ich kann nicht bleiben. Nicht heute. Heute ist – ist kein guter Tag.
Besser, sich kurzzufassen, sibyllinisch. Entschuldige. Die Umstände haben sich geändert, ich kann nicht bleiben.
Y.K. hat auch andere Frauen, vermutet Hannah. Erfahrenere, weniger unbeholfene als Hannah.
Sehr wahrscheinlich, dass Hannah einige von ihnen kennt. Jemand hatte ihn zu der Spendengala eingeladen. Wer, wollte er ihr natürlich nicht sagen.
Wenn es dich nicht stört, dass die Frau verheiratet ist …
Er lachte sie aus, ihr Freimut gefiel ihm. Sie hätte so gern gedacht, dass sie ihn überrascht hat.
Er konnte nicht ahnen, wie untypisch so eine Bemerkung für Hannah war. Sie hatte ein, zwei Glas getrunken. Es hatte unerschrocken klingen sollen, sexuell provokant, passend zu dem schicken schwarzen Crêpe-de-Chine-Kleid von Dior, das sie extra für den Abend gekauft hatte. Für ihre eigenen Ohren hörte es sich aber regelrecht wehmütig an.
Die noch größere Befürchtung blieb unausgesprochen: Wenn es dich nicht stört, dass die Frau verheiratet und Mutter ist …
Ein Mann, der Frauen auslacht. Ein Mann, der Frauen auslacht, wird mit Scherzen, die Frauen machen, nichts anfangen können. Er durchschaut solche Scherze. Männlicher Spott, als ob jemand ein Wäschestück mit dummen Rüschen herunterreißt und so den vor ihm zitternden Frauenkörper entblößt.
Die Kinder! Wenn es hier um Sünde geht, wenn es vielleicht ein sehr schlimmer Fehler ist, dann wegen der Kinder.
Sie hat die Kinder an diesem Morgen zur Schule gefahren. Das lässt sie sich nicht nehmen.
Über Hannah würde es heißen: Sie war eine großartige Mutter, die Kinder haben sie angehimmelt.
Doch sie spüren schnell, wenn Hannahs Aufmerksamkeit nicht ausschließlich ihnen gilt. An diesem Morgen waren sie gereizt und unruhig, weil Hannah im Auto ihrem Geplapper nur mit halbem Ohr zuhörte. Mommy! Mom-my!
Der Vorwurf im Ton des Kindes zerreißt ihr das Herz.
Hungrig nach Mommys Liebe, anhänglich. Unersättlich, aufreibend. Man fragt sich, ob eine Mutter, eine Brust jemals genügen kann, den Hunger eines Kindes zu stillen.
Und der Hunger eines Mannes: weniger persönlich und wählerisch als der einer Frau. Der Fluch der Frau, Liebe zu sehr zu brauchen.
Der Fluch der Frau, sich kümmern zu müssen.
Mommy, Küsschen! Mommy, wo gehst du hin?
Denn sie spüren, Mommy macht eine lange Reise, es besteht das Risiko, dass Mommy sie nie mehr wiedersieht.
Sie ist nicht mehr die Mommy im Cordmantel fürs Autofahren, sondern trägt einen aus weichem schwarzem Kaschmir, der ihr in lockeren Falten über die Beine fällt. Nicht mehr die Leinenschnürschuhe, die so bequem sind wie Schlafzimmerpantoffeln, sondern elegante, unpraktische Stilettos von Saint Laurent.
Als Freund würde ich dich sehr zu schätzen wissen. Als jemanden, bei dem …
Sie darf nicht den Anschein erwecken, als bitte sie ihn. Wenn du einen Mann um etwas bittest, hast du schon verloren.
Hannah würde es sehr schätzen, diesen Mann, der ein paar Jahre älter ist und so viel interessanter als Wes, als Freund zu haben. Einen, dem ich vertrauen und dem ich mich anvertrauen kann.
Denn sie hat niemanden. Nicht einen in ihrem jetzigen Leben. Ihre Freundschaften in Far Hills sind keine engen, es gibt niemanden, bei dem sie sich darauf verlassen könnte, dass er nicht lieblos über sie spricht.
Und Wes ist nicht ihr Freund. Ein Ehemann kann nicht der Freund seiner Frau sein.
Wes ist ihr auch nicht treu gewesen. Hannah ist sich (fast) sicher.
Schau, du weißt, dass du kommst. Zu mir.
Blödsinn, dass dein Mann etwas damit zu tun hat.
Jetzt ist das Gefälle noch deutlicher: abwärts zum Fluss.
Ausfahrten fliegen vorbei wie im Traum. Straßennamen, die häufig in den Lokalnachrichten zu Verbrechen genannt werden: John R., Cass, Vernor, Fort, Freud, Brush, Gratiot.
Warum ist sie nicht früher von zu Hause weggefahren! Sie wird zu spät im Hotel ankommen.
Ihr (weiblicher) Stolz, nicht früher aufzubrechen. Unschlüssig, was sie anziehen soll. Die Kleider (noch einmal) gewechselt. Das blassrosa Seidenhemd, spontan entschieden: Ja! Das.
Und dann kostbare Minuten verloren, als sie dastand und gebannt auf die Uhr im Schlafzimmer starrte.
Er darf nicht merken, wie ungeduldig du bist. Wie groß dein Hunger, dein Verlangen ist.
Kein Mann will eine Frau, die ihn will. Nicht so.
Kein Mann will eine Frau, die will. Darauf läuft es hinaus.
Diese bittere Wahrheit wurde Hannah von ihrer Mutter vermittelt. Vielleicht nicht mit so vielen Worten.
Und jetzt Hannah am Rand eines Abgrunds: neununddreißig Jahre alt.
Nicht alt. Im Kreis ihrer Freunde in Far Hills.
Trotzdem verschlägt es ihr ein bisschen den Atem. Und in ein paar Monaten wird sie noch älter sein: vierzig.
Und wie seltsam und unerwartet: Hannah ist heute nicht wesentlich anders als der Mensch, der sie mit sechsundzwanzig, neunzehn, dreizehn war. Das Kind. Heimatlos. Wer dieser Mensch ist, muss sie vor anderen geheim halten.
Für sie ist es ein Novum, diese Besessenheit von einem Fremden. Irgendwie, auf irgendeine Weise wird ihr klar werden, dass Y.K. eigentlich kein Fremder ist, das spürt sie genau.
Wenn eine Frau nicht begehrt wird, existiert sie nicht. Hilf mir zu existieren.
CITY CENTER
LETZTE AUSFAHRT VOR DEM TUNNEL NACH KANADA
Für einen panischen Moment deutet sie diesen entscheidenden Wegweiser falsch, genau den Wegweiser, auf den sie gewartet hat, dann begreift sie, dass hier ihre Ausfahrt ist.
Eine Wohltat, die dröhnende Autobahn zu verlassen. Sie ist von einem aufsehenerregenden Unfall, einem schnellen Tod verschont geblieben.
Und steckt jetzt in zäh fließendem Verkehr. Lieferfahrzeuge, Einbahnstraßen. Ein wahres Labyrinth von Einbahnstraßen.
Die berüchtigte Innenstadt. Gefürchtet bei (weißen) Vorortbewohnern, die durch diese Straßenzüge zur Renaissance Plaza am Fluss fahren müssen.
Und alles seinetwegen. Sie riskiert so viel für ihn.
Hinter Hannah hupt ein ungeduldiger Fahrer. An der Kreuzung Lared und Fort hat die Ampel von Rot auf Grün geschaltet und Hannah nicht schnell genug reagiert.
Sie biegt auf die Lared ein, die nach Süden in eine trostlose heruntergekommene Straße führt. Denkt, das war wohl falsch, dann aber ragt eine Viertelmeile entfernt das Renaissance Grand auf.
Blendende Fensterfronten, die sich siebzig Etagen in die Höhe erheben. Eine sachte Explosion von Sonnenlicht, als trübe Wolken aufreißen.
Hannah ist begeistert, sie ist da.
Aus morgendlicher Ängstlichkeit heraus eine plötzlich aufschießende Freude.
Aus den Ruinen des alten Detroit das neue.
An das historische Detroit erinnert kaum noch etwas. Nach den »Unruhen« von 1967 ist viel abgerissen worden. Von Wes’ Familie, die über Generationen in dem exklusiven Wohnviertel Palmer Woods lebte, ist niemand mehr hier, alle haben die Stadt verlassen. Hannah hat Fotos von Detroit gesehen, die vor 1967 aufgenommen wurden; eine sepia getönte Vergangenheit.
Die Renaissance Plaza ist das »neue« Detroit: Luxushotels, spektakuläre Bürogebäude, Wohntürme und Eigentumswohnungen, edle Restaurants und Boutiquen, eine medizinische Praxis (spezialisiert auf kosmetische Chirurgie), ein Theater/eine Konzerthalle mit Platz für zweitausend Besucher. Direkt vor ihr, auf der anderen Seite des Flusses, die Skyline der Zweckbauten von Windsor, Ontario.
Innerstädtische Erneuerung, Gentrifizierung. Bürgerschaftlich orientierte Unternehmensentwicklung.
Hoffnung für Detroits Zukunft!
Hoffnung für die dem Untergang geweihte Stadt.
Hannah weiß, dass Wes einer der Investoren beim Renaissance-Plaza-Projekt ist, hat aber keine genaue Vorstellung, wie viel Geld er hineingesteckt hat oder aus welchem Vermögen es eigentlich genau stammt: ausschließlich aus seinem oder aus ihrem gemeinsamen.
Das Projekt ist (heißt es) mit Millionen von Dollar in den roten Zahlen, und dennoch haben die Investoren einen gewissen Gewinn erzielt. Die Unschärfe des »gewissen Gewinns« ist sicher kein Zufall.
Hannah hat nur eine vage Vorstellung davon, was ein Konkurs ist. Auf persönlicher Ebene ja, auf Unternehmensebene nein.
Ihr Vater hat Konkurs angemeldet, sogar mehr als einmal. Als Kind wusste sie davon nichts.
Wes wirkte amüsiert, als er Hannah das Konkursrecht erläuterte. Denn alles steht und fällt mit dem »Steuerrecht«. Wenn es hart auf hart kommt, steht und fällt alles mit den »Steueranwälten«.
Wie auch immer, die im Immobilienrecht geltenden Gesetze unterscheiden sich jedenfalls von der Steuergesetzgebung bei anderen Wirtschaftstätigkeiten. Es kann sein – oder ist es wahrscheinlich? –, dass die Investoren beim Renaissance-Plaza-Projekt keine Grundsteuer zahlen, obwohl die Immobilien auf den teuersten Flächen im Staat Michigan errichtet worden sind.
Hannah war bestürzt und brachte das Wes gegenüber auch zum Ausdruck: Sollten sie sich nicht Gedanken darüber machen, dass sie ihre Investitionen verlieren könnten? Ist das nicht riskant? Doch Wes berührte sie am Handgelenk, wie man ein quengeliges Kind besänftigen mag. Und sagte schulterzuckend: Wenn man weiß, was man tut, ist es kein Risiko.
Hannah hat ihr Ziel erreicht: die bewachte Stadt in der Stadt, drei Meter über Straßenniveau erhoben.
Hohe glatte Betonmauern, nur wenige Eingänge, keiner davon von Fußgängern angesteuert; Fußgänger schreckt man in diesem Teil der Stadt ab. Der auf die Plaza einbiegende Verkehr wird auf spiralförmige Zufahrten gelotst, auf denen Stadtautos und Limousinen, Flughafen-Shuttlebusse und Privatfahrzeuge langsam vorwärtskriechen und von Security-Mitarbeitern und uniformierten Parkwächtern empfangen und kontrolliert werden.
Hannah fühlt sich sofort heimisch. Eine Erleichterung, das auf Straßenniveau liegende Detroit zu verlassen und in die bewachte Stadt hinaufzufahren, in der sie verstanden wird: die Frau eines reichen (weißen) Mannes.
Angestellte in Uniform sind eine Annehmlichkeit. Denn was sie in der bewachten Stadt bieten, ist Sicherheit: Schutz. Parkwächter, Portiers, Hotelpagen: ein Kehrreim herzlicher Begrüßungen, der Hannah in ihrem glänzenden weißen Buick empfängt: Willkommen im Renaissance Grand, Ma’am!
Der Buick wird Hannah abgenommen, dankbar überreicht sie den Zündschlüssel. Ihren Wagen zu parken ist ihr lästig, genauso wie es ihr lästig ist, den Wagen zu waschen oder zur Inspektion zu bringen, bei sich zu Hause staubzusaugen, Waschbecken und Toiletten zu reinigen; solche Arbeiten fallen Personen zu, die dafür ausgebildet sind.
Und wie geht es Ihnen heute, Ma’am?
Ist das Ihr erster Besuch in unserem Haus, Ma’am?
Hannah geht es sehr gut, vielen Dank! Und nein, es ist nicht ihr erster Besuch im Renaissance Plaza.
Sie lächelt bei diesen Begrüßungen, entschlossen, nicht zu bemerken, dass die Angestellten in den Uniformen sie verachten. Natürlich nicht sie (sagt sie sich), sie haben sie mit einer anderen (reichen) (weißen) Frau verwechselt, die ihr ähnlich sehen mag. Genau genommen sollten die Hotelangestellten dankbar dafür sein, dass Hannah Jarrett und jeder andere Besucher der bewachten Stadt im Herzen der dem Untergang geweihten Stadt den unweigerlich kommenden Tag hinausschiebt, an dem ihnen mitgeteilt wird, dass das Luxushotel Konkurs angemeldet hat.
Bis dahin lächelt Hannah das uniformierte Personal genau gleich an und gibt, wenn es angemessen ist, allen das genau gleiche Trinkgeld.
Sie hat immer einen Vorrat an Fünfdollar-Scheinen in der Brieftasche, die sie austeilt wie einen Segen.
Das Ma’am findet sie, offen gesagt, trotzdem ärgerlich.
Sie beißt die Zähne zusammen und lächelt es weg.
Anders denn als Vorwurf kann sie dieses Ma’am nicht verstehen.
Die Frau eines reichen (weißen) Mannes: Ma’am.
Sie nimmt die Parkquittung von dem uniformierten Wächter entgegen, als wäre nichts gewesen. Als habe sie das schon viele Male erlebt. Das Aufblitzen der Zähne, aus den Augenhöhlen des lächelnden Maskengesichts starrende Augen, natürlich sprechen sie sie mit Ma’am an, in dem anderen Leben schlitzen sie Ma’am die Kehle auf, hätten ihr beinahe den blonden Kopf abgeschlagen.
Du hast das schon einmal durchgestanden. All das, was vor dir liegt, du kannst es nicht verhindern.
Noch viele Male. Zum ersten Mal.
Die erste Berührung
Die erste Berührung war wohl ein Versehen. So legte sie es sich zurecht.
Die Finger eines Fremden strichen über ihr Handgelenk, wollten ihre Aufmerksamkeit. Plötzlich, verstohlen, eine eindeutige sexuelle Erregung.
Wie unter Wasser, ungesehen. Nur gespürt.
Vielleicht ein Raubtier, das auf Beute aus war. Ein Hai, der gekonnt durch Flachwasser zog.
Denn es war ein festlicher Anlass, eine Zusammenkunft mehrerer Hundert Gäste in opulentem Rahmen (der Riverview Ballroom des Renaissance Grand Hotel in Detroit), eine jährlich stattfindende Benefizveranstaltung (die March Madness Gala) zugunsten des chronisch unterfinanzierten Detroit Institute of Arts und damit so etwas wie ein Feuchtbiotop, in dem Lebensformen schwimmen, die erwartungsvoll Ausschau nach anderen Lebensformen halten.
Sie wandte sich, ohne nachzudenken, demjenigen zu, der sie am Handgelenk berührt hatte, ein strahlendes leeres Lächeln zu seinem Gesicht erhoben (er war groß, überragte sie deutlich), das Lächeln einer Frau, die sich sicher ist, dass sie in diesem Milieu keinen folgenschweren Fehler machen kann, es war schließlich ihr Milieu – für den Besuch der Gala benötigte man eine Eintrittskarte, die sechshundert Dollar pro Person kostete, und Hannah war ja eine von mehreren Co-Vorsitzenden des Abends. Und so wandte sie sich also um in der Erwartung, ein bekanntes Gesicht zu sehen, doch nein: Das Gesicht war ihr nicht bekannt, war das eines Fremden mit schweren Lidern und stark gewölbter Stirn, kein attraktives Gesicht, keines, das Vertrauen einflößt, ein Gesicht, einzigartig, wie aus Stein gemeißelt, aber – lächelte der Mann sie an? Er trug keine dem Anlass angemessene Garderobe, keinen Abendanzug, sondern eine Krawatte aus einem silbrig seidenen Stoff, einen dunklen Nadelstreifenanzug aus leichter Wolle, ein weißes Hemd mit Manschettenknöpfen aus Onyx. Sein Haar war dicht wie ein Pelz, schwarz, von Grau durchzogen, streng nach hinten gebürstet und an den Schläfen etwas zurückweichend. Seine Augen von Nahem glänzend schwarz wie Murmeln, das Weiß sehr fein geädert; die Lider erinnerten sie an die von Falken oder Adlern – Raubvögeln …
Da hatten sich seine Finger auch schon um ihr Handgelenk geschlossen, umfassten und hielten es, als wollten sie ihr Halt geben, Sicherheit, und das verborgen vor allen, die womöglich herschauten. Und was auch immer dieser Mensch zu Hannah sagte, als er sich vertrauensvoll zu ihr beugte, versonnen, ironisch, sie aufforderte, mit ihm zu lachen, sie bemühte sich, es zu hören, noch immer mit dem leeren strahlenden Lächeln, hörte es aber nicht, nicht genau, hörte nur sich selbst lachen vor körperlichem Erschrecken, als wäre etwas Protoplasmisches, Bakterielles in ihren Blutkreislauf eingedrungen.
Was für eine bist du?, fragte er sie ihrer Erinnerung nach, vielleicht aber auch, sie weiß es nicht mehr genau, Welche von denen bist du?, oder sogar: Wer bist du? Fragen, die Hannah komisch fand, urkomisch, auch wenn sie das (vielleicht) nicht waren, sondern vielmehr aggressiv und anmaßend, und Hannah Jarrett – in dieser besonderen Situation außerdem erhitzt von dem zu schnell getrunkenen Glas Weißwein und dem aufregenden Anlass, den sie gemeinsam mit anderen so viele Wochen lang vorbereitet hatte, wofür ihr vom Podium herab gedankt und sie mit anderen Freiwilligen, als der Applaus ertönte, zum Aufstehen aufgefordert worden war – überraschte sich selbst mit ihrem verblüfften Lachen, das klang wie das wilde Flügelschlagen eines Prärievogels, der sich in Panik aus dem schützenden Präriegras in die Lüfte erhebt, verzweifelt versucht, den Jägern und ihren Hunden zu entkommen, die ihn töten wollen.
Doch nein. Er war ihr Freund. Würde ihr Freund sein. Ihr Freund.
Lachte nicht über sie, sondern mit ihr, anteilnehmend. Als kenne er sie wirklich. Von seiner Warte eine abgepresste Zärtlichkeit, wie ein Älterer sie einem Kind gegenüber empfinden mag. Als wären sie alte Freunde, die sich durch außergewöhnliche Umstände in einem lärmenden Haufen Fremder wiederbegegneten.
Freunde, deren enge Verbindung nach Jahren der Trennung sofort wieder auflebt, was vor anderen geheim gehalten werden muss.
Es hätte eine Szene aus einem Film sein können, in dem aus dem Blick, den eine überrumpelte Frau und der Mann, der sie überrumpelt hat, tauschen, sofort eine intime/erotische/schicksalhafte Verbindung entsteht: Unterlegenheit, Verwunderung und Unbehagen bei der Frau, sexuelle Arroganz und Sicherheit beim Mann.
Wie in einem Film hörte man im Hintergrund Musik, schroffe, abgehackte Noten: Ein Jazzquintett spielte eine nicht identifizierbare Melodie, Töne wie grell aufblitzende Glasscherben, wodurch Gespräche in dem Festsaal mit der hohen Decke und dem harten glänzenden Holzboden praktisch unmöglich waren.
Schwierig für Hannah, zu wissen, was zu ihr gesagt/von ihr erbeten wurde.
Sie selbst, hört sie, spricht leichthin, besonders geistreich. Ihr Ton ist spielerisch, kapriziös, ausweichend – obwohl sie, wie sie sich später erinnert, ihren Namen und ihre Identität arglos preisgibt, mit Gattinnenstolz oder – eitelkeit dem begierig lauschenden Fremden den Namen ihres Mannes nennt. Sie konnte auch nicht widerstehen, sich als »eine Co-Vorsitzende« des Abends vorzustellen.
Sein Name bloße Initialen: Y.K.
Das genügte Hannah fürs Erste.
Sie protestierte zaghaft, lachend. »Aber warum denn? Kennt hier niemand deinen Namen?«
Merkte allerdings, dass es ihm nicht gefiel, ausgefragt zu werden. Einer der Männer, die nur widerwillig, häppchenweise Informationen über sich preisgeben.
Von sich aus sagte Y.K.: Er sei zu der Veranstaltung gekommen, weil jemand ihm eine Eintrittskarte geschenkt habe.
Und – das Museum liege ihm am Herzen. Alle Museen. Die Kunst.
Außerdem übernachte er in dem Hotel. In seinem Detroiter Lieblingshotel, in seiner gewohnten Suite in einer der obersten Etagen.
Er komme oft nach Detroit, geschäftlich. Logiere im Renaissance Grand, das über einen Hubschrauberlandeplatz verfüge. Von Detroit könne er mit dem Heli nach East Lansing gebracht werden.
Oder der Gouverneur des Staates könne per Hubschrauber nach Detroit kommen, sie sähen einander manchmal zum Abendessen, hätten eine alte Verbindung. Sie seien zusammen Kadetten in Colorado gewesen.
Was meint er damit?, fragte sich Hannah. Kadetten, Colorado?
Später ging Hannah auf, dass Y.K. wohl die Luftwaffenakademie in Colorado Springs gemeint hatte.
Wenn Y.K. (seinem Aussehen nach) Anfang vierzig war, war er wahrscheinlich Pilot in Vietnam gewesen.
Dieser gedankenverlorene Blick, wie von ferne. Der Blick eines Piloten, der überlegt, wann er seine Bomben ausklinkt.
Hannah wurde ganz flau, als sie sich den Männerkörper unter der Abendgarderobe vorstellte, überzogen von Narben. Und die Hände einer Frau, die diese Narben lasen wie Brailleschrift. Gespreizte Finger, die sich an seine Seiten klammerten, an seinen muskulösen Rücken.
Diese Vision kam einfach über sie. Und auch das wie im Film, völlig unvermittelt.
Seltsamerweise aber weniger eine Vision als vielmehr eine Erinnerung.
Und während sie sich unterhielten – es zumindest versuchten bei dem Lärm –, hielten seine Finger sie am Handgelenk fest, auf Höhe ihres Oberschenkels. Und drückten gegen ihr Bein. Als hätten ihre Stimmen sich separiert von der seltsamen Intimität, die zwischen ihnen entstanden war, einer Intimität, die die Sprache ausschloss.
Allein hierauf kommt es an, das ist real.
Bilde dir nicht ein, dass ich dir schmeichele. All das in deinem Leben, der Schwindel, die Scheinheiligkeit – der Selbstbetrug –, ist nun vorbei.
Es gibt nur eine Frage: Wozu bin ich fähig?
Keins dieser Worte wurde laut ausgesprochen, und doch verstand Hannah vollkommen. Röte stieg ihr ins Gesicht vor Erregung und Unruhe.
Ganz still stand sie da, kerzengerade. Wie angenehm das Blut in ihr Herz strömte!
Es hatte den Anschein, als unterhielten sie sich, ganz zwanglos. Nicht anders als die anderen im Raum, und es waren so viele, die sich hier wie in einer Unterwasserwelt bewegten. Der Lärm war ohrenbetäubend, doch die Münder formten lautlos Worte. Die Gesichter wirkten verzerrt, fratzenhaft, als gingen sie unter.
Hannah blickte sich um. Ob jemand sie erkannte? Sie rettete? Sie hatte viele Freunde hier, wusste ihre Namen nicht mehr. Einen Ehemann?
Sie entdeckte kein bekanntes Gesicht. Wo war der Mann?
Heimlich hielt Y.K. Hannahs Handgelenk immer noch fest umklammert. Seine Knöchel drückten an ihren Oberschenkel.
Y.K.s Worte ließen direkt oder indirekt darauf schließen, dass er Geld hatte. Oder zu denen gehörte, die mit den schnellen Strömen schwammen, die Geld ermöglicht. Falls es einen Unterschied zwischen einem Kaufmann und einem Unternehmer gibt, war Y.K. vielleicht Letzteres, schwer fassbar, vage. Hannah würde Wes fragen, ob er ihn kannte.
Nein, das würde Hannah nicht tun. Dieses Thema konnte sie bei Wes nicht anschneiden, ohne zu erröten und damit Verdacht zu erregen.
Y.K. sagte, wenn er das nächste Mal in Detroit sei, könnten sie sich vielleicht treffen.
Etwas zusammen trinken, hier im Hotel, würde dir das gefallen? Hannah lachte nervös, bestürzt von der Frage, so unverblümt und dabei doch (sicher) beiläufig und sogar harmlos. Sie wusste nicht, wie darauf antworten, war aber nicht fähig, Nein zu sagen.
War das ein sexuelles Angebot? Hannah war sprachlos.
Oder war es das nicht? Als Y.K. sie, offenbar amüsiert über ihre Not, fragte, ob es eine Nummer gebe, unter der er sie kontaktieren könne, setzte bei ihr für eine kurze Weile das Denken aus, so als hätten ihr Herz und gerade auch ihr Gehirn ihre Tätigkeit eingestellt, sie fing sich aber gleich wieder, natürlich kannte sie ihre Telefonnummer, es war die des Haushalts, der Anschluss der Familie, und fügte mit einfältiger Betonung noch hinzu: »Sie steht nicht im Telefonbuch.«
Nicht im Telefonbuch – das fand Y.K. lustig.
Er neigte sich dicht zu ihr und sagte, ihr ins Ohr lachend: »Hannah! Nummern, die ›nicht im Telefonbuch‹ stehen, gibt es nicht.«
Verlachte sie, sagte aber ihren Namen.
Hannah! – der Klang seiner Stimme, beunruhigend, so dicht an ihrem Ohr.
Auf aggressive Weise vertraulich, intim. Beide Silben gleich stark betont, sodass ein Daktylus daraus wurde – Han-nah! Wie ein im Ausland Aufgewachsener den Namen artikulieren würde, nicht wie ein englischer Muttersprachler.
Sie lachten zusammen, erregt. Beide, so wollte Hannah es sehen, vor Vergnügen …
Dann mach ich das. Dich anrufen.
Ich … ich weiß nicht recht …
Ja.
Es war abgemacht. Kein weiteres Wort nötig.
Endlich: Die Cocktailstunde ging zu Ende. Hannah war benommen von Erschöpfung, der Wortwechsel mit Y.K. war intensiv gewesen, sie wollte dem Mann jetzt entfliehen und an ihn denken.
Und wo war Wes? Nirgends zu sehen.
Wie einen stechenden Schmerz empfand Hannah plötzlich puren Hass auf ihn, den Ehemann, der sie so missachtete.
Nur wenige Zuhörer lauschten dem Quintett schwarzer Musiker, das mit viel Elan und Ausdruckskraft Jazzklassiker gespielt hatte und nun mit »Take the ›A‹ Train« endete, so leidenschaftlich dargeboten, als ziele es mit Maschinengewehrfeuer auf die Herzen der achtlosen Menge.
Hannah sah Y.K. nach, der sich von ihr entfernte, ohne sich noch einmal umzuschauen. Hatte er sich ihre Telefonnummer notiert? Sie glaubte nicht.
Im selben Moment hatte er sie anscheinend vergessen.
Sofort erloschen Hannahs Lebensgeister.
Y.K. war verschwunden, untergegangen in dem Meer aus Männern mittleren Alters und älter, in Abendgarderobe, aus Frauen mit sorgfältig frisiertem Haar, in heiteren bunten Cocktailkleidern und mit Pfennigabsätzen, aus Kellnern, die sich durch die Menge schlängelten, die Tabletts über die Köpfe erhoben wie die heraldischen Gestalten auf ägyptischen Gräbern.
Schnatternden Gänsen gleich zogen fünfhundert Gäste zu den ihnen zugewiesenen Tischen, geschmückt mit frischen Blumen und Reproduktionen klassischer Kunstwerke, die sich nicht alle im Besitz des Museums befanden. Hannah blickte entschlossen geradeaus, wich aber Personen aus, die sie kannte oder zu kennen vermutete, ging dicht an der Wand des Festsaals, wo sie sich ungehindert bewegen konnte wie ein Frischverwundeter, der noch ganz fassungslos ist.
Er ruft natürlich nicht an.
Ich bin nicht in Gefahr – natürlich …
Die Jarretts hatten für sich selbst und acht Gäste einen ganzen Tisch erworben, zu einem Preis von sechstausend Dollar; das auf dem Tisch reproduzierte Kunstwerk waren Monets Seerosen.
Eins von Hannahs Lieblingsbildern, würde sie antworten, wenn sie jemand fragte. Eins dieser träumerischen hellblauen impressionistischen Gemälde, die bei Museumsbesuchern so beliebt sind.
Kunst, die Wohlgefühl erzeugt. Kunst ohne schroffe Linien oder Kanten, Kunst ohne Schatten; Kunst, die nicht das Leben widerspiegelt, sondern dessen Auf und Ab, schimmernde Farbeindrücke wie eine erlesene seidene Wandtapete.
Ein Wohlgefühl auch in dem opulenten Festsaal: elfenbeinfarbene Wände, filigran vergoldete Ornamente, Kronleuchter aus glänzendem Messing und Kristall. Die permanent aus den Lüftungsschlitzen an der Decke strömende kalte Luft kräuselte die Haare an Hannahs Nacken, der ihr zu nackt erschien für so viel Öffentlichkeit.
Sie sah beklommen nach oben. Als ob nur die verzierte Decke Schutz bot vor dem Anblick des unendlichen Alls.
Wes saß bereits an ihrem Tisch in der Nähe des Podiums. Nicht Tisch1, sondern Tisch2, ein VIP-Tisch, wie er Hannah Jarrett bei ihrem Status zukam.
Auf dem Stuhl neben Wes lag seine Aktentasche, leicht geöffnet. Gedanklich abwesend, sah Wes eine Mappe durch, machte sich Notizen. Typisch! In so einem Moment! Es versetzte Hannah einen Stich vor Verdruss und Schmerz, dass ihrem Mann der Abend, der ihr so viel bedeutete, offenbar gleichgültig war.
Er hatte Hannah in der letzten Dreiviertelstunde oder so ja auch nicht vermisst. War blind für Hannah in der Begleitung eines anderen Mannes, der sich Y.K. nannte, gewesen.
Also, was auch immer geschieht. Es ist verdient.
Es kam häufig vor, dass Hannah und Wes sich bei großen gesellschaftlichen Zusammenkünften aus den Augen verloren. Fast so, als vergäßen sie die Existenz des anderen bis zu dem leichten Schock gegen Ende des Abends, wenn sie einander (wieder)entdeckten: Ehefrau, Ehemann.
Ob sie sich heute noch zueinander hingezogen fühlten?, fragte sich Hannah. Zwölf – oder waren es dreizehn? – Jahre nachdem sie sich kennengelernt hatten …
Wes war so jung gewesen, so voller Hoffnung. Seine jungenhafte Begeisterung, sein Idealismus; ein klein wenig Rebellion dabei, entschlossen, seinen Weg zu gehen, ohne sich auf seinen Vater und die Jarretts zu verlassen. Und sein Idealismus hatte Hannah ermutigt, sich auf ihre Art und Weise vielleicht auch von der Herrschaft von Joker Daddy befreien zu können.
Ganz so war es nicht gekommen. Niemandes Schuld, bloß – nein.
Hannahs Kommen bemerkend, schob Wes die Mappe schnell in die Aktentasche, machte sie zu und stellte sie neben seinem Stuhl auf den Boden. Die Bewegung hatte etwas übertrieben Eilfertiges, das Hannah fuchste: Die Andeutung, Hannah, sähe sie ihn hier in der Öffentlichkeit arbeiten, würde es missbilligen wie eine schimpfende Mutter.
Mit spöttischer Galanterie stand Wes auf und zog Hannahs Stuhl neben seinem unter dem Tisch hervor, eine Geste, wie sie von einem Ehemann erwartet wurde.
Hannah ging auf seine gespielte Ironie nicht ein und lachte fröhlich: »Zeit zum Essen, Liebling.«
»Ja!«
»Du sahst aus, als hättest du dich gelangweilt.«
»Gelangweilt! Niemals.«
Und warum sollte sie ihn tadeln, wenn er zu einer Spendengala Arbeit mitbrachte? Sich in eine Ecke zurückzog, so als verstecke er sich vor den Leuten? Wes war erwachsen, er konnte tun und lassen, was ihm gefiel.
Ihre Tischkarte, sah Hannah, stand neben der von Wes. Das war bedauerlich: Um seinetwillen hätte sie es vorgezogen, wenn jemand anders auf diesem Stuhl säße, mit dem Wes die Unterhaltung mehr Freude gemacht hätte als mit ihr, die er ständig sah.
Bei solchen förmlichen Essen spürte Hannah, wie viel Kraft es sie kostete, die Aufmerksamkeit ihres Mannes zu behalten. Wes debattierte gern über Politik, in der richtigen Gesellschaft war er anregend forsch und kritisch; Politik war für ihn, genau wie für seinen Vater, im Grunde genommen ein Witz; sie diente dem Geschäft, war Narretei, ansonsten aber nicht weiter von Nutzen; man konnte ihr nicht trauen.
»Du siehst aus, als hätte es dir gutgetan«, sagte Wes, »deine Freunde zu sehen, beglückwünscht zu werden.«
»So weit würde ich nicht gehen, Wes. ›Beglückwünscht zu werden‹ …«
»Ach, komm schon. Du hast es verdient – der Glanz in deinen Augen.«
Hannah lächelte unsicher. Machte Wes sich über sie lustig, oder war es aufrichtig gemeint? Mit jedem Jahr ihrer Ehe konnte sie das weniger unterscheiden.
Sie wollte glauben, dass sie sich täuschte, dass es ihn doch nicht störte, als ihr Ehemann an der Spendengala teilzunehmen.
Damit sich der Abend auch für ihn lohnte, hatte Wes darauf bestanden, eine Einladung an ein Paar auszusprechen, das Hannah kaum kannte: einen prominenten Manager bei General Motors und dessen Frau, die in Bloomfield Hills wohnten.
Harold Rusch war mindestens fünfundzwanzig Jahre älter als Wes. Zwischen beiden bestand eine für Hannah undurchsichtige geschäftliche Verbindung, die möglicherweise auf eine Verbindung zwischen Rusch und Wes’ Vater zurückging.
Geschäftliche Interessen, das war Hannah mit der Zeit aufgegangen, sind wie ein riesiges Spinnennetz. Allerdings wird das Spinnennetz nicht beherrscht von einer einzelnen Spinne, sondern von Myriaden von unterschiedlich großen und machtvollen Spinnen, jede dicht verwoben mit den anderen, auch wenn sie Konkurrenten, sogar Feinde sind; jede einzelne behält die anderen scharf im Blick, hofft, sie für sich ausnutzen zu können oder zumindest zu vermeiden, von ihnen zerstört und gefressen zu werden. Genauso hoffte Wes, in seinem Netz eine kleine Spinne, eine Verbindung zu Harold Rusch herzustellen, der wesentlich größeren Spinne.
Hannah musste lächeln bei dem Gedanken, der ihr vorkam wie ein Aufbegehren, ein Verrat an ihrem Mann. Genau der Gedanke, den sie ihm mitteilen könnte.
Wenn nicht ihr Geliebter, wäre er ihr Seelenverwandter. Der Mensch, bei dem sie Gedanken aussprechen könnte, die sie in ihrem derzeitigen Leben niemandem anvertraute.
Wie lange er sich noch hinzog, der Rest des Abends! Er beobachtete sie jetzt nicht, war aus ihrem Blickfeld verschwunden.
Ein zäher Lavastrom, der sich nicht beschleunigen ließ, das war die Spendengala: Sie musste durchgehalten werden.
Die Tische waren allesamt so üppig geschmückt, dass die Gäste angestrengt an der ambitionierten Dekoration vorbei zu den anderen dahinter spähen mussten.
Unterhalten konnte man sich nur schreiend, in dem Gewirr der Stimmen verstand niemand ein Wort. Hannah versuchte, mit Christina Rusch ins Gespräch zu kommen, die ihr gegenüber nur ein Minimum an Höflichkeit aufbrachte, so als hätte sie vergessen oder als spiele es für sie keine Rolle, dass Hannah und ihr Mann sie eingeladen hatten; Hannah war bestürzt und gekränkt, wie ein Kind es sein mochte, über so eine eklatante Verweigerung von Dankbarkeit.
Die Eintrittskarten hatten sechshundert Dollar pro Person gekostet. Hoffentlich wusste Mrs. Rusch, dass Hannah sie tatsächlich bezahlt hatte, dass es keine Freikarten waren.
Es war zwar kindisch, so zu empfinden, aber Hannah konnte es nicht verhindern.