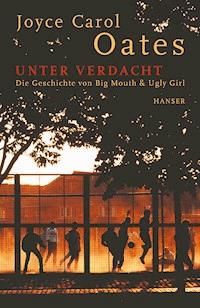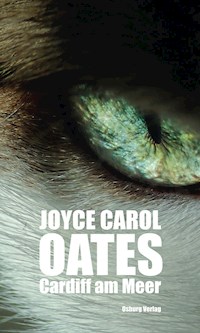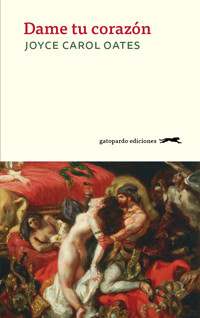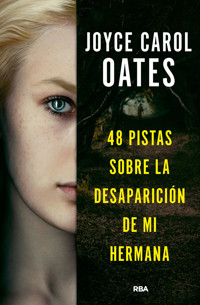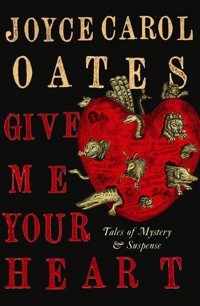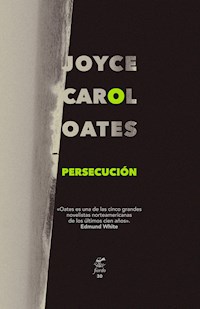6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sieben Kurzgeschichten aus der Feder von Amerikas Ikone und Bestseller-Autorin mit Auszeichnung Joyce Carol Oates. Diese Psycho-Spannung mit Annäherung ans Horror-Genre beweist aufs Neue, dass Joyce Carol Oates eine Meisterin ist, ihre Leser in literarische Albträume zu entführen: Ein Kind verschwindet, was zum Auslöser für eine Hexenjagd auf seinen Lehrer wird; ein abgehalfterter Weiberheld trifft am Ufer eines verlassenen Flussbettes auf seine rachsüchtige Stieftochter; ein eifersüchtiges kleines Mädchen freundet sich mit einer unheimlichen Katze an; ein Zwillingsbruder-Paar kämpft schon im Mutterleib um den besten Platz im Leben; ein Mann plant den Mord an seinem ebenso charmanten wie egoistischen Bruder; eine Witwe mittleren Alters zahlt einen hohen Preis, um nicht alleine zu sein und ein Schönheitschirurg lässt sich von einer seiner Patientinnen zu einem irrsinnigen Eingriff überreden. Die sieben Geschichten sind: - Die Maisjungfer - Beersheba - Niemand weiß, wie ich heiß - Fossile Figuren - Totenmahl - Helfende Hände - Loch im Kopf »Zwar sind ganz klar die Schatten Poes und Hitchcocks über diesen Geschichten wahrnehmbar, doch ist Oates auch allein bereits eine Meisterin darin, den Leser das Grauen zu lehren.« Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Joyce Carol Oates
Sieben Reisen in den Abgrund
Aus dem Amerikanischen von Silvia Visintini
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sieben Kurzgeschichten aus der Feder von Amerikas Ikone und Bestseller-Autorin mit Auszeichnung Joyce Carol Oates. Diese Psycho-Spannung mit Annäherung ans Horror-Genre beweist aufs Neue, dass Joyce Carol Oates eine Meisterin ist, ihre Leser in literarische Albträume zu entführen:
Ein Kind verschwindet, was zum Auslöser für eine Hexenjagd auf seinen Lehrer wird; ein abgehalfterter Weiberheld trifft am Ufer eines verlassenen Flussbettes auf seine rachsüchtige Stieftochter; ein eifersüchtiges kleines Mädchen freundet sich mit einer unheimlichen Katze an; ein Zwillingsbruder-Paar kämpft schon im Mutterleib um den besten Platz im Leben; ein Mann plant den Mord an seinem ebenso charmanten wie egoistischen Bruder; eine Witwe mittleren Alters zahlt einen hohen Preis, um nicht alleine zu sein, und ein Schönheitschirurg lässt sich von einer seiner Patientinnen zu einem irrsinnigen Eingriff überreden.
»Zwar sind ganz klar die Schatten Poes und Hitchcocks über diesen Geschichten wahrnehmbar, doch ist Oates auch allein bereits eine Meisterin darin, den Leser das Grauen zu lehren.« Kirkus Reviews
Inhaltsübersicht
Die Maisjungfer
Ihr Arschlöcher!
Jüngerinnen
Alleinerziehende Mutter, Schlüsselkind
Einsame Wölfe
101 Dalmatiner
Eilmeldung
Habt ihr mich gesehen?
Dem Affen Zucker geben
In U-Haft
Tabu
Die Welt, wie wir sie kannten
Da draußen
Verzweifelt
Abgesandte
Holländerin
Fehler
Unter Beobachtung
Opfer
Ihr Arschlöcher! Ein Abschiedsbrief
Die kleine Familie
Beersheba
Niemand weiß, wie ich heiß
Fossile Figuren
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Epilog
Totenmahl
Helfende Hände
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Loch im Kopf
Die Maisjungfer1
Eine Liebesgeschichte
APRIL
Ihr Arschlöcher!
Warumwarum fragt ihr. Wegen ihrem Haar. Darum.
Ich mein ihr Haar! Ich mein ich hab’s in der Sonne gesehen, sein seidiges Blassgold wie die Fädchen am Mais und in der Sonne könnte es sich an einem Funken entzünden. Und ihre Augen die mich irgendwie nervös und hoffnungsvoll anlächelten als ob sie Judes Wunsch nicht erraten könnte (aber wer hätte das können?). Denn ich bin Jude Obscurus. Meister der Augen. Von sehbehinderten Arschlöchern wie euch lasse ich mich nicht richten.
Da war ihre Mutter. Ich hab sie zusammen gesehen. Ich hab gesehen, wie die Mutter sich zu ihr beugte und sie küsste. Dieser Pfeil traf mich ins Herz. Ich dachte Ihr werdet mich nicht mehr übersehen. Ich würde niemals vergeben.
Also gut. Irgendeinen Bericht müsst ihr Arschlöcher ja tippen. Vielleicht ist noch Platz für das Urteil des Gerichtsmediziners über die Todesursache.
Ihr Arschlöcher habt wirklich keinen Peil, stimmt’s? Denn sonst wüsstet ihr, wie sinnlos es ist, Berichte zu tippen, als ob die euch zur Wahrheit oder auch nur zu »Fakten« verhelfen könnten.
Warumwarum. Nachts am Computer beim Klickklickklicken durch die Galaxien wurde mir verkündet, dass mir der Meister der Augen zum Geburtstag (11. März) meinen Wunsch erfüllen wird. Darum. Alles, was du dir wünschst, wird sich zur gegebenen Zeit finden. Falls du der Meister bist.
Jude Obscurus nannte er mich. Im Cyberspace haben wir uns verbrüdert.
Darum. In der sechsten Klasse auf einer Exkursion ins naturhistorische Museum sonderte Jude sich von den dummen gackernden Kindern ab und betrachtete wie gebannt ein Ausstellungsstück der Onigara. Die Opferung der Maisjungfer. Aufgrund der drastischen Darstellung empfiehlt sich die Besichtigung dieses Exponats für Kinder und Jugendliche unter sechzehn Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. Schritt durch einen Torbogen in einen von Leuchtstoffröhren erhellten Raum mit verstaubten Schaukästen und starrte die Maisjungfer mit den zu Zöpfen geflochtenen schwarzen Borsten und dem flachen Gesicht und den blinden Augen an. Der aufgerissene Mund mit diesem Ausdruck permanenter Verwunderung jenseits allen Schreckens und dieser Anblick traf Jude mit solcher Wucht ins Herz wie vielleicht ein Pfeil ins Herz der Maisjungfer. Darum.
Weil es ein Experiment war um zu sehen ob Gott es zulassen würde. Darum.
Weil niemand da war um mich aufzuhalten. Darum.
Jüngerinnen
Wir haben doch nie geglaubt, dass Jude es ernst meint!
Wir haben doch nie geglaubt, dass es so kommen würde.
Wir haben doch nie geglaubt …
… nicht eine Sekunde!
Wollten doch nie …
… nie im Leben!
Niemand hatte was gegen …
……
(Jude hat gesagt, es ist tabu, diesen Namen auszusprechen.)
Jude war Meister der Augen. Sie war die ganze Schulzeit hindurch unsere Anführerin. Jude war einfach so cool.
In der Fünften hat Jude uns gezeigt, wie man von S. high wird. Wo Jude das S. herhatte, wussten wir nicht.
In der Siebten hat Jude uns X besorgt. So wie’s die Älteren einwerfen. Gekriegt hat sie’s von ihrem Geheimkontakt an der Highschool.
Wenn du HIGH bist, könntest du die ganze Welt umarmen, aber das eigentliche Geheimnis ist, dass dir alles scheißegal ist.
Das ist das Tolle daran! HIGH über Skatskill dahinschweben und das Gefühl du könntest eine Bombe auf die Schule oder dein eigenes Haus werfen und deine Familie stürzt mit brennenden Kleidern und Haaren heraus und schreit um Hilfe und du würdest lächeln, weil es dir völlig schnuppe wäre. Das ist HIGH.
Geheimnisse, die sonst keiner kannte.
Hardcore-Pornos bei Jude zu Hause.
Judes Großmutter Mrs Trahern, die Witwe von irgendwem Berühmten.
Verwilderte Katzen haben wir gefüttert. Cool!
Ritalin und Xanax verschrieben von Judes Ärzten. Jude hat nur so getan, als nähme sie das Zeug. Bei ihr im Bad ein Jahresvorrat.
Mit Häagen-Dazs French Vanilla haben wir die Maisjungfer gefüttert.
Die Maisjungfer war beinahe sofort schläfrig, gähnte. Eis schmeckt ja so gut! Nur eine zerdrückte Tablette, ein halber Teelöffel. Reine Zauberei. Wir konnten es gar nicht fassen.
Jude hat gesagt, man ahnt nichts von den Zauberkräften, die man besitzt, bis einem wer zeigt, wie man sie entfesselt.
Die Maisjungfer war davor noch nie bei Jude zu Hause gewesen. Aber Jude hat sich schon im März mit ihr angefreundet. Hat uns erzählt, dass der Meister der Augen ihr an ihrem Geburtstag einen Wunsch gewährt hat. Und wir durften daran teilhaben.
Der Plan war, Vertrauen aufzubauen.
Der Plan war, sich auf die Maisjungfer vorzubereiten in dem Wissen, dass eines Tages die Zauberstunde schlagen würde, in der (so hat Jude es vorausgesagt) alles klar werden würde, so wie ein Blitz die Dunkelheit erhellt.
Und so war es. Wir waren in Bereitschaft, und die Zauberstunde war so.
Es gibt einen Hintereingang ins Haus der Traherns. Da sind wir reingekommen.
Die Maisjungfer ging hinein! Auf ihren eigenen zwei Beinen ging die Maisjungfer hinein, sie wurde nicht gezwungen oder getragen.
Aus freien Stücken, hat Jude gesagt.
Bei den Onigara-Indianern war das nicht so. Da kam die Maisjungfer nicht aus freien Stücken, sondern wurde entführt.
Ein feindlicher Stamm entführte sie. Sie kehrte nie wieder zu ihren eigenen Leuten zurück.
Die Maisjungfer wurde begraben, sie wurde zusammen mit dem Maissamen in die Sonne gelegt und mit Erde bedeckt. Jude hat uns das erzählt, wie man ein altes Märchen erzählt, bei dem die Zuhörer lächeln, aber nicht nach dem Warum fragen sollen.
Jude wollte nicht, dass wir nach dem Warum fragten.
Bedroht wurde die Maisjungfer nicht. Die Maisjungfer wurde mit Ehrerbietung, Respekt und Güte behandelt.
(Ein bisschen Angst mussten wir ihr schon einjagen. Anders geht’s nicht, hat Jude gesagt.)
Dienstags und donnerstags kam sie auf dem Heimweg von der Schule am 7-Eleven-Laden vorbei. (Jude wusste, warum das so war.) Dort hingen hauptsächlich Leute von der Highschool rum. Die Älteren, die rauchten. Ein popeliges Pseudo-Einkaufszentrum, die Mini-Mall an der Fernstraße. Ein Teppichverramscher, ein Haar- und Nagelstudio, ein China-Imbiss und der 7-Eleven. Dahinter Müllcontainer und der Gestank von vergammeltem Zeug.
Im Gestrüpp hinter den Müllcontainern hausen verwilderte Katzen. Da ist es wie im Urwald, da geht keiner hin.
(Außer Jude. Um die verwilderten Katzen zu füttern. Das sind ihre Totemtiere, sagt sie.)
Am 7-Eleven verlangte Jude, dass wir uns trennen, damit wir nicht zusammen gesehen werden.
Vier Mädchen auf einmal, das könnte wem auffallen.
Ein Mädchen allein oder zwei auf einmal, das fällt keinem auf.
Hat aber eh keiner geguckt. Wir kamen von hinten.
Früher haben mal Hausangestellte unten am Hang gewohnt. Ist aber schon ewig her. Die mussten hoch zu den großen Häusern an der Highgate Avenue.
Historisches Anwesen in Skatskill. Da wohnte Jude mit ihrer Großmutter. Nur die beiden. Kam immer wieder im Fernsehen. In den Zeitungen. In der New York Times war’s auf dem Titelblatt. Immer war die Rede vom holländisch-amerikanischen Herrenhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert. Darüber wussten wir nichts. Von vorn haben wir das Haus nie gesehen. Wir sind nur in Judes Zimmer und in ein, zwei andere gegangen. Und dann gab’s noch den Keller.
Von der Highgate Avenue ist das Haus der Traherns nicht sehr gut zu sehen, da ist eine drei Meter hohe Mauer drum rum. Die ist zwar alt und bröckelt vor sich hin, aber drübergucken kann man trotzdem nicht. Aber durchs Tor, das ist aus Schmiedeeisen, kann man im Vorbeifahren einen schnellen Blick reinwerfen.
Wahrscheinlich fahren da jetzt jede Menge Leute vorbei.
Auf der Highgate Avenue ist überall PARKEN VERBOTEN PARKEN VERBOTEN PARKEN VERBOTEN. Leute von außerhalb sind in Skatskill nicht gern gesehen, außer wenn sie zum Einkaufen kommen.
Das Trahern-Anwesen wurde es immer genannt. Das Grundstück ist fast viereinhalb Hektar groß. Aber von hinten gibt es eine Abkürzung. Als wir die Maisjungfer ins Haus brachten, sind wir hintenrum gekommen. Der Großteil des Grundstücks ist Wald. Der Großteil ist Wildnis, wie ein Urwald. Aber es gibt eine alte Steintreppe, die kann man hochsteigen, wenn man gut aufpasst. Eine alte Anliegerstraße, zugewachsen mit Brombeergestrüpp und unten am Hang mit einer Betonplatte abgesperrt, aber um die kann man rumgehen.
Dass es diesen hinteren Zugang gibt, darauf würde keiner kommen. Nur drei Minuten zu Fuß von der Mini-Mall.
Keiner würde da draufkommen! Die großen alten Häuser auf der Highgate Avenue da ganz oben und die Grundstücke gehen bis ganz runter zur Fernstraße.
Jude hat gesagt Die Maisjungfer muss mit Ehrerbietung, Respekt, Güte und Bestimmtheit behandelt werden. Die Maisjungfer darf nicht mal ahnen, welches Schicksal ihrer harrt.
Alleinerziehende Mutter, Schlüsselkind
»Marissa.«
Erstes Anzeichen, dass etwas nicht stimmt: kein Licht in der Wohnung.
Zweites: zu still.
»Marissa, Mäuschen …?«
Da war er bereits, der erste Anflug von Panik in ihrer Stimme. Da war es bereits, das Gefühl, als schließe sich ein eiserner Ring um ihre Brust.
Sie betrat die dunkle Wohnung. Um 20 Uhr. Spätestens. Das sollte sie später beschwören.
In einem traumähnlichen Zustand bar aller Gefühle schloss sie die Tür hinter sich, knipste ein Licht an. War sich ihrer bewusst wie jemand, der sich in einem Video selbst sieht, wie er sich auffällig normal verhält, obwohl die Umstände sich verändert haben und nicht normal sind.
Eine Mutter lernt, nicht in Panik zu verfallen, sich keine Schwäche anmerken zu lassen. Falls ein Kind sie beobachten sollte.
»Marissa? Bist du nicht … bist du zu Hause?«
Wäre Marissa zu Hause, wären die Lampen an. Marissa würde im Wohnzimmer Hausaufgaben machen, hätte den Fernseher an, laut. Oder den CD-Spieler, laut. War Marissa alleine zu Hause, fühlte sie sich unwohl, wenn es ganz still war.
Die Stille mache sie nervös, sagte sie. Dann müsse sie an Dinge denken, die ihr Angst machten, sagte sie. Ans Sterben zum Beispiel. Dann höre sie ihren eigenen Herzschlag, sagte sie.
Aber es war still in der Wohnung. Still in der Küche.
Leah knipste noch mehr Lichter an. Noch beobachtete sie sich selbst, noch nahm sie sich zusammen. Sah vom Wohnzimmer aus, über den Flur hinweg, dass die Tür zu Marissas Zimmer offen stand, Dunkelheit dahinter.
Es war möglich – ja!, wenn auch nur einen verschwommenen, verzweifelten Moment lang – zu denken, dass Marissa auf ihrem Bett eingeschlafen war, und deshalb … Doch Leah sah nach, da lag keine schmale Gestalt auf dem Bett.
Niemand im Bad. Tür angelehnt, Dunkelheit dahinter.
Irgendwie wirkte die Wohnung nicht vertraut. Als ob Möbel umgestellt worden wären. (Was nicht der Fall war, wie sie sich später vergewissern sollte.) Es war eisig, zugig, als wäre ein Fenster offen gelassen worden. (Kein Fenster war offen gelassen worden.)
»Marissa? Marissa?«
Ungläubigkeit und Beinahe-Ärger schwangen in der Stimme der Mutter mit. So, als solle Marissa, wenn sie sie hörte, nur einen leisen Tadel heraushören.
In der Küche, auch sie leer, stellte Leah die eingekauften Lebensmittel ab. Auf einen Unterschrank. Passte nicht auf, die Tasche sackte langsam zur Seite. Leah nahm kaum Notiz. Ein Joghurtbecher fiel heraus.
Marissas Lieblingsjoghurt, Erdbeer.
So still! Die Mutter, die allmählich fröstelte, verstand, warum die Tochter die Stille hasste.
Sie lief die Zimmer ab, sollte immer wieder die wenigen Zimmer der kleinen Erdgeschosswohnung ablaufen, und rief mit dünner, wie ein gespannter Draht aufsirrender Stimme Marissa? Mäuschen? Sie verlor das Zeitgefühl. Sie war die Mutter, sie war verantwortlich. Elf Jahre lang hatte sie ihr Kind nicht verloren, der Albtraum aller Mütter, ihr Kind zu verlieren, ein jäher körperlicher Verlust, ein Diebstahl, ein Weg-Stehlen, eine gewaltsame Entführung.
»Nein. Sie ist hier. Irgendwo …«
Die Wohnung ablaufen, immer denselben Weg. Es gab doch nur so wenige Zimmer, in denen Marissa sein konnte! Wieder die Badezimmertür öffnen, weiter diesmal. Eine Schranktür. Schranktüren. Taumeln gegen … Die Schulter angeschlagen an … Gegen Marissas Schreibtischstuhl gelaufen, ein Stechen im Oberschenkel. »Marissa? Versteckst du dich?«
Als ob Marissa sich verstecken würde. In so einem Moment.
Marissa war elf. Es war schon sehr lange her, seit Marissa sich zum letzten Mal kichernd und quietschend vor ihrer Mutter versteckt hatte. Damit Mommy nach ihr suchte.
Sie sei keine Mutter, die ihr Kind vernachlässige, würde sie beteuern.
Eine berufstätige Mutter war sie. Eine alleinerziehende Mutter. Der Vater ihrer Tochter war aus dem Leben von Mutter und Tochter verschwunden, zahlte weder Unterhalt für die Frau noch für das Kind. Es war doch nicht ihre Schuld, dass sie arbeiten musste, um ihre Tochter und sich zu ernähren, und ihre Tochter brauchte speziellen Förderunterricht, darum hatte sie sie aus der öffentlichen Schule genommen und in der Privatschule im Ort angemeldet, in der Skatskill Day …
Man würde ihr Vorwürfe machen. Die Boulevardblätter würden sie in der Luft zerreißen.
Wähl die 911, und dein Leben ist gefundenes Fressen für die Meute. Wähl die 911, und dein Leben ist nicht mehr deins. Wähl die 911, und dein Leben wird nie mehr so sein wie früher.
Alleinerziehende Mutter. Schlüsselkind.
Elfjährige vermisst, Skatskill-Süd.
So stimme das ganz und gar nicht, würde sie beteuern! Es stimmte einfach nicht.
Fünf von sieben Tagen stimmte es nicht.
Nur dienstags und donnerstags hatte sie Spätdienst in der Praxis. Erst seit Weihnachten kehrte Marissa in eine leere Wohnung zurück.
Nein. Es war keine ideale Lösung. Und vielleicht hätte sie sich um eine Betreuung kümmern sollen, aber …
Sie habe keine Wahl gehabt, würde sie beteuern. Sie musste Spätdienst machen, man hatte ihr die Schicht geändert. Dienstags/donnerstags fing sie um halb elf an und hatte abends um halb sieben Dienstschluss. An diesen Tagen war sie um Viertel nach sieben, spätestens halb acht zu Hause. Das würde sie beschwören! Da war sie zu Hause. Meistens.
Von Nyack über die Tappan Zee Bridge, dann weiter auf der Route 9 Richtung Norden durch Tarrytown, Sleepy Hollow bis zur Stadtgrenze von Skatskill. War doch nicht ihre Schuld, der Stau auf der Brücke und die Bauarbeiten auf der Route 9. Dazu goss es noch wie aus Kübeln! Aus heiterem Himmel ein Wolkenbruch, Regen! Sie hätte heulen mögen, so ohnmächtig fühlte sie sich, so wütend darüber, was aus ihrem Leben geworden war, Scheinwerfer blendeten sie, fuhren ihr wie Laserstrahlen ins Hirn.
Aber normalerweise war sie um acht zu Hause. Allerspätestens.
Ehe sie die 911 wählte, versuchte sie zu überlegen: nachzurechnen.
Für gewöhnlich war Marissa gegen vier Uhr nachmittags zu Hause. Die letzte Stunde war um Viertel nach drei zu Ende. Marissa ging zu Fuß nach Hause, fünfeinhalb Blöcke, ungefähr achthundert Meter (hauptsächlich) durch Wohngebiet. (Die Fifteenth Street war eine viel befahrene Straße, aber Marissa musste sie nicht überqueren.) Und sie würde mit Schulfreundinnen gehen. (Tatsächlich?) Marissa fuhr nicht mit dem Schulbus, für Privatschulkinder gab es keinen Bus, und überhaupt wohnte Marissa in der Nähe der Schule, weil Leah Bantry eigens in diesen Wohnblock, Briarcliff Apts, gezogen war, weil der in der Nähe der Skatskill Day lag.
Sie würde es erklären! Wenn die Aufregung wegen des Verschwindens ihres Kindes vorübergehend nachließ, würde sie es erklären.
Möglicherweise hatte es an diesem Tag nach der Schule etwas Besonderes gegeben, eine Sportveranstaltung, eine Chorprobe, und Marissa hatte vergessen, es Leah zu sagen … Möglicherweise war Marissa mit einer Freundin nach Hause gegangen.
Sie stand in der Wohnung, neben dem Telefon, als warte sie darauf, dass es klingelte, versuchte sich zu erinnern, woran sie eben gedacht hatte. Wie der Versuch, Wasser mit den Fingern zu packen, dieser Versuch, sich zu erinnern …
Eine Freundin! Genau.
Wie hießen die Mädchen in Marissas Klasse …?
Natürlich! Leah würde herumtelefonieren. Sie war zittrig, und sie war beunruhigt, aber sie würde diese entscheidenden Anrufe machen, bevor sie die Polizei einschaltete, sie war keine hysterische Mutter. Sie konnte Leahs Lehrerin anrufen, deren Namen sie wusste, und von ihr würde sie die Namen der anderen Mädchen erfahren, sie würde diese Nummern anrufen, sie würde Marissa bald ausfindig machen, alles würde gut sein. Und die Mutter von Marissas Freundin würde sich entschuldigen und sagen Aber ich dachte, Marissa hätte Sie gefragt, ob sie zum Abendessen bleiben darf. Es tut mir ja so leid! Und Leah würde erleichtert lachen und schnell sagen Sie wissen ja, wie Kinder manchmal sind. Auch die Braven.
Nur hatte Marissa in der Schule nicht viele Freundinnen.
Das war ein Problem gewesen in der neuen Privatschule. In der öffentlichen Schule hatte sie Freundinnen gehabt, aber an der Skatskill Day war es nicht so leicht. Die meisten Schüler dort kamen aus privilegierten, wohlhabenden Familien. Sehr privilegiert und sehr wohlhabend. Und die arme Marissa war so lieb, so gutgläubig, so hoffnungsvoll und so leicht zu kränken, wenn andere Mädchen es darauf anlegten, sie zu kränken.
Begonnen hatten sie schon in der Fünften, Gemeinheiten, verblüffend mädchentypisch.
In der Sechsten war es schlimmer geworden.
»Warum mögen sie mich nicht, Mommy?«
»Warum machen sie sich lustig über mich, Mommy?«
Denn wenn in Skatskill jemand nicht oben an der Highgate Avenue oder der Summit Street wohnte, sondern unten, war klar, dass er zur Arbeiterklasse gehörte. Marissa hatte gefragt, was das bedeutete. Arbeiteten nicht alle? Und was war eine Klasse? So was wie … eine Klasse in der Schule? Ein Klassenzimmer?
Aber Leah musste sich eingestehen: Selbst wenn Marissa von einer unbekannten Freundin nach Hause eingeladen worden wäre, nie wäre sie so lange weggeblieben.
Nicht über fünf Uhr hinaus. Nicht nach Einbruch der Dämmerung.
Nicht, ohne Leah anzurufen.
»Sie ist kein Kind, das …«
Leah sah noch einmal in der Küche nach. Die Spüle war leer. Keine Packung Hühnerbrust, die dort auftaute.
Dienstags/donnerstags kümmerte Marissa sich um das Abendessen. Marissa kochte gern. Mommy und Marissa kochten gern zusammen. Heute Abend sollte es Hühnchen-Jambalaya geben, das war das Gericht, das sie am liebsten gemeinsam zubereiteten. »Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Cajun-Gewürz. Reis …«
Leah sprach laut. Die Stille war nervtötend.
Wenn ich direkt nach Hause gefahren wäre. Heute Abend.
Der 7-Eleven draußen an der Fernstraße. Dort hatte sie auf dem Heimweg gehalten.
Der höfliche indische Herr mittleren Alters an der Kasse mit seinen traurigen Augen würde für sie bürgen. Leah war eine häufige Kundin, er wusste nicht, wie sie hieß, aber er schien sie zu mögen.
Milchprodukte, eine Tücherbox. Dosentomaten. Zwei Sechserpackungen Bier, kalt. Für den Mann. Er war der Biertrinker. Der Mann an der Kasse musste annehmen, dass Leah einen Ehemann hatte.
Leah sah, wie ihre Hände zitterten. Sie brauchte was zu trinken, um ihre Hände zur Ruhe zu bringen.
»Marissa!«
Sie war vierunddreißig. Ihre Tochter war elf. Soweit Leahs Familie, einschließlich ihrer Eltern, wusste, war sie seit sieben Jahren »einvernehmlich geschieden«. Ihr Ex-Mann, ein Medizinstudent, der das Studium abgebrochen hatte, war nach Nordkalifornien verschwunden. Sie hatten gemeinsam in Berkeley gelebt, wo sie sich Anfang der Neunzigerjahre an der Uni kennengelernt hatten.
Unmöglich, den Ex-Mann/Vater, der nicht Bantry hieß, aufzuspüren.
Man würde sie nach ihm fragen, das wusste sie. Man würde sie vieles fragen.
Sie würde es erklären: Mit elf ist man zu alt für eine Tagesbetreuung. Mit elf ist man absolut in der Lage, allein nach Hause zu kommen … Mit elf kann man die Verantwortung für …
Sie kramte eine Dose Bier aus dem Kühlschrank. Sie öffnete sie und trank durstig. Das Getränk war eiskalt, sie bekam sofort Kopfschmerzen: eine eisige münzgroße Stelle zwischen den Augen. Wie kannst du nur? In so einem Augenblick! Sie wollte nicht in Panik verfallen und die 911 wählen, bevor sie sich alles überlegt hatte. Etwas starrte ihr ins Gesicht, eine Erklärung vielleicht?
Verzweifelte Alleinerziehende. Bescheidene Wohnung.
Vermisste Elfjährige. »Lernschwäche«.
Ungeschickt tappte Leah ein weiteres Mal durch die Wohnung. Sie suchte … Stieß die Türen, die sie schon geöffnet hatte, noch weiter auf. Kniete sich in einem Anfall verzweifelter Energie neben Marissas Bett, um darunter zu sehen und –
– was zu finden? Eine einzelne Socke.
Als ob Marissa sich unter einem Bett verstecken würde!
Marissa, die ihre Mutter liebte, würde nie etwas tun, was ihre Mutter beunruhigen, aufregen oder verletzen würde. Marissa, die noch kindlich war für ihr Alter, niemals aufmüpfig, launisch. Marissa, deren Vorstellung von Schlimmsein war, morgens zu vergessen, ihr Bett zu machen. Die Wasserspritzer auf dem Badezimmerspiegel nicht abzuwischen.
Marissa, die ihre Mommy gefragt hatte: »Habe ich einen Daddy wie die anderen Mädchen, und weiß er, dass es mich gibt?«
Marissa, die mit den Tränen kämpfend gefragt hatte: »Warum machen sie sich über mich lustig, Mommy? Bin ich zurückgeblieben?«
In der öffentlichen Schule waren die Klassen zu groß, ihre Lehrerin hatte keine Zeit für oder keine Geduld mit Marissa gehabt. Darum hatte Leah sie an der Skatskill Day angemeldet, wo es nur fünfzehn Schüler pro Klasse gab und Marissa besondere Aufmerksamkeit von ihrer Lehrerin bekommen würde, und trotzdem: Sie tat sich noch immer schwer mit dem Rechnen, sie wurde aufgezogen, »zurückgeblieben« genannt … Verlacht. Sogar von Mädchen, die sie für Freundinnen gehalten hatte.
»Vielleicht ist sie weggelaufen.«
Ganz plötzlich überfiel Leah dieser Gedanke.
Marissa war aus Skatskill weggelaufen. Aus der Existenz, die Mommy mit so viel Mühe für sie geschaffen hatte.
»Das kann nicht sein! Unmöglich.«
Leah trank noch einen Schluck Bier. Rein medizinische Anwendung. Trotzdem raste ihr Herz mit dumpfen Schlägen, setzte kurz aus. Jetzt bloß nicht ohnmächtig werden …
»Wohin? Wohin sollte Marissa denn gehen? Unmöglich.«
Marissa und weglaufen. Was für ein lächerlicher Gedanke!
Dazu war sie viel zu schüchtern, zu passiv. Viel zu wenig selbstbewusst. Andere Kinder, besonders ältere, machten ihr Angst. Weil Marissa ungewöhnlich anziehend war, ein wunderschönes Kind mit dem seidigen, blonden, schulterlangen Haar, das die stolze Mutter bürstete, bis es glänzte, und manchmal zu kunstvollen Zöpfen flocht, zog sie oft unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Doch Marissa war sich ihrer selbst kaum bewusst und auch nicht, wie andere sie wahrnahmen.
Sie war noch nie allein Bus gefahren. Nie allein ins Kino gegangen. Hatte so gut wie nie einen Laden betreten, ohne dass Leah in der Nähe war.
Aber trotzdem war das wohl das Erste, was die Polizei vermuten würde: Marissa war ausgerissen.
»Vielleicht ist sie nebenan. Bei den Nachbarn.«
Leah wusste, dass das nicht sehr wahrscheinlich war. Sie und Marissa kamen gut mit den Nachbarn aus, aber man besuchte einander nie. Das war in diesem Wohnblock nicht üblich, es gab kaum andere Kinder.
Trotzdem musste Leah sich erkundigen. Es wurde von einer Mutter erwartet, die ihre Tochter suchte, dass sie sich bei den Nachbarn erkundigte.
Also nahm sie sich Zeit, zehn, fünfzehn Minuten, an Türen in Briarcliff Apts zu klopfen. Mit krampfhaftem Lächeln in die verwunderten Gesichter aufgeschreckter Fremder zu blicken. Bemüht, nicht zu verzweifelt, zu hysterisch zu klingen.
»Entschuldigen Sie …«
Eine albtraumhafte Erinnerung überfiel sie. Eine aufgewühlte junge Mutter, die vor Jahren in Berkeley an ihre Tür geklopft hatte, als sie gerade mit ihrem Geliebten zusammengezogen war, der später Marissas Vater werden sollte. Sie waren beim Essen gestört worden, und Leahs Geliebter hatte geöffnet, ein Anflug von Ärger in seiner Stimme, und Leah hatte sich zu ihm gesellt, sehr jung damals, sehr blond und sehr privilegiert, und sie hatten eine junge Filipina angestarrt, die mit den Tränen kämpfte, als sie fragte Haben Sie meine Tochter gesehen … An mehr konnte Leah sich nicht erinnern.
Jetzt war Leah Bantry diejenige, die an Türen klopfte. Fremde beim Essen störte. Sich für die Störung entschuldigte, mit bebender Stimme fragte Haben Sie meine Tochter gesehen …
In dem kasernenartigen Wohnblock, in den Leah vor zwei Jahren aus Kostengründen gezogen war, betrat man die einzelnen Wohnungen direkt vom Parkplatz aus. Der lag hinter dem Haus, war hell erleuchtet, rein funktionell, hässlich. Im Gebäude gab es keine Flure. Es gab keine Innentreppen, keine Eingangshallen. Es gab keine Orte, an denen man sich zufällig treffen und ein paar, wenn auch noch so belanglose, Worte wechseln konnte. Das war keine exklusive Eigentumswohnanlage mit Blick auf den Hudson River, sondern Briarcliff Apts, Skatskill-Süd.
Leahs direkte Nachbarn zeigten sich teilnahmsvoll und besorgt, waren aber keine Hilfe. Sie hatten Marissa nicht gesehen, und natürlich war Marissa sie nicht besuchen gekommen. Sie versprachen Leah, »die Augen offen zu halten«, und rieten ihr, die 911 anzurufen.
Leah klopfte an noch mehr Türen. In ihrem Gehirn war ein Mechanismus ausgelöst worden, der nicht zu stoppen war, bis sie an alle Türen im Haus geklopft hatte. Je weiter sie sich von ihrer eigenen Wohnung im Erdgeschoss entfernte, desto weniger Anteilnahme fand sie. Ein Mieter rief ihr durch die geschlossene Tür zu, was sie wolle. Ein anderer, ein Mann mittleren Alters mit dem roten, verdrossenen Gesicht des Alkoholikers, schnitt ihr die ohnehin schon stockend vorgebrachte Frage ab und sagte, er habe keine Kinder gesehen, er kenne überhaupt keine Kinder und habe auch nichts für Kinder übrig.
Unsicheren Schritts und wie benommen kehrte Leah in ihre Wohnung zurück. Sah zu ihrem Schrecken, dass sie die Tür nicht ins Schloss gezogen hatte. Alle Lampen in der Wohnung schienen zu brennen. Fast glaubte sie, Marissa sei jetzt zu Hause, in der Küche.
Sie stürzte hinein. »Marissa …?«
Ihre Stimme war erwartungsvoll, klagend.
Die Küche war natürlich leer. Die ganze Wohnung war leer.
Ein neuer, verrückter Gedanke: Leah ging wieder hinaus auf den Parkplatz, um in ihrem Auto nachzusehen, das in einiger Entfernung abgestellt war. Sie spähte hinein, obwohl sie wusste, dass es abgesperrt und leer war. Spähte auf den Rücksitz.
Drehe ich gerade durch? Was geschieht mit mir …
Trotzdem, sie musste nachsehen. Sie spürte auch das dringende Bedürfnis einzusteigen und die Fifteenth Street entlang zur Schule zu fahren und dort nachzusehen. Natürlich wäre dort alles abgeschlossen. Der Parkplatz dahinter …
Sie würde die Van Buren entlangfahren. Sie würde die Summit entlangfahren. Sie würde durch das kleine Zentrum von Skatskill mit seinen Boutiquen, angesagten Restaurants, teuren Antiquitäten- und Kleidergeschäften fahren. Hinaus auf die Fernstraße, vorbei an Tankstellen, Fast-Food-Restaurants, Mini-Malls.
Mit welcher Erwartung? Ihre Tochter im Regen herumlaufen zu sehen?
Leah kehrte in die Wohnung zurück, meinte, das Telefon klingeln zu hören, doch das Telefon klingelte nicht. Sie konnte nicht an sich halten, sie musste die Zimmer ein weiteres Mal inspizieren. Diesmal untersuchte sie Marissas kleinen Wandschrank gründlicher, schob energisch Marissas ordentlich aufgehängte Kleider zur Seite. (Marissa war schon immer übertrieben ordentlich gewesen. Leah hatte nie wissen wollen, warum.) Starrte Marissas Schuhe an. So kleine Schuhe! Versuchte sich zu erinnern, was Marissa an diesem Morgen angezogen hatte … So viele Stunden war das her.
Hatte sie ihr an diesem Morgen das Haar geflochten? Wahrscheinlich hatte sie keine Zeit gehabt. Dafür hatte sie es ihr gebürstet, hingebungsvoll. Vielleicht bildete sie sich ein bisschen zu viel auf ihre wunderschöne Tochter ein, und jetzt wurde sie dafür bestraft … Nein, das war absurd. Man wird nicht dafür bestraft, dass man sein Kind liebt. Sie hatte Marissas Haar gebürstet, bis es glänzte, und sie hatte es mit Haarspangen befestigt, Perlmuttschmetterlinge.
»Wie hübsch du bist! Mommys kleiner Engel.«
»Oh, Mommy. Das bin ich nicht.«
Leah stockte das Herz. Sie konnte nicht verstehen, wie der Vater des Kindes sie beide hatte verlassen können. Sie fühlte sich so schuldig, es musste ihre Schuld sein, als Frau und als Mutter.
Immerhin hatte sie den Impuls unterdrückt, Marissa zu umarmen. Mit elf wurde das Mädchen langsam zu alt für spontane, unbegründete mütterliche Umarmungen.
Gefühlsäußerungen verunsicherten Kinder, hatte man Leah eingeschärft. Natürlich hätte man Leah das gar nicht einschärfen müssen.
Leah ging wieder in die Küche, um sich noch ein Bier zu holen. Bevor sie die 911 wählte. Nur ein paar Schlucke, sie würde die Dose nicht austrinken.
Sie hatte nichts Stärkeres als Bier zu Hause. Das war eine Regel ihres Erwachsenenlebens.
Keine harten Getränke. Keine Männer über Nacht. Die Tochter den Emotionen nicht aussetzen, die Mommy manchmal empfand.
Sie wusste: Man würde ihr die Schuld geben. Denn sie trug Schuld.
Schlüsselkind. Berufstätige Mutter.
Die Betreuung hätte sie fast so viel gekostet, wie sie nach Abzug der Steuern als medizinische Angestellte in der Praxis verdiente. Es war ungerecht, und es war unmöglich. Sie konnte nicht.
Marissa war nicht so aufgeweckt wie andere Kinder ihres Alters, aber zurückgeblieben war sie nicht! Sie war in der Sechsten, sie war mitgekommen. Ihre Lehrerin sagte, sie »mache Fortschritte«. Und ihre Einstellung gab viel Anlass zur Hoffnung. Ihre Tochter bemüht sich sehr, Mrs Bantry! So ein liebes, geduldiges Kind.
Im Gegensatz zu ihrer Mutter, dachte Leah. Die nicht lieb war und schon längst nicht mehr geduldig.
»Ich möchte ein vermisstes Kind melden …«
Sie probte die Worte, betroffen von ihrer Endgültigkeit. Sie hoffte, sie würde nicht lallen.
Wo war Marissa? Es war einfach undenkbar, dass sie nicht doch in der Wohnung war. Wenn Leah noch einmal nachsah …
Marissa wusste: Sie musste die Wohnungstür hinter sich abschließen und das Zusatzschloss verriegeln, wenn sie allein zu Haus war. (Mommy und Marissa hatten diese Griffe oft genug geübt.) Marissa wusste: Nicht die Wohnungstür öffnen, wenn es klopfte, wenn Mommy nicht zu Hause war. Nicht ans Telefon gehen, sondern warten, dass der Anrufbeantworter sich einschaltete, um zu hören, ob Mommy dran war.
Marissa wusste: Sich nicht ansprechen lassen. Keine Gespräche mit Leuten, die sie nicht kannte. Nicht zu Fremden ins Auto steigen, auch nicht zu Menschen, die sie kannte, es sei denn, es waren Frauen, die Mommy kannte, oder die Mütter von Klassenkameradinnen zum Beispiel.
Vor allem eins wusste Marissa: Nach der Schule direkt nach Hause gehen.
Nirgendwo hineingehen, in kein Haus, höchstens in das Haus einer Klassenkameradin, einer Schulfreundin … Und selbst dann musste Mommy vorher Bescheid wissen.
(Würde Marissa sich das merken? Konnte man sich darauf verlassen, dass eine Elfjährige sich das alles merkte?)
Leah hatte total vergessen, dass sie Marissas Lehrerin anrufen wollte. Von Miss Fletcher würde sie die Namen von Marissas Freundinnen erfahren. Die Polizei würde erwarten, dass sie die wusste. Dennoch stand sie unschlüssig neben dem Telefon und überlegte, ob sie es wagen sollte, die Frau anzurufen, denn wenn sie es tat, würde Miss Fletcher wissen, dass etwas nicht stimmte.
Der Schmerz zwischen Leahs Augen hatte sich ausgebreitet, ihr ganzer Kopf war ein einziger Schmerz.
Die vierjährige Marissa war immer neben Leah auf das Sofa geklettert und hatte ihr mit der Hand über die Stirn gestrichen, um die »Kummerfalten« glatt zu streichen. Feuchte Küsse auf Mommys Stirn. »Küsschen, damit sie verschwinden!«
Es hatte Mommy ein wenig in ihrer Eitelkeit gekränkt, dass ihr Kind Kummerfalten in ihrem Gesicht sah. Aber sie hatte gelacht und hatte sie zu weiteren Küssen ermuntert. »Na gut, Schätzchen. Küsschen, damit sie verschwinden.«
Es hatte sich zu ihrem Ritual entwickelt. Eine gefurchte Stirn, eine Grimasse, ein melancholischer Blick – und Mommy oder Marissa sagten »Küsschen, damit sie verschwinden.«
Leah blätterte im Telefonbuch. Fletcher. Es gab mehr als ein Dutzend Fletchers. Keine der Initialen schien ihr richtig. Wie hieß Marissas Lehrerin mit Vornamen – Eve? Eva?
Leah wählte eine der Nummern. Es klickte. Eine Stimme vom Band. Die Stimme eines Mannes.
Nächste Nummer, ein Mann antwortete, verneinte höflich: Hier gab es niemanden namens »Eve« oder »Eva«.
Aussichtslos, dachte Leah.
Sie sollte in Notaufnahmen anrufen, in Ärztehäusern, wo man ein Kind hinbringen würde, das vielleicht beim Überqueren einer stark befahrenen Straße von einem Auto angefahren worden war …
Sie tastete nach der Bierdose. Sie würde jetzt schnell austrinken. Bevor die Polizei kam.
Selbst verordnete Medizin hatte ein Therapeut das einmal genannt. In der Highschool hatte sie angefangen. Es vor ihrer Familie geheim gehalten, keiner hatte je etwas gewusst. Nur ihre Schwester Avril hatte einen Verdacht. Anfangs hatte Leah mit ihren Freunden getrunken, dann hatte sie ihre Freunde nicht mehr gebraucht. Es ging ihr nicht um das Hochgefühl, nicht um den Schwips, sondern darum, ihre Nerven zu beruhigen. Die Unsicherheit nicht zu spüren. Den Selbstekel.
Ich muss schön sein. Noch schöner.
Er hatte gesagt, sie sei schön, oft sogar. Der Mann, der Marissas Vater werden sollte. Leah war schön, er liebte sie über alles.
Sie wollten in einer Küstenstadt irgendwo in Nordkalifornien oder Oregon leben. Davon hatten sie fantasiert. Er hatte Medizin studiert und sich über den Druck beklagt. Sie war den einfacheren Weg gegangen und hatte eine Ausbildung als Krankenschwester begonnen, diese jedoch abgebrochen, als sie schwanger wurde.
Später sagte er, sie sei schon schön, aber er liebe sie nicht.
Die Liebe nutzt sich ab. Menschen gehen neue Wege.
Doch da war noch Marissa. Aus ihrer Vereinigung, Marissa.
Bereitwillig würde Leah den Mann, alle Männer, aufgeben, wenn sie nur ihre Tochter zurückbekäme.
Wenn sie auf dem Heimweg nur nicht diesen Umweg gemacht hätte! Wenn sie direkt nach Hause gefahren wäre.
Eins wusste sie: Sie musste der Polizei sagen, wo sie gewesen war, bevor sie nach Hause gefahren war. Warum sie später als üblich dran war. Sie würde beichten müssen, dass sie später dran gewesen war. Ihr Leben würde von innen nach außen gekehrt werden wie die Taschen einer alten Hose. Alles Private, Kostbare rücksichtslos ans Licht gezerrt.
Dieser einzige Abend seit Wochen, Monaten … Ganz entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit.
Aber sie war auch zum 7-Eleven gefahren. Dort war am frühen Abend viel los. Das war nicht entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, Leah fuhr oft zu dem kleinen Supermarkt zwei Blocks von Briarcliff Apts entfernt. Der höfliche Inder an der Kasse würde der Polizei gegenüber gut von ihr sprechen. Er würde erfahren, dass sie Leah Bantry hieß und dass ihre Tochter verschwunden war. Er würde erfahren, dass sie in der Nähe wohnte, in der Fifteenth Street. Er würde erfahren, dass sie eine alleinerziehende Mutter, dass sie nicht verheiratet war. Die zahlreichen Sechserpacks Coors, die sie kaufte, waren nicht für einen Ehemann, sondern für sie.
Bestimmt hatte er sie mit Marissa gesehen. Und daher würde er sich an Marissa erinnern. Schüchternes blondes Kind, das sein Haar manchmal zu Zöpfen geflochten trug. Er würde Leah bemitleiden, die zu bemitleiden er bisher keinen Grund gehabt, sondern nur auf seine zurückhaltende Art bewundert hatte, das glänzende blonde Haar, das amerikanisch-gesunde gute Aussehen.
Leah trank das Bier aus und warf die Dose in den Mülleimer unter der Spüle. Sie spielte mit dem Gedanken, hinauszugehen und alle Dosen im Müllcontainer zu entsorgen, denn die Polizei würde vielleicht die Wohnung durchsuchen, doch sie hatte keine Zeit mehr, sie hatte schon zu lange gewartet, dass Marissa zurückkäme und alles wieder so wäre wie früher. Dachte: Warum habe ich Marissa kein Handy gekauft, warum habe ich gedacht, die Ausgabe lohnt sich nicht? Sie nahm den Telefonhörer und wählte die 911.
Ihre Stimme klang atemlos, als sei sie gerannt.
»Ich möchte – ich möchte – ein vermisstes Kind melden.«
Einsame Wölfe
Ich bin für ein besonderes Schicksal ausersehen.
Er führte ein reges Innenleben. Sie führte ein reges Innenleben.
Er war ehemaliger Idealist. Sie war gnadenlose Realistin.
Er war einunddreißig. Sie war dreizehn.
Er war groß/schlaksig/sehnig, eins achtundsiebzig groß (in seinem vom Staat New York ausgestellten Führerschein hatte er eins achtzig angegeben) und wog siebzig Kilo. Sie war eins fünfzig groß und wog knapp achtunddreißig Kilo.
Er hielt viel von sich, insgeheim. Sie hielt sehr viel von sich, nicht ganz so insgeheim.
Er war Ersatzmathelehrer/»IT-Berater« an der Skatskill Day. Sie war Achtklässlerin an der Skatskill Day.
Sein offizieller Status an der Schule war Teilzeitmitarbeiter.
Ihr offizieller Status an der Schule war Vollzahlerin ohne Ausnahmen.
Teilzeitmitarbeiter hieß: keine Krankenversicherung, niedrigerer Stundenlohn als Vollzeitmitarbeiter und keine Aussicht auf Festanstellung. Vollzahlerin ohne Ausnahmen hieß: weder Schülerstipendium noch Zahlungsaufschub beim Schulgeld.
Er war erst seit relativ kurzer Zeit hier ansässig, in Skatskill-on-Hudson, knapp dreizehn Kilometer nördlich von New York City. Sie lebte hier schon seit 1992, da hatte ihre verwitwete Großmutter die Zweijährige bei sich aufgenommen.
Für sie, und ihm gegenüber, war er Mr Zallman, sonst Mr Z.
Für ihn besaß sie keine eindeutige Identität. Eines von vielen Mädchen in den unterschiedlichsten Altersstufen an der Schule (von der Grundschule bis zur Highschool), denen er Computerunterricht erteilte und half, wenn sie Unterstützung brauchten.
Auch an die Sechstklässlerin Marissa Bantry mit dem langen, glatten Maisseidenhaar sollte er sich nicht gleich erinnern.
Die Kinder nannte er sie. Mit einer Stimme, in der sich widerwillige Zuneigung bemerkbar machte. Oder mit einer Stimme, die vor Sarkasmus triefte. Diese Kinder!
Kam auf den Tag an. Auf die Woche. Auf seine Laune.
Diese anderen nannte sie sie mit vor Verachtung bebender Stimme.
Sie waren eine fremde Rasse. Selbst ihre kleine Bande von Jüngerinnen, das musste sie einräumen, waren Opfer.
In seiner Personalakte im Büro der Schuldirektorin stand Beeindruckende Zeugnisse/Empfehlungen, interagiert gut mit begabteren Schülern. Neigt zu Ungeduld. Kein Teamspieler. Ungewöhnlicher Sinn für Humor. (Bösartig?)
In ihrer Schülerakte (1998–Gegenwart) im Büro der Direktorin stand (nach verschiedenen Quellen) Beeindruckende Herkunft (Großmutter mütterlicherseits/gesetzliche Vertreterin Mrs A. Trahern, Alumna/Stifterin/Treuhänderin [im Ruhestand]), beeindruckender IQ (149, 161, 113, 159 getestet im Alter von 6, 9, 10, 12), häufige Geistesblitze, schwankende schulische Leistungen, einsames Kind, geselliges Kind, schlechte Interaktion mit Klassenkameraden, natürliche Führungspersönlichkeit, antisoziale Tendenzen, aufgewecktes Verhalten in der Klasse, störendes Verhalten in der Klasse, hyperaktiv, teilnahmslos, »Fantasie«-begabt, geringe Kommunikationsfähigkeit, tendenziell unreifes Verhalten, hohe Sprachkompetenz, Fantasie durch neue Projekte stimuliert, schnell gelangweilt, übellaunig, reif für ihr Alter, unterentwickelte Motorik, ADHS-Diagnose im Alter von fünf/Verordnung von Ritalin, Erfolg: gut/gemischt, Diagnose leichter Lese-Rechtschreib-Schwäche im Alter von sieben, Verordnung besonderer Förderung, Erfolg gut/gemischt, Eintrag in die Bestenliste in der Fünften, schlechte Noten/durchgefallen in Englisch in der Siebten, Okt. 2002 einwöchiger Ausschluss vom Unterricht wegen »Bedrohung« einer Mitschülerin, nach drei Tagen aufgehoben/gerichtliches Vorgehen gegen Schule seitens gesetzlicher Vertreterin/Anordnung psychologischer Beratung, Erfolg gut/gemischt. (Außen auf dem Hefter in der Handschrift der Direktorin: Eine Herausforderung!)
Er war eher der dunkle Typ mit olivfarbenem Teint. Sie hatte helle, durchscheinende Haut.
Er war montags/dienstags/donnerstags an der Schule, wenn er nicht gerade für einen anderen Lehrer einsprang, was durchschnittlich vielleicht alle fünf Wochen einmal vorkam. Sie war fünf Tage die Woche da, die Schule war ihr Revier!
Hass/Liebe empfand sie für die Skatskill Day. Liebe/Hass.
(Oft, so vermerkten ihre Lehrer, »verschwand« sie aus dem Unterricht und war dann auf einmal »wieder da«. Lustlos/arrogant ohne Erklärung.)
Er war ein einsamer Wolf und dennoch: Urenkel deutscher Juden, die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in die Vereinigten Staaten eingewandert waren. Enkel und Sohn von Partnern bei Cleary, McCorkle, Mace & Zallman, einem Maklerunternehmen an der Wall Street. Sie war die einsame Enkelin von Elias Trahern, einem Richter am Obersten Gerichtshof des Staates New York, der schon vor ihrer Geburt gestorben war und ihr so wenig bedeutete wie George Washington mit seinem Drosselbartkinn und seiner Perücke, dessen idealisiertes Konterfei in der Rotunde der Schule hing.
Seine Haut war voller Muttermale. Sie entstellten ihn nicht wirklich, aber er merkte, dass die Leute sie anstarrten, als warteten sie darauf, dass die Male sich bewegten.
Ihre Haut war anfällig für zornesrote Ausschläge. Sie wurden als nervöse Ausschläge diagnostiziert, die unter anderem davon kamen, dass sie sich mit den Nägeln im Gesicht kratzte.
Sein dicht gewelltes dunkles Haar, auf das er sich, wie er jetzt erst merkte, einiges eingebildet hatte, begann sich allmählich zu lichten. Wich an den Schläfen zurück, weshalb er es über den Hemdkragen wuchern ließ. Ihr hell rostrotes Haar explodierte wie flockige Pusteblumen um ihr schmales, spitz zulaufendes Gesicht.
Er war Mikal. Sie war Jude.
Er hieß eigentlich Michael, aber es gab so verdammt viele Michaels!
Sie hieß eigentlich Judith, aber – Judith! Da kam einem doch das Kotzen.
Einsame Wölfe, die die Herdentiere verachteten. Natürliche Aristokraten, denen Geld oder Familienbande nichts bedeuteten.
Er war den Zallmans entfremdet. Größtenteils.
Sie war den Traherns entfremdet. Größtenteils.
Er hatte ein kurzes, gewinnendes, ironisches Lachen. Sie hatte ein hohes nasal-kicherndes Lachen, das sie unerwartet wie ein Niesen überkam.
Sein gemurmeltes Lieblingslamento war Was denn noch? Ihr gemurmeltes Lieblingslamento war Laaangweilig!
Er wusste: Präpubertäre/heranwachsende Mädchen verknallten sich oft in ihre männlichen Lehrer. Doch irgendwie schien ihm das nie sehr real oder sehr wichtig. Mikal Zallman lebte in seiner eigenen Welt.
Sie verabscheute Jungen ihres Alters. Und die meisten Männer egal welchen Alters.
Brachte ihre Jüngerinnen zum Kichern und Erröten, wenn sie beim Mittagessen plötzlich ein Gemüsemesser in einer kreisförmigen Abwärtsbewegung durch die Luft sausen ließ, womit sie andeutete: Kas-tra-tion. Wisst ihr, was das ist?, wenn gewisse Jungen aus der Achten mit Tabletts in den Händen lärmend an ihnen vorübergingen.
Jungen nahmen sie kaum wahr. Sie hatte gelernt, sich unsichtbar zu machen wie eine Spielkarte, die man von der Seite betrachtete.
Er lebte – selbstzufrieden, wie es für manche den Anschein hatte – in einer Rüstung aus Ironie. (Außer wenn er allein war. Beim Anblick von Bildern von Hungersnot, Krieg, Zerstörung spürte er, wie er heiße Tränen wegblinzelte. Er hatte sich selbst und andere geschockt, als er vergangenes Jahr bei der Trauerfeier für seinen Vater in einer Synagoge an der Upper East Side hemmungslos weinte.)
Sie hatte seit ungefähr vier Jahren nicht mehr geweint. Damals war sie vom Fahrrad gefallen und hatte sich das Knie so böse aufgeschlagen, dass es mit neun Stichen genäht werden musste.
Er lebte allein in drei spärlich möblierten Zimmern in Riverview Heights, einer Wohnanlage am Hudson in North Tarrytown. Sie lebte allein in ein paar behaglich eingerichteten Räumen im Hauptflügel des Trahern’schen Anwesens an der Highgate Avenue 83. Ihre Großmutter wohnte zwar auch da, war aber nicht mehr als eine vor sich hin alternde Randerscheinung. Der Rest der 30-Zimmer-Villa wurde aus Kostengründen schon lange nicht mehr genutzt.
Er hatte keine Ahnung, wo sie wohnte, und wusste kaum, wer sie war. Sie wusste genau, wo er wohnte, nämlich knapp fünf Kilometer von der Highgate Avenue 83 entfernt. Sie war nicht nur einmal an Riverview Heights vorübergeradelt.
Er fuhr einen nicht gerade fabrikneuen metallicblauen Honda CR-V mit dem New Yorker Kennzeichen TZ 6063. Sie wusste, dass er einen nicht gerade fabrikneuen metallicblauen Honda CR-V mit dem New Yorker Kennzeichen TZ 6063 fuhr.
In Wirklichkeit hatte er nicht immer eine so hohe Meinung von sich. In Wirklichkeit hatte sie nicht immer eine so hohe Meinung von sich.
Er wünschte, er hätte eine hohe Meinung von sich. Er wünschte, er hätte eine hohe Meinung von der gesamten Menschheit. Er wollte nicht denken Homo sapiens ist ein hoffnungsloser Fall, ziehen wir den Stecker. Er wollte denken Ich kann etwas bewegen.
Er war ein Idealist gewesen, der sich mit Ende zwanzig völlig verausgabt, einen Zusammenbruch erlitten hatte. Das waren angemessene Klischees. Klischees, die er sich redlich verdient hatte. Zwischen fünfundzwanzig und dreißig hatte er an öffentlichen Schulen in Manhattan, der Bronx und Yonkers unterrichtet und war nach einer krankheitsbedingten Auszeit zuerst an die Columbia University zurückgekehrt, um seinen Lebenslauf mit einem Master in Informatik aufzupeppen, und danach in den Schuldienst, denn sein alter Idealismus haftete ihm noch an wie die Staubflusen seinen an den Ellbogen abgescheuerten Pullis, und eines wusste er, dass er nie wie sein Vater dem Geld nachjagen würde, hier in Skatskill-on-Hudson, wo er keinen Menschen kannte, konnte er Teilzeit arbeiten, hauptsächlich indem er Kindern am Computer half, wo er, oder wenigstens seine Privatsphäre, respektiert wurde, er hatte keine Ambitionen, sich als Privatlehrer in eine Festanstellung zu zecken, in ein paar Jahren würde er weiterziehen, aber im Moment war er zufrieden mit dem, was er hatte, die Freiheit, seinem Affen Zucker zu geben, wie er es nannte.
Meistens hatte sie keine so hohe Meinung von sich. Insgeheim.
Selbstmordfantasien sind bei Heranwachsenden nicht ungewöhnlich. Kein Anzeichen einer psychischen Erkrankung, solange sie Fantasien bleiben.
Er hatte solche Fantasien auch gehabt. Sogar noch, als er die zwanzig längst überschritten hatte. Jetzt war Mikal Zallman ihnen entwachsen. Und zwar, weil er seinem Affen Zucker gegeben hatte.
Ihre Selbstmordfantasien hatten etwas Comicartiges. Ein Sprung von der Tappan Zee Bridge/George Washington Bridge, Bildbericht in den Achtzehn-Uhr-Nachrichten. Ein lodernder Feuerball auf einem Dach. (Dem Schuldach? Es war das einzige, zu dem sie sich Zutritt verschaffen konnte.) Wenn man fünf, sechs Ecstasy-Pillen auf einmal schluckte, explodierte einem (vielleicht) das Herz. Mit einem Dutzend Schlaftabletten würde man in Tiefschlaf und dann ins Koma fallen und (vielleicht) nicht mehr aufwachen. Bei Medikamenten bestand immer die Möglichkeit, dass man sie erbrach und in der Notaufnahme erwachte, während sie einem den Magen auspumpten. Oder mit einem Hirnschaden. Dann gab es noch Messer, Rasierklingen. In eine Badewanne bluten, während das warme Wasser einlief.
Der Tag vor ihrem dreizehnten Geburtstag, und sie war scheiße drauf und der Rat ihres neuen Freundes/Mentors, des Meisters der Augen (in Alaska, oder war’s die Antarktis?): Wozu Selbsthass, Jude, ist doch laaangweilig. Hass auf die Anderen, die rundherum, ist doch viel besser.
Aber weinen tat sie nie. Nie. Echt nicht.
Als seien Jude Os Angstkanälchen ausgetrocknet. Cool!
Kanälchen erinnerte sie an Schamhaar, das ihr erstmals als Wort in einem Chatroom untergekommen war und sich beim Nachschlagen in einem Wörterbuch als ein ekliges Wort für diese ekligen gekräuselten/wirren Haare entpuppt hatte, die an einer bestimmten Stelle, zwischen ihren Beinen, zu sprießen begonnen hatten. Und unter den Achseln, wo sie sich so lange weigerte, ein Deo zu benutzen, bis ihr das Motzmotzen der Großmutter zu viel wurde.
Großmutter Trahern war zwar fast blind, aber ihr Geruchssinn war noch immer scharf. Großmutter Trahern konnte ausgezeichnet motzen, man könnte sagen, in ihrem achten Lebensjahrzehnt war Motzmotzmotzen das Einzige, was sie noch ausgezeichnet konnte.
Mr Z.! Vielleicht hatte er ihre Achseln gerochen. Hoffentlich nicht das zwischen ihren Beinen.
Einmal, als Mr Z. im Computerraum zwischen den Tischen umherging und die, meist ziemlich selbstverständlichen/blöden, Fragen der Kinder beantwortete, hätte sie ihn gern auf sich aufmerksam gemacht und einen verständnisinnig-hämischen Blick mit ihm gewechselt, aber irgendwie schaute Mr Z. nie in ihre Richtung, und als er dann hinter ihr stand und das Chaos auf ihrem Bildschirm betrachtete, schoss ihr vor Verlegenheit das Blut ins Gesicht, und sie hörte sich mit kindischer Rotzigkeit sagen, Scheiße im Quadrat, was ich da produziert hab, was, Mr Zallman?, wischte sich mit der Handkante die Nase ab und fing zu kichern an, doch Mr Z., so sexy/cool, stand einfach da, fünfzehn Zentimeter von ihr entfernt, und deutete nicht mal mit dem leisesten, geschweige denn vorwurfsvollen Lächeln an, dass er den verbotenen Kraftausdruck aus dem Mund einer unschuldigen Achtklässlerin gehört hatte.
Doch Mr Z. hatte ihn gehört. Keine Frage.
Niemals lachen, niemals ermutigen. Wenn sie Schimpfwörter benutzen oder anzüglich werden.
Und niemals anfassen.
Oder zulassen, dass sie dich anfassen.
Die (unterirdische) Verbindung zwischen ihnen.
Er hatte sich über sie gebeugt, auf ihrer Tastatur getippt. Den Schaden behoben. Ihr gesagt, dass sie das sehr gut mache. Sich nicht entmutigen lassen solle! Anscheinend wusste er ihren Namen nicht, aber vielleicht war das nur Verstellung, sein Sinn für Humor. Weiter ging’s zur nächsten erhobenen Hand.
Trotzdem hatte sie gewusst, dass da diese (unterirdische) Verbindung war.
Genau wie damals, als sie die Maisjungfer zum ersten Mal auf dem Siebtklässler-Flur gesehen hatte. Blondes Maisseidenhaar. Schüchtern, ängstlich.
Eine Neue. Perfekt.
Eines Morgens war sie früh dran und beobachtete, wie die Mutter die Maisjungfer an der Schule aussteigen ließ. Attraktive Frau mit dem gleichen weißblonden Haar, lächelte die Tochter an und beugte sich zu einem hastigen Küsschenküsschen hinüber.
Manche Verbindungen gehen einem durch und durch wie ein Laserstrahl.
Bei manchen Verbindungen weiß man einfach Bescheid.
Sie hatte Mr Z. eine E-Mail geschickt, sie sind ein meister, mister z. Was Jude O gar nicht ähnlich sah, denn im Cyberspace kann keine Nachricht je gelöscht werden. Doch Mr Z. hatte nicht geantwortet.
So leicht, auf eine scheiß E-Mail zu antworten! Aber Mr Z. hatte es nicht getan.
Mr Z. hatte auch kein vielsagendes Lächeln/Blick für sie, wie man es erwarten konnte.
Ignorierte sie einfach!
Als wüsste er nicht, wer von ihnen sie war.
Als könne er sie mit diesen Anderen, den ihr Unterlegenen, verwechseln.
Und da drehte sich etwas in ihrem Herzen wie ein rostiger Schlüssel, und sie dachte gelassen: Das wirst du mir büßen, Mr Arschloch Z., du und all deine Nachkommen.
Dachte daran, ihn dem FBI als mutmaßlichen Terroristen zu melden, Mr Z. war dunkel wie ein Araber, mit unstetem Blick. Obwohl er wahrscheinlich Jude war.
Hinterher sollte er sich vage an sie sind ein meister, mister z. erinnern, aber natürlich hatte er es gelöscht. Nichts leichter, als eine E-Mail zu löschen.
Hinterher sollte er sich vage an das ihm bis dahin – es war Februar/März – unbekannte verschämte Mädchen aus dem Computerraum mit dem strohigen Haar und dem glasig-starren Blick erinnern, von dem ihn (ungewöhnlich für die Skatskill Day ebenso wie für den wohlhabenden Vorort Skatskill überhaupt) ein unerwarteter Geruch wie nach ungewaschenem Körper anwehte. Jude Trahern. Er hatte keine eigene, feste Klasse, sondern sah innerhalb weniger Tage über hundert Schüler kommen und gehen, die im Blick zu behalten er weder die Fähigkeit noch das Interesse hatte. Ein paar Tage später jedoch hatte er, ohne besondere Notiz davon zu nehmen, sie und eine pummelige Freundin überrascht, wie sie im Computerraum einen Mülleimer durchwühlten und bei seinem Erscheinen verlegen kichernd davonliefen, als hätte er eine Tür geöffnet und sie nackt gesehen.
Doch an eines sollte er sich erinnern: Dasselbe Mädchen mit dem strohigen Haar saß eines Tages nach der Schule frech an seinem Computer, starrte mit finsterem Gesicht auf den Bildschirm und hämmerte mit einer Autorität auf die Tastatur ein, als sei es ihr eigener Computer. »Was soll das?«, hatte er sie angefahren, und sie, blicklos zu ihm hochsehend, war zusammengezuckt, als erwarte sie, dass er die Hand gegen sie erhöbe, woraufhin er in scherzhaftem Ton: »Ah, die berühmte Hackerin?« hinzugefügt hatte – er wusste, das war die netteste, und zugleich klügste, Art, auf das dreiste/nicht nachvollziehbare Benehmen von Pubertierenden zu reagieren, sie zur Rede oder bloßzustellen brachte gar nichts. Besonders bei einem Mädchen nicht. Und dieses irgendwie unterentwickelt wirkende Mädchen duckte sich, als wolle es sich noch kleiner machen. Papierdünne Haut, kurze Oberlippe, die den Blick auf die Vorderzähne freigab, wachsamer Nagetierblick, verstohlen, nervös, irgendwie flehend. Ihre Augen waren farblos wie Kies, feucht und aufgerissen. Augenbrauen und Wimpern spärlich, kaum sichtbar. Sie war so gnadenlos unansehnlich, und ihre unschönen Augen starrten ihn so nackt an … Sie tat ihm leid, armes Ding. Frech, unverfroren, aber noch ein Jahr oder so, und sie würde den Anschluss an ihre Klassenkameradinnen endgültig verloren haben, kein Junge würde einen zweiten Blick auf sie verschwenden. Dass dieses verdruckste Etwas der einsame Abkömmling einer angesehenen, privilegierten Familie war, darauf wäre er nie gekommen, höchstens darauf, dass ihre Eltern schon lange voneinander, und vielleicht auch von ihr, geschieden waren. Musste nur schnell was nachsehen, Mr Zallman, eine stammelnd hervorgebrachte fadenscheinige Erklärung. Er lachte und schickte sie mit einer Handbewegung weg. Verspürte den für ihn uncharakteristischen Impuls, die Hand auszustrecken und ihr durch dieses strohige, unbändige Haar zu strubbeln, wie man einem Hund den Kopf rubbelt, halb zärtlich, halb strafend.
Doch er rührte sie nicht an. Mikal Zallman war kein Narr.
101 Dalmatiner
Atmet sie, was meinst du?
Klar doch. Sowieso.
O Gott, was ist, wenn …
Sie atmet. Siehst du?
Die Maisjungfer schlief bei Kerzenlicht. Den bleiernen Schlaf der Betäubten. Mit offenem Mund.
Wir betrachteten sie staunend. Die Maisjungfer, in unserer Gewalt!
Jude nahm die Spangen aus ihrem Haar, damit wir es bürsten konnten. Wir waren nicht neidisch auf das Haar der Maisjungfer, denn Es ist jetzt unser Haar.
Das Haar der Maisjungfer war um ihren Kopf herum ausgebreitet, als sei sie im Fallen begriffen.
Sie atmete, ja, man konnte es sehen. Wenn man ihr eine Kerze nah an Gesicht und Hals hielt, konnte man’s sehen.
Wir hatten der Maisjungfer ein Bett gemacht. Eine Bahre hat Jude es genannt. Aus wunderschönen Seidenschals und einer Bettdecke aus Brokat, einer Kaschmirdecke aus Schottland, Kissen aus Gänsefedern. Mit strahlendem Gesicht brachte Jude sie aus dem abgesperrten Flügel des Hauses herüber.
Ungeschickt schälten wir die Maisjungfer aus ihren Kleidern.
Wenn man sich die eigenen Kleider auszieht, überlegt man nicht groß, aber jemand anderes auszuziehen, selbst ein kleines Mädchen, das mit schlaffen Armen und Beinen flach auf dem Rücken liegt, ist etwas anderes.
Als die Maisjungfer entblößt vor uns lag, konnten wir uns ein schnaubendes Gelächter, selbst ein Kichern, kaum verkneifen …
Sie glich eher einem Kleinkind als uns.
Plötzlich hatten wir Scheu vor ihr. Ihre Brüste hoben sich nicht von ihrem Brustkorb ab, die Brustwarzen waren winzig wie Samenkörner. Zwischen ihren Beinen waren keine Haare zu sehen.
Sie fror, zitterte im Schlaf. Ihre Lippen hatten die Farbe von Kitt. Ihre Zähne klapperten. Ihre Augen waren geschlossen, nur ein schmaler weißer Halbmond war noch zu sehen. Sodass man (fast) Angst hatte, dass die Maisjungfer uns schlafstarr beobachtete.
Jude hatte Xanax für die Maisjungfer vorbereitet. Außerdem hatte sie noch Kodein und Oxycodon, beides schon pulverisiert, als Reserve.
Wir sollten die Maisjungfer »baden«, hat Jude gesagt. Aber vielleicht nicht mehr heute Abend.
Wir rieben die eisigen Finger, die eisigen Zehen und die eisigen Wangen der Maisjungfer. Plötzlich scheuten wir nicht mehr davor zurück, sie zu berühren, wir wollten sie berühren und berühren und berühren.
Hier drin, hat Jude gesagt und die schmale Brust der Maisjungfer berührt, schlägt ein Herz. Ein richtiges Herz.
Jude flüsterte. In der Stille konnte man das Herz schlagen hören.
Dann deckten wir die Maisjungfer mit Seide, Brokat und Kaschmir zu. Wir schoben der Maisjungfer ein Gänsefederkissen unter den Kopf. Jude sprenkelte mit den Fingerspitzen Parfüm auf die Maisjungfer. Es ist eine Segnung, hat Jude gesagt. Die Maisjungfer würde lange schlafen, sehr lange, und wenn sie erwachte, würde sie nur unsere Gesichter kennen. Die Gesichter ihrer Freundinnen.
Wir hatten die Maisjungfer in einen Lagerraum im Keller unter dem Gästeflügel gebracht. Das war ein abgelegener Winkel des großen alten Hauses. Ein abgesperrter Winkel des Hauses, und der Keller war noch abgelegener, hier kommt nie wer her, hat Jude gesagt.
Und man konnte sich die Lunge aus dem Leib schreien, kein Mensch würde es je hören.
Jude lachte, legte die Hände um den Mund, als ob sie schreien wollte. Aber es kam nur ein abgewürgter, erstickter Laut heraus.