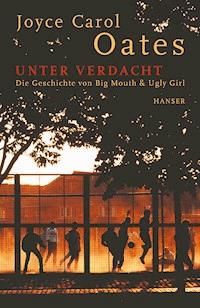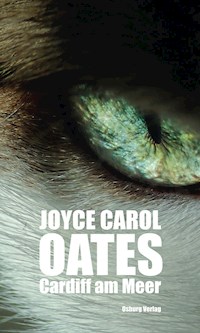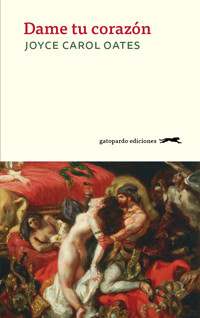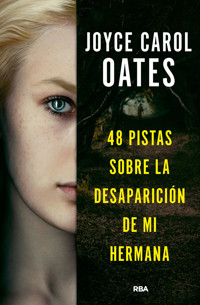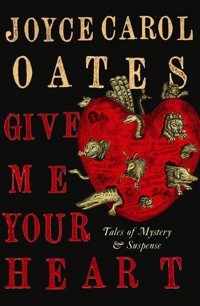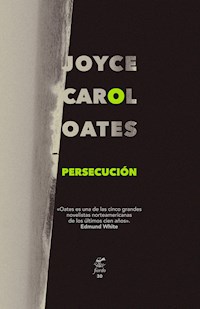Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Franky bewundert ihren Vater, einen beliebten und erfolgreichen Sportjournalisten. So weiß sie ganz genau, auf wessen Seite sie steht, als ihre Eltern sich trennen. Außerdem hat ihre Mutter die Familie im Stich gelassen und ist ausgezogen. Als sie vermisst wird, nimmt Franky das zunächst nicht ernst. Bis sie das Tagebuch ihrer Mutter findet. - Eine spannende aufwühlende Geschichte, die zeigt, wie schwer es ist, das "Richtige" zu tun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Franky bewundert ihren Vater, einen beliebten und erfolgreichen Sportjournalisten. So weiß sie ganz genau, auf wessen Seite sie steht, als ihre Eltern sich trennen. Außerdem hat ihre Mutter die Familie im Stich gelassen und ist ausgezogen. Als sie vermisst wird, nimmt Franky das zunächst nicht ernst. Bis sie das Tagebuch ihrer Mutter findet. — Eine spannende aufwühlende Geschichte, die zeigt, wie schwer es ist, das »Richtige« zu tun.
Joyce Carol Oates
Mit offenen Augen
Die Geschichte von Freaky Green Eyes
Aus dem Amerikanischen von Birgitt Kollmann
Carl Hanser Verlag
Für Tara, wieder einmal
I
Überwechseln
Erstes Kapitel
wie freaky green eyes ihren namen bekam
Später kam es mir immer vor wie ein Überwechseln. Vielleicht war das, was meine Mutter machte, dasselbe. Überwechseln. Von einem bekannten Umfeld in ein unbekanntes. Von einem Ort, an dem die Menschen dich kennen, an einen anderen, wo die Menschen nur glauben, dass sie dich kennen.
So als würde man durch einen wirklichen Fluss schwimmen, einen unberechenbaren, tückischen Fluss, und wenn du es ans andere Ufer schaffst, bist du nicht mehr der Mensch, als der du losgeschwommen bist.
Letztes Jahr im Juli fing das bei mir an. Ein paar Wochen nach meinem vierzehnten Geburtstag. Damals zog Freaky Green Eyes in mein Herz ein.
Die Sache zwischen meinen Eltern hatte da noch nicht angefangen. Das heißt, vermutlich schon, aber ich hab die Signale noch nicht aufgefangen. Wollte sie nicht auffangen.
Auf einer Party hab ich mich mit diesem älteren Jungen eingelassen, eine miese Geschichte, zumindest wäre sie das geworden, wenn Freaky nicht gewesen wäre.
Keine Ahnung, wo Freaky auf einmal herkam. Ich hab noch keinem davon erzählt, nicht einmal Twyla, die meine beste Freundin ist und, wie man so sagt, einen mäßigenden Einfluss auf mich hat. Auch Mom hab ich es nie erzählt, obwohl wir uns zu der Zeit noch ziemlich nahe standen. Rückblickend denke ich, ich hätte es ihr sagen sollen.
Die Party fand bei irgendwelchen reichen Leuten statt, die ein Haus nördlich der Stadt, am Puget Sound, hatten. Meine Familie (bis auf meinen älteren Bruder Todd) war ein paar Tage zu Besuch bei Nachbarn dieser Leute, die ebenfalls steinreich waren und ein spektakuläres Haus in der Bucht besaßen. Von den Gästen auf der Party kannte ich niemanden, die meisten waren im Collegealter. Ein Mädchen aus meiner Schule in Seattle, der Forrester Academy, hatte mich zusammen mit einem Haufen ihrer Freunde eingeladen, und als wir ankamen, war mir sofort klar, dass ich die Jüngste im Raum war. Peinlich. Mit meiner milchweißen, sommersprossigen Haut und den möhrenroten, krausen, elektrisch aufgeladenen Haaren, die tief im Rücken zu einem beinahe berstenden Pferdeschwanz zusammengebunden waren, mit meinem verängstigten Blick, dem schmalen rosa Tube-Top und Flip-Flops, ungeschminkt, sandte ich eindeutig das Signal aus, die Jüngste zu sein.
Die Mädchen, mit denen ich gekommen war, ließen mich in null Komma nichts stehen.
Bis zu dem Haus, in dem ich mit meiner Familie zu Besuch war, waren es mindestens anderthalb Kilometer, und das auf einer vielbefahrenen Uferstraße ohne Gehweg. Trotzdem hätte ich am liebsten kehrtgemacht und wäre weggerannt, kaum dass ich die Szene betreten hatte.
Franky Pierson steigt aufs Zehnmeterbrett. Setzt an zum Sprung, erstarrt.
Nur dass das hier kein Wettspringen war. Ich hätte genauso gut unsichtbar sein können; niemand würdigte mich auch nur eines Blickes.
Die Musik war so laut, dass ich kaum hören konnte, was es war. Hard Rock? Heavy Metal? Sofort schlug mein Herz schnell, im Takt der Musik, so wie es das immer macht, wenn ich angespannt bin. Mein Dad hat oft gesagt, ich sähe zwar aus wie meine Mutter, aber sonst käme ich mehr nach ihm: Er war früher Sportler, Profi-Footballspieler, und er meint, wir reagieren beide spontan auf unsere unmittelbare Umgebung, so wie Vögel oder andere Tiere. Wenn man uns herausfordert, gibt es nur zwei Möglichkeiten: flüchten oder kämpfen.
Zu kämpfen hatte ich definitiv keine Lust. Aber die Vorstellung zu flüchten machte mich auch nicht gerade an.
Nach ein paar Minuten passierte etwas Verrücktes — ich fing an, die Musik zu mögen. Das heißt, im Grunde hasste ich die Musik, aber ich fing an, dieses nervöse Gefühl zu mögen.
Die Leute drängten sich alle in einem lang gestreckten Wohnzimmer mit Glasfronten und einer Aussicht auf die ganze Bucht. Im Hochsommer geht die Sonne am nordwestlichen Pazifik spät unter. Jetzt war sie fast hinter dem Horizont versunken, flammend rote Streifen legten sich über die sanften Wellen, aber keiner der Partygäste beachtete die Landschaft.
Ich ließ mich am Rand der Party treiben, achtete darauf, von niemandem angerempelt zu werden, der ein gefährlich volles Glas in der Hand hielt. Dem Geruch im Raum nach zu urteilen wurde Bier getrunken. Wie Treibgut wurde ich weitergeschoben, bis ich mich in einem anderen, lang gestreckten Raum wiederfand, der noch größer war als der erste und dessen Glasfronten den Blick freigaben auf einen Bootsanleger, an dem ein hohes, schlankes Segelboot und eine große Jacht festgemacht waren. Um mich herum waren lauter Leute, die ich nicht kannte, gut aussehende Jungs, Mädchen, die etliche Jahre älter waren als ich, strahlende Schönheiten, die sehr viel Haut zeigten. Es war, als wäre eine matte Glasscheibe zwischen mir und ihnen: Sie befanden sich in einer Dimension, zu der ich keinen Zutritt hatte. Trotzdem war ich hartnäckig; ich lief nicht weg.
Ich musste an meine Mom denken, die sich oft beschwerte, wie stressig es für sie sei, mit Leuten zusammen zu sein, die nur an Dad interessiert waren, dem stadtbekannten Reid Pierson. Mom ignorierten diese Leute fast vollständig, sagte sie, und wenn sie doch etwas zu ihr sagten, dann in diesem herablassenden Ton (»Ach ja — und was machen Sie beruflich?«). Mom fühlte sich dann immer, als existierte sie gar nicht, sagte sie, und genauso ging es mir auf der Party, die Situation war mir peinlich, aber gleichzeitig war ich auch aufgeregt und gespannt. Ich schaute mich unter den Leuten um, mit einem etwas albernen kleinen Lächeln, voller Erwartung, voller Vorfreude — so als müsste jeden Moment jemand auf mich zukommen und mich umarmen.
Irgendein gut aussehender Typ, ein Senior von der Forrester Academy, der sich durch die Menge drängt und sagt: »Francesca? Hi.«
So war es dann doch nicht. Nicht ganz so.
Stattdessen machte ich erst einmal ein Bad ausfindig, eines mit weißen, wie Perlen schimmernden Fliesen und einer todschicken Badewanne mit Whirlpool und Messingarmaturen. Dazu mein Gesicht im Spiegel, hektisch rote Wangen und verwirrt/verletzt/stoisch dreinschauende grüne Augen. Es machte mich irgendwie verlegen, mich selbst im Spiegel zu sehen, aber andererseits — wen hatte ich denn erwartet?
Es war erst ungefähr ein Jahr her, dass ich meine Tage bekommen hatte (»meine Tage« — was für ein beknackter Ausdruck!). Vorher war ich ein ziemlich jungenhafter Typ gewesen, was ich jetzt war, wusste ich selbst nicht richtig. Ein Mädchen, klar. Aber kein Girlie-Typ.
Oder vielleicht doch. Nicht Franky, sondern Francesca Pierson. Und ich kämpfe bloß noch dagegen an.
Verweigerung nennt man so was.
Als Mom in meinem Alter war, hat sie mal gesagt, da hatte sie nur ihr Aussehen im Kopf. Und Jungs. Sie hat ein paar ziemlich leichtsinnige Sachen gemacht, hat sie mir erzählt, die ihr das Leben echt hätten ruinieren können, wenn sie nicht so viel Glück gehabt hätte. (»Mehr Glück als Verstand, Francesca!«) Deshalb habe ich mir manchmal Sorgen gemacht, ob ich meiner Mutter nicht vielleicht ähnlicher war, als ich es mir eingestehen wollte. Dass ich in der High School auch nur noch mein Aussehen im Kopf haben würde, so wie praktisch alle, die ich kannte.
»Francesca, hi.«
Ich zwinkere mir selbst im Spiegel zu. Schüttle den Kopf, damit der Pony richtig fällt. Beschließe, dass ich ganz okay aussehe. Keine strahlende Schönheit, aber okay.
»Hi.«
Frag mich jetzt nicht, wie oder warum: Ein Typ taucht auf einmal aus der Menge auf, stößt mich aus Versehen an und beschließt dann, einen Moment stehen zu bleiben, mich in Augenschein zu nehmen, zu lächeln. Ich grinse zurück wie ein von innen beleuchteter Halloween-Kürbis. Schon pervers, wie meine Nervosität sich schlagartig legt — ich spiele die Rolle eines Mädchens, das überhaupt nicht aufgeregt/ängstlich/zum Platzen angespannt ist. Man könnte meinen, die Party sei eine Szene in einem Film, und ich hätte die Rolle schon ein paar Mal geprobt.
Dieser Junge, der mich anlächelt, dem ich tatsächlich zu gefallen scheine, brüllt mir ins Ohr, dass er »Cameron« heißt — den Nachnamen verstehe ich nicht. Er ist im ersten Semester an der USC — ich frage, wofür USC steht (University of Southern California), und komme mir richtig dumm vor. Er fragt, wie ich heiße, ich sage »Francesca« — Franky klingt auf einmal so nach kleinem Mädchen — und murmle etwas vor mich hin, wo ich zur Schule gehe. Cameron sagt, seine Familie lebe auf Vashon Island, einer Seattle vorgelagerten Insel, sein Dad sei Manager bei Boeing, sie hätten ein Sommerhaus hier in der Bucht, er sei verrückt auf Segeln — und jetzt sei ich dran. Ich kann riechen, dass er Bier getrunken hat, so nah stehen wir beieinander. Leute, die vorbeigehen, rempeln uns an, drängen uns noch mehr zusammen. Ich höre, wie ich Cameron erzähle, genauer gesagt, wie ich ihm ins Ohr brülle, dass meine Familie in Yarrow Heights wohnt, dass wir nur für ein paar Tage bei Freunden hier in der Bucht zu Besuch sind, aber ohne Einzelheiten darüber, wer mein Vater ist, wie die Freunde heißen, dieser Freund meines Vaters ist nämlich ziemlich prominent. (Nicht als Sportjournalist im Fernsehen wie mein Vater, sondern wegen seiner High-Tech-Computerpatente.) Cameron gibt sich damit zufrieden, er kann mich sowieso nicht verstehen, und wenn doch, dann scheint er nicht sehr beeindruckt. Er ist in Partylaune, aufgedreht, lehnt sich lächelnd zu mir herüber.
»Ich besorg dir ein Bier, okay, Fran — hast du ›Francesca‹ gesagt? Hübscher Name.« Ich sag ihm nicht, dass ich Bier hasse, schon allein den Geruch, vor allem aber den beißenden Geschmack, von dem ich niesen muss; und ganz bestimmt sage ich ihm nicht, dass meine Eltern stinksauer wären, wenn sie wüssten, dass ich auf einer Party bin, auf der »getrunken« wird — allein dass ich hier bin, würde schon reichen. Ich habe ihnen fest versprochen, keinen Alkohol zu trinken und auf keinerlei Weise mit Drogen zu »experimentieren«, aber plötzlich finde ich mich hier auf dieser Party, mit lauter Leuten, die ich nicht kenne, die Jahre älter sind als ich, und es ist, als ob alles, was ich versprochen und beschlossen habe, auf einmal dahinschmilzt.
Cameron fasst nach meiner Hand, führt mich irgendwohin. Die Musik ist jetzt so laut, ich komme mir vor wie im Auge eines Tornados. Stark! Noch nie bin ich auf einer so coolen Party gewesen. Cameron sagt was zu mir und ich grinse und sage »Ja«, ohne zu wissen, was er gesagt hat, ich weiß nur, dass er mich zum Lachen bringt. Ich bin auf einer Party mit einem Jungen, der schätzungsweise achtzehn ist, den ich nicht kenne, aber wir verstehen uns echt gut, die Leute tanzen, flippig, es wird viel gekichert, gekreischt, dauernd stößt man gegen jemanden, doch es geht ganz leicht, man muss sich einfach nur winden wie eine Schlange. Und Franky Pierson ist auf einmal wie verwandelt. Als wäre ich plötzlich ein ganz anderes Mädchen, nur wegen Cameron. Als hätte er bloß einmal mit den Fingern geschnippt, und dadurch wäre ich gut aussehend und sexy geworden, wo ich doch vorher noch so naiv und schüchtern war. Und tanzen kann ich, ich bin total locker und gelenkig, als würde ich dauernd Gymnastik machen. Ich wackele mit den Hüften, schüttele meine Arme, werfe meinen Pferdeschwanz von einer Seite zur anderen. Und Cameron ist beeindruckt, starrt mich die ganze Zeit an. Und es gefällt ihm, dass auch andere, ältere Typen zu mir hinüberschauen und ebenfalls beeindruckt sind.
Aus den Augenwinkeln sehe ich die Mädchen, die mich auf die Party mitgenommen haben, sie glotzen mich an, als trauten sie ihren Augen nicht. Hey — die kleine Franky Pierson kommt ja richtig gut an!
Kann sein, dass ich inzwischen blau bin, macht nichts. Ich schwebe, ich fühle mich super, und ich will, dass die Musik nie aufhört, dass wir immer weitertanzen.
»Fran-cesca. Ein sch-schöner Name.«
Cameron hat mich irgendwohin geführt. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu kichern. Mein Kopf schwillt an, immer mehr, als müsste er gleich platzen, aber es ist ein komisches Gefühl, so als stiegen mir lauter Bierblasen in die Nase und ich müsste ständig niesen — hatschi-hatschi-hatschi.
Die Musik ist jetzt nicht mehr so laut. Ich kann sie noch hören, ich spüre noch, wie der Boden unter mir bebt, aber ich bin nicht mehr so dicht dran.
Cameron murmelt etwas, aber ich kann ihn nicht verstehen. Wir sind in einem Zimmer mit wandhohem Fenster und Blick aufs Wasser, aber inzwischen ist es dunkel. Ich kann das Meer riechen, höre, wie sich die Wellen am Strand brechen, aber sehen kann ich das Wasser nicht. Ich komme mir vor wie auf einem Sprungbrett, die Augen geschlossen, und plötzlich habe ich Angst zu springen. Angst runterzufallen. Camerons Finger sind stark, sie tun mir weh, er umfasst meinen Brustkorb, hebt mich ein Stück hoch. Beugt sich zu mir hinunter und küsst mich. Aber das hier ist nicht wie ein erster Kuss, wo alles noch ganz neu ist, sondern wie ein längst begonnener Kuss, hart, fordernd, seine Zunge drängt gegen meine fest zusammengepressten Lippen, alles passiert so schnell. Ich denke: Das will ich doch, oder: Geküsst werden? Wollte ich das nicht? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich bin oder wer Cameron ist. Aber ich weiß, ich muss ihn zurückküssen. Das ist so — man muss zurückküssen. Ich kichere und zittere, und auf einmal überkommt mich ein ganz merkwürdiges Gefühl, so als würden Teile meines Körpers taub. Meine Finger und Zehen werden zu Eis. Panik? Aber ich küsse Cameron zurück; ich will nicht, dass er weiß, wie viel Angst ich habe, wie jung ich bin. Sein Mund ist warm und fleischig, seine Hände wandern über meinen ganzen Körper, hart und erfahren. Einen Moment lang sehe ich meinen Bruder Todd vor mir bei seinem Krafttraining, wie er auf der Matte liegt und Gewichte hebt, oder keuchend und ächzend auf dem Trimmrad, einen öligen Schweißfilm auf dem Gesicht, wenn man ihn in dem Moment anspricht, hört er nichts, so ist er auf seinen Körper konzentriert. Genauso ist es mit Cameron. Mein Körper kann sich nicht entscheiden, ob er gekitzelt wird oder liebkost oder — irgendwas anderes, nicht so Schönes.
»C-Cameron? Vielleicht k-können wir —«
»Ganz locker, Baby. Du bist so sexy, fantastisch bist du.«
Es ist wirklich nicht mein erster Kuss. Aber es ist das erste Mal mit einem älteren, erfahrenen Jungen. Mit jemandem, den ich nicht kenne, der »Baby« zu mir sagt, als hätte er meinen Namen vergessen. Er schiebt die Hand unter mein Top, berührt meine Brüste, aber da bin ich am kitzligsten, ich muss kichern und schnappe nach Luft, und Camerons Kopf glüht, so als wäre er gerannt, und ich denke: Will ich das, ist es das, was ich möchte? Ich versuche mich an das zu erinnern, was ich über sicheren Sex gelernt habe, und denke: Sicherer Sex? Aber ist es das überhaupt — Sex?
»Cameron, ich glaube, ich will nicht —«
»Komm schon, Baby. Klar willst du, das weißt du auch.«
Ich bin in Panikstimmung, aber gleichzeitig erregt. Ich nehme an, so nennt man das, was ich empfinde: Erregung. Ich glaube nicht, dass ich blau bin, jetzt nicht. Aber der Magen dreht sich mir um und mir ist leicht schlecht. Die Haare hängen mir ins Gesicht — mein Pferdeschwanz muss aufgegangen sein. Cameron zieht an meinen Haaren. Jetzt küsst er mich wieder; es ist, als würde sein Mund an mir nagen. Ich versuche, ihn wegzustoßen, aber er rührt sich nicht. Es geht alles viel zu schnell; es ist, als ob man unter Wasser gerät, nach Luft schnappt, Wasser schluckt, plötzlich kriegt man Panik, schlägt um sich, kämpft um sein Leben.
Cameron drückt mich auf irgendetwas runter. Kein Bett oder Sofa, eher ein Tisch. Irgendetwas Hartes, die Kante schneidet in meinen Oberschenkel. Er nennt mich immer noch Baby, aber jetzt klingt es weniger freundlich. So als würde er ein Tier zu sich locken, dem er wehtun will. Außerdem benimmt er sich wie jemand, der reingelegt worden ist. Als hätte ich ihm einen Streich gespielt. Er nagelt mich mit eiserner Hand fest, den Reißverschluss seiner Hose hat er aufgezogen, keuchend fummelt er herum, zerrt an meinen Shorts, als wäre es ihm egal, ob er sie kaputtmacht, und ich will schreien, aber sein Unterarm drückt gegen meine Kehle. »Verdammt, hör jetzt auf mit dem Spielchen. Du kleine —«
Ich winde mich heftig. Versuche zu schreien. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Dann, plötzlich, weiß ich es. Als hätte jemand ein Streichholz angezündet. Mein Knie kommt hoch, mit aller Kraft. Ich erwische diesen Typ voll im Unterleib, direkt in der Leiste. Er stößt einen erstickten Schrei aus und erschlafft im selben Moment. Ich sage: »Lass mich los! Runter von mir!« Noch liege ich auf dem Rücken, aber ich trete um mich wie wahnsinnig. Es ist, als würde ich quer durchs Becken schwimmen, aber nur mit den Beinen, ich hab kräftige Beine, vom jahrelangen Schwimmen und Laufen. Ich seh vielleicht mager aus, aber ich bin stark, so wie eine Katze stark ist. Camerons Gewicht lastet noch auf mir, aber ich kann mich unter ihm rausschlängeln, ich schlage nach ihm, wo immer ich ihn erwischen kann, haue sogar meine Zähne in ihn — meine Zähne!
Das muss ihm Angst gemacht haben. Er stöhnt und flucht, legt sich vorsichtig die Hände zwischen die Beine. Er starrt mich an und sagt: »Du F-Freak! Du solltest deine Augen sehen! Echt freaky— freaky green eyes! Du bist doch gestört!«
Wildes Gelächter kommt aus meinem Mund. Es ist, als hätte der Typ auf den Grund meiner Seele geblickt.
Ich bin jetzt frei von ihm, renne los. Aus dem Zimmer, den Flur runter, vorbei an Zimmerfarnen und Indianermasken, die an einer Wand hängen, ich bin wie ein wildes Tier, das seinen Weg aus einem Labyrinth sucht, hier ist eine Tür, mit einem Mal bin ich draußen an der frischen Luft, in Sicherheit.
Es ist dunkel, neblig, ich kann das Meer in der Bucht riechen und hole tief Luft, immer wieder, so als wäre ich kurz vorm Ertrinken gewesen.
Aber jetzt bin ich SICHER.
Ich bin eine gute Läuferin, Ich laufe fast so gern, wie ich schwimme. Also jogge ich neben der Uferstraße nach Hause, versuche, mich von den Autos fern zu halten, der Wind bläst mein Haar nach hinten. Die Menschen in den Autos, die an mir vorbeifahren, halten mich vermutlich für eine Verrückte. Aber ich fühle mich so gut. Es ist gar nicht so, wie man vielleicht denken sollte, ich denke nicht: O Gott, um ein Haar wäre ich vergewaltigt worden, stattdessen denke ich, wie glücklich ich bin, wie viel Glück ich gehabt habe. Meine Mutter hat gesagt, sie hätte in meinem Alter mehr Glück als Verstand gehabt, aber ich muss denken, dass ich sowohl Glück als auch Verstand gehabt habe. Ich hab gegen meinen Angreifer gekämpft, und er hat es nicht geschafft, mich kleinzukriegen. Ich hab ihm mein Knie in den Unterleib gerammt, hab ihn getreten und gebissen. Ich bin abgehauen. Ich hatte nicht einmal Zeit, Angst zu haben. Ein Brutalo war er und ein Feigling, und jetzt macht er sich bestimmt Sorgen, dass ich meinen Eltern erzähle, was passiert ist, und er ernsthaft Probleme kriegt.
Aber ich sag nichts. Es reicht mir, dass ich davongekommen bin.
FREAKY GREEN EYES hat er mich genannt.
FREAKY GREEN EYES hat mir das Leben gerettet.
Zweites Kapitel
die feier: 18. april
Die gute Nachricht: Dads Vertrag mit seinem Fernsehsender war verlängert worden.
Die weniger gute Nachricht: Mom war nicht da, um mit uns zu feiern. Und das nicht zum ersten Mal.
Dad sagte: »Ich habe hart dafür gearbeitet, und ich meine, ich habe es mir verdient. Ich bin wirklich dankbar. Es ist ein wahrer Segen. Und ihr, meine Kinder …« Wir liebten Dad, wenn er so war wie jetzt, wenn er uns so fest in den Arm nahm, dass unsere Rippen fast krachten. »Also, was ich damit sagen will: Das Einzige, worauf es wirklich ankommt, ist die Familie. Die Familie eines Mannes ist seine Ehre. Sie bedeutet ihm viel mehr als sein Ruf in der Welt. Als das, was die Welt von ihm weiß. Familie, das bedeutet Würde, Respekt. Wir lieben uns, wir Piersons, und wir halten zusammen, stimmt’s? Wir sind ein Team.«
Dad sprach mit diesem Tremolo in seiner warmen Stimme, so wie er es auch im Fernsehen machte, wenn ein Sportler oder eine Mannschaft irgendetwas Sensationelles geschafft hatten. Als früherer Fußballstar identifizierte sich Reid Pierson auf eine Weise mit den Athleten, die den meisten der anderen Sportjournalisten nicht möglich war. Sein jungenhaftes, wenn auch leicht ramponiertes gutes Aussehen und sein Hundert-Watt-Strahlen hatten ihn zu einem Liebling der Sportfans gemacht, und wenn wir ihn im Fernsehen sahen, konnten wir es fast selber nicht glauben, dass er unser Dad war.
Zum Beispiel an meinem fantastischen zehnten Geburtstag, als Dad aus Florida im Fernsehen über ein Spiel berichtete, Mom hatte eine große Schüssel Popcorn gemacht, heiß, mit Butter, und mein großer Bruder Todd, meine kleine Schwester Samantha und ich saßen mit ihr im Familienzimmer und schauten zu, und da stand Reid Pierson, so gut aussehend und so glücklich, und kurz bevor umgeschaltet wurde, zwinkerte er in die Kamera und sagte: »Herzlichen Glückwunsch, Franky!« — ganz schnell, so schnell, dass es außer uns vermutlich niemand gehört hat. Herzlichen Glückwunsch, Franky.
Klar war ich stolz. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich hätte es schön gefunden, wenn Dad an meinem Geburtstag zu Hause gewesen wäre, aber dass Reid Pierson mein Vater war und mir übers Fernsehen zuzwinkern und zum Geburtstag gratulieren konnte, das war keine schlechte Entschädigung.
Dad feierte gern. Immer gab es irgendwelche tollen Neuigkeiten zu feiern. Zum Beispiel mit einem üppigen chinesischen Festessen. Dad liebte es einfach, ans Telefon zu gehen und Essen für ein Dutzend Leute zu bestellen, und wenn Mom gerade im Zimmer war, dann lachte sie (ein klein wenig ängstlich, manchmal jedenfalls) und protestierte: »Aber Liebling, wer soll denn das alles essen?«
Heute war Mom nicht bei uns. Ich wusste, dass Dad sauer war deswegen, ich hatte zufällig mitbekommen, wie sie am Morgen über das Thema »diskutiert« hatten. Es war wohl so, dass Dad wusste, dass die gute Neuigkeit unmittelbar bevorstand, auch wenn er uns gegenüber nichts rausgelassen hatte (in der Medienwelt war man nämlich zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet, bis gewisse Fakten öffentlich gemacht wurden), und deshalb passte es ihm ganz und gar nicht, dass Mom nach Kalifornien wollte, auf eine Kunst- und Kunsthandwerksmesse in Santa Barbara. Nicht nur, dass Mom nicht bei unserer Feier dabei sein würde — Dad mochte es generell nicht, dass seine Frau mit »diesen Künstlertypen« zu tun hatte, mit Leuten, die für ihn allesamt »Schwule« und »Frauen im Klimakterium« waren, zwei Gruppen von Menschen, für die er nur Verachtung hatte.
Ich wusste, dass Dad Mom unter Druck gesetzt hatte, ihre Reise abzusagen, so wie er im Januar so lange Druck gemacht hatte, bis sie auf einen Flug nach Vancouver in Kanada verzichtet hatte. Damals hatte es gar nichts zu feiern gegeben, keine tollen Neuigkeiten, Dad hatte einfach nur gewollt, dass Mom am Wochenende zu Hause war. Er selbst müsse in seinem Beruf so viel reisen, da brauche er es, dass Mom zu Hause war, wenn er mal da war. »Liebling, mein Job ermöglicht uns diesen eleganten Lebensstil. Und den genießt du doch, oder?«
Sofort hatte Mom gesagt: »Aber das weißt du doch, Reid. Natürlich ist —«
»Das Mindeste, was ich von meiner Frau erwarten darf, ist emotionale Unterstützung, oder nicht?«
»Doch, Reid. Du hast ja Recht.«
»Einfach nur Recht — oder ›Recht mit Kuss‹?« Das war so eine Redewendung von Dad, zu jedem von uns sagte er das. Es war schon zum Lachen — es reichte nicht, dass man ihm zustimmte (selbst wenn er nicht hundert Prozent im Recht war), man musste ihn auch auf die Wange küssen.
Mom hatte gelacht und nachgegeben. Meistens war Dad so witzig, dass man einfach nachgeben musste.
Man könnte vielleicht denken, dass Dad uns mitgenommen hätte auf seine Reisen, aber so war es nicht. Gerade mal für zwei, drei Wochen in den Sommerferien. Dad war immer so beschäftigt, und die Konkurrenz im Fernsehgeschäft war »mörderisch« (wenn er das sagte, fuhr Dad sich immer mit dem Zeigefinger über die Kehle, mit einem gewissen Behagen, so als genieße er die Berührung des unsichtbaren Rasiermessers), sodass er kaum freie Zeit hatte. Deswegen gefiel es ihm auch nicht, wenn Mom Samantha und mich auch nur für ein paar Tage mit nach Portland nahm, um unsere Großeltern zu besuchen. (Irgendwas musste zwischen Dad und den Connors vorgefallen sein, denn Moms Familie kam so gut wie nie nach Seattle, um uns zu besuchen. Überhaupt hatten wir nie Gäste im Haus, außer manchmal Freunde oder Leute, mit denen Dad beruflich zu tun hatte.) Ich vermute, Dad war im Grunde seines Herzens einfach altmodisch — er mochte es nicht, wenn irgendjemand aus der Familie weit reiste. Als Moms ältere Schwester Vicky vor ein paar Jahren in Mexiko-Stadt an Ruhr erkrankte und ins Krankenhaus musste, da hatte Dad gesagt: »Siehst du, was passiert, wenn man die USA verlässt? Vor allem als alte Jungfer.« Das sollte ein Witz sein, aber immer war auch ein Fünkchen Ernst dabei.
Einmal habe ich meinen Bruder Todd gefragt, wieso Dad so einen Aufstand macht, wenn Mom ein paar Tage wegfährt. »Schließlich fliegt sie nicht zum Mond«, habe ich gesagt, »sie kommt ja immer gleich wieder.«
Aber in jeder Auseinandersetzung stand Todd auf Dads Seite. Mit seiner genervten Großer-Bruder-Miene sagte er: »Weil Dad will, dass Mom zu Hause ist.« Als ob das alles wäre, so einfach.
Wie auch immer, an diesem Morgen jedenfalls war Mom nach Santa Barbara geflogen. Zum Zeitpunkt unserer Feier befand sie sich fünfzehnhundert Kilometer südlich von Seattle. Als sie anrief, klang sie schuldbewusst wie ein kleines Mädchen, das etwas angestellt hat. »Hier ist es Sommer, könnt ihr das glauben? Das Meer schimmert, es ist so schön. Ich bin barfuß am Strand entlanggelaufen …«
Bei uns war es kalt, neblig, grau, so als hätte sich eine klebrige Masse über alles gelegt. Typisches Frühlingswetter am nordwestlichen Pazifik.
Ich liebte Dads Feiern. Aber insgeheim wünschte ich trotzdem, Mom hätte mich mitgenommen. Nur dieses eine Mal! Zur Kunst- und Kunsthandwerksmesse in Santa Barbara. Wir hätten uns davonstehlen und barfuß am Strand entlanglaufen können …
Zögernd sagte Mom am Telefon zu mir: »Francesca, grüß deinen Vater ganz lieb von mir, ja? Ich kann ihn irgendwie nicht erreichen, weder im Büro noch übers Handy. Und er hasst E-Mails, wenn es nicht um die Arbeit geht. Aber er weiß, wie stolz ich auf ihn bin … Francesca?«
»Klar, Mom. Ich sag’s ihm.«
Es war eine merkwürdige Unterhaltung. Aber damals wollte ich nicht weiter darüber nachdenken. Ein ganz feines Zittern lag in Moms Stimme, fast unhörbar. So als würde sie mich um etwas anflehen. Wieso?
»H.D.L., Schätzchen!«
»I.D.A., Mom.«
Das war die übliche Art, wie wir uns am Telefon verabschiedeten. Mom und ich konnten uns einfach nicht ernsthaft sagen, dass wir uns lieb hatten, selbst wenn wir es so meinten; es musste immer eher witzig klingen, beiläufig.
Als ich am Abend versuchte, Dad zu sagen, was Mom mir aufgetragen hatte, winkte er ab. »Keine Heucheleien, Fran-ces-ca. Ich darf doch um etwas mehr Aufrichtigkeit bitten, jetzt, wo deine Mutter nicht zu Hause ist.«
Dad nannte mich normalerweise Franky. Wenn er so betont Fran-ces-ca zu mir sagte, dann hieß das, er ahmte Mom nach, die mich Francesca nannte und nie Franky.
Todd kicherte. Er hatte Dads Antwort gehört und wusste genau, was Sache war.
Samantha hörte ebenfalls mit und schaute nur von einem zum anderen. Meine Schwester war noch zu klein, um die Unterströmungen der Familienpolitik zu erfassen, und begriff überhaupt nichts.
(Und was dachte ich? Möglichst gar nichts. Lachte ich über Dads Spott, dann fiel ich Mom in den Rücken. Runzelte ich die Stirn, würde ich Dad damit zeigen, dass ich seine Art von Humor nicht gut fand. Also verzog ich keine Miene und blieb eisern neutral.)
Ich war also still. Samantha auch. Dad war in einer seiner unberechenbaren Launen, die in die eine oder andere Richtung auflodern konnten. Wie diese schrecklichen Springfeuer, die man manchmal im Fernsehen sieht, wenn der Santa-Ana-Wind die Flammen mal hierhin und mal dahin treibt und Häuser und tausende Hektar Wald vernichtet.
Todd hingegen, der übers Wochenende vom College nach Hause gekommen war, machte unsere Schweigsamkeit wieder wett.
»Hey, Dad, gratuliere! Ein Typ aus meiner Mannschaft hat mir heute den Artikel aus USA Today gezeigt. Echt cool.« Todd hatte den Artikel ausgeschnitten und Samantha und ich lasen ihn eifrig. Dad zeigte uns eine Meldung in der Seattle Times vom selben Tag:
Der beliebte CBS-Sportjournalist Reid Pierson hat soeben mit dem Sender einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Das Honorar, so sein Agent, sei »großzügig, aber für Reid Pierson durchaus angemessen«. Pierson wird bei den nächsten Olympischen Sommerspielen zur ersten Riege der Berichterstatter gehören.
»Unsere einzige Grenze ist der Himmel, Kinder! Ihr könnt alle mitkommen.«
Als ich noch kleiner war, habe ich tatsächlich geglaubt, Dad würde mich auf einige seiner Reisen mitnehmen. Samantha glaubte es vielleicht immer noch — sie war erst zehn. Aber Todd und ich, wir wussten, dass Dad das nur so sagte. Es war seine Art, großzügig zu sein. Beim Wort nehmen durften wir ihn natürlich nicht.
Oder doch? Würde es dieses Mal vielleicht anders sein?
»Das Festbankett kann beginnen. Franky?«
Wie immer hatte Dad genug Essen für ein ganzes Bataillon bestellt. In seiner eigenen Kindheit war, wie er oft sagte, »Schmalhans Küchenmeister gewesen« — was wohl heißen sollte, dass seine Familie in Moose Lake, Washington, in eher ärmlichen Verhältnissen gelebt und er oft Hunger gehabt hat. Wenn Mom nicht da war, war ich für die Küche zuständig. Was meist nichts anderes bedeutete, als dass ich Essen in der Mikrowelle heiß machte. Samantha half mir, die dampfenden Teller hereinzutragen, und wir taten, als wären wir Kellnerinnen. Wenn Mom da gewesen wäre, hätte sie das Essen in mehreren Gängen serviert, aber Dad wollte, dass alles gleichzeitig auf dem Tisch stand, sodass wir es sehen konnten: Pekingente, gebratener Reis mit Shrimps, Sesamnudeln, Sojahuhn mit Peperoni, Rindfleisch in Knoblauchsauce, Schweinefleisch Szechuan, Hühnchen in Zitronensauce und Jumbogarnelen à la »Happy Family«, die mit Rindfleisch, Schweinefleisch und Huhn zusammen gedünstet wurden. Dazu brauner Reis und eine große Platte mit chinesischem Gemüse. Samantha und ich tranken chinesischen Tee (den wir hassten — er schmeckte wie alte Socken), während Dad und Todd chinesisches Bier tranken. Uns war festlich, aber auch etwas ängstlich zu Mute.
Es fühlte sich einfach nicht richtig an, dass wir vier hier allein im Familienzimmer saßen, ohne Mom. Und Dad machte auch dauernd sarkastische Bemerkungen dazu: »Garnelen ›Happy Family‹ — na ja, jedenfalls glauben wir das.«
Rabbit, unser Jack Russell Terrier, war in einem anderen Teil des Hauses weggesperrt, und ab und zu hörte man ihn winseln. Armer Rabbit! Wenn Mom weg war, war Rabbit völlig daneben. Er war vor allem Moms Hund, auch wenn Samantha und ich ihn sehr liebten. Aus irgendeinem Grund hat Dad Rabbit nie gemocht. Der Hund gehe ihm auf die Nerven, beschwerte er sich, und deswegen durfte Rabbit nicht bei uns sein, solange Dad zu Hause war. (Ich wartete schon die ganze Zeit, dass Dad fragte, was für ein Geräusch das sei, Rabbits Winseln und Kratzen, und irgendeine ironische Bemerkung darüber machte, dass Mom ihr geliebtes Hündchen nicht mitgenommen hatte, aber es kam nichts.)
Wie immer, wenn wir im Familienzimmer aßen, war der Fernseher eingeschaltet, damit Dad und Todd die Sportsendungen schauen konnten, auf unserem riesigen Bildschirm, der die halbe Wand einnahm. Auf einem Sportkanal wurde ein Boxkampf übertragen. Zum Glück für Rabbit übertönte der Lärm den Krach, den er machte.
»Wow! Schau dir die an!«
Zwei junge Leichtgewichtsboxer mit kräftigen Muskelpaketen hieben mit den Fäusten aufeinander ein. Der eine war ein hellhäutiger Schwarzer mit finsterer Miene, der andere war ein hispanischstämmiger junger Mann mit einem übel zugeschwollenen Auge. Es war verrückt, zwei Männer zu sehen, die wild darauf waren, einander wehzutun, und das Ganze nur drei Meter entfernt von unserem chinesischen Bankett. Dad stellte den Ton lauter und das Tosen der Zuschauer füllte den Raum.
Mom hätte das nicht gefallen, wenn sie zu Hause gewesen wäre. Eine andere Sportart vielleicht, Basketball oder Baseball, aber nicht Boxen. Es war auch ungewöhnlich, dass Dad sich einen Boxkampf ansah; Boxen gehörte nicht zu Reid Piersons Sportarten und er berichtete nie darüber. Außerdem gefiel es ihm grundsätzlich nicht, Sportkommentatoren auf konkurrierenden Fernsehsendern zuzuschauen, vor allem, wenn sie nicht selbst Sportler gewesen waren. »Schwindler« nannte er sie, oder »Hochstapler«, die sich im Unterschied zu ihm ihre Stellung nicht verdient hatten.
Dad war ganz aufgeregt und sagte: »Das wird ja ein richtiger Fight. Diese Jungs sind vielleicht Leichtgewichte, aber sie haben das Herz von Schwergewichten. Wisst ihr, was Herz haben bei einem Sportler bedeutet, Mädels?«
Todd musste man das nicht fragen. Als Sportler mit zwei Metern Körperlänge und über neunzig Kilo Gewicht wusste er das natürlich.