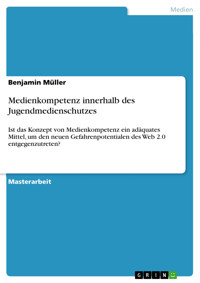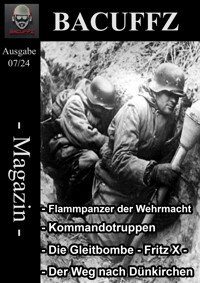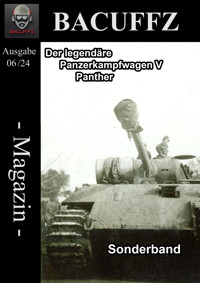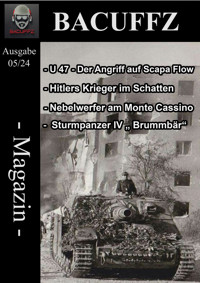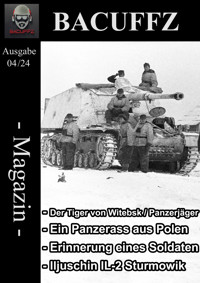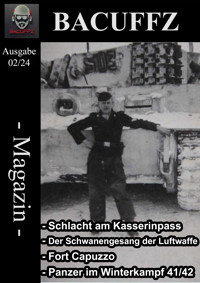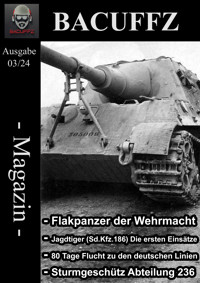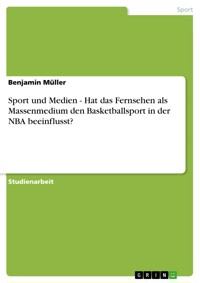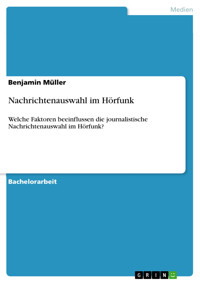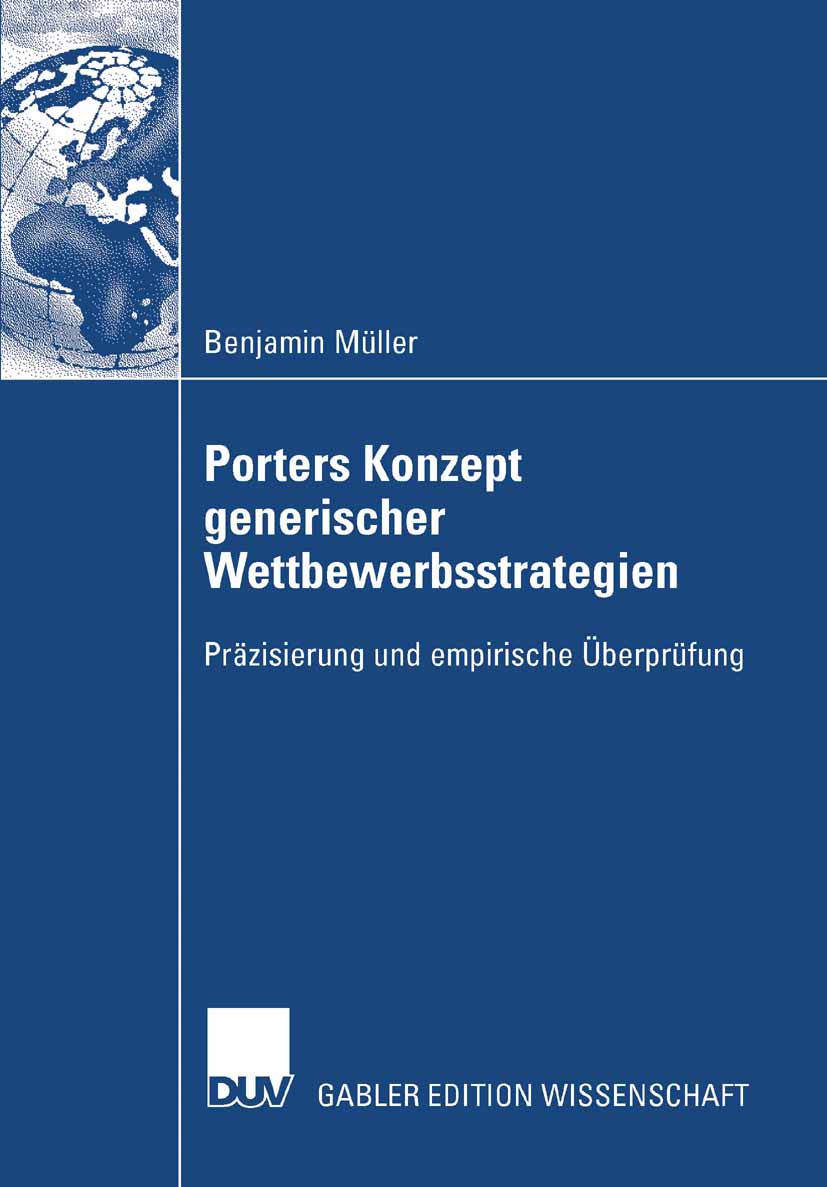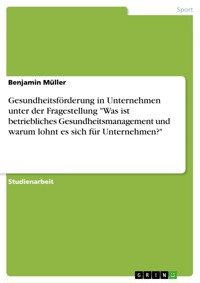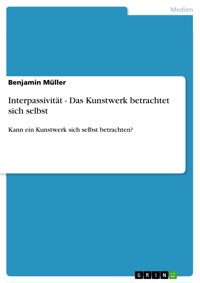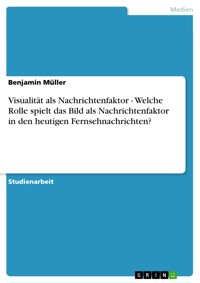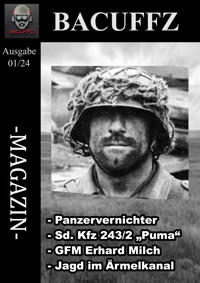
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BACUFFZ / Kriegstagebücher
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bacuffz Magazin
- Sprache: Deutsch
Das Bacuffz Magazin enthält Berichte über den zweiten Weltkrieg. Wir schildern u.a. was die Soldaten im Einsatz erlebten, gehen den technischen Details von Waffen und Fahrzeugen auf den Grund und beleuchten berühmte Persönlichkeiten der Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe des BACUFFZ Magazins präsentieren zu können. In diesem Magazin finden Sie sorgfältig ausgewählte Skripte vergangener Beiträge, die wir redaktionell aufgearbeitet haben, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Inhalte noch einmal in Ruhe nachzulesen. Als geschichtsinteressierte Zuschauer wissen Sie, wie vielfältig und faszinierend die Themen sind, die wir auf unserem Youtube-Kanal behandeln.
Unsere Redaktion hat mit viel Sorgfalt und Hingabe jedes einzelne Skript bearbeitet, um sicherzustellen, dass Sie eine qualitativ hochwertige Lektüre erhalten. Dabei haben wir nicht nur die inhaltliche Richtigkeit überprüft, sondern auch den Schreibstil angepasst, um ein angenehmes und leicht verständliches Leseerlebnis zu bieten. Wir möchten sicherstellen, dass Sie die Informationen aus unseren Videos nicht nur hören, sondern auch schwarz auf weiß vor sich haben, um sie immer wieder zu konsultieren und Ihr Wissen zu vertiefen.
Dieses Magazin ist eine Zusammenstellung von Skripten aus verschiedenen Themenbereichen, die auf unserem Youtube-Kanal behandelt wurden. Von der Panzerei bis zur Fliegerei, von historischen Ereignissen bis zu faszinierenden Persönlichkeiten - wir haben eine breite Palette an Inhalten für Sie zusammengestellt.
Wir hoffen, dass Sie viel Freude beim Lesen haben und dass dieses Magazin Ihnen dabei hilft, Ihr Wissen zu vertiefen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr BACUFFZ Team
Inhaltsverzeichnis
In eigener Sache
Inhaltsverzeichnis
Das Niederkämpfen von Panzerwagen…
1 Entwicklung der Panzerabwehr nach dem 1. Weltkrieg
2 „Unmittelbare Notwehr gegen Panzer“
3 Entwicklung zu Beginn des 2. Weltkrieges
4 Der „Panzerschreck“
5 Die Professionalisierung der Panzernahbekämpfung
5.1 Panzerwurfkörper
5.2 Hafthohlladungen
5.3 Faustpatrone/Panzerfaust
5.4 Ofenrohr/Panzerschreck
6 Fazit
Quellen
Mit der Ju 88 gegen England
Quellen
Panzerspähwagen „Puma“ – eben ein anderer Weg!
1 Vorgeschichte
2 Entwicklung
3 Produktion und Varianten
4 Organisation und Einsatz
5 Nachfahren
Quellen
Verantwortlich für den Untergang der 6. Armee???
1 Frühe Jahre und Einsatz im 1. Weltkrieg
2 Zwischenkriegszeit
3 Milch im neugegründeten Luftfahrtministerium
4 Milchs Verhältnis zur Göring und Beginn des 2. Weltkrieges
5 Karriere bis zum Ende des Krieges
6 Kriegsende
Quellen
Disclaimer
Das Niederkämpfen von Panzerwagen…
1Entwicklung der Panzerabwehr nach dem 1. Weltkrieg
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begann Deutschland intensiv damit, die Kriegserfahrungen auszuwerten und seine Panzerabwehrfähigkeiten zu verbessern. Es wurde erkannt, dass man dem massenhaften Einsatz von Panzern auf Seiten der Alliierten kein effektives Mittel entgegenzusetzen hatte. Um solche Versäumnisse in Zukunft zu vermeiden, wurden in der Reichswehr sowohl passive als auch aktive Panzerabwehrstrategien entwickelt.
Die passive Panzerabwehr bestand aus der vorausschauenden Nutzung des Geländes, indem beispielsweise Stellungen in einem für Panzer schwer zugänglichen Terrain angelegt wurden. Diese Stellungen konnten mit Hilfe von Panzergräben und sperren weiter verstärkt werden. Auf der anderen Seite stand die aktive Panzerabwehr, bei der hierfür vorgesehene Waffen eingesetzt wurden. Hier lag der Schwerpunkt zunächst maßgeblich auf Geschützen der Feldartillerie. Zu jener Zeit begann jedoch auch die Planung und Entwicklung der ersten Panzerabwehrkanonen (PaK), welche jedoch aufgrund der vom Versailler Vertrage ausgehenden Restriktionen möglichst geheim vonstatten ging.
Zur aktiven Panzerabwehr gehörte auch der Nahkampf gegen Panzer, im Zuge dessen unter anderem Handgranaten, Minen und Flammenwerfer als Einsatzmittel vorgesehen waren.Eine wichtige Erkenntnis, die allgemein aus dem Ersten Weltkrieg gewonnen wurde, war die Notwendigkeit, Soldaten speziell für die effektive Abwehr von Panzern auszubilden. Bedingt durch die Erkenntnis, dass Panzer insbesondere in ihrer Warte- und Ausgangsstellung verwundbar waren, oblag die Aufgabe der Bekämpfung zunächst vor allem bei der Artillerie und wurde bereits in der D.V.PI Nr.487 „Führung und Gefecht der verbundenen Waffen“ aus dem Jahr 1921 formuliert. Eine direkte Verteidigung gegen Panzer aus den Reihen der Infanteristen heraus war zwar grundsätzlich richtig, aber angesichts der zunehmenden Vielfalt und Anzahl von Panzern in den Armeen fehlte ihr eine solide Grundlage zu Identifizierung von Schwachstellen. Die fortlaufende qualitative Entwicklung der Panzerwaffe, wie deren stärkere Panzerung, bessere Bewaffnung und höhere Beweglichkeit, ermöglichte es ihnen immer wieder, die Panzerabwehr zu überwinden und die Infanterie schlicht zu überrollen. Es verwundert daher nicht, dass das Thema der infanteristischen Panzerabwehr in der Fachliteratur der damaligen Zeit ein oft diskutiertes Problemfeld war.
2„Unmittelbare Notwehr gegen Panzer“
Ein weiteres Anliegen war die Aufrechterhaltung der Kampfmoral, um ein Gefühl der Lähmung und Hilflosigkeit gegenüber den Stahlkolossen zu vermeiden. Infolgedessen war es dringend geboten verschiedene Ansätze zur infanteristischen Bekämpfung von Panzern zu diskutiert. Einige Autoren hielten spezielle selbstladende Schrotflinten für geeignet im Nahkampf gegen Panzer, wiederum andere bevorzugten spezielle Sprengladungen, Gewehrgranaten und Panzerbüchsen. Es wurden auch improvisierte Kampfmittel diskutiert, beispielsweise das Blockieren von Panzern anhand von Eisenstangen, die in die Fahrwerke gesteckt wurden. Dynamitladungen und Brandflaschen spielten ebenfalls in der Panzerabwehr während des Spanischen Bürgerkriegs von 1936 bis 1939 eine Rolle.
Trotz dieser Erkenntnisse wurde die Bedeutung einer erfolgreichen Beteiligung der Infanterie an der Panzerabwehr in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg unterschätzt. Erst im Krieg selbst erkannte man die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer effektiven Panzerabwehr. Die Wehrmacht verfügte 1939 bereits über rund 11.000 3,7-cm Panzerabwehrkanonen, jedoch fand der Begriff „Panzernahbekämpfung“ erst während des Krieges Eingang in die einschlägigen Vorschriften. In den Richtlinien für die Panzerabwehr aller Waffen vom 2. Mai 1936 wurde noch von „unmittelbarer Notwehr gegen Panzer“ gesprochen.
3Entwicklung zu Beginn des 2. Weltkrieges
Im Jahr 1938 begann die Produktion der Panzerbüchse 38, eine Waffe, die aufgrund ihrer geringen Stückzahl nur begrenzt in der Wehrmacht Verwendung fand – so wurden etwa lediglich 62 Exemplare im Zuge des Polenfeldzugs eingesetzt. Dies resultierte unter anderem aus dem verwendeten Verschluss, welcher relativ aufwändig in der Produktion war. Infolgedessen wurde im Jahr 1939 die vereinfachte Panzerbüchse 39 entwickelt, die bei den Panzerbüchsentrupps der Schützenkompanien zum Einsatz kam.
Die Panzerbüchsen verwendeten die 7,92 mm Patrone SmK H Rs Lspur. Mit einem Gewicht von 14,6 g konnte das Geschoss eine Stahlpanzerung von rund 25 mm durchschlagen. Allerdings stellte sich die Frage nach dem Einsatz dieser Waffen gegen Panzer, da zu dieser Zeit der Übergang zu granatsicheren Panzerungen stattfand, wodurch die Weiterentwicklungen herkömmlicher Panzerbüchsen generell in Frage gestellt wurde. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die schwere Panzerbüchse 41, die aufgrund ihrer Abmessungen und ihres Gewichts den Panzerabwehrkanonen nahe kam und eine entsprechende Durchschlagkraft besaß. Ihre konische Laufform ermöglichte den Einsatz von Hartmetallkern-Geschossen.
In der Wehrmacht stand deshalb zunächst nur die T-Mine als wirksamstes Panzernahbekämpfungsmittel zur Verfügung. Bereits in der Reichswehr hatte man die T-Mine 29 entwickelt, welche etwa bis 1937 im Einsatz war. Mitte der 30er Jahre wurde ein verbessertes Modell, die T-Mine 35, eingeführt, welche rund 80 mm Panzerstahl durchschlagen konnte. Das Produktionssoll lag im Januar 1939 zunächst bei 36.060 Stück und steigerte sich im weiteren Verlauf des Krieges auf beachtliche 500.000 Stück.
Die 3,7-cm Panzerabwehrkanone wurde zum Standardgeschütz der Infanterie-Panzerjägerkompanien in den Schützenregimentern und in den Panzerjägerabteilungen der Divisionen. Mit der Panzergranate konnte sie Panzerstahl bis zu einer Entfernung von 500 m effektiv bekämpfen. Doch bereits im Frankreichfeldzug im Jahr 1940 war ihre Durchschlagskraft gegen die englischen und französischen Panzer mit Panzerstärken von 60-70 mm nicht mehr ausreichend.
Dadurch kam es örtlich zu Krisensituationen, die jedoch durch den Einsatz im Erdkampf von 8,8-cm Flugzeugabwehrkanonen und Feldhaubitzen bewältigt werden konnten.
Die Situation änderte sich jedoch nach dem 22. Juni 1941, dem Beginn des Feldzugs gegen die Sowjetunion. Operation Barbarossa offenbarte eine völlig neue Dimension in Bezug auf die Ausdehnung der Fronten, die Härte der Kampfhandlungen und die Anzahl der eingesetzten Kampfmittel. Die Rote Armee verfügte über eine erheblich größere Anzahl von Panzern, darunter 1.225 T-34 und 636 KW mit einer granatsicheren Panzerung. Diese Panzer machten die 3,7-cm Panzerabwehrkanone praktisch nutzlos und führten bereits in den ersten Tagen zu komplexen Kampfsituationen. Plötzlich gab es einen akuten Mangel an effektiven Panzerabwehrwaffen, und auch die neue 5-cm Panzerabwehrkanone 38 erwies sich als unzureichend. Die relativ wenigen verfügbaren Panzerabwehrwaffen mussten in den besonders gefährdeten Frontabschnitten gezielt massiert werden, um entsprechend wirken zu können.
Die schiere Menge an sowjetischen Panzern und ihre Fähigkeit, auch in unwegsamem Gelände zu operieren, stellten eine permanente brisante Gefahr die deutsche Infanterie dar. Zwar konnten die gut ausgebildeten Infanteristen mit ihrer im Polen- und Frankreichfeldzug gewonnenen Kriegserfahrung kritische Situationen auf dem Schlachtfeld ohne verheerende Niederlagen meistern, doch perspektivisch war dies keine Lösung. Es wurde erkannt, dass die Panzerabwehr nicht nur die Aufgabe einer speziellen Truppe, den Panzerjägern, war, sondern ein komplexer Einsatz, der von allen Waffengattungen des Heeres, teilweise auch von der Luftwaffe, bewältigt werden musste.
4Der „Panzerschreck“
Um dem aufkommenden „Panzerschreck“ entgegenzuwirken sollten die neuen Panzernahbekämpfungsmittel Panzerstärken von bis zu 70-100 mm zuverlässig durchschlagen können, ohne dabei ihre zerstörerische Wirkung im Inneren des Fahrzeugs zu verlieren. Zudem sollten diese Mittel leicht und handlich sein, um von der Infanterie flexibel mitgeführt werden zu können. Die Ausbildung der Soldaten an den neuen Waffen sollte möglichst schnell und entsprechend unkompliziert erfolgen können. Geringe Herstellungskosten waren ebenfalls von Bedeutung, um die Massenfertigung zu erleichtern.
Die Entwicklung neuer Panzernahbekämpfungsmittel gestaltete sich jedoch schwierig. Es wurden verschiedene Ansätze ausprobiert, aber nur wenige schienen geeignet zu sein. Herkömmliche Panzerbüchsen mit Wuchtgeschossen erwiesen sich als wenig erfolgversprechend. Die schwere Panzerbüchse 41 war mit ihren über 200 Kilogramm zu schwer für den infanteristischen Einsatz und zu dem zu teuer in der Herstellung. Die Verwendung rückstoßfreier Munition, der Einsatz des Raketenantriebs und des Hohlladungseffekts boten sich als vielversprechende Lösungen an. Insbesondere die Verwendung von Hohlladungen hatte bereits am 10. Mai 1940 beim Angriff auf das belgische Fort Eben Emael seine Wirksamkeit im Gefecht bewiesen.