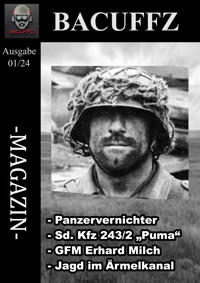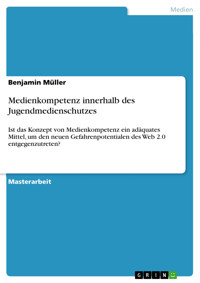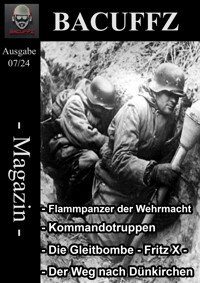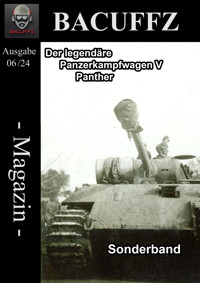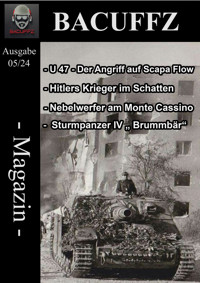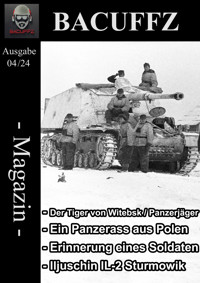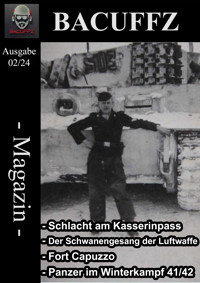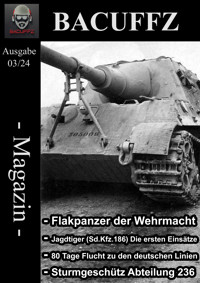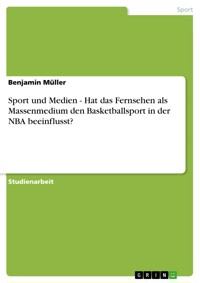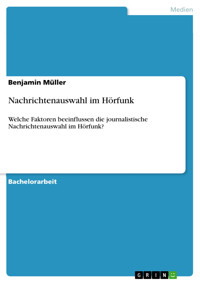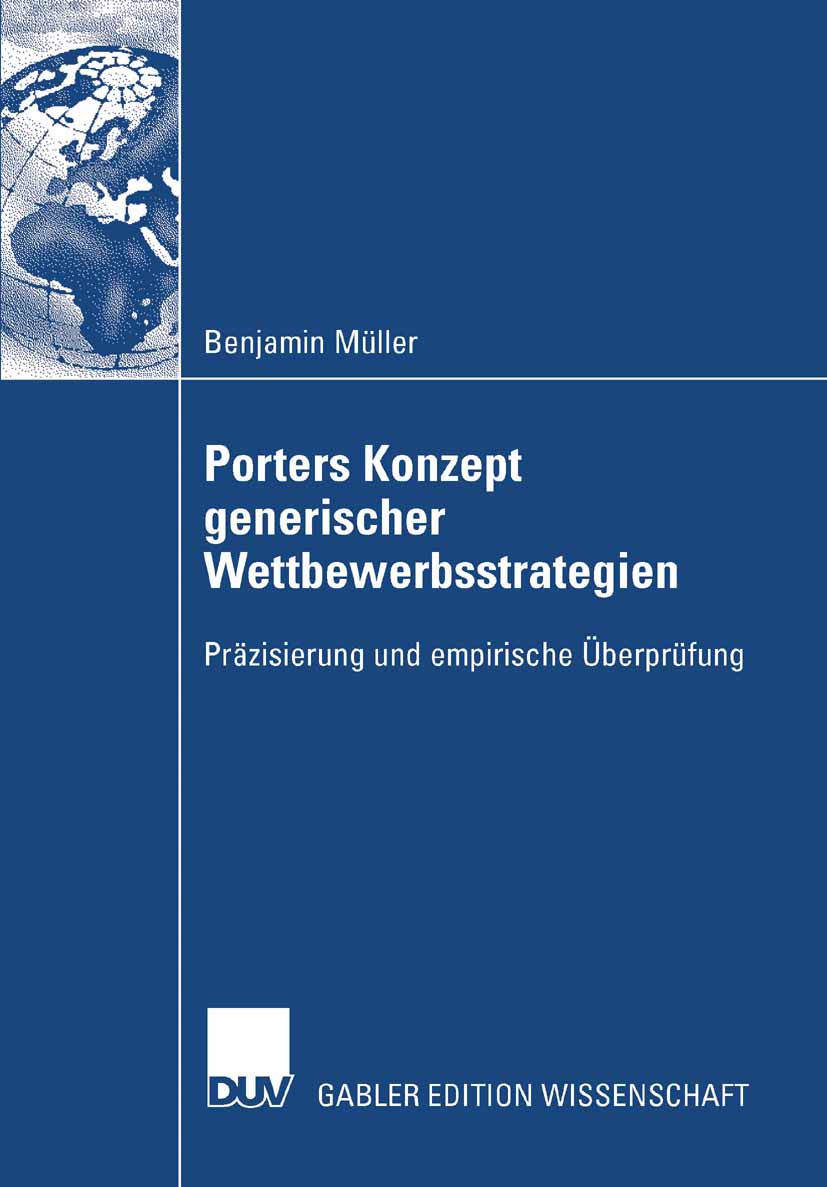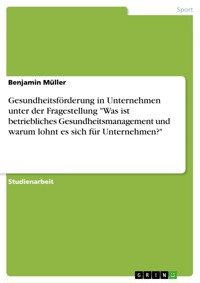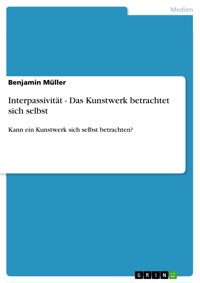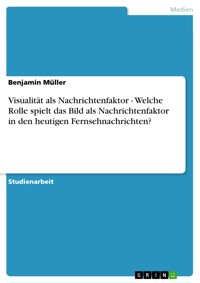Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BACUFFZ / Kriegstagebücher
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bacuffz Magazin
- Sprache: Deutsch
Das Bacuffz Magazin enthält Berichte über den zweiten Weltkrieg. Wir schildern u.a. was die Soldaten im Einsatz erlebten, gehen den technischen Details von Waffen und Fahrzeugen auf den Grund und beleuchten berühmte Persönlichkeiten der Zeit. Also eine Reise in die Zeit, in welcher Europa und die Welt im Donner der Kanonen erzitterte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In eigener Sache
Unsere Titelgeschichte widmet sich dem legendären U-Boot Typ XXI, das als eine der innovativsten Entwicklungen der Kriegsmarine gilt. Wir beleuchten die Vorgeschichte, die Entwicklung und den Einsatz dieses technologischen Wunderwerks und werfen einen kritischen Blick auf seine tatsächliche Bedeutung und den Mythos, der es umgibt.
Neben dem Typ XXI stellen wir Ihnen den Panzerspähwagen Sd.Kfz. 234/2 „Puma“ vor, ein weiteres beeindruckendes Fahrzeug der deutschen Wehrmacht. Wir verfolgen seine Entwicklung, die verschiedenen Einsatzgebiete und werfen einen Blick auf seine Nachfolger in der Nachkriegszeit.
Ein weiteres Thema dieser Ausgabe ist das Porträt von Generalfeldmarschall Georg von Küchler. Wir betrachten sein Leben von den frühen Jahren über seine Rolle im Zweiten Weltkrieg bis hin zu seiner Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der Nachkriegszeit und bieten eine Einschätzung seiner moralischen Position.
Schließlich werfen wir einen detaillierten Blick auf die letzten Tage der Schlacht um Berlin, die das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa markierte.
Euer BACUFFZ-Team
Inhaltsverzeichnis
In eigener Sache
Inhaltsverzeichnis
Typ XXI – Vorgeschichte, Entwicklung, Bau und Einsatz
1 Vorgeschichte
1.1 U-Boot Entwicklung zwischen den Kriegen
1.2 Der U-Boot-Krieg und die Niederlage im Atlantik
1.3 Die Walter-Boote und Ihr Schöpfer
2 Entwicklung
2.1 Das E-Boot
2.2 Sektionsbau mit Hindernissen
2.3 Erprobung und Ausbildung
2.3 Bunker Valentin
2.4 U-Schnee und die HMS Norfolk
3 Fazit
3.1 Eine Wunderwaffen und die harte Realität
3.2 Nutzung und Einfluss im Ausland
Quellenverzeichnis
Der Panzerspähwagen Sd.Kfz. 234/2 Puma
1 Vorgeschichte
2 Entwicklung
3 Produktion und Varianten
4 Organisation und Einsatz
5 Nachfahren
Quellen
Georg von Küchler
1 Einleitung
2 Frühe Jahre und Beginn des 2. Weltkriegs
3 Nachkriegszeit und Konfrontation mit der Vergangenheit
4 Einschätzungen zum Verhältnis zu Hitler
5 Versuch einer moralischen Verortung
Quellenverzeichnis
Schlacht um Berlin (1945)
26. April
27. April
28. April
Bild des Monats
Disclaimer
Typ XXI – Vorgeschichte, Entwicklung, Bau und Einsatz
Von Alex
1Vorgeschichte
1.1U-Boot Entwicklung zwischen den Kriegen
Die Niederlage im Ersten Weltkrieg führte nicht nur zum Ende der Monarchie und zur Gründung der Republik im Deutschen Reich, sondern auch zum als Diktat empfundenen Friedensvertrag von Versailles. Neben den vielfältigen Reparationsleistungen und anderen Punkten wurde in dem Vertragswerk vor allem die Beschränkung des deutschen Wehrpotenzials geregelt, wie es die Siegermächte empfanden. In Bezug auf die Reichsmarine bedeutete dies einen maximalen Personalbestand von 15.000 Mann und eine im Vergleich zur Kaiserlichen Marine winzige Flotte, bestehend aus höchstens 6 Schlachtschiffen, 6 kleinen Kreuzern, 12 Zerstörern und 12 Torpedobooten. In der Praxis verhinderte die Personalobergrenze jedoch selbst das Ausschöpfen der erlaubten Flottengröße. Entwicklung, Bau und Besitz von Unterseebooten waren gänzlich verboten, was auf zwei Faktoren zurückzuführen war: den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, den die kaiserlichen U-Boote zeitweise geführt hatten, und die Tatsache, dass die U-Boote erfolgreich gegen die importabhängige Weltseemacht Großbritannien eingesetzt worden waren. Bis es mit neuer Technik (ASDIC, Wasserbomben, über 100.000 Seeminen) und Taktik (Geleitzugtaktik, U-Bootfallen und Seeraumüberwachung aus der Luft) gelang, der U-Boot-Bedrohung Herr zu werden. Dieser erste Versuch, die "Insel" auszuhungern, scheiterte somit. Die Bilanz war jedoch militärisch so beachtlich wie humanitär und moralisch katastrophal. Die 320 U-Boote hatten 6.394 Schiffe mit 7,75 Millionen Tonnen Schiffstonnage versenkt, den Großteil davon in der kurzen Phase von Februar 1917 bis Kriegsende. Mit den Schiffen blieben ca. 30.000 Menschen auf See. Aber auch die U-Bootwaffe zahlte einen enormen Preis: Rund 5.100 Mann kehrten nicht mehr von der "Feindfahrt" zurück, somit starb jeder zweite U-Bootsmann des Kaisers den Seemannstod. Trotz des Verbots wurde bald "illegal" weiter an U-Booten gearbeitet. Schon 1920 baute man in Japan U-Boote unter Aufsicht deutscher Konstrukteure nach deutschen Plänen aus der Kriegszeit. Auch in Holland entstanden mit Hilfe von Tarnfirmen Neubauten, wie etwa die "Birindji-In-Uni" für die Türkische Marine. So wurde die Entwicklung und der Bau von U-Booten, wenn auch in bescheidenem und streng geheimem Rahmen fortgesetzt. Im Jahr von Hitlers Machtergreifung 1933 entstand am 01. Oktober im Marienstützpunkt Kiel mit der "U-Boot-Abwehrschule" die Keimzelle der neuen U-Bootwaffe. Fast genau ein Jahr später gab Erich Raeder als Chef der Marineleitung den Bau von 6 U-Booten in Auftrag. Im Anfang 1939 verabschiedete Z-Plan zur Flottenrüstung waren insgesamt 249 U-Boote vorgesehen. Der Kriegsausbruch kam diesen Plänen bekanntlich zuvor.
1.2Der U-Boot-Krieg und die Niederlage im Atlantik
Der Kriegsausbruch im September 1939 kam für die Kriegsmarine in mehrfacher Hinsicht ungelegen. Die großen Pläne zur maritimen Aufrüstung waren erst im Januar in Kraft getreten. Somit blieb der Flotte beim Kriegseintritt Großbritanniens mit seiner Royal Navy am 03.09.39 nur zu zeigen, "dass sie mit Anstand zu sterben versteht", wie es im Kriegstagebuch der Seekriegsleitung vermerkt wurde. Auch waren die führenden Köpfe der Marine sich keinesfalls einig darüber, wie nun vorzugehen sei. Unter Readers Führung hatte man für einen weltweiten Handelskrieg mit mittleren und schweren Überwassereinheiten geplant. Diese Pläne waren nun praktisch gescheitert. Die erste Bewährungsprobe der deutschen Seestreitkräfte kam mit der Invasion Norwegens. Hier konnte man sich zwar durchsetzen, verlor aber nicht nur eine der wenigen schweren Einheiten, sondern auch einen Großteil der ohnehin zu schwachen Zerstörer Flotte. Der überraschende Blitzsieg über Frankreich schuf aber einen direkten Atlantikzugang für die U-Boote des Befehlshabers der U-Boote (kurz BdU) Karl Dönitz. Dessen wenige Einheiten hatten bereits einige teils spektakuläre Erfolge erzielt und sollten nun das vollbringen, was ihren Vorgänger im Ersten Weltkrieg nur fast gelungen war: das Abschneiden der britischen Inseln von lebens- und kriegswichtigem Nachschub über See. Bis zum Frühjahr 1943 erzielten die „Grauen Wölfe“ mit Hilfe der von Dönitz vorangetriebenen Rudeltaktik große Erfolge gegen die in Geleitzügen fahrende Handelsschifffahrt der alliierten Gegner im Atlantik, aber auch im Nord- und Mittelmeer. Dönitz' Rudeltaktik funktionierte so, dass ein U-Boot, welches einen Geleitzug gefunden hatte, diesen nicht angriff, sondern seine Position meldete. Woraufhin die Führung an Land alle in Frage kommenden Boote heranführte, bis sie wie ein Wolfsrudel gemeinsam angriffen und so den Geleitschutz überforderten. Diese Kampfwiese erforderte eine Unmenge an Kommunikation per Funk. Anfang 1943 hatte sich das Kriegsglück jedoch offensichtlich gewendet. Die Versenkungszahlen nahmen ab, während gleichzeitig die Verluste an Booten dramatisch stiegen. Diese Wende wird heute gerne auf die britischen Erfolge in der Fernmeldeaufklärung und dem "Knacken" der deutschen Funkcodes zurückgeführt. Kaum jemand kennt nicht die Begriffe Enigma, Bletchley Park mit den Codeknacker um Alan Turing. Aber das ist wie so oft allenfalls die halbe Wahrheit. Denn die Kryptologie allein hätte kein U-Boot versenkt und blieb von Natur aus eine reaktive Waffe, angewiesen auf die Mithilfe des Gegners. Der wörtliche Untergang für die Jäger des Atlantiks kam in Form von Radar und der "Huff-Duff" genannten High-Frequency Direction Finding (Kurzwellenpeilung) und Leigh Light (Suchscheinwerfer an Patrouillenflugzeugen). Die ständigen Funksprüche der U-Boote wurden nicht nur in Buckinghamshire entschlüsselt, sondern auch die Boote selbst per Funkortung angepeilt. Auch wenn sie sich nicht selbst verrieten, wurden die Boote ab Mitte 1943 in jedem Winkel des Atlantiks von alliierten Seefernaufklärern per Radar geortet und selbst bei Nacht attackiert. Alle Boote, wie das wichtigste deutsche Modell der Typ VII C, waren keine wirklichen Unterseeboote, sondern vielmehr hochseefähige Torpedoboote mit der Fähigkeit für kurze Phasen zu tauchen. Dabei wurden sie durch aus Batterien gespeiste Elektromotoren angetrieben. Ein Einsatz der Dieselmotoren war unter Wasser nicht möglich. Die Höchstgeschwindigkeit im E-Betrieb lag bei etwa 7 Knoten, doch waren die Batterien dann nach ca. einer Stunde erschöpft. War der Strom erst einmal verbraucht, musste das Boot unweigerlich auftauchen, um mit den Dieseln aufzuladen. Ein getauchtes U-Boot bewegte sich meist mit der Geschwindigkeit eines Fußgängers, bestenfalls eines Fahrradfahrers, und versuchte so, seinen Jägern zu entkommen. Erfolgreiche Angriffe erforderten das aufgetauchte Erreichen einer günstigen Position vor dem Tauchen oder wie es die Regel war gleich einen Anlauf über Wasser. Den meisten wird der nächtliche Überwasserangriff aus dem Film "Das Boot" ein Begriff sein, den der Dieselheizer Schwalle alias Oliver Stritzel treffend mit "War ja ein Schnellbootangriff" kommentiert.
Im Mai gingen allein 43 U-Boote verloren, darunter auch U-954, das am 19. Mai von einem Liberator-Bomber mit der gesamten Besatzung versenkt wurde. Darunter Oberleutnant z. S. Peter Dönitz, der jüngste Sohn des inzwischen zum Oberbefehlshaber der gesamten Kriegsmarine aufgestiegenen Admirals Karl Dönitz.
Kurz darauf brach man die Schlacht im Atlantik ab, doch Dönitz verstand dies nur als Unterbrechung und keinesfalls als Ende des Kampfes. Noch am 21. Mai funkte er an alle U-Boote: „Derjenige, der nun glaubt, dass die Geleitzugbekämpfung nicht mehr möglich ist, ist ein Schwächling und kein echter U-Boot-Kommandant. Die Schlacht im Atlantik wird härter, sie ist aber die entscheidende Kriegführung. Ich glaube an Euch.“
Der Kampf wurde somit nicht gänzlich eingestellt, sondern nur mit geringer Intensität fortgesetzt, bis ein neuer Bootstyp seine Wiederaufnahme ermöglichte. Das Kämpfen und Sterben der U-Boot-Waffe ging somit weiter!
1.3Die Walter-Boote und Ihr Schöpfer
Am 31. Mai trug Dönitz Hitler vor. Er erklärte, dass die alliierten Seestreitkräfte und Flugzeuge möglicherweise durch Verrat oder durch neue britische Ortungsgeräte an die U-Boote herangeführt würden. Viele U-Boote waren selbst bei schlechtem Wetter und Dunkelheit überfallartig durch Flugzeuge versenkt worden. Trotz der Einführung neuer Technologie und einer monatlichen Produktionserhöhung von 27 auf 30 bis 40 Boote waren die U-Boote des alten Typs hoffnungslos unterlegen. Ein neuer Bootstyp mit hoher Unterwassergeschwindigkeit und langer Tauchzeit war die einzige Möglichkeit, um die Wende zugunsten der U-Bootwaffe zu schaffen. Wie Dönitz und auch Hitler wussten, gab es in Deutschland zumindest in der Theorie bereits ein solches echtes Unterseeboot. Seit 1933 arbeitete der Ingenieur Hellmuth Walter in Kiel an Antriebsverfahren unter Nutzung von Wasserstoffperoxid (H2O2). Aus einem kleinen zweiköpfigen Ingenieurbüro hatte Walter die Hellmuth Walter KG aufgebaut. Dort entwickelte man Antriebe nachdem Walter-Prinzip für verschiedenste Anwendungsbereiche. Waltertriebwerke kamen etwa in der Heinkel He 176 und später auch in der Me 163 zum Einsatz. Der Schwerpunkt von Walters Arbeit war jedoch die Entwicklung eines Untersee-Schnellboots, das Unterwasser bis dato unerhörte Geschwindigkeiten erreichen sollte. Nach vielen Entwürfen und einem ständigen Hin und Her zwischen Walter mit seiner Firma HWK, dem Marinekonstruktionsamt und dem OKM entstand bis April 1940 das Versuchsboot V 80 mit Walterantrieb. Es wurde auf der Germaniawerft in Kiel gebaut und unter strengster Geheimhaltung in der äußeren Schlei sowie später vor Hela in der Danziger Bucht getestet. Im November 1941 wurde das Boot sogar Großadmiral Raeder, dem Chef des K-Amts (Amt für Kriegsschiffplanung) Fuchs und weiteren hochrangigen Marineoffizieren und Beamten vorgeführt. Das Boot erreichte routinemäßig Unterwassergeschwindigkeiten von 20 Knoten. Über die Projekte V300, V301 und Wa201 entstand schließlich der Entwurf für den Typ XVIII, ein großes atlantiktaugliches Kampfboot (1625 t Verdrängung getaucht), das neben dem herkömmlichen dieselelektrischen Antrieb durch Nutzung des Walterantriebs Unterwassergeschwindigkeiten von 24 Knoten für bis zu 8 Stunden also rund 200 Seemeilen erreichen sollte.
Allerdings liefen diese Arbeiten wie alle experimentellen Arbeiten im Rüstungssektor spätestens ab August 1940 nur noch sehr eingeschränkt weiter. Im besagten Monat hatte eine Umsteuerung der Rüstung begonnen, um sowohl das Heer zu stärken (Bau von Panzer III mit 5 cm KwK und Panzer IV) als auch die schweren Verluste der Luftwaffe aus der Luftschlacht um England (rund 2000 Flugzeuge) auszugleichen.