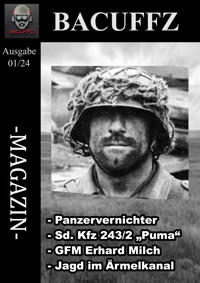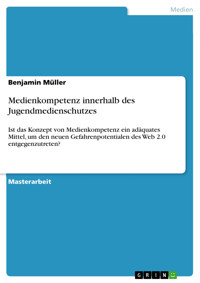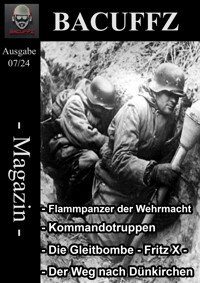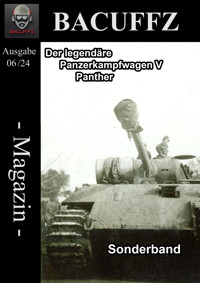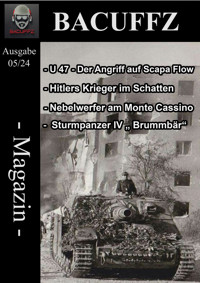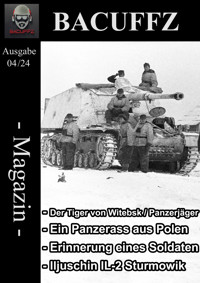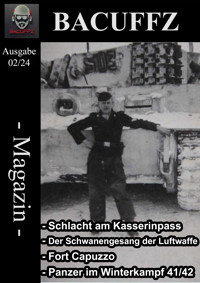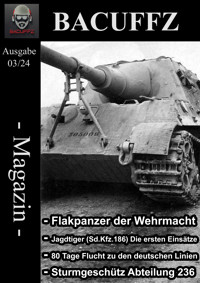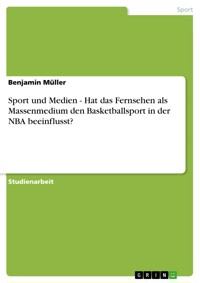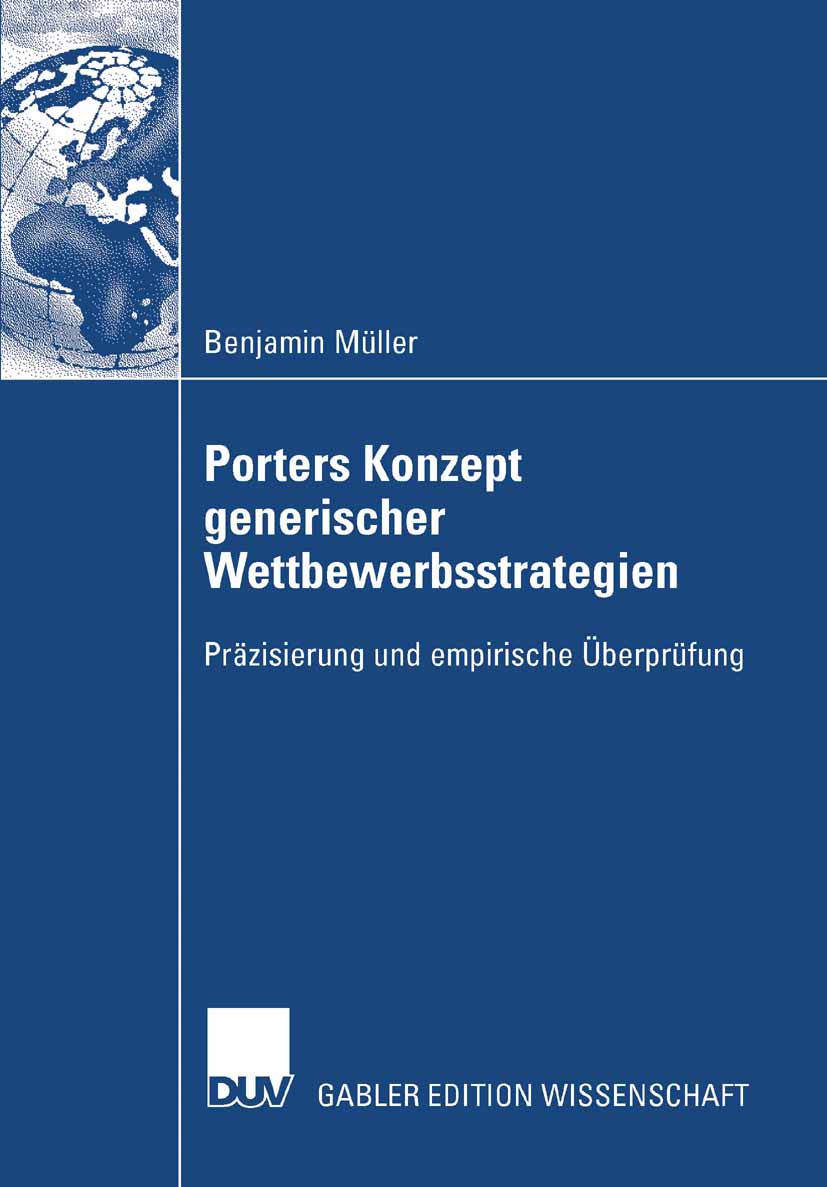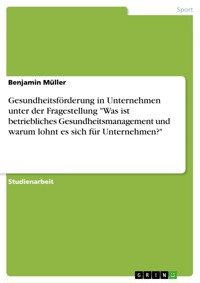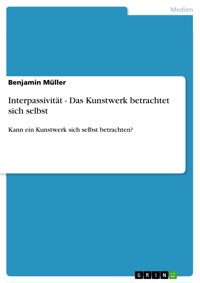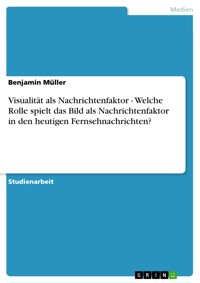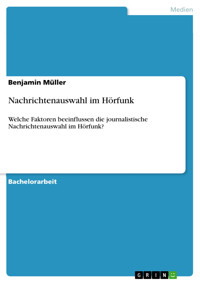
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Journalismus, Publizistik, Note: 1,3, Universität Bremen (Kulturwissenschaft/ Medienwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: „Sie gelten als die „Königsdisziplin im Radio“ – Nachrichten“ (Linke 2007, S. 9). Sie informieren die Menschen, geben ihnen Orientierung und eine Art eigenen Blickwinkel Ereignisse auf der ganzen Welt zu betrachten. Ihre Themen reichen von Lokal-, Regional- und Weltnachrichten bis hin zu Sport, Wetter und Verkehr. Aber, wer oder was entscheidet eigentlich, wann eine Nachricht zur Nachricht wird, bzw. ob sie letztendlich gesendet wird oder nicht? Seit den 20er Jahren befassen sich Forscher nun schon mit dieser Frage und entwickeln immer wieder neue Theorien, die immer komplexer werden. Das Radio als Medium wurde in der Forschungstradition oft vernachlässigt, obwohl Untersuchungen zeigen, dass die Menschen gerade durch das Radio oft als erstes von Ereignissen erfahren (vgl. Vowe, Wolling 2003, zit. nach Linke 2007, S. 9). Auch auf Zuschauerseite scheint das Radio als Informationsmedium einen hohen Stellenwert einzunehmen. So ermittelte die repräsentative ARD/ZDF-Studie „Massenkommunikation 2005“ (Ridder, Engel in Media Perspektiven 9/2005) das Interesse an aktueller Information als zweitwichtigstes Motiv der Hörer für das Einschalten eines Radioprogramms. Als erstes Motiv wurde „Weil es mir Spaß macht“ (Linke 2007, S. 9) genannt. Daher erscheint es wichtig, das Radio als Informationsmedium näher zu beleuchten. Für die nachfolgende Studie möchte ich mich speziell auf die journalistische Nachrichtenauswahl und somit auf die Produzentenseite beziehen. Dies scheint notwendig, da es zwar einige Studien zum Rezeptionsverhalten von Radionachrichten gibt, allerdings nur sehr wenige Studien, die sich mit der Nachrichtenauswahl befassen. Meine Arbeit hat nicht den Anspruch neue Erkenntnisse im Bereich der Nachrichtenauswahl im Hörfunk zu schaffen, viel mehr soll sie den aktuellen Forschungsstand abbilden und diesen in einen neuen Zusammenhang einordnen, um eine Grundlage für weitere empirische Forschungen zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Bachelorarbeit:
„Nachrichtenauswahl im Hörfunk“
Page 2
Page 1
1. Exposé
„Sie gelten als die „Königsdisziplin im Radio“ - Nachrichten“(Linke 2007, S. 9).Sie informieren die Menschen, geben ihnen Orientierung und eine Art eigenen Blickwinkel Ereignisse auf der ganzen Welt zu betrachten. Ihre Themen reichen von Lokal-, Regional- und Weltnachrichten bis hin zu Sport, Wetter und Verkehr. Aber, wer oder was entscheidet eigentlich, wann eine Nachricht zur Nachricht wird, bzw. ob sie letztendlich gesendet wird oder nicht? Seit den 20er Jahren befassen sich Forscher nun schon mit dieser Frage und entwickeln immer wieder neue Theorien, die immer komplexer werden. Das Radio als Medium wurde in der Forschungstradition oft vernachlässigt, obwohl Untersuchungen zeigen, dass die Menschen gerade durch das Radio oft als erstes von Ereignissen erfahren(vgl. Vowe, Wolling 2003, zit. nach Linke 2007, S. 9).Auch auf Zuschauerseite scheint das Radio als Informationsmedium einen hohen Stellenwert einzunehmen. So ermittelte die repräsentative ARD/ZDF-Studie „Massenkommunikation 2005“(Ridder, Engel in Media Perspektiven 9/2005)das Interesse an aktueller Information als zweitwichtigstes Motiv der Hörer für das Einschalten eines Radioprogramms. Als erstes Motiv wurde „Weil es mir Spaß macht“(Linke 2007, S. 9)genannt.
Daher erscheint es wichtig, das Radio als Informationsmedium näher zu beleuchten. Für die nachfolgende Studie möchte ich mich speziell auf die journalistische Nachrichtenauswahl und somit auf die Produzentenseite beziehen. Dies scheint notwendig, da es zwar einige Studien zum Rezeptionsverhalten von Radionachrichten gibt, allerdings nur sehr wenige Studien, die sich mit der Nachrichtenauswahl befassen. Die Gründe hierfür scheinen einen ökonomischen Hintergrund zu haben, da viele Studien der Hörfunkforschung von öffentlichrechtlichen Hörfunkanstalten selbst oder von Organisationen, wie z.B. dem Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation (VPRT), welcher die Interessensvertretung privater elektronischer Medienunternehmen stellt, in Auftrag gegeben werden und diese aus wirtschaftlichen Gründen mehr Interesse am Hörverhalten von Rezipienten, als am Auswahlverhalten von Produzenten haben(vgl. Primavesi 2007, S. 37).In den letzten 15 Jahren lassen sich aufgrund ökonomischer und technischer Entwicklungen - Stichworte sind hier Kommerzialisierung und Digitalisierung - eine Reihe von medienübergreifenden
Page 2
Veränderungen beobachten(vgl. Maier et al. 2003, S. 13).Die Annahme, dass in immer kürzerer Zeit, von immer weniger Journalisten, immer mehr Nachrichtenplätze gefüllt werden müssen, wird auch in anderen Studien, wie z. B. „Die Souffleure der Mediengesellschaft“(Weischenberg 2006)belegt. Auch der Trend zum Infotainment lässt sich medienübergreifend feststellen, wie es z. B. in „Infotainment: zwischen Bildungsanspruch und Publikumserwartung; wie unterhaltsam darf Information sein?“(Klöppel 2008)beschrieben wird. In einem ersten einleitenden Teil werde ich zunächst auf die Notwendigkeit journalistischer Selektion eingehen.
Der zweite große Teil meiner Arbeit soll einen Überblick über modernen Radionachrichten und deren Bedeutung für die Selektionsentscheidungen von Journalisten geben. Ich möchte weiter auf die Nachrichtenwerttheorie eingehen, welche als Grundlage der Selektion von Nachrichten für alle Medien gilt. Nachdem ich die Forschungtraditionen und moderne Weiterentwicklungen dargelegt habe, werde ich außerdem auf verwandte Modelle der Nachrichtenwerttheorie eingehen, welche die Nachrichtenauswahl direkt beeinflussen. Anschließend werde ich speziell auf die Hörfunkforschung eingehen und den aktuellen Forschungsstand darstellen. Anhand der Studie „Nachrichten im Hörfunk - Ein Vergleich der Nachrichtenprofile norddeutscher Radioprogramme“(Volpers, Schnier, Salwiczek 2005)werde ich danach nochmals genauer auf den norddeutschen Raum eingehen, welcher in der Hörfunkforschung oft vernachlässigt wurde.
In einem dritten Teil werde ich zur Abrundung, der von mir gewonnenen Erkenntnisse aus der Forschungs- und Datenanalyse, ein Leitfadeninterview mit Guido Schulenberg, dem Nachrichtenchef von Radio Bremen, durchführen, welches weitere Erkenntnisse liefern soll und eine gute Vergleichbarkeit mit der Studie von Volpers, Schnier und Salwiczek(2005)bietet. Meine Ergebnisse werde ich in einem Fazit festhalten und versuchen eine eigene Einschätzung für kommende Entwicklungen zu liefern. Ich werde außerdem eine kritische Betrachtung vornehmen, welche auf Schwierigkeiten der Selektion hinweisen wird.
Meine Arbeit hat nicht den Anspruch neue Erkenntnisse im Bereich der Nachrichtenauswahl im Hörfunk zu schaffen, viel mehr soll sie den aktuellen
Page 3
Forschungsstand abbilden und diesen in einen neuen Zusammenhang einordnen, um eine Grundlage für weitere empirische Forschungen zu schaffen.
2. Die Notwendigkeit journalistischer Selektion
2.1 Informationsflut und Selektionszwang
Journalisten sehen sich heute einer wahren Informationsflut gegenüber. Alleine der Basisdienst der Deutschen Presseagentur (DPA) bedient die Redaktionen deutscher Medien mit knapp 750 Meldungen und Berichten pro Tag(vgl. Maier et al. 2003, S. 27).Hinzu kommen weitere Geschichten, welche von anderen Medien, den so genannten Leitmedien, geliefert werden, außerdem eigene Recherchen von Journalisten der jeweiligen Redaktion und sogar das Publikum ist heute in der Lage Themenwünsche zu äußern und sich somit aktiv an der Programmgestaltung zu beteiligen. Bei dieser Fülle an Informationen scheint es klar, dass eine Selektion stattfinden muss. Diese extreme Vielzahl an Informationen, welche bereits durch verschiedenste Instanzen vorgefiltert ist, muss auf ein Minimum reduziert werden, welches dann tatsächlich in den Nachrichten oder im laufenden Programm eines Radiosenders auftaucht. Daher gehört die Auswahl von aktuellen, relevanten und für die Rezipienten interessanten Ereignissen auch zu einer der Hauptaufgaben des journalistischen Arbeitens(vgl. Maier et al. 2010, S. 13).
Schon Walter Lippmann stellte 1922 in seinem Text „The nature of news“ über die Entstehung von Nachrichten fest: „All the reporters in the world working all the hours of the day could not witness all happenings in the world. There are not a great many reporters. And none of them has the power to be in more than one place at a time. Reporters are not clairvoyant, they do not gaze into a crystal ball and see the world at will, they are not assisted by thought-transference. Yet the range of subjects these comparatively few men manage to cover would be a miracle indeed, if it were not a standardized routine”(Lippmann 1922, S. 338 in Maier et al. 2010, S. 14).
Lippmann erkennt schon früh, dass nicht alleine die Redaktion für die Beschaffung und Auswahl von Nachrichten verantwortlich sein kann, sondern verschiedene Instanzen an diesem Ablauf beteiligt sein müssen. Schulz(2004)beschreibt dies mit dem Begriff der „Nachrichtenkette“. Er geht dabei von vielen
Page 4
lokalen Journalisten aus, die Nachrichten an Nachrichtenagenturen weitergeben und diese wiederum von den Nachrichtenagenturen vorselektiert und international verbreitet werden. Walter La Roche(2008, S. 17)vermutet, dass nur gut ein Viertel aller Agenturmeldungen tatsächlich durch die Medien übertragen werden. Diese Vermutung wurde in einer stichprobenartigen Erhebung vom 9. und 10. März 2009 für Zeitung und Fernsehen bestätigt. Die vier wichtigsten Nachrichtenagenturen in Deutschland (Deutsche Presseagentur (DPA), Associated Press (AP), Agance France Press (AFP) und Reuthers) verbreiteten am 09. März 2009 genau 427 politische Meldungen. Von diesen Meldungen tauchten 38 in der Süddeutschen Zeitung, 37 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 14 in der BILD auf. Für das Fernsehen lag die Zahl deutlich niedriger. Hier tauchten fünf Meldungen in der Tagesschau, vier in der ZDF-Nachrichtensendung, drei in RTLaktuell und zwei in den Sat.1 News auf(vgl. Maier et al. 2010, S. 15).Für das Radio wurde keine Erhebung vorgenommen, allerdings deutet der geringe Sendeplatz pro Nachrichtensendung, die Anzahl der pro Tag gesendeten Nachrichten und die komplexitätsreduzierte Konstruktion von Radionachrichten darauf hin, dass es zu einem ähnlichen Ergebnis, wie bei den Fernsehnachrichten kommen würde.
2.2 PR und weitere Quellen
Nachdem wir gesehen haben, welche Masse an Ereignissen alleine von Nachrichtenagenturen an die Journalisten herangetragen werden, gilt es nun die weiteren Bereiche zu erfassen, welche eine unglaubliche Fülle an Informationen für die Redaktionen liefern.
Einen immer größeren Stellenwert nehmen hier Öffentlichkeits- und PR-Abteilungen ein, welche sich nach Weischenberg, Malik und Scholl(2006)deutlich professionalisiert haben. „Immer mehr gesellschaftliche Akteure versuchen mit immer ausgefeilteren Methoden, ihren Anliegen über die journalistische Berichterstattung öffentliche Aufmerksamkeit und Legitimation zu verschaffen“(Weischenberg et al. 2006, S. 122).Auch die Journalisten bestätigen in der repräsentativen Umfrage nach Weischenberg et al.(2006)die stetige Zunahme von Pressemitteilungen. Knapp 60 Prozent der befragten Journalisten gaben an, dass ihrer Meinung nach zu viele Pressemitteilungen produziert werden.