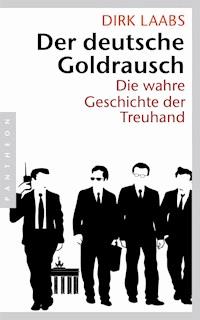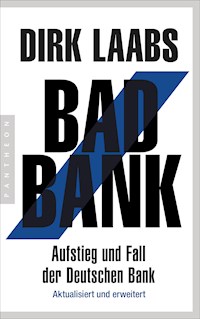
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Deutsche Bank: Die Demontage eines deutschen Vorzeigeunternehmens
Die Deutsche Bank war einst der mächtigste Konzern der Republik. Fast nichts geschah in Deutschland ohne Wissen der Banker aus Frankfurt. Ende der 1990er Jahre baute das Institut seine Machtposition aus, schloss zur Weltspitze auf. Ein einzigartiger Aufstieg, der unaufhaltsam schien. Mehr Umsatz, mehr Profit, immer größere Boni für die Banker. Doch Dirk Laabs’ Recherchen zeigen: Nur weil die Bank oft illegal, teils kriminell und regelmäßig skrupellos handelte, konnte das Institut so erfolgreich und mächtig werden. Der tiefe Fall der Deutschen Bank begann mit der weltweiten Finanzkrise und ist bis heute nicht zu Ende.
»Bad Bank« macht das System Deutsche Bank transparent und enthüllt dessen perfide Machenschaften und zerstörerische Mechanismen. Ein Milliarden-Poker, der letztlich mit unser aller Geld gespielt wird.
Aktualisiert und um ein Nachwort erweitert.
- »Eine atemberaubende Geschichte bis ins Detail recherchiert.« (ZDF "Markus Lanz")
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1063
Ähnliche
Zum Buch
Die Deutsche Bank war einst der mächtigste Konzern der Republik. Fast nichts geschah in Deutschland ohne Wissen der Banker aus Frankfurt. Ende der 1990er Jahre baute das Institut seine Machtposition aus, schloss zur Weltspitze auf. Ein einzigartiger Aufstieg, der unaufhaltsam schien. Mehr Umsatz, mehr Profit, immer größere Boni für die Banker. Doch Dirk Laabs’ Recherchen zeigen: Nur weil die Bank oft illegal, teils kriminell und regelmäßig skrupellos handelte, konnte das Institut so erfolgreich und mächtig werden. Der tiefe Fall der Deutschen Bank begann mit der weltweiten Finanzkrise und ist bis heute nicht zu Ende.
Bad Bank macht das System Deutsche Bank transparent und enthüllt dessen perfide Machenschaften und zerstörerische Mechanismen. Ein Milliarden-Poker, der letztlich mit unser aller Geld gespielt wird.
Aktualisiert und um ein Nachwort erweitert.
Zum Autor
Dirk Laabs, 1973 in Hamburg geboren, ist Autor und Filmemacher. Sein Film Der Fall Deutsche Bank wurde 2015 mit dem Georg von Holtzbrinck Preis ausgezeichnet, das Nachfolgeprojekt Inside Deutsche Bank mit der Silber-Medaille bei den New York TV- und Film-Festivals prämiert. 2012 erschien sein preisgekröntes Buch Der deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand, 2014 Heimatschutz. Der Staat und die Mordserie des NSU (mit Stefan Aust).
DIRK LAABS
BAD BANK
Aufstieg und Fall der Deutschen Bank
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.BildnachweisGetty Images: Vorsatz li. (Bloomberg)Alle anderen Fotos sind dem Archiv des Autors entnommen. © Dirk Laabs.
Copyright © 2018 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Pantheon Verlag München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Karten: Peter Palm, Berlin
Lektorat und Satz: Büro Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-641-18142-0V005www.pantheon-verlag.de
Inhalt
Karte: Die Organisation der Deutschen Bank
Karte: Die Jäger
Prolog
TEIL I – EIN AMERIKANISCHER TRAUM
Willkommen auf der »Titanic«
Schwarze Witwen an der Wall Street
Eine drittklassige Bank
»Only money matters«
Donald J. Trump – ein Kunde nach ihrem Geschmack
Eine Welle aus giftigem Wasser
High Risk Opportunities
Liquidiert die Deutsche Bank!
Die »Merrill-Mafia«
Death of a Salesman
Ein Monster wird erschaffen
TEIL II – AGE OF RISK, AGE OF CRIME
Deckname »Prince«
»Please do not mention our bank’s name«
Die Schuldenmaschine
Lie-bor oder Der Preis des Geldes
V für Victory
»Warum also Gutes tun, wenn Böses tun so einträglich ist?«
OPM – Other People’s Money
»But u don’t sign my bonus right?«
Eine verrückte Wette
Zu viele Schweine-Deals
»Deutsche at it’s best«
»Can’t you see I’m on a losing streak?«
Unter Geiern
»Was ist die IKB?«
Die Rückkehr von Bill Broeksmit
»Kapital ohne Gewissen – wie sicher ist unser Geld, Herr Ackermann?«
Die Mutter aller Krisen
Das Ende des Kapitalismus
Donald J. Trump for President
Die Gnade der Märkte
TEIL III – DEAD BANK WALKING
Überleben
Das Lügner-Paradoxon
The new normal
Ausgerechnet ein Mann mit Prinzipien
Russische Spiegel
Tod eines Risikomanagers
Der härteste Job der Welt für den jüngsten Chef aller Zeiten
»Eine nationale Schande«
Nachwort
ANHANG
Über dieses Buch
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Glossar
Personenregister
Prolog
London, 26. Januar 2014
»Emergency, emergency, your father, your father!« Valentin »Val« Broeksmit presst das Handy an sein Ohr, hört eine Frauenstimme. Er kann die Anruferin nicht zuordnen, mit den Worten nichts anfangen. Sein Vater? Ein Notfall? Schließlich erkennt er den starken Akzent, es ist die Haushälterin seiner Eltern. Val, ein Musiker, der schon länger auf den nächsten Achtungserfolg wartet, ist mit seiner Mutter und seinem Stiefvater zum Brunch in einem Café im Londoner Westen verabredet. Gemeinsam wollen sie Vals 37. Geburtstag nachfeiern. Seine Mutter Alla und William – genannt »Bill« – Broeksmit hatten ihn verpasst, weil die beiden Anfang des Jahres in den Oman gereist waren. Alla war zuvor allein in Indien. Ihr Mann, der US-Amerikaner Broeksmit, Manager bei der Deutschen Bank, hat viel Zeit, seit er vor drei Monaten in Rente gegangen ist – mit gerade 58 Jahren. Über ein Jahrzehnt hatte er bei der Bank gearbeitet und dabei Millionen verdient. Die Broeksmits wollten an diesem Sonntagmorgen auch über Bills neue Freiheit sprechen. Als das Telefon klingelte, schaute sich Val gerade einen Bildband an, Schwarzweißfotos der Beatles, John Lennon nachdenklich neben einem Telefon, eine Originalausgabe. Val überlegte noch, wie er seinen Vater überreden könnte, ihm das teure Buch zu schenken – »ihr habt meinen Geburtstag verpasst, so könnt ihr es wiedergutmachen« –, als ihn die Frauenstimme aus seinen Gedanken riss.
»Dein Vater. Ein Notfall.«
Val Broeksmit hält eines der schwarzen Taxis an, springt auf den Rücksitz, rast nach Chelsea, wo seine Eltern leben. Rote Backsteinhäuser, kleine Gärten, schwarze, gusseiserne Zäune. Die Häuser sehen bescheiden aus, aber nur wenige Londoner können es sich leisten, hier zu wohnen. Als das Taxi am Ziel ankommt, sieht Val Broeksmit eine Ambulanz vor dem Apartmenthaus seiner Eltern. Er rennt über die Straße zum Eingang, die Treppen hoch, in die Wohnung. Im Flur trifft er auf die Haushälterin und vier Sanitäter, die ihre Ausrüstung einpacken. Am Boden sieht er seinen Vater. Er liegt auf dem Rücken, daneben kniet seine Mutter, außer sich.
Val fragt die Haushälterin, die Sanitäter, seine Mutter: »Was ist passiert?«
»Er hat sich umgebracht, dein Vater hat sich umgebracht.«
Was seine Mutter sagt, dringt kaum zu Val durch. Sie war joggen, eine Stunde lang, als Bill sie anrief. Sie sollte noch Kaffee mitbringen und war so länger unterwegs als geplant. Als sie in die Wohnung zurückkam, fand sie Vals Vater im Flur. Er hatte sich mit der Leine seines Hundes an einer Tür erhängt.
Val nimmt die Männer vom Bestattungsunternehmen kaum wahr, als sie sagen, »die Polizei ist auf dem Weg«. Er schreckt hoch, wendet sich an seine Mutter: »Mum, die Polizei kommt, wen kann ich anrufen, einen Anwalt, gibt es irgendjemanden?« Die Mutter reicht ihm ein Telefon: »Ruf Michele an, Michele!« Er findet die Nummer, ruft an und bittet den Mann am anderen Ende, schnell zu kommen.1
Die Polizei trifft schon vorher ein. Ein junger Beamter sondiert die Lage: Ist jemand eingebrochen? Gibt es Abschiedsbriefe? Wer ist alles anwesend? Auf einmal steht ein schlanker, dunkelhaariger Mann im Flur. Val spricht ihn an: »Sind Sie Michele, der Anwalt?« Ja, sagt der Mann, sein Name sei Michele Faissola, aber ein Anwalt, nein, das sei er nicht.
Val hat Faissola noch nie in seinem Leben gesehen. Faissola stellte sich ihm als ehemaliger Kollege seines Vaters bei der Deutschen Bank und Freund vor. Was er nicht weiß: Faissola ist zu diesem Zeitpunkt einer der mächtigsten Strippenzieher bei der Deutschen Bank, zuständig für die weltweite Verwaltung des Vermögens der wichtigsten privaten Kunden. Und er ist umstritten. Er testet immer wieder die Grenzen des Erlaubten aus, was einige Kollegen gegen ihn aufgebracht hat. Gemeinsam mit Bill Broeksmit hatte er in den 1990er Jahren die Investmentbank der »Deutschen« in London aus dem Nichts aufgebaut. Später, als Broeksmit nach einer erster Auszeit zurückgekommen war, hatten sie gemeinsam die Finanzkrise durchgestanden. Ein gemeinsames Jahrzehnt, das nun ein gewaltsames Ende gefunden hat.
Val Broeksmit ist mit den Geschichten aufgewachsen, sein Stiefvater, erst erfolgreich bei Merrill Lynch, dann einem Freund zur Deutschen Bank gefolgt, inzwischen mit einigen Managern in Schlüsselpositionen befreundet, darunter der Vorstandsvorsitzende Anshu Jain. Nach seinem offiziellen Abschied hatte Broeksmit der Bank weiterhin geholfen. Im Auftrag von Jain behielt er als freischaffender Berater eine Tochter der Deutschen Bank in den USA im Blick – die Deutsche Bank Trust Company Americas, kurz DBTCA, einst der ganze Stolz des Managements, weil die DBTCA aus der Wall-Street-Legende Bankers Trust hervorgegangen war, deren Übernahme die Deutsche Bank im Jahr 1999 zum größten Finanzkonzern der Welt gemachte hatte. Fünfzehn Jahre später ist alles anders. Wie große Teile der Deutschen Bank steckt auch die DBTCA in ernsten Schwierigkeiten. Stresstests stehen an, Ermittler haben die Bank im Visier, weil sie Geld gewaschen haben soll, selbst das FBI interessiert sich für die Geschäfte der DBTCA, die unter anderem Kredite an windige Unternehmer wie Donald J. Trump vergeben hat.
Bevor er die Hundeleine nahm, hatte der Risikomanager Broeksmit einen Teil der Wohnung in Chelsea sorgsam hergerichtet. Als seine Frau ihn fand, lagen Dokumente zu seinen Füßen – interne Unterlagen der DBTCA aus New York. In dem Hundekorb stellte der Polizist mehrere Abschiedsbriefe sicher, deren Handschrift Val identifizierte. Flüchtig geschriebene Zeilen seines Vaters an seine Ehefrau, seine beiden Töchter und an Val: »Du bist ein warmherziger, cleverer junger Mann (…). Du hast dem Namen, den ich Dir gegeben habe und nun entehre, selber Ehre gemacht.« Auch ein Abschiedsbrief an seinen Chef und Freund, Anshu Jain, lag in dem Korb. »Anshu«, hatte Broeksmit geschrieben, »es tut mir leid, dass ich Dich enttäuscht und meine dunkle Natur vor Dir geheim gehalten habe.«
Doch es war nicht zuletzt die Bank selber, die ihre dunkle Natur vor der Welt geheim halten musste. Sie hatte Kunden, Konkurrenz und Kritikern jahrelang vorgemacht, dass man das Geschäft entschlüsselt habe. Die Risiken seien zwar gigantisch, aber kalkulierbar, so das Versprechen – einfach weil man die Deutsche Bank war und damit besser, professioneller, cleverer, größer. Man könne fast beliebig Gewinne machen. Doch die vermeintlich todsicheren Geschäfte waren zumeist nichts weiter als eine Schimäre, ein Trick. Und kaum jemand wusste das besser als Bill Broeksmit.
TEIL I EIN AMERIKANISCHER TRAUM
OK. If I am being honest with you then yes, let’s whisper it, but the truth of the matter is that all of us are overpaid. There is nothing magical about what we do. Anybody can do it.
ALLEN WHEATInvestmentbank-Legende
Willkommen auf der »Titanic«
Es ist der 3. Oktober 2001 in New York. Der Chef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, besucht am Tag der Deutschen Einheit die Börse an der Wall Street. Gemeinsam mit dem New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani eröffnet er den Handel. Es ist ein großer Tag für die Deutsche Bank: Erstmals werden die Aktien des Konzern auch in den USA gehandelt. Einer der Banker aus Deutschland trägt zur Feier des Tages unter seinem Sakko eine Weste in den Farben der US-Flagge. Als Giuliani und die Banker aus Deutschland auf der Galerie oberhalb des Börsenparketts stehen, sind vor ihnen Baseballmützen aufgereiht, darauf die Logos der New Yorker Polizei, der Feuerwehr und anderer Rettungsdienste.
In der Stadt und an der Wall Street interessiert man sich kaum für den Besuch aus Deutschland. New York steht unter Schock. Nur wenige Hundert Meter weiter westlich bergen Räumungsmannschaften noch immer Leichen aus den Trümmern des World Trade Center. Drei Wochen zuvor, am 11. September, hatten islamistische Terroristen vier Jets entführt – zwei der Flugzeuge steuerten sie in die Twin Towers. Die Selbstmordpiloten hatten zuvor lange in Hamburg gelebt und studiert. In Afghanistan schlossen sie sich al-Qaida an, reisten später in die USA, um sich dort zu Piloten ausbilden zulassen. In großen Teilen finanzierten sie sich dabei durch ein Stipendium, das einer der späteren Täter als Militärangehöriger der Armee der Vereinigten Arabischen Emirate erhielt. Um die gewaltige Zerstörung anzurichten und Tausende von Menschen zu ermorden, hatten die Terroristen nicht viel Geld gebraucht.
Breuer will mit seinem Auftritt in New York demonstrieren, dass seine Bank sich durch die Terroranschläge nicht aufhalten lässt, dass man weiter international expandieren wird. Die Führung der Deutschen Bank hatte gehofft, dass der US-Börsengang als Höhepunkt der Expansionsstrategie Aufmerksamkeit erregen werde, die den Konzern so viel Geld gekostet hatte. Man will endlich auch als Wall-Street-Bank wahrgenommen werden, auf Augenhöhe mit den US-Instituten agieren. Unter Investmentbankern ist es üblich, dass sie sich selbst sogenannte Grabplatten verleihen, Plaketten, die große Deals feiern, einen Börsengang etwa, eine Fusion oder einen gewaltigen neuen Kredit. Die führende Bank bei dem Deal wird traditionell auf der Plakette in erhabenen Lettern gedruckt, so dass die Schrift hervorsteht – to bulge im Englischen. Deshalb heißen die großen US-Investmentbanken, die bei fast jedem Deal oben stehen, Bulge Bracket. Dazu gehören J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Merrill Lynch. Mit dem Börsengang wollte die Deutsche Bank vor allem symbolisieren, dass man in die Phalanx dieser US-Banken eingebrochen war, dass man endlich auch zum Bulge Bracket gehörte. Doch dann kam der 11. September.
Vier Jahre zuvor, 1997, war Rolf Breuer Vorstandssprecher der Deutschen Bank geworden und hatte die gescheiterte internationale Strategie seines Vorgängers Hilmar Kopper geerbt. Kopper hatte vergeblich versucht, mit der Deutschen Bank an die Weltspitze zu gelangen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte er Scharen von Investmentbankern angeworben. Die meisten der neuen Mitarbeiter stammten aus England und den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es führende Manager der Deutschen Bank lange zusammengeschweißt, dass sie fast alle an der Ost- oder Westfront gekämpft hatten. Kopper und Breuer hatten den Krieg ebenfalls noch miterlebt, wenn auch als Kinder. Kopper hatte vor der Roten Armee fliehen müssen, Breuer hatte in Bonn die Bombardierungen durch die Westalliierten erlebt. Die neuen Banker waren dagegen oft keine vierzig Jahre alt, manche erst Ende zwanzig, blutjung. Trotzdem verdienten einige auf Anhieb fast so viel wie die Vorstandssprecher.
Unter den jungen Talenten, die man Mitte der 1990er Jahre anwarb, war auch der 41-jährige Amerikaner Bill Broeksmit, ein Spezialist für die sogenannten Derivate, ein neues Finanzinstrument, das gerade das Bankengeschäft durcheinanderwirbelte. Broeksmit war ein Aufsteiger. Er stammte aus einer Familie ohne großes Vermögen und ohne Einfluss in der New Yorker Finanzszene. Er hatte niemanden, der seine Karriere mit Tipps oder Beziehungen befördern konnte. Im Zweiten Weltkrieg hatte Broeksmits Vater John auf einem Zerstörer der US-Marine gedient und deutsche U-Boote gejagt. Danach arbeitete er in einem Versandhaus, verabschiedete sich aber bald wieder aus der Welt der Waren, studierte Theologie und wurde schließlich Pfarrer in einer kleinen Gemeinde in Illinois. Obwohl Bill fünf Geschwister hatte, die alle versorgt werden mussten, finanzierte John seinem Sohn Bill eine teure Ausbildung. Zunächst kam er auf eine Privatschule, anschließend auf ein College in Kalifornien. Es waren die wilden 1970er Jahre. Broeksmit ließ sich trotzdem nicht allzu sehr ablenken. Er machte seinen Abschluss, kehrte nach Illinois zurück und studierte Management auf der renommierten North-Western University. 1982 bekam er seinen ersten festen Job bei einer Bank und sollte dort – wie noch viele Male in seinem Leben – in die tiefen Abgründe der Finanzindustrie blicken. Er war gerade 27 Jahre alt.
Broeksmits ersten Arbeitgeber – die Continental Illinois National Bank and Trust Company (CINB) – gibt es nicht mehr. Die Bank ist heute fast vergessen, war aber damals eine der größten der Welt, obwohl sie nicht in New York, sondern in Chicago ihren Stammsitz hatte. Sie residierte im Chicagoer Bankenviertel »La Salle Canyon« in einem eindrucksvollen Gebäude, dessen mächtiges Portal über mehrere Geschosse aufragte. Auf die Continental Illinois, 1910 gegründet, geht ein Satz zurück, der ebenfalls die Karriere von Broeksmit prägen sollte: Die Bank war too big to fail – zu groß zum Scheitern. Tatsächlich, bemerkte ein Beobachter, traf der Satz den Kern des Problems nicht. Die Bank war nicht zu groß zum Scheitern, sondern in Wahrheit äußerst spektakulär kollabiert, weil sie sich auf riskante und komplizierte globale Geschäfte eingelassen hatte. Sie war deshalb too big to liquidate – zu groß, um liquidiert zu werden, zu groß also, um sie einfach vom Markt verschwinden zu lassen, ehe man Vorkehrungen getroffen und sich um die anderen Banken gekümmert hatte, die mit der Continental eng verwoben waren.2
Als Broeksmit im Sommer 1982 als junger Händler bei der Bank begann, steckte die Continental Illinois bereits in ernsten Schwierigkeiten. Bis dahin war sie von Analysten, der Presse und den Anlegern gefeiert worden, da sie sich über die Jahre durch eine besonders aggressive Strategie an die Spitze geboxt hatte. Der Aufstieg der Continental Illinois und ihr tiefer Fall sollten das Geschäftsgebaren vorwegnehmen, mit dem viele Banken mehr als zwanzig Jahre später die Finanzkrise auslösten. Und Broeksmit sollte das erste, aber nicht das letzte Mal lernen: Es ist alles schon einmal da gewesen. Der legendäre Börsenmakler Jesse Livermore, der sein riesiges Vermögen ausgerechnet in der Zeit der Großen Depression an der Wall Street gemacht hatte, prägte den Satz: »Es gibt nichts Neues an der Wall Street. Es kann auch gar nichts Neues geben, der Mensch spekuliert, seit es Hügel auf dieser Welt gibt. Was auch immer am Aktienmarkt passiert, ist schon einmal passiert und wird wieder passieren.«
Krisen gehören also zum Bankgeschäft wie Unfälle zum Autorennen. Man muss sie verdrängen und weiter Gas geben, als sei nichts geschehen. Und dennoch war der Kollaps der Continental Illinois etwas Besonderes. Grenzen wurden verschoben und Gesetze gebrochen.
Die Continental war in den 1970er Jahren an den Rand gedrängt worden, ihr Standort Chicago erwies sich als großer Nachteil, die Musik spielte anderswo, und dort hatte sich das Geschäft dramatisch verändert. Am 1. Mai 1975 war in der Wall Street die Revolution ausgerufen worden, ausgerechnet am Mayday, dem Tag der Arbeit. Die Börse hatte die fixed incomes abgeschafft, was in diesem Fall bedeutete, dass die Brokerfirmen ihre Marge fortan selber aushandeln durften – und mussten. Viele Händler hatten sich lange gegen die radikale Reform gewehrt. Dank der abgesprochenen Preise – im Schnitt 80 Cent für jede verkaufte Aktie – war ihr Job überaus lukrativ, wenn auch nicht sehr interessant. Doch es gab erste Gerichtsurteile, die andeuteten, dass man die Gepflogenheiten an der New Yorker Börse als kartellartige Absprachen einordnen könnte. Also handelte die Börse lieber selber und schaffte die Preisabsprachen ab.
Dass die Abschaffung der fixed incomes am Mayday sich derart drastisch auswirken würde, hatte niemand erwartet. Die Welt der Börsianer wurde auf den Kopf gestellt. Die Kommissionen und Preise verfielen, die Betroffenen mussten sich schnell neue Produkte ausdenken, sie brauchten dringend neue Felder, auf denen Geld zu verdienen war. Selbst große Firmen verschwanden, denn man brauchte enorm viel Kapital, um weiter Erfolg zu haben. Das alles passierte zu einer Zeit, als New York am Ende zu sein schien, die Stadt vor dem Bankrott stand. Kein Geld bedeutete: kein Glamour, keine Zukunft.
Auch Banken wie die Continental mussten kämpfen, um nicht unterzugehen oder geschluckt zu werden. Das Management entschied sich daher Ende der 1970er Jahre, voll auf Risiko zu setzen. Und so wurde in nur fünf Jahren aus einer verschlafenen, regionalen Bank mit Stammsitz in Chicago einer der größten Kreditgeber in den USA. Die Continental verdreifachte in dieser kurzen Zeit die Summe des verliehenen Geldes, ihre Bilanzsumme verdoppelte sich. Auf den ersten Blick schien sie dabei solide vorzugehen. 15 Prozent des eingesetzten Kapitals konnte sie als Gewinn verbuchen (der sogenannte Return On Investment). Das Institut war als Anlageobjekt beliebt, da es besser als die Konkurrenz abschnitt. Der Aktienkurs schoss in die Höhe. Doch eine Kennzahl – die Loans to Assets Ratio – wurde ebenfalls immer größer, und das war verräterisch: Das Unternehmen hatte rechnerisch 70 Prozent des eigenen Vermögens verliehen.3 Keine große Bank in den USA ging ein derart hohes Risiko ein. Die Zahlen ließen darauf schließen, dass die Bank besonders riskante Kredite vergeben hatte, um möglichst schnell zu wachsen. Kunden erzählten sich, dass die Konditionen ausgesprochen günstig seien und man auf der Suche nach einem Kredit das Angebot der Continental kaum ablehnen könne. Ein Konkurrent sagte einer Zeitung: »Wir hören immer wieder, dass die Continental fast alles macht, um einen Deal abzuschließen.«
Einer dieser riskanten Deals platzte, als Bill Broeksmit in die Bank eintrat. Die Continental hatte nicht nur selber Kredite vergeben, sondern auch die Kredite anderer, meist kleinerer Banken aufgekauft. Darunter waren Kredite in Höhe von fast einer Milliarde Dollar an eine Firma, die mit hochspekulativen Öl- und Gasgeschäften Geld verdienen wollte. Als daraus nichts wurde, ging die Firma pleite. Die Papiere waren nichts mehr wert, standen aber noch als »faule« Kredite in den Büchern der Continental. Die Frage drängte sich auf: Mit wem hatte die Bank aus Chicago Geschäfte gemacht? Wie viele »faule« Kredite hatte sie noch in den Büchern? Die Bank geriet in einen Abwärtsstrudel. Weitere Großkunden gingen bankrott. Und dann stellte sich heraus, dass Mexiko, das sich von der Continental und anderen US-Banken viel Geld geliehen hatte, überschuldet war und die Kredite nicht mehr bedienen konnte.
Sobald der Markt – andere Banken, Investoren, Fonds – wittert, dass ein Teilnehmer in Schwierigkeiten steckt, versuchen alle mit der Krise des Konkurrenten Geld zu verdienen. Die Continental, die bis 1982 als Top-Adresse galt, musste plötzliche höhere Zinsen als andere Banken zahlen, wenn sie Geld leihen wollte. Um liquide zu bleiben, setzte das Management auf Kredite mit extrem kurzer Laufzeit. Jeden Tag musste sie acht Milliarden Dollar an sogenannten overnight loans auf dem Markt besorgen, Kredite, die nur wenige Stunden laufen und daher sehr billig sind. Wenn eine Bank sich derartig viele kurzfristige Kredite besorgen muss, dann hat sie meist etwas zu verbergen. Schließlich lieh sich die Continental Geld von ausländischen Banken – zu hohen Zinssätzen. Die Konkurrenz konnte die Angst förmlich riechen. Ein Mitarbeiter des angeschlagenen Unternehmens sagte einer Zeitung: »Der einzige Unterschied zwischen der Continental und der Titanic? Die Titanic hatte ein Orchester.«
Im Mai 1984 kam das Aus für die Chicagoer Bank. Zu diesem Zeitpunkt hatte Broeksmit seinen Job dort noch keine zwei Jahre. Am Ende reichte ein Gerücht: Eine japanische Nachrichtenagentur hatte eine Meldung aus den USA aufgegriffen und berichtet, die Continental stehe vor einer Übernahme und werde von den Regulatoren genau überprüft. Der Bericht basierte, wie sich herausstellte, auf einem Übersetzungsfehler, dennoch war die Wirkung fatal. Über Nacht zogen japanische Finanzkonzerne zwei Milliarden Dollar von der Continental ab. Das Institut musste sich Geld von der US-Bundesbank leihen, schließlich sprangen andere US-Banken ein, stützten den Konkurrenten. Doch die Maßnahmen verpufften. Die Continental war am Ende. Die Bankenaufsicht fürchtete, dass das gesamte System in den Abgrund gerissen werden könnte. 2300 andere Banken hatten Geld in die Continental investiert, 200 davon über die Hälfte ihres Kapitals, bei manchen waren es sogar 100 Prozent.
Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), der Einlagensicherungsfonds, trat auf den Plan. Diese US-Behörde hatte man nach der großen Weltwirtschaftskrise 1933 gegründet, um das Vertrauen in die Banken wieder zu stärken. Die Leitung der FDIC entschloss sich zu einem drastischen Schritt: Der Fonds übernahm 80 Prozent der Continental, verstaatlichte die Bank damit de facto und garantierte so, dass die Einlagen sicher waren und mit dem Institut verknüpfte Geldhäuser nicht ebenfalls Bankrott anmelden mussten, denn die Einlagen bei der Continental waren nur bis zu 100000 Dollar versichert. Damit setzte sich die FDIC über geltendes Recht hinweg.
Der Staat bürgte für die Verluste und befreite die anderen Banken, die sich offensichtlich mit der Continental den völlig falschen Geschäftspartner ausgesucht hatten, auf diese Weise aus einer ernsten Klemme. Damit griff er massiv in den Markt ein. Aber der gerade amtierende US-Präsident Ronald Reagan galt als ein unerschütterlicher Anhänger der Marktwirtschaft. Er sprach gern von der »Magie des Marktes« und vertrat die Ansicht, dass der Markt alles regele, für faire Preise sorge und Unternehmen bestrafe, die zu teuer, zu billig oder zu unrentabel arbeiteten. Die Magie des Marktes hatte bei der Continental offenbar versagt. Die FDIC und die Bankenaufsicht suchten mit ihrem Eingreifen zu verhindern, dass Zweifel an anderen, sehr viel größeren Banken aufkamen – der Citibank zum Beispiel, die ähnlich riskante und schlecht versicherte Kreditpapiere hielt. Die Frage war allerdings, ob mit dem Eingriff nicht eine gefährliche Ausnahme von der Regel geschaffen worden war.
Ein Schlagwort machte die Runde: bank bail-out. Auf einer Pressekonferenz fragte ein Reporter: »Mr. President, nach dem ›Bail-out‹ der Continental Illinois Bank machen sich einige Experten Sorgen, dass Ihre Regierung noch weitere Banken retten muss, weil man sie – wie öffentliche Versorger – nicht kollabieren lassen darf.« Reagan antwortete: »Nein, also diese bestimmte Bank wurde ja von dem Bankensystem selber gerettet.«4 Das stimmte nicht, die FDIC hatte ja gerade massiv in das System eingegriffen. Dann fügte Reagan noch etwas an, was wie eine Blaupause für die Finanzkrise zwanzig Jahre später wirkt: Nur die Kontoinhaber, so der Präsident, seien geschützt worden, die Aktionäre dagegen hätten ihr Engagement mit dem Kursverfall der Aktie bezahlt. Damit lenkte er vom eigentlichen Zweck der Bankenrettung ab: Es war der FDIC nicht um die kleinen Sparer gegangen, die wären sowieso entschädigt worden, sondern vor allem um die anderen Banken und damit um das System an sich. Zur Bekräftigung erklärte der Präsident noch: »Ich kann nicht erkennen, dass das eine Bedrohung für das ganze Bankensystem ist. Es geht um eine Bank, und die braucht ein wenig Hilfe.«5
Ein Abgeordneter, der Republikaner Stewart McKinney, erklärte hinterher bei einer Debatte im Kongress ganz unverblümt, was da gerade geschehen war: »Lassen Sie uns nicht drum herumreden. Wir haben eine neue Art von Banken geschaffen. Sie heißt ›too big to fail‹ – TBTF –, und es ist eine ganz wunderbare Bank.« Tatsächlich wurde die Continental von der US-Regierung über Jahre in einer Art künstlichem Koma gehalten. Am Ende wurden die Reste der Bank verkauft, ihr Name verschwand. Für über zwanzig Jahre – bis zur weltweiten Finanzkrise – sollte der Kollaps der Continental der am schwersten wiegende Kollaps einer Bank in den USA bleiben.
Welch ein Start für Bill Broeksmit ins Berufsleben.
Erst später gaben Bankenaufseher zu, dass man sich schon Jahre vor der Eskalation große Sorgen um die Continental gemacht hatte – die Risiken, die die Bank einging, waren augenscheinlich außergewöhnlich hoch. Doch man wollte den Aufschwung nicht abwürgen, setzte auf die Bank als innovativen Wachstumsmotor und verließ sich auf die internen Kontrollen der Bank. Die waren allerdings äußerst fehlerhaft und schlicht zu lasch. Jahre später kam bei einem Prozess in Chicago heraus, dass der Vizepräsident der Bank bestechlich war. Er hatte von einem Kunden – einer Bank, die sich im Erdölgeschäft verspekuliert hatte – Kickbacks erhalten, insgesamt 585000 US-Dollar. Im Gegenzug kaufte ihm die Continental die riskanten Kredite ab. Der Vizepräsident der Continental musste dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, und Broeksmit wie seine Kollegen lernten bereits 1984: Eine einzige Bank, geführt von kriminellen Bankern, kann das ganze System in den Abgrund ziehen. Ein erschreckendes Bedrohungspotenzial und zugleich – wie es schien – eine ultimative Absicherung für die Bank. Es hatte sich ja gezeigt, dass der Staat dem Totalabsturz einer Bank nicht tatenlos zusehen konnte, wenn sie so groß und so vernetzt war, dass ihr Bankrott andere Banken gefährdete. Dann rettete er lieber die Bank, ihre Einlagen und das System – auch wenn der Staat dabei seine eigenen Gesetze brechen musste.
Als die Continental zahlungsunfähig wurde, weil sie mit extrem viel geborgtem Kapital operiert hatte, mussten sich kleine, solide, konservative Banken fragen, ob es nicht zu gefährlich sei, mit derartig risikofreudigen Partnern überhaupt Geschäfte zu machen. Diese Frage hatte die US-Regierung klar und eindeutig beantwortet: Da besteht kein Risiko. Wenn etwas schiefgeht, bekommt man den Einsatz zurück. Es wurden zudem keine Gesetze zur strengeren Kontrolle großer, vielfach vernetzter Banken erlassen. Man ließ der Entwicklung einfach ihren Lauf. Nach dem Sündenfall der Continental vertraute der Staat darauf, dass sich die großen Banken in Zukunft ihrer Verantwortung bewusst sein würden. Die US-Regierung hatte sich mit ihrem Eingreifen im Fall der Continental zur Geisel der großen Banken gemacht. Die Banken und viele ihrer Kunden hatten das Signal verstanden: Man konnte unbedenklich immer größere Risiken eingehen.
Existenzielle Krisen kannte die Deutsche Bank lange nicht. Bis in die 1980er Jahre hinein galt sie als unangreifbar, als ein Solitär, mächtig, angsteinflößend. Die Deutsche Bank war die Spinne im Netz der Deutschland AG, hielt Beteiligungen an allen wichtigen Industrieunternehmen der Republik und übte dadurch einen gewaltigen wirtschaftlichen und politischen Einfluss aus. Das Magazin Der Spiegel erstarrte fast in Ehrfurcht vor der »Weltmacht Deutsche Bank«, wie 1985 eine Titelgeschichte überschrieben war. »Machtbewusst wie die Renaissancefürsten bauten die Manager der Deutschen Bank ihr Institut zum alles überragenden Geldhaus der Nation aus. Leise, konsequent, nur durch sich selber kontrolliert, knüpfte die 1870 gegründete Bank ein Netzwerk von Geld, Geist und Gesinnung, gegen das in Deutschland nichts mehr läuft (…). Ein Verfassungsorgan des Geldwesens, von keinem kontrolliert, doch alles kontrollierend«, sei herangewachsen, »ein aufgeklärter Feudalstaat inmitten einer sozialen Massendemokratie«. Das Magazin zitierte einen »notorischen Hauptversammlungsnörgler«, und selbst der konnte kein Haar in der Suppe finden: »Die Deutsche Bank ist wohl die beste Bank der Welt.« Der Konzern hatte damals gerade seine neue Zentrale in Frankfurt eingeweiht – die Zwillingstürme – und überragte nicht nur die Konkurrenz in der Stadt, sondern alle anderen Banken im Land.
Vor seinem Tod erzählte der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler die Geschichte von Lothar Späth. Der baden-württembergische Ministerpräsident wollte im September 1989 den politisch geschwächten Helmut Kohl auf einem Parteitag als CDU-Vorsitzenden stürzen. Geißler sagte in einem Interview: »Er ist zur Deutschen Bank, ich will nicht sagen: zitiert worden, aber jedenfalls war er dort. Die Banker haben ihm gesagt: Kohl soll bleiben.« Späth hat seine Kandidatur dann zurückgezogen. Nachfrage der Interviewer: »Die Deutsche Bank hat also dafür gesorgt, dass Kohl weiter an der Macht blieb?« Darauf Geißler: »Das kann man so sagen.«6
Die Deutsche Bank bestimmt, wer Kanzler bleibt und wer es nicht wird. Eine Bank – wie es scheint – auf dem Gipfel der Macht. International stand die Bank in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre jedoch unter großem Druck. In dieser Zeit wurde sie von Alfred Herrhausen geführt. Der gebürtige Essener hatte eine NS-Ausleseschule in Bayern besucht und nach dem Krieg Karriere als Manager bei Energiekonzernen gemacht, bevor er zur Deutschen Bank geholt wurde. Das brachte ihm dort den Spitznamen »der Elektriker« ein. Herrhausen sagte 1985: »Natürlich haben wir Macht, aber nur im Sinne von Einflussmöglichkeit, nicht im Sinne von Beherrschung. Denn beherrschen können wir nichts.« Das wurde als Understatement abgetan, traf aber den Kern. Denn das Geschäft hatte sich inzwischen nicht nur in den USA, sondern auch in Europa fast über Nacht von Grund auf verändert. Vor allem die City of London, das Zentrum der britischen Finanzindustrie, war kurz vor Ende des Kalten Krieges immer mächtiger geworden. Die angelsächsischen Banken verdienten sehr viel mehr Geld als die Konkurrenz aus Deutschland. Sie fusionierten, verschmolzen, wurden immer größer – und das war die eigentliche Bedrohung.
Ein Urknall hatte diesen Prozess ausgelöst: der Big Bang vom 27. Oktober 1986. Er hatte eine noch stärkere Wirkung als der Mayday in New York. Bis zu diesem Tag durften ausländische Firmen nicht an der Londoner Börse handeln oder Anteile an britischen Firmen halten. Zudem durften die Berater nicht selber Aktien kaufen oder verkaufen, und die Brokerfirmen mussten sich bei der Honorierung ihrer Dienstleistungen an feste Gebühren halten. Diese Regeln schaffte die Regierung unter Margaret Thatcher ab. Berater durften nun selber mit Aktien handeln und an diesem Handel mitverdienen. Das Entscheidende aber war, dass nun ausländische Banken in London richtig mitmischen konnten. Bang! Bang! Bang!
Zusätzliche Kraft entfesselte der Urknall, weil die Londoner Börse an diesem Tag den Digitalhandel mit Aktien aufnahm. Zunächst bewältigten die Computer den Andrang nicht, doch nach kurzer Zeit hatte man die Technik im Griff. Nun konnten Geschäfte in bis dahin nicht gekannter Höhe abgewickelt werden. Der Umsatz der Börse explodierte, das Handelsvolumen stieg von 4,5 auf 7,4 Milliarden Britische Pfund – innerhalb einer Woche. Seit damals hat sich der Gesamtumsatz bis 2017 um den Faktor 45 vergrößert. 1986 begann also eine Revolution.
Mit diesem Ergebnis hatten Premierministerin Thatcher und ihre Minister nicht gerechnet. Sie hatten die Maßnahmen eigentlich nur eingeleitet, weil die – staatliche – Londoner Börse unter großem Druck stand. Schwere Korruptionsvorwürfe waren laut geworden, eine Kommission hatte bereits Reformen angemahnt. Dem war die Regierung zuvorgekommen, indem sie die Börse kurzerhand privatisierte und ganz nebenbei den Markt zu mehr Wettbewerb antrieb. Doch die Revolution fraß ihre Kinder. Die City of London verringerte zwar den Abstand zum führenden Finanzplatz New York, aber im Gegenzug kauften US-amerikanische Firmen – später auch europäische und japanische Unternehmen – die Konkurrenz in England einfach auf. Von 300 großen Handelsfirmen in London waren nach einem Jahr 75 in ausländischem Besitz. Am Ende verschwanden 19 der 20 größten Broker als eigenständige Unternehmen. Immer mehr Firmen mit großer Tradition, aber kleiner Bilanzsumme wurden von internationalen Banken geschluckt. Auch die Gepflogenheiten in der City änderten sich nun endgültig. Die Londoner Finanzbranche war in den 1970er Jahren für einen einmaligen Tagesablauf berühmt: 10 Uhr Arbeitsbeginn, ab 12 Uhr zwei Stunden Lunch inklusive einiger Drinks, Arbeitsende um 16 Uhr. Das war nun für immer vorbei.
Die Deutsche Bank schaute drei Jahre lang zu, wie sich die Revolution entfaltete. Noch verdiente sie in Deutschland, ohne sich groß anstrengen zu müssen, gutes Geld und galt im Heimatland als unantastbare Weltmacht. Die Bank war damals, so sagt es der Bankexperte Professor Reinhard H. Schmidt, »ziemlich behäbig, sehr selbstgefällig, sehr selbstzufrieden«. Aber Herrhausen ahnte, dass sich das Geschäft durch den Big Bang radikal ändern würde und die Bank daher modernisiert und internationalisiert werden musste. Einerseits forderte er einen Schuldenerlass für die Länder der Dritten Welt, andererseits hatte er gleichzeitig begonnen, Investmentbanker im eigenen Haus ausbilden zu lassen. Zwar konnte die Deutsche Bank eine große Bilanzsumme vorweisen, aber sie hatte so gut wie keine Kenntnisse von dem gerade entfesselten Investmentbankgeschäft, also ging es mit der internen Ausbildung der Talente nicht schnell genug voran. Alfred Herrhausen verlor die Geduld und suchte mit dem damaligen Vorstandsmitglied Hilmar Kopper im Ausland nach Banken, die man übernehmen könnte. Das sollte die Strategie für die nächsten Jahre werden. Was man nicht hatte, kaufte man teuer, oft zu teuer ein. Herrhausen und seine Berater fanden schließlich eine Investmentbank, die ihnen zusagte. Es handelte sich um die – zumindest auf den ersten Blick – altehrwürdige Institution Morgan Grenfell. Das Bankhaus war 1838 gegründet worden und residierte in einer kleinen Seitenstraße der Great Winchester Street in London, etwas abseits vom Herzen der City of London. Man beschloss, das Unternehmen zu kaufen.
Morgan Grenfell war allerdings nicht so solide, wie man aufgrund der langen Unternehmensgeschichte hätte annehmen können. Die Bank war in einen ernsten Skandal verwickelt: Sie hatte dabei geholfen, die Aktien der Brauerei Guinness durch verschleierte Aufkäufe zu verteuern. Guinness wollt einen Konkurrenten übernehmen und dies durch einen Aktientausch finanzieren. Mit dem künstlich hochgetriebenen Preis der eigenen Aktie wollte man attraktiver wirken und einen Mitbewerber ausstechen. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Die britische Regierung und neue Institutionen wie das Serious Fraud Office (SFO) griffen durch, auch um zu zeigen, dass man in London nach dem Big Bang rigoros gegen Wirtschaftskriminalität vorging. Morgan Grenfell brauchte eine neue Führung und blieb geschwächt zurück. Trotzdem zahlte die Deutsche Bank 2,7 Milliarden Mark für die Bank – damals ein gewaltiger Preis.
Am 27. November 1989 reiste Herrhausen nach London, besiegelte die Übernahme der Bank, lächelte in die Kameras. Er trug einen grauen Maßanzug und sah nicht weniger geschmeidig aus als die britischen Banker, deren Boss er nun war. Die Deutsche Bank spielte jetzt mit, gehörte dazu, so schien es. Doch beim großen Rest der Bank, zu Hause in Deutschland, in der Zentrale in Frankfurt und in den traditionell mächtigen regionalen Stützpunkten löste der Schritt einen Kulturschock aus. Einer der vielen Direktoren der Deutschen Bank, der Herrhausen nach London begleitete, fragte vor den neuen britischen Kollegen, welche Sprache denn von jetzt an in der Bank gesprochen werden würde. Herrhausen erwiderte, wer nicht Englisch spreche, habe in seiner Bank keine Zukunft. Markige Worte.
Doch die Beharrungskräfte in seiner Bank, der Deutschen Bank, waren enorm. Schon zwei Tage später musste Herrhausen auf einer Vorstandssitzung eine bittere Niederlage einstecken. Er wollte die damals noch sehr einflussreichen Regionalfürsten der Bank schwächen, sie zwingen, einen Teil ihrer Macht an die Zentrale abzugeben, und eine entsprechende Organisationsreform durchsetzen. Doch er scheiterte mit seinem Vorstoß. Große Teile der Bank wollten sich nicht ändern, das hatte die Vorstandssitzung deutlich gemacht. Am Abend war er deprimiert, zermürbt offenbarte er einem Weggefährten, dass er im Januar zurücktreten wolle. Dazu kam es nicht. Am nächsten Morgen zerriss eine ferngesteuerte Bombe Herrhausens Dienstmercedes. Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank starb noch am Tatort. Die Rote Armee Fraktion bekannte sich zu dem Anschlag.
Nur drei Tage nach Alfred Herrhausens Tod unterschrieb Hilmar Kopper als kommissarischer Chef der Deutschen Bank den Kaufvertrag für Morgan Grenfell. In das neue Geschäft, in das man sich so teuer eingekauft hatte, wollte er sich allerdings nicht einmischen. Die Bank Morgan Grenfell blieb größtenteils selbständig, als wollte die Frankfurter Zentrale bewusst Abstand zu der neuen Zeit wahren und sich nicht zu vielen neuen Einflüssen aussetzen.
Der Plan war, dass die britischen Investmentbanker, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzten, den Deutschen behutsam beibrachten, wie die Angelsachsen seit dem Mayday und dem Big Bang ihren fetten Profit machten, kurz, was sie dachten, planten und wie sie an das Geld der Kunden herankamen. Man hoffte auf einen allmählichen, umfangreichen Know-how-Transfer. Aber die britischen Banker von Morgan Grenfell dachten gar nicht daran, den Deutschen zu helfen. Sie wurden zwar fürstlich bezahlt, verdienten mehr als die meisten Mitglieder der Führungsetagen der Bank in Deutschland, behielten ihr Eigenleben aber bei und ihr Wissen für sich. Die Besucher aus Frankfurt ließ man auflaufen. Mancher fühlte sich behandelt wie ein Praktikant und nicht wie ein ebenbürtiger Partner. Die neuen Kollegen wollten sich in London offenbar nicht beim Geldverdienen stören lassen.
In der City of London hatten sich die Gepflogenheiten innerhalb weniger Jahre radikal verändert. Den Kunden zu kennen, ihn gut zu beraten, damit er wiederkommt mit seinem Geld, das war dort über Jahrhunderte der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Das Motto der Londoner Börse lautet dictum meum pactum – mein Wort ist meine Verpflichtung. Doch der Urknall hatte diese kulturelle Tradition ausradiert. London passte sich dem US-amerikanischen System an, ohne zu begreifen, wie die Financial Times später schrieb, was dieser Schritt am Ende bedeutete: »Es wurde Wertpapierhandelsunternehmen erlaubt, sowohl auf eigene Kosten als auch für den Kunden Wertpapiere zu handeln – ein schwerwiegender Interessenkonflikt.«
Der Big Bang zog gerade deshalb nicht nur die größten Talente und schlausten Köpfe an, sondern auch Kandidaten, die einfach nur schnell reich werden wollten. Mit dieser Hoffnung waren sie nicht allein. Die extreme Konkurrenzsituation setzte zerstörerische Kräfte frei, ein egoistischer Exzess war die Folge. Viele in der neuen Generation der Banker dachten, sie seien die neuen Götter in der City – schlauer als der Rest, hungriger und jünger.
Die alte Generation musste nur noch hinweggefegt werden.
Schwarze Witwen an der Wall Street
Nachdem die Continental Illinois verstaatlicht worden war, verließ Bill Broeksmit Chicago und zog nach New York, um dort an der Wall Street zu arbeiten. Noch war er nicht vermögend. Er wohnte mit seiner Frau Alla, die aus Weißrussland stammte, dem Stiefsohn Valentin und zwei kleinen Töchtern in einem bescheidenen Apartment. Sehr bald sollte es jedoch aufwärtsgehen. Broeksmit bekam einen Job bei Merrill Lynch. Die US-Bank galt als etwas dröger, unflexibler Gigant am Markt. Doch in den 1980er Jahren versuchte das Institut im Investmentbankgeschäft Boden gutzumachen und ein stolzes Mitglied des Bulge Bracket zu werden. Es war fast so, als durchlebte Broeksmit im Laufe seiner Karriere Zeitschleifen, denn Merrill war wie die Deutsche Bank zu spät dran.
Mitte der 1980er Jahre, fast ein Jahrzehnt nach dem Mayday in New York, hatte sich die Wall Street erholt. Nicht allen, aber vielen Bürgern der Stadt ging es besser. Glamour und Geld waren zurück. Die Investmentbanken hatten sich an die neuen Bedingungen angepasst und verdienten mehr Geld als jemals zuvor, sofern sie groß genug waren. Wer verstand, wie der neue Markt funktionierte, konnte mit einer Investmentbank oder Brokerfirma auf viele Arten zu Geld kommen. Akteure wie Salomon, Morgan, Goldman handelten inzwischen verstärkt auf eigene Rechnung mit Aktien. Sie nutzten ihr Know-how – welcher Titel hat Potenzial, welches Unternehmen wird wachsen? –, um selber Kasse zu machen und nicht nur ihre Kunden – nach Möglichkeit – immer reicher zu machen. Seit die Investmentbanken auf eigene Faust handeln durften, konnten Händler durch die Bonuszahlungen sehr viel mehr Geld verdienen als ihre Ansprechpartner bei den etablierten Konzernen. Das Geschäft erlebte eine »kopernikanisch-kapitalistische Wende«, denn die Investmentbanker bestimmten nun das Schicksal des Marktes mit, weil sie selber davon profitierten. Die Wall Street konnte auch Einsteiger steinreich machen, wenn sie den Markt verstanden, große Risiken eingingen – und Glück hatten. Die Banker der Wall Street wurden zu einem kulturellen Phänomen. Tom Wolfe nannte sie in einer Reportageserie für das Magazin Rolling Stone »Masters of the Universe«. Wenn man als Banker zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, konnte man in dieser neuen Welt schnell Karriere machen. Broeksmits Timing stimmte.
Zwar war Merrill Lynch etwas hüftsteif, aber das Management bot hungrigen jungen Mitarbeitern eine Chance. Einer von ihnen war Edson – genannt »Ed« – Mitchell, ein 32-jähriger Mann, klein, drahtig, rothaarig, der im Nordosten der USA, im Bundesstaat Maine, geboren worden war. Wie Broeksmit hatte er die Provinz verlassen, strebsam studiert und seine Karriere in Chicago begonnen, wo er von Merrill entdeckt wurde. Ein Jahr vor Broeksmit kam Mitchell zu der Bank nach New York und hatte dort sofort Erfolg. Er war ein Getriebener, ein Mann, der endlich eine Mission gefunden hatte: Er wollte eine zweitklassige Bank an die Spitze führen. Obwohl er ein Zugezogener war, wurde Mitchell schon bald als ein typischer New Yorker beschrieben, den Ungeduld und überbordende Energie fast zerrissen.
Eine Investmentbank kann auf zwei verschiedene Arten Geld verdienen: Sie kann ins Risiko gehen oder als Agent, als Berater, tätig werden. Berät sie Konzerne bei einer Fusion oder einem Börsengang und stellt dafür Gebühren in Rechnung, geht sie kein Risiko ein. Handelt sie auf eigene Rechnung mit Devisen und Aktien, um einen möglichen Gewinn einzustreichen, oder legt Anleihen, Optionen und neue Finanzinstrumente auf, um sie an Käufer zu vermitteln, dann geht sie selbst ins Risiko – oder überzeugt Kunden, das zu tun. Diese Überzeugungsarbeit leisten in einer Investmentbank die Risk Taker, eine Rolle, die Mitchell auf den Leib geschneidert war.
Die Risk Taker waren bei Merrill Lynch in der Abteilung Capital Markets zusammengefasst. Edson Mitchell, der Mann mit dem Drive, wurde der Chef der Derivate-Abteilung. Broeksmit arbeitete ihm zu und machte an Mitchells Seite schnell Karriere. Innerhalb von nur vier Jahren stieg er in der Hierarchie weit auf. Mit gerade einmal 33 Jahren wurde er zu einem der Direktoren – von denen es allerdings einige gab.
Broeksmit arbeitete mit seinem Team in einem Großraumbüro, an dessen Wänden digitale Ticker die aktuellen Börsenkurse und Uhren die Zeit an den Börsenplätzen Tokio, Frankfurt und London anzeigten. Die Händler trugen Hosen aus teurem Zwirn, weiße Hemden, die Ärmel hochgekrempelt, Krawatten, kein Sakko. Sie arbeiteten an langen Tischreihen, die vollgestellt waren mit Bildschirmen, Telefonen, Tastaturen und Aktenordnern, in denen Kundeninformationen oder Spreadsheets gesammelt wurden. Die Computer waren besonders leistungsstark und spielten in dem Geschäft eine immer größere Rolle. Verschiedene Faktoren und Variablen mussten ständig bedacht, gegeneinander geschnitten werden. Beim Verkauf eines Finanzinstruments musste das Risiko für die Bank möglichst exakt berechnet werden. Genauso macht es ein Spieler, der im Kasino beim Black Jack die Karten zählt. Im Capital Market Team bei Merrill arbeiteten bald mehrere Hundert Mitarbeiter. Edson Mitchell trimmte sie in wenigen Jahren auf Erfolg, und Merrill schüttelte das alte, langweilige Image ab. Manch einer berauschte sich an diesem Geschäft.
Es kam nicht selten vor, dass einer der jungen Männer seinen Abschied vom Junggesellenleben in der Bank feierte und Stripperinnen ins Büro bestellte. Die entblätterten sich auf den Tischen mitten im Handelsraum, wie Janet Tavakoli, eine ehemalige Kollegin von Broeksmit, später berichtete: »Die Stripperin zog ihre Performance fünf Meter von mir entfernt durch, vor meinen Mitarbeiterinnen und einer Kundin, die ein Anlageportfolio für eine Bank managte. Der Auftritt wurde von einem hauseigenen Fernsehsender live übertragen. Die Stripperin war angestrengt, konzentriert und komplett nackt, sie balancierte auf der Stuhllehne des Händlers, streckte ihm ihre Hüfte entgegen. Die Kollegen feuerten sie an und machten anzügliche Bemerkungen. Mein Chef George stand dabei in der ersten Reihe.«7 Als Janet Tavakoli sich über derartige Auftritte bei George beschwerte, wurde sie kurzerhand aus der feierfreudigen Gruppe rausgeschmissen. Bill Broeksmit bekam das mit und holte Tavakoli umgehend in sein Team. Die Teams bei Merrill, die in einzelne Handelstische, Trading Desks, aufgeteilt waren, standen in unerbittlicher Konkurrenz zueinander. Sie jagten sich Händler und Kunden ab, manchmal machten sie auch Geschäfte miteinander und verkauften sich gegenseitig eine Anleihe oder ein Derivat. Das war die Kultur, die Edson Mitchell eingeführt hatte: gnadenloser Wettbewerb – survival of the fittest.
Wenn gerade keine Stripperin auftrat, widmete man sich im Handelsraum von Merrill Lynch dem Verkauf der neuen Wunderwaffe im Finanzgeschäft: den Derivaten. Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen einer Bank oder einem Wertpapierhändler und einem Kunden. Der Begriff – Derivat – kommt vom englischen to derive, ableiten. Das Derivat leitet seinen Wert vom Zeitwert eines Wertpapiers, Rohstoffs oder einer Währung ab. Ein Kunde kauft etwa ein Derivat, das ihm garantiert, Aluminium an einem bestimmten Tag zu einem festgelegten Kurs kaufen zu können. Die Bank bekommt für die Vermittlung des Derivats eine Prämie.
Derivate waren zunächst als eine Art Versicherung gedacht, vor allem für Firmen, die sich gegen Preisschwankungen bei Rohstoffen absichern wollten, die sie für die Produktion brauchten. Termingeschäft heißt das in Deutschland. Im Prinzip ist das Geschäft eine Wette und ein Derivat ein Wettschein. Die Derivate wurden gehandelt wie Wertpapiere, als seien sie Papiere mit einem tatsächlichen Wert.
Broeksmits Chef, Edson Mitchell, hatte in den 1980er Jahren erkannt, dass die Derivate zu einer Geldmaschine für die Banken werden könnten. Die Idee, diese Derivate zu strukturieren und mit ihnen zu handeln, stammte nicht von ihm, aber er verstand das Grundprinzip. Man musste die Instrumente schnell an den Kunden bringen, der Konkurrenz zuvorkommen. Andere Banken – etwa Bankers Trust – waren darin äußerst kreativ, aber Merrill war schneller, schneller beim Kunden und schneller beim Kopieren von Produktideen. Edson Mitchell galt als einer der Pioniere in dem neuen Geschäft. Er gehörte zur »Gruppe der Dreißig«, die sich regelmäßig traf, um das Finanzinstrument weiterzuentwickeln. Dieser Kreis bestand aus Experten, die für verschiedene Banken arbeiteten und Derivate selber mitentwickelt hatten. Aber Mitchell war gleichzeitig abhängig von den Ideen junger Männer wie Bill Broeksmit: »Broeksmit war der Boss des Bosses«, so schätzte Janet Tavakoli später die Dynamik zwischen den beiden Männern ein.
Broeksmit war der Chef eines Teams, das sich auf eine ganz spezielle Art von Derivaten konzentrierte – »Interest Rate Swaps«. Der erste große moderne Swap Deal war 1981 organisiert worden, nicht bei Merrill, sondern ein Stück weiter die Straße hinunter bei Salomon Brothers. Wie bei den meisten Derivaten ging es darum, dass ein Kunde die Finanzkontrollen mehrerer Länder austricksen wollte. In diesem Fall war der Kunde die Weltbank. Die Weltbank wollte D-Mark und Schweizer Franken leihen, um eigene Aktivitäten zu finanzieren. Doch die Regierungen der beiden Länder – die Schweiz und Deutschland – hatten es der Weltbank untersagt, die Währungen in zu großen Mengen aufzukaufen. Also vermittelte das Investmenthaus Salomon der Weltbank einen Konzern – die Firma IBM –, der D-Mark und Franken in großem Umfang geliehen hatte und zurückzahlen musste.8
Händler bei Salomon hatten die Idee, dass man die Währungszahlung quasi tauschen könnte – to swap im Englischen. Die Weltbank kaufte IBM die Kredite ab, die das Unternehmen in Franken und D-Mark aufgenommen hatte, im Gegenzug nahm IBM einen Kredit auf, der in US-Dollar abgerechnet wurde. Die Weltbank wollte ihre Geschäfte nicht in Dollar abwickeln, weil der Zinssatz in den USA damals bei 17 Prozent lag, während Kredite in Franken oder D-Mark für die Weltbank sehr viel billiger waren. Salomon strukturierte den Deal, berechnete, wie sich die verschiedenen Zinssätze halbwegs gerecht gegeneinander aufwiegen ließen, und kassierte eine Vermittlungsgebühr von gut zwei Prozent, was bei diesem Swap 20 Millionen Dollar ausmachte. Die Idee schlug ein, da alle Seiten profitiert hatten. Bald wurden nicht nur Währungen, sondern auch immer mehr Zinssätze, Kredite, Anleihen oder Papiere, die an einen Zinssatz gekoppelt waren, getauscht. 1983 stieg Edson bei Merrill Lynch in genau dieses Geschäft ein.
Die Banken hatten ein völlig neues Spielfeld entdeckt. Die Regeln waren für neue Kunden zwar kompliziert und schwer zu durchschauen, aber jeder wollte mitspielen. Die Banken konnten gerade zu Beginn des Booms hohe Prämien fordern, da viele Kunden einfach nur Regulierungen umgehen wollten und nicht zu viele Fragen stellten, solange das Instrument dafür taugte, irgendwo auf der Welt Finanzaufsichtsbehörden auszutricksen.
Die Wall Street machte mit den neuen Instrumenten viel Geld, aber im Mittelpunkt standen nach wie vor die herkömmlichen Geschäfte mit Aktien. Bill Broeksmit war gerade ein Jahr bei Merrill, als die Börsenkurse am Schwarzen Montag – dem 19. Oktober 1987 – weltweit spektakulär abstürzten. Allein der Dow-Jones-Aktienindex verlor innerhalb eines Tages fast ein Viertel seines Wertes. Kritiker machten neue Computerprogramme als Ursache für den Crash aus, denn diese waren so programmiert, dass sie bei einem bestimmten Kurs große Mengen an Aktien automatisch verkauften. Der Absturz im Herbst 1987 unterbrach den Siegeszug der Computer im Finanzsektor allerdings nur kurz.
Keine zwei Monate nach dem Crash an der Börse kam Oliver Stones Film Wall Street in die Kinos. Die Sprüche des Protagonisten Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas, wurden bei den Bankern Kult: »Wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund.« Gecko verkörperte das, was viele junge Banker waren: Angehörige einer neuen Generation, jünger, schneller als die Alten. Zerstörung bedeutete für sie nicht Krieg, Unheil und Tod, sondern vor allem Bewegung. Zerstörung – auch von Börsen- und Unternehmenswerten – eröffnete die Chance auf mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Bonus. Denn selbst wenn der Markt fällt, kann man viel verdienen, Hauptsache, es ist Bewegung im Markt. Die Figur Gekko brachte in einer Rede vor Aktionären einer Firma, die er übernehmen wollte, ziemlich genau zum Ausdruck, was die jungen Händler an der Wall Street antrieb: »Ich zerstöre kein Unternehmen, ich befreie sie vielmehr. Der entscheidende Punkt ist doch, dass die Gier, leider gibt es dafür kein besseres Wort, gut ist. Die Gier ist richtig, die Gier funktioniert. Die Gier klärt die Dinge, durchdringt sie und ist der Kern jedes fortschrittlichen Geistes. Gier in all ihren Formen, die Gier nach Leben, nach Geld, nach Liebe, nach Wissen, hat die Entwicklung der Menschheit geprägt.«
Die Gier nach Geld trieb auch Edson Mitchell an, und er trieb seinerseits »Mitchells Boys« mit hohen Bonuszahlungen an. Später wurde ihm ein Ausspruch zugeschrieben, der in der Branche ebenfalls Kultstatus erreichte: »Wer mit 40 noch keine 100 Millionen Dollar verdient hat, ist ein Versager.« Mit solchen Sprüchen versuchte er immer neue Talente anzulocken und überdeckte mit der Rhetorik zugleich die Mühen des Alltagsgeschäfts, das kompliziert, riskant, dabei oft eintönig war. Es gab kein Rezept, das einem Händler, egal bei welcher Bank er arbeitete, garantierte, zu den Gewinnern zu gehören.
Als man sich nach dem Börsencrash wieder berappelt hatte, machte Bill Broeksmit sich daran, eines der neuen Derivate – »Interest Rate Swaps« – weiterzuentwickeln. Diese Zinsswaps funktionieren so: Der Zinssatz von Krediten ist an den Libor gekoppelt, also den Zinssatz, zu dem sich die Banken untereinander Geld leihen. Der Zinssatz, den der Kreditnehmer zahlen muss, kann sich also verändern, im schlimmsten Fall kann er höher werden. Wenn einem Unternehmer das zu unsicher ist, kann er sich mit einem Swap gegen Zinsschwankungen absichern. Mit dem Swap können die Kunden den flexiblen, an den Libor gekoppelten Zinssatz gegen einen festen, unveränderten Zins tauschen. Den bieten etwa eine Bank, ein Investor oder ein anderes Unternehmen an, die darauf spekulieren, dass sich die Zinssätze zu ihren Gunsten entwickeln. Der Anbieter geht also eine Wette mit dem Kunden der Bank ein, tauscht die Zinssätze und hofft, am Ende den besten Schnitt zu machen.
Das Team von Broeksmit begab sich auf die Suche nach Unternehmen, Banken und anderen Investoren, die in einen Zinsswap einsteigen wollten. Das Instrument selber – wer tauscht was, wie lange, mit wem, zu welchen Bedingungen – wurde von Broeksmits Teams strukturiert. Es gab viele Variablen, viele Möglichkeiten, aber immer war mit ihnen die ultimative Unsicherheit verknüpft: Kein Mensch wusste, wie hoch die Zinsen in drei, vier oder fünf Monaten sein würden. Von diesem Risiko erfuhr der Kunde zunächst nichts. Mitchell und Broeksmit heuerten Verkäufer an, die diese neuen, riskanten Produkte in den Markt drückten. Das waren Kollegen, die andere Banken, Investoren, Hedgefonds oder die Verwalter großer Vermögen bedrängten: Wir haben da was, das spart Geld! Oder auch: Sie können noch mehr Geld machen!
Bei Broeksmits neuem Arbeitgeber kursierte damals ein Video, das einen der Starverkäufer der Bank zeigt, einen der erfolgreichsten Klinkenputzer: Michael Stamenson aus San Francisco. Auf einer Schulung erklärte Stamenson dem Nachwuchs: »Im ganzen Land gibt es vielleicht eine Handvoll von Masters of the Universe. Einer davon bin ich. Nun, wer ist ein Master of the Universe? Ein Master of the Universe ist jemand, der eine Idee von einem Kollegen an einem der Tische im Handelsraum aufschnappt, sie auf 25 Wörter oder weniger verdichtet, einen Kunden anspricht, ihn nervt, ihn überzeugt, etwas zu tun, was er normalerweise von sich aus niemals tun würde. Ein Master of the Universe macht genau das alles möglich, und zwar im ganz großen Stil.« Am Ende trug Stamenson noch dicker auf: Um ein erfolgreicher Broker bei Merrill zu werden, brauche man »die Zähigkeit einer Klapperschlange, das Herz einer Schwarzen Witwe und den Panzer eines Alligators«.9
Wie Drückerkolonnen, nur in sehr teuren Autos und Anzügen, tauchten die Bankverkäufer beim Kunden auf oder redeten auf sie am Telefon ein. Für jeden Abschluss bekamen sie einen Bonus. Edson Mitchell baute sich eine Armee von Verkäufern auf, die Broeksmits Instrumente an den Kunden brachten, darunter nicht wenige, die zu dem wurden, als was sie sich intern verkauft hatten: Raubtiere mit dicken Panzern und ohne jedes Gefühl für die Kunden, die Opfer.
Nachdem die Deutsche Bank Morgan Grenfell gekauft hatte, um das Investmentbankgeschäft zu erobern, kam ihr ein historisches Ereignis in die Quere: die deutsche Wiedervereinigung. Die Deutsche Bank galt bei ihren Kritikern als skrupellos, aber selbst die größten Gegner des Frankfurter Instituts hatten immer geglaubt, dass der Konzern professionell geführt wurde. Die Deutsche galt ja als die wahrscheinlich beste Bank der Welt. Doch mit dem Fall der Berliner Mauer wurde das Geschäft unübersichtlicher: Im Westen lockten die Investmentgeschäfte, im Osten die neuen Märkte. Überall wollte die Bank dabei sein – und so machte man Fehler.
Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob der Konzern nach dem Ende der DDR noch einflussreicher werden würde. Schon in den ersten Wochen nach der Grenzöffnung hatte die Deutsche Bank Kontakt zu hochrangigen Funktionären aufgenommen, die der ostdeutschen Staatsbank vorstanden. Vor allem zu dem zweiten Chef der Bank, Edgar Most, baute man eine enge Beziehung auf, indem man ihn beriet und betreute.10 Noch zu DDR-Zeiten, Anfang 1990, organisierte die Deutsche Bank dem Mann aus dem Osten ein Bundeswehr-Feldfunkgerät, damit man ihn jederzeit erreichen konnte. Aber das war nicht alles. Die Bank flog Most diskret mit einem Privatjet durch die Gegend. Am Ende gründete der DDR-Banker – angeblich auf eigene Faust – eine neue Bank, übertrug ihr den Besitz der Staatsbank, die Konten, das Know-how, und privatisierte die Neugründung sofort, so dass die Deutsche Bank fast die Hälfte des neuen Instituts übernehmen konnte. So bekam sie Zugriff auf die Daten der ehemaligen Staatsbank und damit auf das Gedächtnis der ostdeutschen Volkswirtschaft. Auch in der Bundesrepublik war das einer der größten Vorteile der Deutschen Bank: Sie führte die Konten vieler zentraler deutscher Unternehmen, wickelte deren Zahlungsverkehr ab, war im Bilde, wie es den Firmen ging, was geschäftlich funktionierte und was nicht.
In der DDR holte die Deutsche Bank noch vor der Wiedervereinigung für sich heraus, was herauszuholen war. Als Nachfolgerin der Staatsbank musste sie deren Gebäude und Filialnetz zwar mit der Dresdner Bank teilen, nachdem deren Manager bei der Bundesregierung protestiert hatten, trotzdem bekam die »Weltmacht Deutsche Bank« den Osten des Heimatmarktes schnell unter Kontrolle. In den geheimen Berichten des Bundesrechnungshofs über dieses Geschäft wird vor allem beklagt, dass zu den Ad-hoc-Geschäften der Deutschen Bank in der ersten Nachwendezeit kaum Dokumente angelegt wurden. Als immer deutlicher wurde, wie viel Geld in die Führung und Sanierung der ostdeutschen Unternehmen gesteckt werden müsste, organisierte die Bank der Bundesregierung umgehend und dezent das notwendige Kapital auf dem Finanzmarkt. Sie führte als erste Bank die D-Mark im Osten ein, in ihrer Filiale am Alexanderplatz in Berlin. Das war vor allem ein PR-Coup. Die Bilder von schwitzenden, singenden Ostdeutschen, die Hundertmarkscheine schwenken, gingen um die Welt. Die Bank organisierte auch die Verwaltung der Altschulden von ostdeutschen Unternehmen, die mit der Währungsunion plötzlich in D-Mark abgegolten werden mussten. Dafür nahm sie Rekordzinsen und erhob einen Risikozuschlag – obwohl sie selber keinerlei Risiko trug, das hatte die Bundesregierung übernommen. In der Ex-DDR schien ansonsten kein großes Geschäft zu winken, alles im postsozialistischen Staat wirkte marode und kaputt, der Markt war viel zu klein, und vor allem hatte dort niemand Kapital. Was die Bank wollte, hatte sie schon bekommen. Mit dem Rest wollte sie nichts zu tun haben.
Die Deutsche Bank zahlte für ihren Widerwillen, sich stärker in den neuen Bundesländern zu engagieren, einen hohen Preis: Ihr erwuchs ein Konkurrent im eigenen Land. Ausgerechnet eine der gewieftesten Investmentbanken, Goldman Sachs aus dem Bulge Bracket, begann in Deutschland Geschäfte zu machen. Die Treuhandanstalt, noch eingesetzt von der DDR-Regierung und seit der Währungsunion endgültig verantwortlich für die Privatisierung der Betriebe in Ostdeutschland, war auf der Suche nach Banken, die sie bei ihrem schwierigen Geschäft unterstützten. Man brauchte vor allem Hilfe beim Verkauf von Ladenhütern wie den Chemiewerken in Leuna. Da die Deutsche Bank kein Interesse gezeigt hatte, fragte die Treuhandanstalt bei US-Investmentbanken an. Goldman Sachs erhielt den Zuschlag. Von da an waren junge Mitarbeiter von Goldman Stammgäste bei der Treuhand, darunter Paul Achleitner, der 2012 Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank werden sollte.
Die Deutsche Bank konzentrierte sich derweil auf Geschäfte, die schnelle Erträge versprachen. Dazu bietet sich der Immobilienmarkt an. Bevor die vielen alten Gebäude in Leipzig, Dresden, Berlin verkauft oder vermietet werden konnten, musste sie aber jemand sanieren. Ein Bauunternehmer aus Frankfurt brachte sich hier in Stellung: Jürgen Schneider. Schneider kaufte in ganz Deutschland teure Immobilien, die er aufpäppeln und anschließend teuer vermieten wollte. Der Unternehmer trat geschmeidig auf, seine Halbglatze mit einem Toupet kaschierend. Nur das erste Projekt finanzierte er zum Teil mit eigenem Geld, den Rest baute er komplett auf Pump, vor allem in Ostdeutschland. Er erhielt fast sieben Milliarden D-Mark an Krediten, weil er sich nicht scheute, bei Mieteinkünften, Kosten und der Zukunft im Allgemeinen maßlos zu übertreiben. Da sich die Mietpreise nach der Wende nicht wie erwartet entwickelten, geriet er schnell in Liquiditätsengpässe. Als er keinen Ausweg mehr sah, überwies er sich selber schnell noch 245 Millionen D-Mark, beichtete der Deutschen Bank, dass es eventuell kleine Probleme mit dem Cashflow geben könne, und setzte sich nach Miami ab, wo er Jahre später verhaftet wurde. Sein Unternehmen wurde abgewickelt, die Banken verloren viel Geld, Handwerker blieben auf unbezahlten Rechnungen sitzen.
Der damalige Chef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, führte in den Tagen des Skandals etwas vor, was seine Nachfolger in Krisenzeiten nachahmten: Er überspielte eine existenzielle Krise mit einer verblüffenden, aber kühl kalkulierten Zurschaustellung großer Arroganz. Diese Arroganz war triefend, schwer zu ertragen und so maßlos, dass sie zwangsläufig ins Zentrum der Berichterstattung rückte. Kopper wurde auf einer Pressekonferenz im April 1994 gefragt, ob die Bank die Rechnungen der Handwerker übernehmen würde und wie hoch der Betrag wohl sei. Er antwortete: »Wir schätzen, dass bei allen drei Projekten ein Betrag zur Debatte steht, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts. Fast jeden Monat fällt ein Bauträger in dieser Republik um, ich kann nur sagen – so what?«
»Peanuts«. Er hatte tatsächlich »Peanuts« gesagt. 50 Millionen D-Mark sind »Peanuts«, sind nichts für die Deutsche Bank. So what. Was soll’s. Mit diesem scheinbar dahingesagten Satz hatte Kopper gleich mehreres erreicht: Die Deutsche Bank wurde weiter als unendlich reich, als unantastbar angesehen, da 50 Millionen mehr oder weniger offenbar keine Rolle spielten. So entging fast allen, wie existenziell die Schneider-Krise für die Bank war. Drei Milliarden D-Mark standen mittelbar im Feuer, wie später ein hochrangiger Manager der Deutschen Bank zugab. Das waren damals 25 Prozent des Eigenkapitals der Bank. Doch in Deutschland konnte und wollte sich niemand vorstellen, dass die Deutsche Bank durch den Verlust von »Peanuts« und einen Mann mit Toupet in ernsthafte Bedrängnis geraten konnte. Doch genau das war geschehen. Und Kopper erreichte mit seinem arroganten Ausspruch, dass die Reputation intakt und das Bild von der mächtigen Bank beinahe unbeschädigt blieb. Der Glaube an die Stärke einer Bank ist eben fast wichtiger als die Höhe ihres tatsächlich bilanzierten Vermögens. So ging es nach einem schlechten Quartal für die Bank rasch wieder aufwärts. Immerhin hatte Kopper Englisch gesprochen. So what.