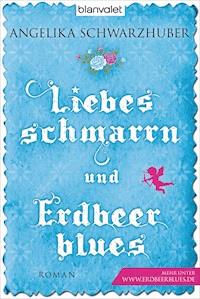8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Komm, tanz mit mir ins Glück!
»Kostenloses Wohnen auf dem Bauernhof. Gegenleistung: Unterstützung unseres noch rüstigen Onkels Alfred.« Als Romy den Aushang im Supermarkt entdeckt, scheint das die Lösung all ihrer Probleme zu sein, denn die Singlemama aus München hofft auf einen Neuanfang auf dem Land. Alfred ist zwar wenig begeistert, doch nach anfänglichen Schwierigkeiten entsteht eine ganz besondere Freundschaft zwischen Romy und ihm. Zusammen entwickeln sie dann auch eine Geschäftsidee, die dem Hof finanziell auf die Beine helfen soll – unterstützt durch Hannes, der Romy nicht gerade kaltlässt. Doch dann taucht der Vater ihres Sohnes auf und stürzt Romy in ein Gefühlschaos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
»Kostenloses Wohnen auf dem Bauernhof. Gegenleistung: Unterstützung unseres noch rüstigen Onkels Alfred.« Als Romy den Aushang im Supermarkt entdeckt, scheint das die Lösung all ihrer Probleme zu sein, denn die Singlemama aus München hofft auf einen Neuanfang auf dem Land. Alfred ist zwar wenig begeistert, doch nach anfänglichen Schwierigkeiten entsteht eine ganz besondere Freundschaft zwischen Romy und ihm. Zusammen entwickeln sie dann auch eine Geschäftsidee, die dem Hof finanziell auf die Beine helfen soll – unterstützt durch Hannes, der Romy nicht gerade kaltlässt. Doch dann taucht der Vater ihres Sohnes auf und stürzt Romy in ein Gefühlschaos.
Autorin
Die bayerische Autorin Angelika Schwarzhuber lebt mit ihrer Familie und einem äußerst willensstarken Kater, der in Eigenregie die Schlafzeiten der Autorin bestimmt, in einer kleinen Stadt an der Donau. Sie arbeitet auch als Drehbuchautorin für Kino und TV. Wenn sie nicht am Computer Texte dichtet, verzieht sie sich gerne mit Freunden in kleine Berghütten zum Schafkopfspielen.
Von Angelika Schwarzhuber ebenfalls bei Blanvalet erschienen:
Liebesschmarrn und Erdbeerblues ∙ Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück ∙ Servus heißt vergiss mich nicht ∙ Der Weihnachtswald
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Angelika Schwarzhuber
Barfuß im Sommerregen
Roman
Für Gerhart und Martin – die Väter meiner Söhne
Kapitel 1
Ich muss dringend wieder mehr Sport machen, dachte ich, als ich zwischen Regalen mit Frühstücksflocken und Marmelade meinem Sohn hinterherhastete. Ich erwischte ihn gerade noch rechtzeitig, bevor er die kunstvoll aufgebaute Pyramide aus Cornflakes-Packungen zum Einstürzen brachte, und klemmte mir das zappelnde und fröhlich quietschende vierjährige Energiebündel unter den Arm.
»Du hast mich gefangen, Mama«, rief er glucksend, »du bist Sieger.« Wie sollte ich ihm da böse sein, auch wenn uns einige Kunden im Supermarkt kopfschüttelnd ansahen? Glücklicherweise kannte uns hier niemand.
Als ich seine Lieblingskekse und zwei Flaschen Wasser auf das Band legte, entwischte Tommi mir ein weiteres Mal und rannte auf den Ausgang zu. Vor der automatischen Schiebetür hielt er jedoch inne. Er wusste ganz genau, dass es mächtig Ärger geben würde, wenn er den Supermarkt ohne mich verließ.
Mach doch bitte schneller, dachte ich, während die Verkäuferin im Tempo einer Schildkröte beim Sonnengruß das Wechselgeld herauszählte. Inzwischen zupfte Tommi in aller Seelenruhe Zettel von einem schwarzen Brett, das von privaten Angebots- und Gesuchsnotizen geradezu überquoll.
»Also, Junge, das geht doch nicht«, hörte ich einen älteren Herrn schimpfen, der Tommi mit strengem Blick bedachte. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich mein Kleiner erschrocken etwas in die Hosentasche schob.
Endlich hatte mir die Verkäuferin das Wechselgeld in die Hand gedrückt, und ich eilte zum Ausgang.
»Entschuldigen Sie bitte.« Ich hob rasch die am Boden liegenden Kärtchen auf und heftete sie zurück an die Pinnwand. »Normalerweise macht er so was nicht.«
Was nicht so ganz der Wahrheit entsprach. Denn mein Sohn war ein kleiner Wirbelwind, der gerne mal Unfug trieb. Das war auch der Grund gewesen, warum die Tagesmutter nach zwei Wochen aufgegeben hatte.
Mit ihrer Kündigung war auch mein Job bei McDonald’s Geschichte. Die Arbeitszeiten waren nicht kompatibel mit dem Betreuungsangebot im Kinderhort, den ich mir ohne Job ohnehin nicht leisten konnte. Als meine beste Freundin Teresa und ihre fünfjährige Tochter Ina noch in unserer gemeinsamen kleinen Wohnung lebten, war alles viel einfacher. Da hatten wir unsere Dienstzeiten abgestimmt und uns mit der Betreuung der Kinder abgewechselt. Doch letzten Herbst hatte Teresa Leander kennengelernt, einen Patentanwalt aus Österreich. Und vor vier Monaten war sie mit Ina aus München weg und zu ihrer neuen Liebe nach Wien gezogen. Der Abschied war uns allen ziemlich schwergefallen, vor allem den Kindern, die wie Geschwister aufgewachsen waren. Ich vermisste die beiden immer noch sehr.
Doch vielleicht würde auch mein Leben jetzt eine Wendung nehmen. Ich war unterwegs zu einem Vorstellungsgespräch. Und diesmal standen die Chancen für eine längerfristige Anstellung gar nicht mal so übel. Eine Realschule in Passau hatte eine Hausmeisterstelle ausgeschrieben. Glücklicherweise suchten sie weniger einen Handwerker als vielmehr jemanden, der sich neben der Reinigung des Gebäudes und der Pflege des Gartens um den Pausenverkauf kümmerte. Das würde ich auf jeden Fall hinbekommen. Und das Beste daran war, dass eine Hausmeisterwohnung zur Verfügung stand, die für eine alleinerziehende Mutter mit Sprössling groß genug war. Das musste einfach klappen. Andernfalls würden wir in knapp einem Monat auf der Straße stehen, denn mein Vermieter hatte inzwischen kein Verständnis mehr dafür, dass ich ständig mit den Zahlungen im Rückstand war.
»Mami, komm jetzt.« Tommi zog mich ungeduldig hinaus auf den Parkplatz.
»Hör mal, Schatz, du darfst nicht einfach Zettel herunterreißen«, tadelte ich ihn auf dem Weg zum Auto.
»Warum?«
Seine Lieblingsfrage.
»Die Zettel haben Menschen dorthin gehängt, die etwas verkaufen oder verschenken wollen. Oder etwas suchen.«
»Haben die was verloren?«
»Nein.«
»Warum suchen die denn dann?«
Ich seufzte und überlegte einen Moment, bis mir etwas einfiel.
»Wir suchen doch auch oft nach einem Parkplatz.«
Er hatte verstanden und nickte.
»Einen Parkplatz kann man nicht verlieren, oder?«
»Nein. Den kann einem nur jemand wegschnappen.«
Er kicherte.
»So wie du dem Mann vorhin.«
»Genau.« Ich streichelte über seinen Kopf.
»Wann gehen wir baden, Mama?«
»Später. Wie ich es dir versprochen habe«, sagte ich und öffnete die Beifahrertür des Renault Clios, den meine Nachbarin Hedwig mir für heute geliehen hatte.
»Es ist so heiß«, jammerte mein Kleiner.
Das war es allerdings für Ende April. Vor drei Wochen waren die Temperaturen von einem Tag auf den anderen auf über achtundzwanzig Grad gestiegen, und eine Wetteränderung war laut Vorhersagen nicht in Sicht. Da ich den Sommer jedoch liebte, machte mir die Hitze nicht viel aus.
»Ich mach gleich alle Fenster auf, dann wird es kühler. Außerdem muss es heiß sein, sonst können wir später nicht schwimmen gehen.«
Das Argument war überzeugend. Tommi setzte sich in seinen Kindersitz, und ich kontrollierte, ob er sich richtig festgeschnallt hatte.
Langsam, aber sicher machte sich Nervosität in mir breit. Falls es mit diesem Job klappte, wäre das ein echter Neuanfang für uns. Es würde bedeuten, München zu verlassen und in die wesentlich kleinere Stadt Passau zu ziehen, die ich bisher nur von Fotos aus dem Internet kannte. Und so eine Veränderung war genau das, was ich brauchte.
Verdammter Mist! Das wär auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, dachte ich, als wir zwei Stunden später vom Parkplatz der Schule wegfuhren. Leider hatte ich zu große Hoffnungen in dieses Jobangebot gesetzt. Der Schulleiter war höflich gewesen, hatte sich jedoch bereits für ein Hausmeisterehepaar jenseits der fünfzig entschieden, die sich kurz vor mir vorgestellt hatten. Und jetzt? Ich war ohne einen Plan B nach Passau gefahren. Mir blieb nicht mehr viel Zeit, um einen anderen Job und eine neue Wohnung zu finden. Klar, ich hatte ein paar Freunde, bei denen wir zumindest für ein paar Tage unterkommen konnten, aber das würde unsere Situation auf Dauer auch nicht verbessern. Meine finanziellen Reserven waren bald aufgebraucht, und eine neue Wohnung konnte ich mir abschminken. München war für eine alleinerziehende Mutter, die sich hauptsächlich mit Nebenjobs durchschlug, einfach viel zu teuer.
»Fahren wir wieder heim, Mami?«, fragte Tommi.
»Ja.«
»Machst du mir Pfannkuchen mit Nutella?«
»Klar. Einen großen Stapel.«
»Aber vorher gehen wir baden!«
»Sowieso. Wie ausgemacht.«
Im Rückspiegel sah ich, wie er mich mit glücklich funkelnden Augen anlächelte. Ich sollte diesen Tag mit meinem Sohn einfach genießen und mir später darüber Gedanken machen, wie es weitergehen sollte.
Wir waren noch keine zehn Minuten unterwegs, da rief Tommi aufgeregt: »Mama! Anhalten! Schau! Da können wir baden!«
Ich warf einen Blick aus dem Fenster der Beifahrerseite und entdeckte etwas abseits von der Straße die glitzernde Oberfläche eines Gewässers.
»Wir wollten doch in München ins Bad gehen«, warf ich halbherzig ein. Doch der kleine Weiher, umgeben von Wiesen und Sträuchern, sah tatsächlich sehr einladend aus. Und die Badesachen waren ja bereits im Kofferraum. So ein wenig Abkühlung könnte jetzt nicht schaden.
»Ich will jetzt«, sagte er und setzte noch ein »Bitte, bitte, Mama« hinzu.
»Na gut!«
Ich bog bei der nächstmöglichen Gelegenheit ab und fuhr ein wenig herum, bis wir schließlich über einen Feldweg am Gewässer ankamen, das etwa die Größe eines Fußballfeldes hatte. Ich parkte den Wagen unter einem Baum und suchte eine Stelle, an der es flach ins Wasser ging. Es handelte sich tatsächlich um einen Badeweiher, trotzdem war an diesem Montagnachmittag nicht allzu viel los. Nur wenige Leute schwammen, und zwei junge Burschen lagen auf einer aufblasbaren Palmeninsel, die im Wasser trieb. Ich breitete die Decke so aus, dass sie zur Hälfte im Schatten lag.
Tommi konnte es kaum erwarten, bis er ausgezogen war und Badehose und Schwimmschuhe anhatte, und am liebsten wäre er sofort ins Wasser gerannt.
»Wenn du nicht wartest, bis ich umgezogen bin, dann fahren wir sofort nach Hause«, stellte ich klar.
»Aber ich kann doch schon alleine schwimmen«, protestierte Tommi und konnte es nicht lassen, zumindest schon mal die Füße ins Wasser zu strecken.
»Tommi!«
»Beeil dich, Mami!«
»Ich mach ja schon.«
Umständlich schlüpfte ich unter dem luftigen Sommerkleid aus meiner Unterwäsche und in den Badeanzug. Verdammt! Der war seit letztem Sommer aber eng geworden! Und schon da hatte ich ihn eine Kleidergröße größer kaufen müssen. Seufzend zog ich das Kleid aus. Ich war zwar nicht dick, aber meine ehemals durchtrainierte sportlich schlanke Figur war in den letzten Jahren etwas rundlicher geworden. Ganz zu schweigen von meiner Oberweite. Die hatte sich während der Schwangerschaft fast verdoppelt. Ich band meine schulterlangen dunkelbraunen Haare hoch, streifte meine Ballerinas ab und schlüpfte in hellblaue Schwimmschuhe. Ohne würden mich keine zehn Pferde in einen Badeweiher bringen. Man wusste ja nie, ob nicht Glasscherben oder scharfkantige Abfälle am Grund lagen.
»Na dann rein!«, rief ich. Das war das Startsignal für Tommi. Ohne mit der Wimper zu zucken, stürzte er sich begeistert ins kalte Wasser. Mich kostete es einiges an Überwindung, ihm zu folgen, und ich schnappte ein paarmal nach Luft. Doch nachdem ich einmal kurz untergetaucht war, spürte ich, wie meine Lebensgeister erwachten.
Mit seinen gerade mal vier Jahren schwamm Tommi problemlos mit mir quer durch den Badeweiher bis zum anderen Ufer. Es war mir wichtig gewesen, ihm das Schwimmen so früh wie möglich beizubringen. Deswegen hatte ich ihn schon mit drei Monaten zum Babyschwimmen angemeldet. Natürlich würde ich ihn niemals unbeaufsichtigt ins Wasser lassen, dennoch war es beruhigend für mich zu wissen, dass er sich gut über Wasser halten konnte.
Fast eine halbe Stunde lang alberten wir im Weiher herum, und die beiden Jungs erlaubten Tommi sogar, auf die Schwimminsel zu klettern. Jauchzend vor Vergnügen sprang er von dort immer wieder ins Wasser.
»Jetzt machen wir mal Pause, Tommi.« Langsam wurde mir doch ein wenig kalt. Auch Tommis Lippen hatten bereits eine bläuliche Färbung angenommen. »Nicht dass du dich noch erkältest.«
»Nur noch ein Mal, Mami.«
Ich seufzte.
»Na gut!«
Und nach einem allerletzten Sprung schwammen wir zurück zum Ufer.
Als wir auf die Decke zugingen, entdeckte ich einen Mann, der nur wenige Meter entfernt bäuchlings auf einem großen Handtuch lag. Reflexartig zog ich den Bauch ein. Dabei war das Gesicht des Mannes zur anderen Seite abgewandt, also konnte er mich gar nicht sehen. Ich trocknete Tommi ab und rieb ihn mit Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 ein. Dann wickelte ich ihn in ein flauschiges Kapuzen-Badetuch mit dem Motiv eines Riesenkraken.
»Darf ich Hummel Bommel hören?«, fragte er.
»Klar«, antwortete ich und gab ihm den iPod. Er kuschelte sich im Schatten auf die Decke und lauschte der Geschichte. Es war ein anstrengender Tag gewesen, und das Toben im Wasser hatte ihn müde gemacht.
Ich genoss es, mich von den warmen Sonnenstrahlen trocknen zu lassen. Dann setzte ich einen Strohhut auf und cremte auch mich sorgfältig ein.
Zwischendurch warf ich immer wieder einen Blick zu dem dunkelblonden Mann, der offenbar eingeschlafen war. Zumindest hatte er sich bis jetzt noch keinen Zentimeter bewegt. Er war schlank und trug graue Badeshorts. Ich rätselte, wie alt der Mann war und wie sein Gesicht wohl aussah. Ein auf der Rückseite ansprechender Körper bedeutete ja noch lange nicht, dass auch der Rest dazu passen musste. Ob er Brusthaare hatte? Inzwischen war ich tatsächlich ein wenig neugierig und wartete darauf, dass er sich endlich umdrehte. Doch den Gefallen tat er mir nicht.
Plötzlich hörte ich ein leises Summen und entdeckte eine Wespe, die über mir schwebte.
»Weg da!«, rief ich erschrocken, und als ob sie mich verstanden hätte, zog sie ab. Gebannt sah ich zu, wie das Insekt in Richtung des schlafenden Mannes flog und sich auf seinem Hals niederließ, ohne dass er es bemerkte. Ich wurde unruhig. So ein Wespenstich tat immerhin ganz schön weh. Und vielleicht war der Mann ja allergisch. Was sollte ich denn jetzt tun? Ich setzte mich auf und räusperte mich vernehmlich. Keine Reaktion.
»Hallo!?!« Nichts!
»Huhu!! Aufwachen!« Ich versuchte es ein weiteres Mal. Doch er reagierte nicht. Also entweder schlief dieser Mann tatsächlich wie ein Murmeltier, war taub oder bereits tot.
Und wieso meinte ich eigentlich, mir immer und über alles Sorgen machen zu müssen? Schließlich ging mich der Mann nichts an. Doch noch bevor ich es mir anders überlegen konnte, stand ich auf, wickelte mir das Handtuch um die Hüften und ging zu ihm.
»Husch, husch!«, zischte ich und wedelte mit meinem Hut über dem Hals des Mannes herum, um die Wespe zu verscheuchen, die immer weiter in Richtung Kehlkopf krabbelte. »Hau ab.«
In diesem Moment schrak er hoch, und die Wespe suchte zum Glück das Weite.
»Hey!«
Erschrocken und ziemlich perplex trat ich einen Schritt zurück. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, hatte jetzt aber die Antwort auf meine Fragen vor Augen: Sein Gesicht passte eindeutig zum Rest des Körpers, Brustbehaarung war mäßig vorhanden, und er schien nicht wesentlich älter zu sein als ich, allerhöchstens Anfang dreißig.
»Was machst du denn da?«, fuhr er mich an. Sein Blick blieb kurz am Ausschnitt meines Badeanzuges hängen, bevor er nach seiner Jeans griff, die neben ihm auf der Decke lag, und die Hosentaschen abtastete. Er wollte wohl kontrollieren, ob ich ihn beklaut hatte. Was irgendwie nachvollziehbar war, trotzdem wurmte es mich ein wenig. Schließlich hatte ich nichts Böses im Sinn gehabt. Ganz im Gegenteil.
»Da war eine Wespe«, stellte ich klar und setzte meinen Hut wieder auf.
»Wespe?«
»Ja. Direkt an deinem Hals. Und du hast nicht reagiert. Ich wollte nicht, dass du gestochen wirst. Es hätte ja sein können, dass du allergisch bist.«
»Ach so«, sagte er schon etwas weniger verstimmt, »ja dann … danke.«
»Bist du denn allergisch?«
Etwas irritiert über meine Frage sah er mich an.
»Äh, ich denke nicht. Nein.«
»Da kannst du echt froh sein. Aber trotzdem … weißt du eigentlich, wie leichtsinnig es ist, direkt in der prallen Sonne einzuschlafen? Ganz abgesehen davon, wie schädlich das für die Haut ist, da kann man auch schnell einen Sonnenstich bekommen. Ich hoffe, du hast dich wenigstens ordentlich eingecremt.«
Er stand auf und schlüpfte in seine Jeans.
»Du solltest besser was aufsetzen oder …«
»Sonst noch was?«, fuhr er mich pampig an, und seine hellen grüngrauen Augen funkelten.
»Äh, nein.«
Er nahm ein weißes T-Shirt und zog es über den Kopf. Dann schulterte er seinen Rucksack, und ich sah ihm hinterher, wie er, immer noch barfuß, zu einem in der Nähe geparkten roten Mercedes Vaneo mit der Aufschrift »Zum Drei-Flüsse-Wirt« ging.
Ich wollte mich gerade wieder hinsetzen, da sah ich eine Sonnenbrille an der Stelle, wo er gelegen hatte.
»Hey! Warte mal!«
Er blieb stehen und drehte sich zu mir um.
»Was denn noch?«, fragte er ein wenig genervt. »Bewege ich mich vielleicht zu schnell und könnte davon Muskelkater bekommen?« Er musterte mich von oben bis unten. »Oder willst du mir auch so neckische Plastikschuhe andrehen, damit ich meine kleine Zehe nur ja nicht an einem Steinchen stoße?«
Ich blickte kurz zu den Schwimmschuhen an meinen Füßen, ging jedoch nicht auf seinen Kommentar ein. Wenn er so unvorsichtig sein wollte, bitte schön!
»Um dich nicht unnötig zu nerven, sag ich dir halt nicht, dass du deine Sonnenbrille vergessen hast.« Ich nickte in Richtung der Brille. »Vielleicht brauchst du sie ja auch gar nicht mehr.«
»Ach so – danke«, murmelte er und kam zurück, um die Sonnenbrille aufzuheben.
»Ist wohl nicht so dein Tag heute?«, stellte ich fest.
»Nicht wirklich«, brummte er.
»Meiner auch nicht«, gab ich zu.
»Dann kann es bei uns beiden ja nur noch besser werden.«
»Das wär schön«, sagte ich.
Er öffnete den Kofferraum und warf seinen Rucksack mit den Badesachen hinein. Dann hob er wortlos die Hand zum Gruß, stieg in den Kleintransporter und fuhr weg.
»Ich hab Durst, Mami«, sagte Tommi und gähnte müde.
Ich holte die Wasserflasche aus der Tasche und gab sie ihm.
»Hier. Und wir fahren jetzt nach Hause, Spatz«, sagte ich. »Komm, zieh dich an.«
Als ich ihm seine Hose reichte, rutschten ein paar zusammengeknüllte Fetzen aus der Tasche. Die Abreißzettel mit Notizen und Telefonnummern von der Pinnwand im Supermarkt, die Tommi heruntergerupft und eingesteckt hatte. Als ich sie aufhob, sprangen mir ein paar Worte besonders ins Auge: Kostenloses Wohnen auf … Plötzlich neugierig geworden, faltete ich das Papier auseinander und las weiter:
Kostenloses Wohnen auf dem Bauernhof.
Gegenleistung: Unterstützung unseres noch rüstigen Onkels Alfred.
Infos unter: 0147-01074329.
»Kostenloses Wohnen …«, murmelte ich und biss mir auf die Unterlippe. Dann griff ich nach meinem Handy und wählte die Nummer.
»Hallo? Hier ist Romy Bronner … Ja genau. Deswegen rufe ich an.«
Kapitel 2
Nach dem Telefonat beschloss ich, mich gleich auf dem Hof vorzustellen, damit mir niemand diese einmalige Gelegenheit vor der Nase wegschnappen konnte. Helga Lippel, Nichte von besagtem Alfred, für den eine Hilfe gesucht wurde, hatte mir am Telefon versichert, dass sich bisher nur wenige auf die Annonce gemeldet hätten.
»Wie alt ist denn Ihr Onkel?«
»Er wird bald siebzig, ist jedoch noch sehr rüstig. Aber die Arbeit am Hof und der Haushalt werden ihm allein einfach zu viel.«
Die Bedingungen hätten kaum idealer sein können: Kost und Logis waren frei, es gab ein Fahrzeug zur Mitbenutzung, und die Arbeit im Haus und auf dem Hof war nicht viel mehr als das, was bei mir zu Hause auch anfallen würde. Putzen, waschen und kochen. So könnte ich mich nach irgendeinem angemeldeten Teilzeitjob umsehen. Ich verspürte ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch. Auf einem Bauernhof leben – Tiere, die gesunde Luft, Wiesen, auf denen Tommi unbeschwert herumtollen konnte. Hoffentlich hatte dieser Onkel Alfred nichts gegen einen kleinen Jungen, denn ich hatte meinen Sohn beim Gespräch mit Helga Lippel noch nicht erwähnt.
Ich warf einen Blick zum Himmel. »Bitte, liebes Universum. Mach, dass alles gutgehen wird und Tommi und ich hier eine neue Bleibe finden, wo wir uns wohlfühlen«, bat ich in Gedanken. »Dafür verzichte ich auch weiterhin auf einen Mann«, bekräftigte ich einen Deal, den ich vor ein paar Jahren geschlossen hatte.
Besagter Bauernhof war gar nicht so weit weg, und schon fünf Minuten später fuhr ich durch den beschaulichen Ort Halling. Kurz hinter dem Ortsschild bog ich rechts über eine Brücke in eine leicht ansteigende Straße ein, die zum Bauernhof von Alfred Holler führte.
»Wann fahren wir denn heim?«, wollte Tommi nun schon zum zehnten Mal wissen. »Ich hab schon so Hunger.«
»Ich muss hier nur mit jemandem reden, dann fahren wir bald zurück, Tommi. Außerdem hast du vorhin fast die ganze Packung Kekse gefuttert.«
»Bin aber immer noch nicht satt.«
»Auf der Heimfahrt besorge ich dir eine Brezel.«
Ich sah mich um. Nur drei Häuser mit riesigen Gärten standen entlang der Straße, die an einem Hügel in einer Sackgasse mit der Zufahrt zu einem großen Bauernhof endete.
»Schau mal, wie toll es hier ist«, sagte ich und fuhr in den Hof. In der Mitte wuchs eine riesige Linde, unter der ein alter silbergrauer Peugeot-Speedfight-Roller stand.
Ich parkte den Wagen im Schatten neben der Scheune und stieg aus.
»Komm, Tommi.«
»Ich mag nicht.«
»Jetzt komm. Es dauert auch bestimmt nicht lange.«
Doch er schüttelte den Kopf.
»Ich will hierbleiben und mit dem Handy spielen«, bettelte er.
Ich seufzte.
»Na gut.«
Die beiden Fenster öffnete ich halb, damit frische Luft hereinkam.
Dann holte ich mein Handy aus der Tasche und rief eine App mit einem Spiel auf, bei dem Farben und Formen zugeordnet werden mussten. So hatte ich zumindest das Gefühl, dass Tommi dabei etwas lernen würde. Und ich war sicher, dass er sich nicht von der Stelle bewegte.
»Hier. Ich bin bald wieder zurück.«
Doch Tommi hörte mich schon gar nicht mehr. Er tippte und wischte bereits voller Begeisterung auf dem Display herum.
Ich ging auf das Haus zu und bemerkte überrascht, dass die Haustür offen stand. Durfte ich einfach so das Haus betreten? Warum gab es denn hier keine Türklingel?
»Hallo?«, rief ich in den Flur hinein.
»Ich dir sein kann beste Frau in alle Dingen«, hörte ich eine verführerische Stimme mit einem Akzent, den ich nicht zuordnen konnte.
Langsam ging ich in die Richtung, aus der die Stimmen kamen, und öffnete eine Tür, die in eine große Wohnküche führte.
Eine sehr schlanke Frau stand mit dem Rücken zur Tür. Ihre hellblonden Haare waren zu einem strähnigen Pferdeschwanz zusammengebunden und reichten bis zu einem knackigen Hinterteil, das in einer engen Hose steckte. Neben ihr ein älterer Herr mit noch vollem grauem Haar, bei dem es sich zweifellos um Alfred Holler handeln musste.
»Himmeldonnerwetter noch mal! Ich hab Ihnen schon x-mal gesagt, dass ich hier niemanden brauch!«, fuhr er die Frau an.
»Entschuldigung«, machte ich mich bemerkbar, und die beiden drehten sich zu mir um.
Hinten zwanzig, vorne achtzig mit Glitter, schoss es mir durch den Kopf, als ich das sonnen- oder solariumverbrannte faltige Gesicht der Frau sah. Sie war so übertrieben geschminkt, dass es aussah, als würde der blaue Lidschatten die dick getuschten Wimpern nach unten drücken. Ein über die Konturen hinaus aufgetragener pinkfarbener Lippenstift sollte den schmalen Lippen wohl mehr Volumen verleihen, erzielte jedoch nur den Effekt, dass man den sofortigen Wunsch verspürte, ihr ein Taschentuch zu reichen, damit sie alles abwischen konnte.
»Was wollen Sie?«, riss der Herr des Hauses mich aus meinen Gedanken.
»Ich komme wegen des Aushangs im Supermarkt«, erklärte ich.
»Du können gleich gehen wieder!«, fuhr die Dame mich an. »Bin ich schon hier für gute Hilfe.«
Ich fragte mich, an welche Art von Hilfe sie dabei dachte.
Alfred warf einen finsteren Blick zwischen uns hin und her.
»Muss ich vielleicht ein Schild aufstellen: Keine Hilfe gewünscht?! Verschwinden Sie! Und zwar sofort.«
»Aber ich gerufen extra an mit Telefon …«, begann Old Blondie zu insistieren. Doch Alfred Holler verschränkte die Arme und schnitt ihr sogleich das Wort ab.
»Ich will hier niemanden haben. Also, raus aus meinem Haus! Alle beide.«
Wie um die Worte seines Herrchens zu unterstreichen, kam plötzlich ein beiger Hund aus einem angrenzenden Raum, der wie eine Mischung aus Dackel und Labrador aussah, und bellte.
»Hermes. Aus!«, kam der Befehl. Ruhig, aber wirkungsvoll. Das Tier war sofort still und setzte sich.
»Du es überlegten dir noch doch?«, drängte die andere Kandidatin, die offensichtlich noch nicht aufgeben wollte.
»Ich überlege höchstens, ob ich nicht die Polizei anrufe, wenn Sie nicht auf der Stelle verschwinden!«
Es war vergebliche Liebesmüh, mit dem Mann hier sprechen zu wollen. Gewiss hatte nicht er selbst das Inserat im Supermarkt aufgehängt, sondern seine Nichte. Und es war nicht zu übersehen, dass er ganz und gar nicht begeistert darüber war.
»Entschuldigen Sie die Störung«, sagte ich deswegen. »Auf Wiedersehen.«
Ich nickte ihm noch kurz zu und verließ das Haus, gefolgt von der anderen Bewerberin, die wohl ebenfalls eingesehen hatte, dass sie hier nicht erwünscht war. Womöglich hatte sie aber auch die Erwähnung der Polizei davon überzeugt, besser das Weite zu suchen. Empörte Worte in ihrer Muttersprache murmelnd, deren Sinn ich nur erahnen konnte, ging sie zur Linde und stieg auf den alten Roller.
Gleich darauf ratterte das Gefährt lautstark aus dem Hof. Ich sah ihr noch kurz hinterher, dann ging ich enttäuscht zum Auto. Aber einen Versuch war es wert gewesen.
»So, Schatz«, sagte ich und versuchte, heiter zu klingen. »Jetzt fahren wir aber echt heim.«
»Ich muss aufs Klo, Mami.«
»Jetzt gleich?« Eine Frage, die ich mir hätte sparen können. Welches Kind kündigte so etwas schon eine halbe Stunde vorher an? Ich seufzte.
»Gaaanz schnell!«
Er hatte schon den Gurt an seinem Kindersitz gelöst. Ich öffnete die Tür.
»Komm. Wir gehen hinter die Scheune!«
»Aber ich muss groß«, protestierte er empört. Und mir war klar, was das bedeutete. Wir brauchten eine Toilette. Und zwar dringend.
Mit Tommi an der Hand eilte ich zur Haustür, die inzwischen jedoch verschlossen war. Vermutlich würde auch bald das angekündigte Schild an der Tür hängen.
Ich klopfte und wartete. Als er nicht kam, ging ich zu einem der Fenster und sah ihn am Herd stehen. Der musste mich doch gehört haben! Ich klopfte mehrmals an die Fensterscheibe.
»Hallo!«
Endlich drehte er sich um. Und seinem Gesichtsausdruck nach, war er nicht gerade erfreut.
»Darf mein Sohn Ihre Toilette benutzen? Es ist wirklich ganz dringend!«, rief ich ihm durch die Scheibe zu. »Bitte!« Ich deutete auf meinen Sohn.
»Mama, ich muss ganz ganz schnell«, drängte Tommi.
Und ich wusste, wir hatten nur noch wenig Zeit!
»Wir sind auch gleich wieder weg. Versprochen. Aber lassen Sie uns nur kurz herein.«
Endlich verließ er seinen Platz am Herd, und wenige Sekunden später wurde die Haustür aufgesperrt.
»Danke!«, sagte ich erleichtert.
»Hinten links«, brummte Alfred Holler, und ich huschte rasch mit Tommi an ihm vorbei.
Es war wirklich allerhöchste Eisenbahn gewesen.
Als wir ein paar Minuten später wieder zurückkamen, stand Alfred immer noch im Flur. Vermutlich wollte er sich davon überzeugen, dass wir auch bestimmt gleich wieder verschwanden.
»Ich hab eine riesige Wurst gemacht«, flötete Tommi stolz.
»Pst.« Ich bemühte mich, ein nervöses Kichern zu unterdrücken.
Gerade als ich mich bedanken wollte, zog ein beißender Duft in meine Nase.
»Hier brennt was an!«, rief ich, gleichzeitig begann der Hund zu bellen.
Alfred drehte sich um und ging mit großen Schritten in die Wohnküche. Dort stieg Rauch aus einer gusseisernen Pfanne auf.
»Still, Hermes!«
»Kann ich was helfen?«, rief ich hinterher. Doch Alfred hatte die Pfanne bereits neben die Spüle gezogen, in der sich ein Berg schmutziges Geschirr stapelte.
Wütend drehte er sich zu mir um.
»Das ist Ihre Schuld!«, brummte er. Dann ging er zu einem Fenster und riss es auf.
»Es tut mir leid. Das wollte ich nicht«, sagte ich, obwohl ich ja nicht wirklich was dafür konnte.
»Mama? Warum ist der Mann denn so grantig?«, wollte Tommi wissen und drückte sich enger an mich.
»Schon gut, Tommi. Herr Holler ist nur erschrocken«, sagte ich leise.
»Jetzt gehen Sie doch endlich!«
Ich nickte, nahm Tommi an der Hand und war schon bei der Tür, da drehte ich mich noch mal zu ihm um.
»Was wollten Sie denn machen?«, fragte ich.
»Wie?«
»Kochen. Sie wollten doch was kochen.«
»Also jetzt reicht es mir wirklich und …«, begann er.
»Ich bin schuld daran, dass – was auch immer Sie machen wollten – angebrannt ist«, unterbrach ich ihn. »Und wenn ich was angestellt habe, dann möchte ich das auch in Ordnung bringen.«
»War nur Fett, das zu heiß wurde. Nicht nötig, irgendwas in Ordnung zu bringen.«
»Doch. Für mich ist es das schon. Ich bin hierhergekommen, weil ich dachte, Sie wären für diesen Aushang im Supermarkt verantwortlich. Wissen Sie, das wäre für mich und meinen Sohn ein Ausweg …«, ich winkte ab und versuchte zu lächeln. »Inzwischen hab ich verstanden, dass Sie niemanden hier haben wollen. Aber ich finde, das ist kein Grund, mich so anzublaffen.«
Ich sah, wie er mit wütendem Blick die Luft anzuhalten schien, und machte mich auf ein letztes Donnerwetter gefasst.
»Bratkartoffeln mit Spiegeleiern«, sagte er zu meiner Überraschung. »Das wollte ich gerade machen.«
»Bekomm ich da auch was?«, fragte Tommi hoffnungsvoll. »Ich mag so gern Kartoffeln. Und ich hab schon so Hunger.«
Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte.
»Nein, Tommi, ich hab dir doch gesagt, dass wir …«
»Eier sind im Kühlschrank«, unterbrach Alfred mich. »Gekochte Kartoffeln hier.« Er deutete auf einen Topf am Herd. »Es reicht bestimmt für drei.«
Er ging zur Tür.
»Wo gehst du denn hin?«, fragte Tommi.
Alfred drehte sich zu ihm um.
»Wachteln und Enten füttern.«
»Was sind Wachteln? Darf ich mit? Bitte, bitte«, bettelte Tommi.
»Nein!«
»Warum nicht?«
Mein Kleiner ließ nicht locker.
»Weil ich es sage!«
»Ich hab Enten im Tierpark gesehen. Und am See. Die schwimmen. Können deine Enten auch schwimmen?«
»Alle Enten können schwimmen.«
Damit ließ Alfred uns stehen und ging hinaus. Hermes trottete ihm hinterher.
»Na, dann werde ich mich hier mal an die Arbeit machen«, sagte ich. Immerhin bekam mein Kleiner so wenigstens noch etwas zu essen. »Und du kleiner Mann setzt dich jetzt an den Tisch.«
Er tat, was ich sagte, und ging zur großen Eckbank. Allerdings kniete er sich hin und sah durch das Fenster hinaus in den Hof.
Ich schaute mich um. Es herrschte ein mittelgroßes Chaos. Ich ließ Wasser einlaufen und spülte das Geschirr, damit ich einen sauberen Arbeitsplatz hatte.
Im Kühlschrank gab es Butter, in Papier eingewickeltes Geräuchertes, Essiggurken, Dosenfische und verschiedene Päckchen Käse. Und eine Porzellanschüssel, die mit einem Tuch abgedeckt war. An der Seite standen einige Flaschen Bier. Doch nirgends waren Eier zu finden. Aber er hatte doch gesagt, dass sie im Kühlschrank waren? Ob er vielleicht schon ein wenig senil war und seine Familie deswegen jemanden suchte, der hier mit auf dem Hof wohnte?
Ich holte die Porzellanschüssel heraus und staunte nicht schlecht, als ich darin die Eier fand. Aber keine normalen Hühnereier, sondern jede Menge braun gesprenkelter kleiner Wachteleier. Bestimmt an die fünfzig Stück. Daraus sollte ich die Spiegeleier machen?
In einem Körbchen waren rote Zwiebeln, von denen ich eine klein hackte und mit etwas Speck in Butter anbriet. Zuletzt gab ich die geschälten und gewürfelten Kartoffeln dazu.
»Hm. Das riecht gut, Mama.«
Allerdings. Auch mir lief schon das Wasser im Mund zusammen. Der Tag war anstrengend gewesen, und bis auf ein paar Kekse hatte ich seit dem Frühstück noch nichts gegessen. Überhaupt hatte ich die letzten Tage wenig Appetit gehabt, weil mir die ungewisse Situation inzwischen auf den Magen schlug.
Während die Kartoffeln langsam anrösteten, schlug ich die Schalen der kleinen Eier vorsichtig mit einem Messer ein und ließ den Inhalt in eine Schüssel gleiten. Ich würde die Spiegeleier erst dann anbraten, wenn Alfred wieder zurück war. Wie viele brauchte ich denn davon für eine Portion? Ich entschied mich für sechs Stück pro Person. Die Eier waren ja wirklich winzig.
Während ich den Tisch deckte, sah ich durchs Fenster, wie ein Wagen in den Hof fuhr und eine Frau ausstieg, die zielstrebig auf die Eingangstür zuging. Noch eine Kandidatin, die sich vorstellen will, dachte ich und zog die Pfanne vorsorglich auf eine andere Herdplatte.
Gleich darauf betrat die Frau die Küche.
»Guten Tag«, sagte sie. »Ich bin …«
Doch ich ließ sie gar nicht aussprechen.
»Falls Sie wegen des Aushangs im Supermarkt gekommen sind – tut mir leid, die Stelle ist nicht mehr frei.«
Ein überraschtes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht.
»Ach ja?«
»Ja.« Ich nickte bekräftigend, obwohl mir schon etwas mulmig bei der Schummelei war. Allerdings hatte der Bauer vorhin unmissverständlich klargestellt, dass er hier keine Hilfe wollte. Ich tat ihm also einen Gefallen, wenn er sich nicht auch noch mit dieser Dame auseinandersetzen musste.
»Ich bin Tommi«, sagte mein Sohn und sah die Frau neugierig an.
»Hallo, Tommi«, grüßte sie ihn freundlich.
»Sie sind leider umsonst hergekommen«, sagte ich schnell.
»Wirklich? Das überrascht mich jetzt ein wenig. Aber ich bin froh, das zu hören.«
Ich war irritiert. Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Wieso war sie froh darüber?
»Und Sie sind auch schon am Kochen!«
»Äh, ja.«
In diesem Moment kam Alfred von draußen herein.
»Was willst du denn hier?«, fragte er wenig begeistert.
»Ich hab gehört, du hast dich schon für jemanden entschieden?«, sagte die Frau zu ihm. In diesem Moment war mir klar, dass sie ganz offensichtlich nicht gekommen war, um hier kostenlos zu wohnen und mitzuhelfen.
Alfred schüttelte den Kopf.
»Ich brauch niemanden«, brummte er und setzte sich an den Tisch.
»Wissen Sie«, begann ich schnell. »Eigentlich ist es nicht ganz so, dass die Stelle nicht mehr frei ist.«
»Hätte mich auch gewundert.« Die Frau seufzte und streckte mir ihre Hand entgegen »Ich bin Helga Lippel. Die Nichte.«
Jetzt erkannte ich auch die Stimme wieder.
»Natürlich … Und ich Romy Bronner. Wir haben telefoniert. Es tut mir leid … ich hab das vorhin nur gesagt, weil Ihr Onkel niemanden hier haben will. Sobald das Essen fertig ist, werden mein Sohn und ich nach München zurückfahren.«
»Aber erst krieg ich Kartoffeln«, stellte Tommi klar.
»Ich versteh dich nicht, Onkel Alfred«, begann die Frau. »Du kannst das nie und nimmer länger alleine schaffen hier. Sieh dich doch nur um. Wenn du den Hof schon nicht übergeben willst, dann lass dir doch wenigstens helfen.«
»Brauchst du ein Hörgerät? Oder wie oft soll ich es noch sagen«, polterte er. »Mischt euch nicht ständig in meine Angelegenheiten! Ich bin noch ganz gut in der Lage, hier allein klarzukommen. Auch wenn ihr das nicht hören wollt!«
»Wir machen uns nur Sorgen um dich!«
»Einen Schmarrn tut ihr! Am liebsten wär es deinem Mann doch, wenn mich der Schlag treffen würde. Dann könntet ihr den Hof verkaufen und euch das Erbe teilen, solange es noch was zu teilen gibt!«
Helga schnappte nach Luft.
»Wie kannst du so was nur sagen? Traust du mir das wirklich zu, Onkel Alfred?«, fragte sie empört.
»Nein, dir nicht. Aber deinem Mann …« Es folgte ein bedeutungsvolles Schweigen.
»Weißt du was?« Sie sah ihn wütend an. »Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dann lass es eben bleiben.«
Sie drehte sich zu mir um.
»Mir war klar, dass mein Onkel ein Sturkopf ist, aber dass er so verbohrt ist, hätte ich nicht gedacht. Da kann man wohl nichts machen. Tut mir leid, dass Sie umsonst hergefahren sind, Frau Bronner.«
»Schon gut. Es war kein Umweg für mich.«
»Auf Wiedersehen.«
»Wenn du mir noch einmal jemanden herschickst, dann jag ich ihn vom Hof. Verstanden?«, drohte Alfred.
Ohne auch nur noch einen Blick mit ihrem Onkel zu wechseln, rauschte die Nichte hinaus und fuhr kurz darauf aus dem Hof. Wortlos setzte sich Alfred.
Ich machte mich eilig daran, das Essen fertig zu kochen. Dann stellte ich die beiden Pfannen auf den Tisch.
»Wenn’s recht ist, gebe ich nur noch meinem Sohn ein wenig, dann fahren wir.« Und das schien mir auch wirklich das Beste zu sein. Hier schwelte wohl schon länger ein Familienstreit. Da wollte ich nicht mit hineingezogen werden.
»Jetzt setzen Sie sich schon«, brummte Alfred. »Wer soll das denn alles essen?«
»Das sind ja kleine Babyeier!«, rief Tommi begeistert.
»Die sind von Wachteln!«, erklärte ich, während ich einen vollen Teller vor ihm abstellte. Auch Alfred bediente sich.
»Was sind denn jetzt überhaupt Wachteln?«, fragte der Kleine.
»Das sind so was wie ganz kleine Hühner.«
»Darf ich die dann anschauen?«
»Nein«, sagte Alfred.
»Warum nicht?«
»Jetzt iss, Tommi«, forderte ich ihn auf.
Und das ließ er sich nicht zweimal sagen. Ich war immer wieder verblüfft, welche Mengen er verdrücken konnte, wenn ihm etwas schmeckte. Gleichzeitig kam er auch mit sehr wenig aus, wenn es mal nicht nach seinem Geschmack war.
Als wir fertig waren, räumte ich den Tisch ab und wollte mich an den Abwasch machen.
»Ich mach das schon. Fahren Sie jetzt!«, sagte Alfred.
Ich legte den Spüllappen zur Seite.
»Danke, dass wir mitessen durften.«
»Schon gut. Möchten Sie vielleicht ein paar Eier mitnehmen?«
»Gern!«, nahm ich sein Angebot erfreut an.
Alfred holte einen kleinen Eierkarton aus einem Schränkchen und füllte ihn mit vierundzwanzig Wachteleiern.
»Die sind ganz frisch, die halten sich eine Weile.«
»Super! Das ist echt nett von Ihnen.«
Ich drehte mich zu Tommi, der vor Hermes stand und ihn interessiert beim Schlafen beobachtete. »Kommst du?«
»Können wir nicht noch ein wenig hierbleiben, Mami? Ich will doch noch die Wachteln sehen. Und die Enten.«
»Nein. Das geht nicht … Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Holler.«
»Danke. Ihnen auch.«
Bevor ich mich umdrehte, erhaschte ich seinen Blick, der für einen Moment traurig wirkte. Doch gleich darauf hatte er wieder diese abweisende mürrische Miene auf.
Er nickte uns zu, dann gingen wir.
Kapitel 3
September 1955 in Halling
»Jetzt lauf doch heim, Hexi!«, rief Alfred schon zum dritten Mal. »Du kannst nicht mit!« Der Siebenjährige hatte seiner Mutter beim Melken geholfen und war spät dran. Wenn er sich nicht beeilte, würde er gleich am ersten Tag im neuen Schuljahr zu spät kommen. »Geh! Ab!«, versuchte er es erneut mit den Kommandos, die er immer bei seinem Vater hörte. Doch die alte Dackeldame machte keinerlei Anstalten, sich wieder auf den Heimweg zu begeben. Seufzend zuckte Alfred mit den Schultern. Dann musste sie eben mit. Er hatte jedenfalls keine Zeit, sich weiter um sie zu kümmern. Alfred nahm die Abkürzung über die Weide und wich dabei geschickt den Kuhfladen aus. Dass seine Wadenstrümpfe inzwischen nass vom Tau auf den Gräsern waren, bemerkte er gar nicht.
Als er knapp zehn Minuten später die fünf Stufen zum Haupteingang der Schule hochflitzte, begann die Kirchturmglocke zur vollen Stunde zu schlagen. Acht Uhr. Oje. Das würde Ärger geben. Er drehte sich noch mal kurz um, aber Hexi war Gott sei Dank nicht mehr zu sehen. Sicher war sie inzwischen wieder auf dem Weg nach Hause, wo sie es sich in der Stube auf ihrer alten Decke gemütlich machte.
In der Eingangshalle, die auch als kleine Aula diente, war niemand mehr, doch aus einem Klassenzimmer hörte man das Rücken von Stühlen und gleich darauf einen Chor heller Kinderstimmen. »Guten Morgen, Fräulein Püschelmann.« Das musste die 2 a sein und damit seine Klasse. Denn Fräulein Püschelmann war schon im ersten Jahr seine Lehrerin gewesen und würde es noch ein weiteres Jahr bleiben. Das hatte sie ihnen am letzten Schultag noch verraten und damit ihrer Freude auf die langen Sommerferien einen gehörigen Dämpfer verpasst.
Mit klopfendem Herzen öffnete er die Tür, und alle Köpfe drehten sich zu ihm. Einige Kinder kicherten verhalten.
»Entschuldigung«, murmelte Alfred kleinlaut.
Die Lehrerin sah ihn mit hochgezogenen Brauen an, und da sie ihre Haare stets streng zu einem dicken Knoten am Hinterkopf gesteckt hatte, erinnerte ihr rundes Gesicht mit der spitz zulaufenden Nase an eine Eule.
»Entschuldigung, Fräulein Püschelmann«, setzte er hinzu, da ihm wieder eingefallen war, wie viel Wert sie darauf legte, dass man sie immer mit ihrem Namen ansprach.
»Wer kommt zu spät? Natürlich der Holler Alfred. Setz dich sofort!«
Wenig erfreut stellte Alfred fest, dass der einzige freie Platz ganz vorne beim Pult der Lehrerin war, wo sonst immer die kleinsten Mädchen saßen. Und als ob das noch nicht genug wäre, war sein Banknachbar ein pummeliger Junge, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Was hatte der wohl angestellt, dass er schon am ersten Tag ganz vorne sitzen musste?
Um Fräulein Püschelmann nicht noch mehr zu verärgern, schlüpfte Alfred rasch zwischen den Bänken hindurch an seinen Platz.
»Vor dem Morgengebet möchte ich euch einen neuen Klassenkameraden vorstellen«, sagte die Lehrerin, und alle Blicke richteten sich nun auf den Jungen neben Alfred, der den Kopf einzog.
»Steh doch bitte mal auf, Wolfgang.«
Langsam und noch immer mit gesenktem Kopf erhob sich der Junge.
»Wolfgang Linde kommt aus Köln. Seine Mutter ist die neue Haushälterin bei unserem Herrn Pfarrer«, erklärte die Lehrerin.
Einige der Kinder begannen zu tuscheln, doch ein strenger Blick von Fräulein Püschelmann genügte, damit es sofort wieder mucksmäuschenstill im Klassenzimmer war. Dann ließ sie alle zum Beten aufstehen.
Der erste Schultag war unterbrochen von einem Gottesdienst und glücklicherweise schon nach der fünften Stunde vorbei. Als die Schulglocke ertönte, hatten es die Kinder eilig, nach draußen zu kommen. Alfred war schon auf dem Weg zur Tür, da rief ihn die Lehrerin noch einmal zurück.
»Alfred?«
Er blieb stehen, fühlte sich ertappt, dabei hatte er doch gar nichts angestellt.
»Ja, Fräulein Püschelmann?«
»Wenn du noch einmal zu spät kommst, lasse ich dich einen ganzen Nachmittag nachsitzen. Verstanden?«
»Ja.«
Die Augenbrauen hoben sich wieder.
»Ja, Fräulein Püschelmann.«
Und dann ließ sie ihn endlich gehen.
Die anderen Kinder waren alle schon weg, und Alfred beeilte sich, nach Hause zu kommen. Seine Mutter hatte versprochen, zum ersten Schultag einen Apfelstrudel zu backen, und schon wenn er daran dachte, lief ihm das Wasser im Mund zusammen.
Er war erst ein paar Minuten unterwegs, da sah er drei Jungs an der kleinen Holzbrücke stehen, die über den Weidenbach führte. Um wieder die Abkürzung zu nehmen, müsste Alfred die Brücke überqueren. Er zögerte kurz, denn die drei waren ihm nur allzu bekannt. Sie gingen in die fünfte Klasse und machten ständig Ärger. Vor allem einer von ihnen: Uwe Dinkel, der offenbar glaubte, andere schikanieren zu können, nur weil sein Vater ein vermögender Autohändler war. Vielleicht sollte er sich lieber verdrücken? Doch wenn er umkehren und den längeren Weg nehmen würde, käme er viel später nach Hause. Und dann hätten ihm die anderen seine Lieblingsspeise vielleicht schon weggegessen. Außerdem hatten die Jungs ihn, zumindest bis jetzt, immer in Ruhe gelassen. Er würde es einfach wagen, schließlich wollte er auch kein Angsthase sein!
Als er näher kam, hörte er ein klägliches Schreien und gleich darauf schadenfrohes Gelächter und Gejohle.
»Haltet ihn fest«, rief Uwe. Er war der Kleinste, aber trotzdem Anführer des Trios. Alfred erschrak, als er sah, dass die zwei anderen den Neuen aus Köln an den Füßen gepackt und kopfüber über das Brückengeländer gehängt hatten, so dass seine Haare schon fast im Wasser hingen. Sein Pullover war nach unten gerutscht, und man sah seinen schwabbeligen weißen Bauch.
»Nein!«, schrie Wolfgang panisch auf, und die Jungs lachten noch lauter.
Alfred war gleichzeitig entsetzt und wütend darüber, wie die drei Rabauken den Jüngeren schikanierten. Und auch wenn er bisher in der Schule kaum ein Wort mit dem Neuen gewechselt hatte und er viel lieber neben einem seiner Freunde sitzen würde, so tat der Junge ihm leid. Was sollte er machen? Weglaufen? Sich einmischen?
»Bitte nicht!« Wolfgangs Stimme überschlug sich vor Angst, was den dreien nur noch mehr zu gefallen schien. Das war der Moment, in dem Alfred seinen ganzen Mut zusammennahm.
»Hört sofort auf!«, schrie er so laut, dass die Buben sich erschrocken zu ihm umdrehten. Als sie bemerkten, dass es nur Alfred war, lachten sie.
»Was willst du denn, du Hosenscheißer?«, fragte Uwe, der selbst nicht viel größer war als Alfred.
»Lasst ihn los«, beharrte er und war selbst überrascht über sein Auftreten.
»Ja? Willst du das?« Uwe lächelte seltsam.
»Ja!«
»Na, wenn du das willst …«
Alfred atmete erleichtert auf.
»Danke.«
»Dann lasst ihn mal los, Jungs.«
Bevor Alfred realisierte, was das bedeutete, platschte Wolfgang bereits ins Wasser.
»Und jetzt ihn«, befahl Uwe weiter.
Und schon hatten sich Uwes Handlanger Alfred geschnappt. Er versuchte sich zu wehren und trat wild um sich. So leicht würde er sich nicht geschlagen geben. Doch es half nichts. Die anderen waren stärker, und so landete auch Alfred samt Schultasche im Wasser.
An dieser Stelle war der Weidenbach nach den Regenfällen der letzten Tage zum Glück tief genug, und so hatten sich weder Alfred noch Wolfgang an den Steinen im Bachbett verletzt.
»Viel Spaß beim Schwimmen!«, rief Uwe und machte sich lachend mit den anderen davon.
Wolfgang ruderte noch immer hektisch mit den Armen herum.
»Halt still!«, rief Alfred, aber der dicke Junge schien ihn gar nicht zu hören. Schließlich packte Alfred ihn beherzt am Arm und zog ihn mühevoll aus dem Wasser. Wolfgang hustete und würgte. In seiner Panik hatte er jede Menge Wasser geschluckt. Alfred klopfte ihm auf den Rücken, bis Wolfgang sich erbrach, worauf es ihm bald besser ging. Erschöpft sanken sie ins Gras. Eine Weile lagen sie einfach da und sagten kein Wort.
»Danke«, murmelte Wolfgang schließlich in seinem Kölner Dialekt.
»Passt schon!«
»Ich kann nicht schwimmen«, gestand Wolfgang verlegen.
»Was?«, fragte Alfred ungläubig. »Aber jeder kann doch schwimmen!«
»Ich nicht.«
Alfred wischte einen Wassertropfen weg, der aus den Haaren über seine Stirn rann.
»Meine Mutter wird ziemlich böse sein, wenn ich so nach Hause komme«, sagte Wolfgang.
»Meine auch … Und deine ist wirklich Haushälterin beim Pfarrer?«
Wolfgang nickte.
»Und was macht dein Vater?«
»Der ist im letzten Jahr gestorben«, sagte er leise und senkte den Kopf.
Alfred sah ihn betroffen an. Seine Eltern zu verlieren war das Schlimmste, das er sich vorstellen konnte.
»Tut mir leid.«
»Deswegen sind wir aus Köln weg. Weil Mama dort keine Arbeit bekam.«
»Vermisst du es?«
»Ja. Meistens.«
Die Spätsommersonne verschwand hinter dicken Wolken. Alfred begann langsam zu frieren.
»Gehen wir?«
Wolfgang nickte.
Alfred stand auf, streckte Wolfgang die Hand hin und half ihm hoch.
Sie nahmen ihre Schulranzen und gingen nebeneinander her, bis plötzlich dicke schwere Regentropfen auf sie niederprasselten.
»Wenigstens sind wir schon nass«, sagte Wolfgang und warf seinem Retter ein schiefes Lächeln zu. Dann lachten sie beide.
»Sag mal, magst du eigentlich Apfelstrudel?«
»Kenn ich nicht«, gab Wolfgang zu.
»Dann komm mit. Vielleicht ist ja noch was für dich übrig.«
Alfred grinste Wolfgang zu, dann rannten sie los.
Ab diesem Tag wurden aus Alfred und Wolfgang beste Freunde.
Kapitel 4
»Schau mal, Mami, die vielen Kühe!«, rief Tommi begeistert und deutete auf eine Weide neben der Straße. »Hier ist es so schön.«
»Ja, finde ich auch«, stimmte ich ihm zu. Die Gegend hier war tatsächlich herrlich.
Wir waren noch keine fünf Kilometer gefahren, als wir an einen Kreisverkehr kamen. Ein Schild zeigte den Weg zur Autobahn Richtung München.
Doch anstatt den Kreisverkehr bei der zweiten Ausfahrt zu verlassen, drehte ich in einem spontanen Entschluss eine komplette Runde und fuhr wieder zurück in Richtung Holler-Hof. Ich konnte mir nicht erklären, warum, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, es noch ein allerletztes Mal versuchen zu müssen.
»Auch wenn das verrückter als verrückt ist – so einfach gebe ich nicht auf«, murmelte ich entschlossen.
Alfred ging gerade in Richtung Scheune, als wir ein zweites Mal in den Hof fuhren. Sein Blick war alles andere als begeistert. Doch davon ließ ich mich nicht abschrecken. Ich parkte und stieg aus dem Wagen.
»Zwei Wochen Probezeit!«, sagte ich.
»Was muss ich denn noch tun, damit ich …«
»Ja, ich weiß, Sie wollen hier niemanden haben«, fiel ich ihm ins Wort. »Aber mal ehrlich. Wenn man sich hier am Hof und im Haus so umschaut, dann würde es echt nicht schaden, wenn Sie ein bisschen Hilfe hätten. Bitte, können wir nicht einen Deal machen? Wir müssen bald aus unserer Wohnung, und ich weiß nicht, wohin. Ich sag das nicht, weil ich Mitleid möchte oder Almosen – ich will einfach nur eine Chance. Und glauben Sie mir, es fällt mir verdammt schwer, Sie darum zu bitten. Aber versuchen wir es, bitte – nur vierzehn Tage. Und wenn es nicht klappt, dann verspreche ich hoch und heilig, dass Sie mich niemals mehr wiedersehen werden.«
Ich war außer Atem, und mein Herz klopfte so wild gegen meine Brust, als ob ich gerannt wäre.
Alfred sah mich mit ausdruckslosem Blick an. Ich biss auf Granit. Das war’s. Aber zumindest hatte ich es noch mal versucht.
»Dann halt nicht!«, sagte ich resigniert und ging zum Wagen.
»Na gut. Aber nur eine Woche!«
Ich schluckte und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Hatte ich das jetzt richtig verstanden? Langsam drehte ich mich zu ihm um. Sein Gesichtsausdruck hatte sich nicht verändert.
»Wirklich?«
»Unter einer Bedingung.«
»Welcher?«
»Fahren Sie zu diesem Supermarkt, und nehmen Sie die verdammten Zettel ab, falls noch welche herumhängen. Ich traue es meiner Nichte nämlich zu, dass sie nicht aufgibt, wenn noch mal jemand bei ihr anruft.«
Vor Erleichterung fühlten sich meine Knie so weich wie Gummi an.
»Das mach ich. Sofort. Versprochen!«
Ich streckte ihm die Hand entgegen.
»Und jetzt noch mal ganz offiziell. Ich heiße Romy. Romy Bronner. Und das ist Tommi, mein Sohn.«
Nach einem kurzen Zögern nahm er meine Hand und schüttelte sie mit einem festen Händedruck.
»Lassen wir das mit dem ›Sie‹. Ich bin Alfred.«
Nach Alfreds völlig überraschendem Sinneswandel war ich mit Tommi erneut nach Passau gefahren. Der Supermarkt lag in der Nähe der Steuerkanzlei, in der Helga halbtags arbeitete, wie ich inzwischen von Alfred wusste. Zwei Abreißzettel mit dem Angebot zum kostenlosen Wohnen auf dem Bauernhof hingen noch an der Pinnwand.
Nachdem ich mein Versprechen eingelöst hatte, machten wir uns auf den Weg nach Hause. Als wir zwei Stunden später in München ankamen, war es bereits dunkel geworden. Während Tommi schlief, begann ich eilig zu packen. Ich würde zunächst nur Kleidung für eine Woche, wenige Spielsachen und die wichtigsten persönlichen Dinge mitnehmen. Da ich das Auto meiner Nachbarin nicht eine ganze Woche lang ausleihen konnte, würden wir mit dem Zug fahren.
Es war schon weit nach Mitternacht, als ich ins Bett kam. Doch ich konnte ewig nicht einschlafen. Jetzt, nachdem ich endlich zur Ruhe kommen konnte, fragte ich mich, ob es nicht eine Schnapsidee war, diese Probezeit zu vereinbaren. Den ganzen Tag über war es mir nur wichtig erschienen, einen Ausweg aus unserem Dilemma zu finden. Doch war das tatsächlich der richtige Weg? Was, wenn Alfred immer so grantig war? Könnte ich es aushalten, mit so einem Menschen unter einem Dach zu leben? Und vor allem: Durfte ich das meinem Sohn zumuten? Aber vielleicht war er ja gar nicht so schlimm, wenn man ihn näher kannte? Außerdem gab es hier für mich momentan keine Alternative. So oder so konnte ich mir München nicht mehr länger leisten.
Ich würde mich einfach auf das Abenteuer auf dem Holler-Hof einlassen und mir eine Woche lang anschauen, wie wir zurechtkamen. Falls es uns dort überhaupt nicht gefiel oder wir es mit Alfred gar nicht aushalten konnten, wäre meine Situation kaum schlimmer als bisher. Also hatte ich nichts zu verlieren. Und es gab noch einen weiteren Grund, warum ich mein Glück versuchen wollte. Ich hatte mich auf dem Hof sofort wohlgefühlt und den Eindruck gehabt, dass auch dieser Alfred wirklich jemanden brauchte. Das könnte ein gutes Arrangement für uns beide sein.
Als ich knapp vierzehn Stunden später in dem Zimmer des Hauses stand, das von nun an – zumindest für eine Woche – mein neues Schlafzimmer sein sollte, konnte ich es kaum glauben. Tommi hüpfte begeistert im Bett auf und ab, das ein rhythmisches Quietschen von sich gab.
»Es. Ist. Schön. Hier. Mami«, stieß er begeistert bei jedem Sprung ein Wort aus.
»Ja«, sagte ich und setzte in Gedanken hinzu: Schön altmodisch. Die glänzend lackierten Schlafzimmermöbel, eine Plisseehängelampe und gerüschte Vorhänge versprühten den Charme einer Kulisse für eine Putzmittelwerbung aus den sechziger Jahren. Trotzdem war es auf eine besondere Weise gemütlich. Allerdings musste erst gründlich sauber gemacht werden, bevor ich unsere Sachen einräumen und wir hier wohnen konnten. Ich riss die Fenster auf. Der Ausblick auf die sanften Hügel des bayerischen Waldes in der Ferne erinnerte mich ein wenig an die Toskana, in der ich als Kind zweimal mit meinen Eltern Urlaub gemacht hatte.
Fürs Erste würden Tommi und ich hier in dem großen Doppelbett schlafen. Das angrenzende kleinere Zimmer war momentan noch eine Abstellkammer für allerlei Krimskrams. Das könnte ich später als Kinderzimmer herrichten. Falls wir hierbleiben sollten.
Alfred war verschwunden, nachdem er uns die Räume gezeigt hatte. Er war noch grantiger gewesen als gestern. Ich hoffte sehr, dass seine Laune sich bald bessern würde.
»Eine Katze!«, rief Tommi und sprang mit einem Satz aus dem Bett. Ich sah nur noch einen getigerten Schwanz, der um die Ecke verschwand, gefolgt von meinem Sohn.
»Sei vorsichtig, Tommi!«, mahnte ich ihn, doch mein Kleiner war schon weg. Ich seufzte und eilte ihm hinterher. Er hatte eine über zweistündige Zugfahrt hinter sich, und sein Bewegungsdrang war kaum zu bremsen. Am besten machte ich einen kleinen Spaziergang mit ihm, damit er sich austoben konnte. Das war auch eine gute Gelegenheit, die Gegend ein wenig zu erkunden. Um das Zimmer würde ich mich danach kümmern.
Tommi war der Katze bis nach draußen gefolgt.
»Mami, schau, die hat nur drei Beine!«, rief er aufgeregt und deutete zu dem Tier, das schnell wie der Wind in Richtung Stall davonlief. Offensichtlich schien es die Katze nicht zu beeinträchtigen, dass ihr rechtes Hinterbein fehlte.
»Warum hat die Katze ein Bein weniger?«, wollte Tommi wissen.
»Keine Ahnung. Da müssen wir später Alfred fragen. Komm, wir sehen uns ein wenig um.«
Tommi war begeistert. Der Bauernhof war das reinste Paradies für ihn. Es gab zwar keine Kühe mehr – worüber ich sehr froh war –, allerdings tummelten sich auf einem eingezäunten eher kargen Teil der Weide zwei Schafe, drei Ziegen und ein Esel. Es gab einen Unterstand, unter den sich die Tiere bei zu großer Hitze oder Regen zurückziehen konnten. Daneben schwammen in einem Teich, der zum Glück eingezäunt war, ein paar Enten. Hinter dem Stall entdeckten wir eine große Voliere, die mit Büschen, Steinen, dicken Ästen und Rindenstücken und mehreren Tonschalen mit Sand eingerichtet war. Außerdem gab es Futter- und Wasserspender. Eine Öffnung verband die Voliere mit dem Stall. Ich kannte mich mit diesen Tieren zwar nicht aus, vermutete aber, dass sie dort die Nacht verbrachten.
»Sind das die Wachteln?«, fragte Tommi aufgeregt und deutete auf eines der Tiere, das hingebungsvoll ein Sandbad nahm.
»Ja, du kleiner Schlaumeier. Das sind Wachteln.«
»Die sind aber süß! Darf ich die streicheln?«
»Nein!«
Erschrocken drehten wir uns um. Alfred war aufgetaucht, ohne dass wir ihn bemerkt hatten.
»Warum nicht?«
Der Bauer schnaubte kurz. Mit Erklärungen hatte er es wohl nicht so. Doch dann ging er plötzlich in die Hocke und sah Tommi auf Augenhöhe an.
»Die Wachteln sind noch nicht lange hier«, sagte er dann ruhig. »Die kann man noch ganz leicht erschrecken. Deswegen müssen sie sich erst an dich gewöhnen.«
»Haben die Angst vor mir?«, wollte Tommi wissen.
»Vielleicht.«
»Aber ich tu denen doch nichts.«
»Das wissen die Wachteln aber nicht.«
»Hmmm … schade …« Tommi warf einen traurigen Blick in die Voliere.
»Komm jeden Tag hierher und erzähle den Wachteln eine kleine Geschichte. Dann gewöhnen sie sich an deine Stimme«, schlug Alfred vor.
»Und dann fürchten sie sich nicht mehr vor mir?«
»Vielleicht. Aber du darfst niemals allein ohne mich hineingehen. Verstanden?«
Er nickte eifrig.
»Verstanden.«
»Gut. Sonst gibt es nämlich ein Donnerwetter.«
Tommi nickte noch mal.
Damit stand Alfred auf und ging in Richtung Scheune davon. Ich sah ihm erstaunt hinterher. Im Gegensatz zu seiner schlechten Laune gestern und heute bei unserer Ankunft war er gerade ein Ausbund an Freundlichkeit gewesen.
Inzwischen war es Abend geworden, und ich fühlte mich total erschlagen. Während Tommi spielte, hatte ich am Nachmittag das Zimmer blitzblank geputzt, die Betten frisch bezogen und unsere Sachen im Schrank verstaut. Tommi war vor wenigen Minuten eingeschlafen, und ich ging nach unten.
Alfred saß mit einer Flasche Bier auf der Bank an einem Holztisch vor dem Haus. Neben ihm lag Hermes und kaute voller Hingabe an einem Knochen.
»Ab morgen wird dann gekocht«, sagte ich. Ich hatte es gerade mal geschafft, ein paar Wurstbrote zu machen.
»Wir sind nicht verhungert«, bemerkte Alfred.
»Wir können eine Liste machen, welche Gerichte du magst und was überhaupt meine Aufgaben hier sind.«
»Hm«, brummte er nur.
»Ist es recht, wenn ich mir auch ein Bier hole?«, fragte ich.
Alfred nickte. Da seine Flasche fast leer war, nahm ich ihm auch noch gleich eine Halbe mit nach draußen.
So warm es tagsüber schon war, so frisch wurde es, sobald die Sonne verschwunden war, und ich fröstelte ein wenig in meiner dünnen Jacke, die ich über dem T-Shirt trug. Aber um noch mal nach oben zu gehen und mir etwas Wärmeres zu holen, war ich zu faul.
»Danke noch mal, dass wir hier sein dürfen«, sagte ich und setzte rasch hinzu: »Wenn auch erst nur zur Probezeit.«
Alfred nickte, nahm einen Schluck, und ich tat es ihm gleich. Eine Weile lang schwiegen wir. Ich zupfte am Etikett der Flasche.
»Warum?«, fragte ich plötzlich und sah ihn an.
»Warum was?«
»Warum hast du doch noch zugestimmt?«