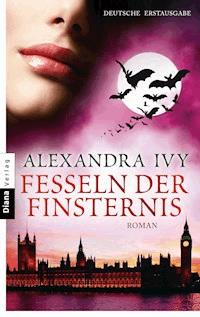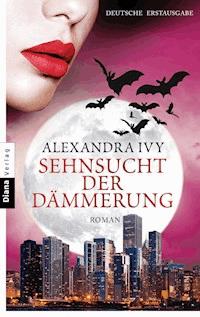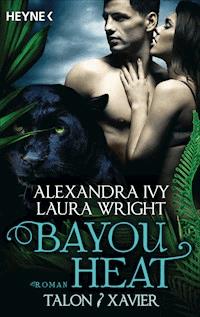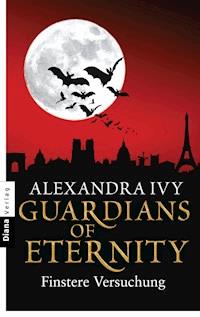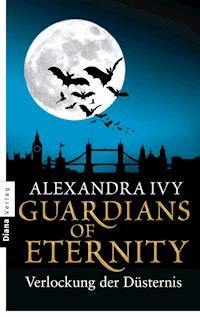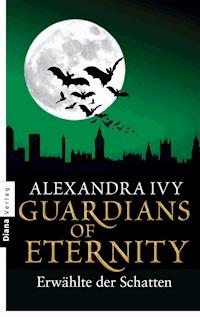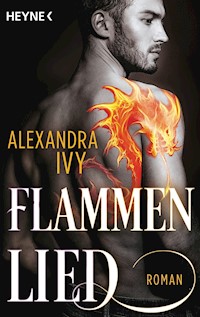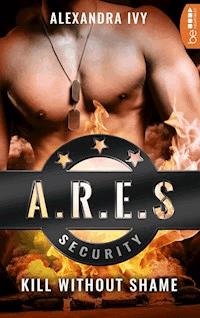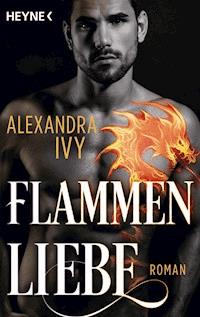6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Bayou Heat-Serie
- Sprache: Deutsch
Zwei heiße neue Liebespaare und zwei neue atemberaubende Abenteuer
Die Bayous sind ein Ort voller Magie und Geheimnisse. Dort leben die Pantera, ein Clan mächtiger Gestaltwandler. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten soll ein Kind in diesem Clan geboren werden, doch das Glück der Pantera wird schnell getrübt, denn die werdende Mutter wird von den Feinden der Pantera entführt. Als die beiden sexy Krieger Bayon und Jean-Baptiste ausgeschickt werden, um sie zurückzuholen, sind sie auf alles vorbereitet – nur nicht auf die beiden atemberaubend schönen Frauen, die ihnen ihre Mission erschweren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ALEXANDRA IVY
LAURA WRIGHT
BAYOU
HEAT
BAYON & JEAN-BAPTISTE
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Titel der amerikanischen OriginalausgabeBAYOU HEAT – BAYON/JEAN-BAPTISTE
Deutsche Übersetzung von Cornelia Röser
Redaktion: Anna Katharina Gruber
Copyright © 2013 by Alexandra Ivy and Laura Wright
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter der Verwendung von thinkstock / iStock /inarik
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-15328-1V005
www.penguin.de
Die Sage von Opela und Shakpi
Tief unter dem Bayou regte sich Shakpi in ihrem dunklen Gefängnis. Jahrhundertelang war sie unter dem erdrückenden Gewicht der Magie gefangen gewesen, dem letzten Geschenk ihrer Schwester Opela an ihre geliebten Pantera.
Eine uralte Wut wallte in ihr auf, deren Druckwellen das Land über ihr erschütterten. An allem waren nur diese verdammten Pumas schuld.
Am Anfang hatte es nur sie und Opela gegeben. Zwillingsschwestern, geboren aus Magie, die dazu bestimmt waren, über die Welt zu herrschen. Sie hatten alles gemeinsam gemacht und niemand anderen gebraucht.
Dann wurde Opelas Kinderwunsch übermächtig. Sie behauptete, das Dasein hätte keinen Sinn, wenn sie ihre Liebe nicht ihren eigenen Geschöpfen schenken konnte. Ohne an jemand anderen als sich selbst zu denken, erschuf Opela eine neue Spezies – die Pantera – die sie als ihre Kinder betrachtete.
Shakpi hatte alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihre Schwester davon abzuhalten. Sie hatten doch einander. Wozu brauchten sie jemand anderen? Aber Opela hatte nicht auf ihre Bitten gehört und stattdessen die Pantera mit all ihrer Liebe und Hingabe überschüttet.
Von Neid zerfressen, hatte Shakpi geplant, diese Monstren umzubringen. Sterbliche Wesen waren nicht dazu bestimmt, mit Opelas Magie gesegnet zu werden. Auch sollten sie nicht die Fähigkeit besitzen, sich in Pumas zu verwandeln. Sie waren eine Abscheulichkeit, die vernichtet werden musste.
Shakpi war zuversichtlich gewesen, dass ihre Schwester Verständnis für ihren Wunsch haben würde, zu ihrem früheren Leben zurückzukehren – einem Leben, in dem sie beide glücklich gewesen waren. Zusammen.
Für die Zerstörung geboren, konnte sie selbst keine Kinder erschaffen, die sie als Werkzeuge für ihre Rache hätte benutzen können. Stattdessen infizierte sie Menschen mit ihrem bösartigen Gift und gab ihnen die Macht, es in den Bayous zu verbreiten. So sollten sie die Magie zerstören, die den Pantera ihre Macht verlieh.
Wie hätte sie ahnen können, dass ihre Schwester das höchste aller Opfer bringen würde? Dass Opela ihre eigene Lebenskraft einsetzen würde, um Shakpi in diesem Grab gefangen zu halten und ihre Kinder zu schützen?
Aber sie hatte Shakpi unterschätzt.
Nach Jahrhunderten der Gefangenschaft drangen ihre Fangarme nun endlich über die Grenzen ihres Gefängnisses hinaus und erreichten die Schwachen, die Verzweifelten und die Gierigen.
Ihre Infektion breitete sich aus, und diesmal würde sie nichts daran hindern, ihre Feinde zu zerstören …
Erstes Buch
Bayon
von
Alexandra Ivy
1
Die Wildlands in den Tiefen der Bayous von Louisiana waren nie ein friedlicher Ort gewesen.
Das magische Land der Pantera war von Puma-Gestaltwandlern bevölkert, die nicht nur die volle Aggressivität ihrer Tierwesen in sich trugen, sondern auch die unbeständigen Gefühle der Menschen. Eine solche Kombination führte zu reichlich Leidenschaft und Konflikten, und so war im Laufe der Jahrhunderte nicht gerade wenig Blut geflossen.
Aber noch nie zuvor hatten Feinde durch die Grenzen der Wildlands schlüpfen können, um die Pantera direkt anzugreifen.
Während sich unter den versammelten Pantera noch Wellen des Entsetzens ausbreiteten, rannte Bayon zur Grenze ihres Territoriums. Raphael war bei seiner schwangeren Gefährtin Ashe geblieben, ihm konnte er nicht helfen. Er hatte nicht das Talent, Ashe zu heilen oder das geheimnisvolle Böse zu bekämpfen, das versuchte, das Baby in ihrem Bauch zu vernichten.
Bayon war ein Jäger. Ein großer Mann mit golden schimmernden Haaren, dessen Augen bei Erregung zwischen Grün und tief Golden changierten und der die festen Muskeln eines Kriegers hatte. Sein Talent lag darin, diese Schweine, die es gewagt hatten, in seine Heimat einzudringen, zu fangen und zu vernichten.
Gut, zuerst würde er sie foltern. Langsam. Qualvoll. Er musste erfahren, wer sie waren und ob sie wirklich Anhänger von Shakpi, der Erzfeindin der Pantera waren.
Vorher allerdings musste er seinen derzeitigen Auftrag für Raphael erledigen.
Als er sich dem stellenweise von Trauerweiden verborgenen Wohnhaus näherte, verlangsamte er sein rasantes Tempo.
Die meisten Pantera zogen es vor, mit ihren jeweiligen Fraktionen in der Hauptgemeinde zu leben. Da gab es die Diplomaten, die sich mit allen politischen Angelegenheiten befassten, darunter auch das Netzwerk von Spionen und die Geeks, die ihre Magie mittels Computern ausübten. Es gab die Versorger, die eine der besten medizinischen Einrichtungen der Welt aufgebaut hatten, um die Ursache für den Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit bei den Pantera zu erforschen. Außerdem gab es die Ältesten, die obersten Herrscher und spirituellen Führer dieser magischen Spezies der Puma-Gestaltwandler.
Und dann gab es noch die Jäger.
Die Krieger, die alles daransetzten, ihr Volk zu beschützen.
Aber es gab auch Pantera, die die Einsamkeit suchten.
Parish, der Anführer der Jäger, hatte in Höhlen am anderen Ende der Wildlands gelebt, nachdem Menschen seine Schwester umgebracht hatten. Alle hatten Verständnis für sein Bedürfnis gehabt, ungestört zu trauern.
Was Jean-Baptiste, einen ihrer besten Heiler, dazu gebracht hatte, sich von seiner Familie abzuschotten und so weit von allen anderen entfernt zu leben, wusste Bayon nicht. Und er hatte nicht vor, ihn danach zu fragen. Pantera lebten zwar in einer eng verwobenen Gemeinschaft, aber das bedeutete vor allem, dass es klare Grenzen in Sachen Privatsphäre geben musste. Wer seine Nase in fremde Angelegenheiten steckte, musste damit rechnen, dass sie ihm abgebissen wurde.
Mit einem Satz sprang Bayon auf die umlaufende Veranda vor Jean-Baptistes Holzhaus und hämmerte mit der Faust gegen die schwere Holztür. Als niemand öffnete, zog er ein finsteres Gesicht.
Verdammt. Er wusste, dass Jean-Baptiste zu Hause war.
Also warum zum Geier ignorierte er ihn?
»Jean-Baptiste«, knurrte er, seine Stimme scharf vor Ungeduld. Er hatte keine Zeit für solchen Mist. »Ich weiß, dass du da bist. Mach die scheiß Tür auf.«
Eine Reihe hässlicher Verwünschungen hallte durch das Haus, bevor die Tür aufgerissen wurde und ein Pantera-Mann vor ihm stand. Er war über eins achtzig groß und hatte dunkelbraune, kinnlange Haare, und Augen in einem eigentümlichen Bernsteinton. Wie Bayon trug er verwaschene Jeans und derbe Kampfstiefel, und über seinem schlanken, muskulösen Oberkörper spannte sich ein weißes T-Shirt. Anders als Bayon trug er eine schwere Lederjacke, unter der sich die zahlreichen Tätowierungen verbargen, die Bayon bisher nur aus der Ferne gesehen hatte. Oh, und er hatte die Art Piercings, mit denen er aussah, als würde er zu einer Motorradgang gehören, nicht in ein Krankenhaus.
»Verdammt, was ist?«, fauchte Jean-Baptiste.
»Du wirst gebraucht.«
Die bernsteinfarbenen Augen verengten sich. »Warum?«
Bayon ballte die Fäuste, immer noch pulsierte blanke Wut in seinem Körper »Raphaels Gefährtin wurde angegriffen.«
Offenbar waren die Neuigkeiten noch nicht bis zu dem Heiler vorgedrungen. »Wo?«
»Hier. In den Wildlands.«
Vor Schreck über Bayons unverblümte Erklärung, zuckte Jean-Baptiste zusammen. Wütende Ungläubigkeit knisterte in der Luft.
»Unmöglich.«
Jean-Baptiste hatte recht, es hätte unmöglich sein müssen.
Und das machte Bayon nur noch wütender.
»Tja, das kannst du ja Ashe erklären.«
Eine lange Stille entstand, während Jean-Baptiste Mühe hatte, dieses beispiellose Ereignis zu begreifen.
»Wann ist es passiert?«
»Bei der Jagd.«
Jean-Baptiste kam auf die Veranda und lief mit grimmiger Miene auf den Holzbohlen auf und ab. Offensichtlich hegte er düstere Gedanken.
»Wer würde es wagen, in die Wildlands einzudringen?«
Bayon zog die Lippen kraus und bleckte seine Reißzähne. »Das gedenke ich herauszufinden. Aber erst will Raphael dich im Krankenhaus sehen.«
Jean-Baptiste blieb abrupt stehen, seine Kieferpartie verspannte sich. »Falls es deiner Aufmerksamkeit entgangen ist, mon ami, ich bin nicht im Dienst.«
»Zu schade«, sagte Bayon, der nicht in der Stimmung war, die Gefühle seines Freundes mit Samthandschuhen anzufassen. Was dieser Kerl auch für ein Problem hatte, er würde es verdammt noch mal auf Eis legen müssen. Nichts war wichtiger, als Ashe und ihr Baby zu retten. »Du wirst gebraucht.«
In den bernsteinfarbenen Augen glühte die Kraft seines Pumas. »Nein.«
Bayon trat auf ihn zu. Er war einer der wenigen Pantera, die keine Angst vor dem Gebiss dieses Mannes hatten. »Hör mal, ich weiß ja nicht, was dir für eine Laus über die Leber gelaufen ist …«
»Es gibt andere Heiler, die besser geeignet sind, um einen Menschen zu behandeln«, fuhr Jean-Baptiste ihn an.
Bayon wich keinen Schritt zurück. »Raphael braucht nicht deine Heilkünste.«
Sein Freund verharrte reglos. »Was dann?«
»Sie spüren, dass etwas von Ashe Besitz ergreifen will. Oder von dem Baby«, erklärte er. »Du musst nach New Orleans gehen und einen Talisman finden, der das Böse abhält, bis wir den Ursprung des Angriffs ausmachen können.«
»Scheiße.« Der Heiler zog eine Grimasse und fuhr sich durch die Haare. Er wusste, dass er diese Aufgabe nicht ablehnen konnte. Von der Rettung des Babys konnte ihre ganze Zukunft abhängen. »Sag ihm, ich …«
»Sag es ihm selbst. Ich bin ein Jäger, kein beschissener Kurier«, knurrte Bayon, während er bereits zum Rand der Veranda ging und über einen dichten Strauch gelber Teichrosen sprang.
Als er den Boden berührte, hatte er sich schon in seine Pumagestalt verwandelt, und die aufwallende Magie, die ihn durchfuhr, ließ sein Herz vor Freude höher schlagen.
Sein Brüllen hallte durch die schwere, feuchte Luft. Mère de dieu. Es gab nichts Berauschenderes, als das Tier in ihm zur Jagd loszulassen. Er bleckte seine gewaltigen Zähne, als sein Puma ihn an eine Sache erinnerte, die noch berauschender war.
Heißer, wilder Sex, bei dem die Frau vor Lust schrie.
Nein. Nicht irgendeine Frau.
Die richtige Frau.
Etwas, das ihm viel zu lange verwehrt geblieben war.
Mit einem ungeduldigen Kopfschütteln verscheuchte er den schmerzlichen Gedanken. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt.
Er rannte leichtfüßig über den sumpfigen Boden und suchte mit seinen scharfen Sinnen nach Spuren der Eindringlinge, fand jedoch nichts, bis er an den schmalen Fluss kam, auf dem Ashe angegriffen worden war. Er stieß ein tiefes, kehliges Knurren aus, als er den säuerlichen Geruch der Eindringlinge witterte und dem Gestank zum Rand ihres Territoriums folgte.
Entweder hatten die Eindringlinge unverschämtes Glück gehabt und waren direkt nach dem Betreten der Wildlands über genau die Person gestolpert, die sie hatten umbringen wollen, oder sie hatten eine Möglichkeit gehabt, sie zu verfolgen.
Magie? Oder eine profanere, menschliche Technik?
Er nahm sich vor, Ashe nach einem Peilsender absuchen zu lassen, der klein genug war, um unter ihrer Haut versteckt zu werden. Raphael hatte gesagt, sie wäre kurz vor der ersten Attacke der Fremden bei einem Arzt gewesen.
Wie leicht hätte ihr der Mediziner ohne ihr Wissen einen Sender einsetzen können.
Als er spürte, dass Parish sich ihm näherte, nahm Bayon widerstrebend wieder seine Menschengestalt an und richtete sich auf, während er den glänzend schiefergrauen Puma auf sich zukommen sah. Begleitet von einem magischen Schimmer verwandelte Parish sich in einen Menschen von über einem Meter achtzig, mit breiten Schultern und langem, tiefschwarzem Haar. Sein kantiges Gesicht verriet sein raubtierhaftes Wesen, was durch die beiden verheilten Narben an seinem Mund und dem rechten Ohr noch stärker betont wurde.
»Hier sind sie über die Grenze gekommen«, fauchte Parish, der noch wilder aussah als üblich. Gemeinsam untersuchten sie eine Lücke zwischen den Zypressen, durch die die Angreifer in die Wildlands gelangt waren. »Verdammt, ich hätte gründlicher suchen müssen. Schon seit Jahren spüren wir die wachsende Bedrohung.«
Bayon schüttelte den Kopf. Der Anführer der Jäger war zu sich selbst ebenso hart wie zu seinen Kriegern.
Sogar noch härter.
Parish hatte sich nie verziehen, dass seine Schwester gestorben war.
Vielleicht würde er jetzt, nachdem er endlich seine Gefährtin gefunden hatte, ein wenig Frieden finden.
»Ja, wir haben etwas gespürt. Aber bis vor Kurzem hatten wir keinen konkreten Beweis«, bemerkte Bayon. »Wir hätten nichts dagegen tun können, Parish.«
»Die Vergangenheit kann ich nicht ändern, die Zukunft schon.« Parish deutete mit dem Kopf auf die beiden großen Pumas, die leise durch das dichte Laub glitten. »Bis auf Weiteres werden die Wachen verdoppelt.«
Bayon ging in die Hocke und witterte den sauren Geruch der Eindringlinge. Seine Nackenhaare richteten sich auf.
»Wie konnten sie die magische Grenze durchdringen?«, wollte Bayon wissen.
»Das wirst du herausfinden.«
Allerdings würde er das. Bayon hatte nicht vor, ohne Antworten zurückzukehren. »Ich brauche meine Waffen.«
Parish nickte. »Willst du Verstärkung mitnehmen? Ich kann dir Talon schicken.«
Bayon kniff die Augen zusammen. »Willst du mich beleidigen?«
»Wir können das Ausmaß der Gefahr nicht einschätzen«, rief ihm Parish ins Gedächtnis, seine Züge waren wie aus Granit gemeißelt. »Wenn es wirklich das Werk der uralten bösen Macht ist, wie wir befürchten, können wir es uns nicht leisten, weitere Risiken einzugehen.«
Bayon erzitterte.
Jeder Pantera war mit der Geschichte der beiden Zwillingsschwestern aufgewachsen, die die Wildlands erschaffen hatten. Opela war die Mutter aller Pantera, doch ihre Schwester Shakpi war eifersüchtig auf Opelas Liebe zu ihren Kindern geworden. Mithilfe ihrer Anhänger unter den Menschen, die sie mit ihrer Bösartigkeit verdorben hatte, versuchte sie die Pantera zu vernichten. Letztendlich war Opela keine andere Wahl geblieben, als ihre Schwester einzusperren.
War es möglich, dass Shakpi tatsächlich noch am Leben war? Dass sie versuchte, sich aus ihrem geheimnisvollen Gefängnis zu befreien? Dass das Böse in ihr vielleicht sogar schon in die Welt vorgedrungen war?
Seine Gedanken scheuten vor dieser Möglichkeit zurück. Er musste sich darauf konzentrieren, die Schweine zu finden, die Ashe und ihr Baby verletzt hatten.
Die potenzielle Bedrohung durch eine bösartige, auf Rache sinnende Göttin überließ er den Ältesten.
»Ich werde keine Risiken eingehen«, murmelte er und hob die Hände, als Parish ihn mit ernster Miene betrachtete. »Ich schwöre.«
»Also gut. Bleib in Kontakt.«
»Aye, aye, Captain.« Bayon drehte sich um und wollte sich auf den Weg zu den Räumlichkeiten machen, die er zusammen mit seinen Jägerkollegen bewohnte. Doch bevor er loslaufen konnte, stand Parish vor ihm.
»Bayon.«
»Was?«
»Ich weiß, es macht dir Spaß, die Grenzen meiner Geduld auszutesten, indem du dein eigenes Ding durchziehst«, warnte ihn der Pantera. »Wenn ich nichts von dir höre, komme ich dich suchen und mach dir die Hölle heiß.«
»Ich werde anrufen.« Bayon verdrehte die Augen. »Großes Indianerehrenwort.«
Keira wusste nicht, wie lange sie schon in diesem Käfig auf dem stickigen Dachboden eingesperrt war.
Zu Beginn ihrer Gefangenschaft hatte sie die Anzahl der verstreichenden Tage mit einem Stein in den Boden geritzt, weil sie irgendetwas brauchte, um bei Verstand zu bleiben.
Doch aus den Tagen wurden Wochen und dann Monate und dann endlose Jahre, und so verlor sie jedes Gefühl für die ihr entgleitende Zeit.
Sie wusste, dass es nicht ihr erstes Gefängnis war. Vage erinnerte sie sich daran, dass sie zwischen grauen Zementblöcken aufgewacht war, die sie in einem unterirdischen Versteck umgeben hatten. Darauf war ein enger, vollgestellter Raum gefolgt, den sie für einen Lagerschuppen gehalten hatte, und dann ein Rübenkeller, in dem es nach feuchter Erde und fauligen Kartoffeln gestunken hatte.
Es hatte noch weitere gegeben, doch ihre Erinnerungen waren so verworren, dass es ihr nicht gelang sie zu ordnen.
Sie waren wie sie selbst. Zerbrochen. Zersplittert. Zum Teil irreparabel zerstört.
An den meisten Tagen wusste sie ihren Namen. Keira. Keira Montreuil. Sie wiederholte ihn immer und immer wieder in dem verzweifelten Versuch, sich an ihr früheres Leben zu klammern.
Und sie wusste, dass sie eine Pantera war, obwohl sie keinen Kontakt zu ihrem Puma herstellen konnte, so verzweifelt sie es auch versuchte.
Doch davon abgesehen war ihr Leben ein einziger verschwommener Fleck, gelegentlich durchdrungen von den Besuchen ihrer Entführer, die ihr etwas zu essen brachten.
Wenn man vom Teufel sprach …
Sie konnte ihn riechen, noch bevor er die Treppe zum Dachboden hinaufstieg.
Der ranzige, saure Gestank, der auf ihre Sinne eindrang, ließ sie vor Ekel würgen.
Unter großer Anstrengung stand sie auf. Sie fühlte sich ständig lethargisch, egal wie viel sie aß oder schlief, weshalb sie überzeugt war, dass sie irgendwie geschwächt wurde. Im Verdacht hatte sie das Metallhalsband, das sie trug. Ihre Entführer versetzten ihr damit Stromstöße, wenn sie sie bestrafen wollten. Doch sie vermutete, dass etwas im Material des Halsbands ihr die Kräfte raubte.
Wie sonst hätte man sie hier festhalten können?
Ein Käfig, so solide er auch gebaut sein mochte, konnte sie nicht aufhalten. Nicht, wenn sie ganz bei Kräften war.
Und auch der Dachboden hätte sie nicht aufhalten können.
Das Fenster, das auf einen kleinen Garten hinausging, war zwar schmal, aber sie hätte sich leicht hindurchzwängen können. Und als letzten Ausweg hätte sie sich auf den Stapel staubiger Kartons stellen und die vergammelten Dachziegel durchstoßen können.
Aber sie war nicht ganz bei Kräften.
Man hatte sie ihr geraubt, wie man ihr auch die tröstliche Nähe ihres Pumas geraubt hatte.
Dabei spielte es keine Rolle, ob es die Wirkung des Metallhalsbands, ein Gift oder ein magischer Fluch war, sie fühlte sich so ausgeliefert und beschämend verletzlich, dass sie sich am liebsten in einer Ecke verkrochen hätte.
Stattdessen stand sie in der Mitte ihres Käfigs, als der Menschenmann über die verzogenen Bodendielen schritt und ihr ein Tablett mit Brei, der wohl als etwas zu essen durchgehen sollte, durch einen kleinen Schlitz in der Tür schob. Grimmig fing Keira das Tablett auf, bevor es herunterfiel. Dieser Fraß schmeckte schon schlimm genug, wenn sie ihn nicht vom Boden essen musste.
Der Mann grinste selbstgefällig. Seine braunen Haare waren fettig, und sein Gesicht hätte eine Rasur vertragen können. Er trug Jeans und ein Flanellhemd, das immer aussah, als müsste es mal gewaschen werden. In seinen schlammbraunen Augen allerdings lag eine gerissene Intelligenz, und in seinem Blick, der langsam an ihrem schlanken Körper hinabglitt, sah sie einen sadistischen Hunger.
Dank des altmodischen Standspiegels in einer Ecke des Dachbodens wusste sie genau, was er sah. Glattes, dunkles Haar, das ihr, zu einem Zopf zusammengebunden, bis über die Schulterblätter hing; Augen in einem matten Gelb; feine Gesichtszüge; vom mangelnden Sonnenlicht bleiche Haut und ein geschmeidiger, zu magerer Körper, der nur mit einer Trainingshose und einem passenden Sport-BH bekleidet war.
»Wie geht’s meinem kleinen Miezekätzchen heute?«, fragte der Mann höhnisch. Sie kannte seinen Namen nicht. Warum auch? Er war nur einer in einer langen Reihe von Peinigern, die sie hatte ertragen müssen. Aber insgeheim nannte sie ihn das Frettchen. »Bist du bereit, für Daddy zu schnurren?«
Nachdem sie das Tablett auf der schmalen Pritsche abgestellt hatte, die neben dem kleinen Fernseher die einzige Möblierung ihrer Zelle war, wandte sie sich mit einem spöttischen Lächeln wieder an den Mann. Sie wusste nicht, warum es ihr so wichtig war, sich gegen ihre Bewacher zur Wehr zu setzen. Sie saß wie eine Ratte in der Falle. Hilflos. Verlassen. Und jeder Tag brachte sie näher an den Rand des Wahnsinns.
Warum also?
Aber irgendein sturer, rebellischer Teil von ihr weigerte sich, diese Niederlage anzuerkennen.
Sie würde dem Schicksal ins Gesicht spucken, bis der Wahnsinn sie vollends verschlang.
»Komm und hol’s dir, Arschloch«, höhnte sie.
Er leckte sich bedächtig die Lippen. »Eines Tages.«
Diese Drohung hörte sie ständig, aber bisher hatte es keine sexuellen Übergriffe gegeben.
Noch nicht.
Keira wusste nicht, warum. Sie hatten sie auf jede andere Art gedemütigt, beschämt, geschmäht. Aber falls es noch zu sexuellen Übergriffen kommen sollte, hoffte sie von ganzem Herzen, dass ihr Glück anhielt und sie bis dahin zu verrückt geworden war, um noch etwas davon mitzubekommen.
Sie stieß verächtlich die Luft aus. »Dafür bist du nicht Manns genug«, gab sie dann zurück.
»Böse Miezekatze.« Der Mistkerl berührte das Armband an seinem Handgelenk und jagte damit einen Stromstoß durch Keiras Halsband. Sie zischte, als ihr Herz unter Schmerzen einen Schlag aussetzte. »Aber keine Sorge, du wirst nicht mehr lange in deinem Käfig sein.«
Keira runzelte die Stirn. »Warum nicht?«
»Die Nachricht sickert allmählich nach unten durch. Endlich ist unsere Zeit gekommen.«
»Eure Zeit? Du klingst wie ein schlechter Superschurke.«
Das Frettchen trat einen Schritt auf sie zu. In seinen Augen glitzerte fieberhafte Begierde. »Wenn wir dich nicht mehr brauchen, wirst du nicht mehr annähernd so witzig sein. Dann ficke ich dich nämlich bis du tot bist.«
Ihr Lächeln blieb ungerührt, doch eine ekelerregende Angst schnürte ihr den Magen zu. In seiner Stimme lag eine selbstgefällige Großspurigkeit, die ihr sagte, dass es diesmal keine leere Drohung war.
Er war sich wirklich sicher, sie bald in die Finger zu kriegen.
Scheiße. Scheiße. Scheiße.
»Mit diesem winzigen Schwanz?« Sie neigte das Kinn, um ihm ihre Angst nicht zu zeigen. »Wenn ich schon gefickt werden soll, dann schickt dafür wenigstens einen Mann.«
»Du Miststück.«
Er betätigte den Knopf, der die Stromschläge in ihrem Halsband auslöste. Doch diesmal hielt er ihn gedrückt und jagte einen Stromstoß nach dem anderen durch ihren Körper. Zähneknirschend fiel Keira auf die Knie. Heilige Scheiße. Sie war zu weit gegangen. Das Schwein würde sie umbringen.
Ihr Kopf hing herab, und ihr Geist verlor sich im Dunkel, als durch die Tür am Fuße der Treppe der Klang einer Männerstimme drang.
»Roger.«
Roger? Trotz der brennenden Qualen in ihren starren Muskeln, zuckten ihre Lippen. Er hieß Roger?
Frettchen passte besser zu ihm.
Der Mann murmelte einen Fluch, und ihre Schmerzen brachen abrupt ab. »Was?«
»Besprechung.«
»Schon wieder?«, rief das Frettchen. »Worum zum Geier geht es diesmal?«
»Ich habe sie nicht einberufen«, murrte sein Kumpel. »Wir brechen in zehn Minuten auf.«
Das Frettchen trat dicht vor die Gitterstäbe von Keiras Zelle, sein Gestank machte ihr Elend nur noch schlimmer.
»Vielleicht gibt es gute Neuigkeiten. Vielleicht gehen wir an die Öffentlichkeit, und ich kann dich endlich flachlegen, wie du es verdient hast.«
Lachend wandte er sich ab und verließ den Dachboden, und Keira konnte einen tiefen, reinigenden Atemzug nehmen, während sie gegen den Nebel in ihrem Kopf ankämpfte.
»Pass auf, was du dir wünschst, Arschloch«, flüsterte sie, die Finger an ihre pochenden Schläfen gepresst.
Auf den Knien wartete sie, bis die Übelkeit vorüberging. Sie ertrug die Zeit, indem sie sich die verschiedenen Möglichkeiten ausmalte, wie sie das Frettchen töten würde, wenn der Typ dumm genug wäre, ihre Zellentür zu öffnen.
Ihm das Genick zu brechen wäre die effizienteste Methode, aber das war ein viel zu sauberer Tod für diese abscheuliche Kreatur. Es sollte langsam sein und ihm größtmögliche Schmerzen bereiten.
Eine Stunde verging. Dann zwei. Langsam wurde es dunkel auf dem Dachboden, und sie rollte sich auf dem Boden vorsichtig zu einer kleinen Kugel zusammen. Später würde sie versuchen, den Pamp herunterzuwürgen, den die Männer Essen nannten, doch im Moment war sie allein und hatte keinen Grund, die Tapfere zu spielen.
»Keira. Ich heiße Keira«, murmelte sie. »Ich bin stark. Ich bin mutig. Und diese Schweine werden mich nicht kleinkriegen.«
Über diese Worte, die sie immer und immer wieder vor sich hin summte, hätte sie beinahe das leise Geräusch von schleichenden Schritten auf der Treppe überhört. Sie runzelte die Stirn, als eine seltsame Angst ihr das Herz zusammenpresste. Diese Schritte waren zu leicht, zu anmutig für einen normalen Menschen.
Was war da auf dem Weg zu ihr?
In den Schatten verborgen, blieb sie auf dem Boden zusammengerollt liegen und spähte misstrauisch in die sich verdichtende Düsternis.
Die Umrisse eines großen Mannes tauchten auf, doch er drehte erst mit sichtlicher Vorsicht eine Runde über den gesamten Dachboden und suchte nach versteckten Feinden, bevor er seine Aufmerksamkeit schließlich auf den Käfig lenkte, der mitten im Raum stand.
Dann erst sog er entsetzt die Luft ein, als er ihre kauernde Gestalt erblickte.
»Zum Teufel, was ist hier los?«
Der Mann kam näher, und Keiras Herz setzte einen Schlag aus, als sie die golden schimmernde Schönheit dieses Mannes erblickte. Er beunruhigte sie. Nicht wie der Frettchen-Mann oder seine zahlreichen menschlichen Freunde. Das hier war … anders …
»Ist das ein Trick?«, hauchte er.
Sie zog die Brauen zusammen. »Ich verstehe die Frage nicht.«
»Du bist tot.«
Seine harten Worte durchschnitten das Durcheinander in ihrem Kopf. Blinzelnd bemühte sie sich, diese Worte zu verarbeiten. Tot. Bizarrerweise machte ihr der Gedanke keine Angst.
Das hätte eine ganze Menge erklärt.
»Dann ist das also die Hölle?« Sie lachte kurz, fast hysterisch auf. »Hoffentlich habe ich mir meinen Platz hier verdient, indem ich es richtig habe krachen lassen. Laisser les bons temps rouler.«
Eine kurze, nervenaufreibende Stille entstand, bevor ein zartes Wort durch die Luft heranschwebte.
»Keira?«
Ein überraschtes Zischen drang aus ihrer Kehle. Ihr Name. Das Einzige aus ihrer Vergangenheit, das sie hatte festhalten können. Er hatte sie geerdet, wenn ihre Entführer mit allen Mitteln versucht hatten, ihren Willen zu brechen. Oder wenn ihr Verstand sich in den dunklen Tiefen der Verzweiflung zu verlieren drohte.
Die ganze Zeit über hatte sie ihn beschützt.
Niemand kannte diesen geheimen, kostbaren Namen.
Niemand außer ihr.
»Nein«, keuchte sie mich schwacher Stimme. »Er gehört mir. Nur mir.«
»Heilige Scheiße.« Der Mann kam noch einen Schritt näher. »Du bist es wirklich?«
Keira wich hastig zurück, und aller Widerstand war vergessen, als sie den warmen, männlichen Duft witterte. Pantera. Er war wie sie.
»Wer bist du?«, krächzte sie.
Mit einem anmutigen Sprung landete er direkt vor ihrer Zellentür. Seine wunderschönen, golddurchsetzten grünen Augen strahlten vor fassungsloser Freude.
»Oh mein Gott.«
»Nein.« Sie hob die Hand, ihr Herz raste. Sie wusste nicht, was ihr zu schaffen machte. Einem Teil von ihr war klar, dass sie zutiefst erleichtert sein müsste. Dieser Mann gehörte zu ihrem Volk. Aber da war auch ein anderer Teil, der sich vor seinem Geruch fürchtete. »Bleib zurück.«
Er runzelte die Stirn und betrachtete sie mit suchendem Blick. »Keira, ich bin’s. Bayon.«
Bayon. Lautlos testete sie den Namen. Er war vertraut. Der Mann war ihr vertraut.
Aber das Durcheinander in ihrem Kopf war zu groß, sie konnte die Erinnerung nicht herausfischen.
»Bleib zurück«, wiederholte sie mit scharfer Stimme. Sie begriff nicht, was hier los war, und das war ebenso furchtbar wie Folter.
»Ist es eine Falle?« Er neigte den Kopf zur Seite und schnupperte. »Keira, Süße, werde ich einen Alarm auslösen?«
Sie schüttelte den Kopf, ihr Mund war trocken. »Du musst gehen.«
Prüfend betrachtete er ihr blasses, verängstigtes Gesicht, dann ergriff er ohne Vorwarnung die Gitterstäbe und riss die Zellentür heraus.
Mit einem Satz sprang Keira auf ihre Pritsche, eine Handfläche an ihren hämmernden Kopf gepresst, als er unaufhaltsam auf sie zukam. Er streckte die Hand aus, doch anstatt nach ihr zu greifen, wie sie beinahe erwartet hatte, strich er mit dem Finger über ihr Halsband.
Erschrocken riss er die Hand von dem Metall zurück.
»Scheiße. In dem Metall steckt irgendeine Art Gift.« Er schüttelte den Kopf. »Ich muss den Schlüssel finden. Bin gleich wieder da.«
Sie sah ihm schweigend nach, als er leichtfüßig die Treppe hinunterlief und sie alleinließ.
Stumm betrachtete sie die verbogene Zellentür, während eine Stimme in ihrem Hinterkopf sie drängte, die Flucht zu ergreifen. Sie könnte aus einem der Fenster schlüpfen, vom Dach springen und die Straße hinunterrennen, bevor der … bevor Bayon überhaupt bemerkte, dass sie fort war.
Ihre Glieder allerdings verweigerten jede Bewegung. Es war, als würden sie gewaltsam an ihrem Platz gehalten.
Sie blieb zusammengekauert auf der Pritsche hocken, und der Atem strich kratzend durch ihre Kehle, während sie Bayon im Haus umherlaufen hörte. Angespannt wartete sie, bis er die Treppe wieder hinaufgerannt kam und zu ihrer Zelle zurückkehrte.
Sie stieß ein Zischen aus, als sich sein warmer Moschusduft auf ihre Sinne legte und sie an etwas erinnerte – aber an was?
An etwas, dem sich ihr Verstand noch nicht stellen wollte.
Zitternd schüttelte sie den Kopf, als er langsam die Zelle durchquerte und sich auf den Rand ihrer Liege hockte.
»Halt einfach still, Keira«, drängte er sie sanft. Ohne den Blick von ihrem Gesicht abzuwenden, schloss er das Halsband auf und nahm es ihr ab. Mit verzerrtem Gesicht warf er es in die Ecke.
Dann legte er die Finger wieder an ihren Hals, um behutsam über die vom Metall wund gescheuerte Haut zu streichen. Sofort zog sie sich zurück. Das Herz hämmerte wild gegen ihre Rippen, als sie bei seiner sanften Berührung wirre Empfindungen durchfuhren.
»Nein.« Sie sprang von der Liege auf und drückte sich an die Gitterstäbe. Sie hasste sich dafür, dass sie sich wie ein beschissenes Mäuschen aufführte, konnte ihre heftige Reaktion aber nicht unterdrücken. »Fass mich nicht an.«
»Okay.« Er stand auf und streckte ihr in einer versöhnlichen Geste die Hände entgegen. »Wir müssen hier raus.«
»Raus?« Sie leckte sich die trockenen Lippen. »Wohin bringst du mich?«
»Zurück in die Wildlands.«
Aufsteigende Panik überrollte sie und schnürte ihr die Kehle zu, bis sie kaum noch Luft bekam. »Nein, das geht nicht.«
Bayon legte die Stirn in Falten, und seine Finger zuckten, als müsse er gegen den Drang ankämpfen, sie mit körperlicher Gewalt aus der Zelle zu zerren.
»Keira. Wir können nicht hierbleiben«, brachte er schließlich in beruhigendem Ton hervor. »Kommst du mit mir? Bitte.«
Keira blickte zur Tür. Sie wollte nach draußen. Unbedingt. Und ein Teil von ihr wusste, dass dieser Mann ihr nichts zuleide tun würde.
Dennoch musste sie jeden Funken ihrer Willenskraft aufbringen, um ruckartig zu nicken. »Also gut. Aber … fass mich nicht an.«
»Okay.« Während er rückwärts aus der Zelle wich, beobachtete er sie mit sorgsam beherrschter Miene. »Alles, was du willst, Süße. Du brauchst es nur zu sagen.«
»Ich brauche Platz.«
»Den kriegst du«, versprach er, ohne zu zögern. »Komm mit.«
Sie tat es. Allerdings hielt sie vorsichtigen Abstand zu ihm, während sie leise die Treppe hinunterschlichen und das Haus durch eine kleine Küche mit rissigem Linoleumboden und einem Stapel schmutzigem Geschirr auf der Anrichte verließen.
Im Garten angekommen, blieb er stehen und suchte die Dunkelheit nach Anzeichen für eine Falle ab. Keira stand hinter ihm; sie zitterte, als ihre abgestumpften Sinne unter Schmerzen zu neuem Leben erwachten.
Gott, war das real?
Ein warmer Windhauch auf ihrer Wange. Das Gras unter ihren Füßen. Der ferne Klang eines Kinderlachens.
Zu oft hatte sie im Laufe der Jahre geträumt, frei zu sein, nur um beim Aufwachen festzustellen, dass sie noch immer in ihrem Käfig gefangen war.
Sie hätte es nicht ertragen, wenn es auch diesmal nur eine Halluzination gewesen wäre.
Als er endlich sicher war, dass sie allein waren, führte Bayon sie durch ein unverschlossenes Tor in eine schmale Gasse, die nach fauligen Abfällen und menschlichen Fäkalien roch.
Keira schlug sich die Hand vor ihre empfindliche Nase und konzentrierte sich verbissen darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Oh, nein. Das hier war kein Traum. Ihre Vorstellungskraft war nicht fähig, derart faulige Gerüche hervorzubringen.
Erleichterung wallte in ihr auf, aber gleichzeitig nahm ihre Schwäche mit jedem Schritt zu. Verbissen weigerte sie sich, ihr Tempo zu verlangsamen. Es war ihr egal, ob sie auf allen vieren kriechen musste. Nichts würde sie wieder in dieses Gefängnis bringen.
Sie hatten das Ende der Gasse erreicht, als der Pantera stehen blieb und ihr ein Zeichen gab, hinter ihm zu bleiben, während er durch ein Fenster in eine baufällige Garage spähte.
»Was tust du da?«, wollte sie wissen und sah sich nervös um.
Verdammt. Warum zögerte er? Ihre Bewacher würden nicht ewig fortbleiben.
»Mit einem Auto wären wir schneller«, raunte er.