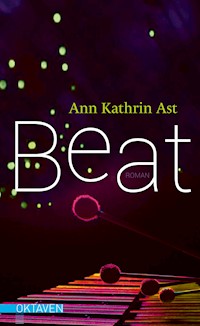
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Oktaven. Das kleine feine Imprint für Kunst im Leben und Lebenskunst
- Sprache: Deutsch
Aus dem Rhythmus - in der Musik und im Leben Bald kann es beginnen, das Leben. Noch eine letzte Prüfung, dann endlich nur noch spielen, spielen, spielen. Musik ist alles - er ist Musik. Im letzten Studienjahr plant Beat zuversichtlich seine Zukunft, doch auf einmal ändert sich seine Beziehung zur Musik - und damit ändert sich alles. Sein Leben verliert die Struktur und er den Bezug zur Realität. Doch wie soll er ohne Musik leben? Und was ist Leben überhaupt für ihn und seine Generation, deren Zukunft sich an den Informationen der gegenwärtigen Krisen immer wieder neu verwundet? Ann Kathrin Ast erzählt in "Beat" von einem jungen Studenten, der an sich und seiner Beziehung zur Musik zweifelt, fast verzweifelt. Mit ihrer pointiert gesetzten Sprachmelodie, durchzogen von den Dissonanzen der Gegenwart, komponiert sie einen Roman über Sinnsuche in der Kunst und die Kunst des heutigen Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ann Kathrin Ast
Beat
oderIn diesem trockenen, süßlich riechenden Nebel
OKTAVEN
INHALT
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
PROLOG
1. ES WAR EINMAL
Ihr werdet die Wirklichkeit erkennen, und was wirklich ist, wird euch frei machen.
nach Johannes 8,32
Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt.
E. T. A. Hoffmann
Jetzt. Das ist es. Darauf hat er gewartet. Beats Arm hebt sich, nähert sich und – der Schlägel trifft im richtigen Moment auf die riesige Bronzescheibe des Tamtams. Einschwingen, er schwillt an, dieser weiche, tiefste, umfassendste Ton des Abends – alles im Körper vibriert –, der sich ausbreitet wie ein Farbfleck, erst die Luft, dann alle Anwesenden im Saal der Musikhochschule einfärbt; eine Welle in der Raumzeit, die sich von ihm aus fortbewegt. Das Tempo verlangsamt sich abrupt, in Zeitlupe auf- und absteigende Streicherkaskaden, die Sopranistin zieht einen hohen Ton in die Länge, der zusammen mit Beats Tiefton den Raum einrahmt, der Arm des Dirigenten steht in der Luft, es soll nie enden, ich liebe diese – würde Beat am liebsten rufen, dann ist der Moment schon vorbei. Er dämpft die vibrierende Scheibe ab. Natürlich, Musik ist Zeit, Werden, sie bleibt nicht stehen, aber manchmal würde er eine Stelle gern anhalten, wie beim Musikhören das Band zurückspulen, immer wieder dieselbe Stelle.
Der Saal mit Dachschräge ist bis zum letzten Stuhl besetzt für die Opernaufführung der Musikhochschule, 300 Studentinnen und Studenten, Professorinnen, Eltern, Musikliebhaber sehen ihm entgegen, ihre offenen, teils verträumten, teils schläfrig-abwesenden Gesichter.
Der Dirigent wirft Beat einen gestressten Blick zu, ist er nervös? Beat lächelt. Er nimmt je zwei Schlägel mit kleinen Köpfen in beide Hände und stellt sich an das Marimbaphon. Gleich kommt die schwierigste Passage des Abends: Marimbasolo.
Sein Herz schlägt rascher, doch das ist in Ordnung, hilft ihm auch. Die Schlägel liegen gut in seinen Händen. Er begibt sich in den Modus voller Konzentration, freut sich darauf.
Seine Arme rauschen über die Klangplatten, fast von selbst, eine furiose Stelle, für beide Hände weite Sprünge in hohem Tempo, mit rhythmischen Verschiebungen zwischen rechts und links. Alles fließt, Beat fokussiert den Dirigenten, setzt die Eins exakt, wenn dessen Stab den tiefsten Punkt erreicht, die Koordination mit den Kontrabässen auf der anderen Seite läuft besser als je zuvor, er freut sich. Noch ein paar Takte reine Begleitung, er lehnt sich zurück – doch warum fixiert der Dirigent ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen? Im nächsten Moment ist da vor seinen Augen ein feines Geäst aus Äderchen in einem Lichtfeld, wie ein Abdruck von Blutgefäßen. Bloß für eine Sekunde, schon wieder weg, zu kurz zum Erschrecken.
Habe ich die eine Achtel im letzten Takt überhaupt gespielt? Tatsächlich ist er nicht sicher und versucht zurückzudenken, sich zu erinnern an die Bewegung – da kommt nichts. Als er auf seine Hände sieht, zuckt er zusammen: Sein g erklingt, kurz bevor er mit dem Schlägel die Klangplatte berührt. Beat schüttelt sich, sicher nur eine Sinnestäuschung? Doch im nächsten Takt passiert es wieder. Erst hört er den hellen Ton, eine Sekunde später trifft der Schlägel auf – das kann nicht … Er sieht den Arm des Dirigenten nach unten ziehen, aber das Orchester hat den Schlag längst gespielt. Heißt das? Ja. Bild und Ton sind verschoben, auseinandergerissen. Blut rauscht in seinem Kopf, immer lauter, schon alle äußeren Laute übertönt, der Puls pocht ihm in den Ohren, sein Gesicht heiß. Zitternde Hände, doch er muss weiterspielen. Sich überschlagende Gedanken, ist das ein epileptischer Anfall? Gehirntumor? Die Hände zittern unkontrollierbar. Seit Jahren keine solche Angst auf der Bühne gehabt, so peinlich, ausgerechnet heute, vor Professoren und Kollegen aus der Schlagzeugklasse. Gleich kommt die Wiederholung des Marimbasolos, bei dem er mit der Flötistin perfekt zusammenspielen muss.
Er macht eine Atemübung, die Töne von außen kehren zurück, hört die Flötenachtel des Übergangs. Beat schließt die Augen und spielt – zu dem Zeitpunkt, den er für den richtigen hält – auswendig das Solo. Nur 1 – 2 – 3 – 4 fühlen, die Bewegungen dem Körpergedächtnis überlassen, den Automatismen, sie nicht durch das Bewusstsein stören. Bald denkt er nichts mehr.
Das Solo endet, Beat öffnet die Augen. Kaum zu glauben: Der Dirigent lächelt und nickt ihm anerkennend zu, also ist es gut gelaufen? Beat legt die Schlägel ab, lockert die Arme, atmet aus.
Auf der aus Podesten zusammengeschobenen Bühne liegt der hellgrüne Teppich wie eine Wiese, begrenzt durch Stellwände mit Blümchentapete und aufgemalten Fenstern. Gemütlich sieht er aus, dieser kleine Raum im Raum, den Beat von tagelangen Proben kennt, er entspannt sich. Gerade fläzt die Sopranistin mit pinkfarbenem Minirock in gespielter Langeweile auf dem Sofa, während der Bariton ihr mit großen Gesten einen Vortrag hält. Beat würde gern zu ihr gehen … Dann erst bemerkt er: Bild und Ton sind wieder synchron, die Wahrnehmung ist normal! Er lacht vor Erleichterung fast laut auf. Danke, danke, danke, vielleicht war es nur ein Stressphänomen. Beat streicht über das geschliffene Holz des Tamtamschlägels, den er bald wieder braucht. Gut, dass ich meinen eigenen mitgenommen habe, denkt er, mit ihm bringt er die meisten Obertöne und tiefen Frequenzen heraus, diesen schillernden Klang. (Wie er vor Kurzem fünfzig verschiedene Schlägel nach Hause bestellte und sie alle einzeln probierte, um den besten herauszufinden. Ob jemand im Raum den Unterschied merkt? Spielt keine Rolle.)
Er stutzt. Etwas ist anders. Es riecht nach Rauch und gemähtem Gras. Zum Test hält er kurz seine Nase zu, lässt sie wieder los – es riecht nur nach Rauch, sehr deutlich, und da steht Rauch im Raum, nahe der Tür, scheint von hinter der Bühne zu kommen. Aber Kunstnebel ist in der Inszenierung nicht vorgesehen. Noch während er sich wundert, platzt eine Sirene in die Musik, ein nach oben ziehender, gepresster Ton, der Dirigent erstarrt, dann winkt er das Orchester ab. Alle im Saal sehen sich nervös um, auch die Sirene bricht abrupt ab und eine Durchsage, es ist die Stimme des Hausmeisters, schallt aus den Lautsprechern. «Rauch im obersten Stockwerk. Bitte ruhig bleiben und das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr ist unterwegs.» Seine breite, pfälzische Aussprache lässt die Aussage zwar beruhigender klingen, als sie ist, trotzdem: dröhnendes Gemurmel, schreiende Stimmen und beschwichtigende, tiefe – alles durcheinander. Die Musiker, schon aufgestanden, befinden sich der seitlichen Tür am nächsten, Beat sieht zwei Geigerinnen dorthin rennen, die Arme schützend um ihre Instrumente gelegt, als wären sie Säuglinge, die vom Rauch abgeschirmt werden müssen. Wo ist der Dirigent? Auch die Sänger eilen von der Bühne, wo der Rauch deutlich stärker wird, in wirbelnden Bahnen, Schwaden sich dreht. Geschieht das – Beat sitzt noch auf dem Hocker hinter der Marimba. Feuer sieht er keines, doch der Weg zur Tür ist jetzt verstopft. 300 Menschen wollen gleichzeitig durch eine Tür den Saal verlassen, während die Sirene wieder die Ohren terrorisiert. Erstaunt über seine eigene Ruhe, bewegt er sich langsam auf das Ende der Schlange zu, beobachtet die anderen. Viele der Wartenden haben Handys am Ohr und brüllen hinein, es gibt mehr als eine weinende Person, jemand erteilt mit Gesten seiner Umgebung Anweisungen, ohne Beachtung zu finden. Eine Gruppe Musikstudenten in einiger Entfernung bemerkt Beat nicht. Leichte Panik steigt in ihm auf, Enge im Brustkorb, er spürt seinen trockenen, vom Rauch brennenden Hals, auch sein Herzschlag beschleunigt, doch nur schwach, eher die Erinnerung von Panik. «Stay-Put-Regel», ruft ein älterer Mann. Mit Predigerstimme versucht er, die anderen zu überzeugen, sich nicht aus dem Saal zu drängeln, «die Feuerwehrmänner werden kommen, es ist viel gefährlicher, allein durch einen verrauchten Gang», niemand beachtet ihn. Die Frau neben ihm schüttelt den Kopf. Beat fühlt sich schläfrig, fast abwesend, vielleicht eine Schutzreaktion des Körpers? Da taucht der Bühnenmeister mit einem Notfeuerlöscher auf, zeigt auf den dichten Qualm hinter der Bühne und ruft etwas für Beat Unverständliches. Ein paar Personen rennen nun in den Qualm hinein und kommen kurz darauf hustend mit vor den Mund gehaltenen Händen zurück. Beat hält sich die Ohren zu, kann so einen Lärm nicht ertragen.
Der Notfeuerlöscher ist zu schwach. Eine kleine Flamme schlägt aus dem Rauchfeld heraus, greift auf die blümchenbemalte Stellwand über, sie ist aus Holz, nimmt das Feuer dankbar auf und fängt an zu brennen. Sekunden später haben die Flammen schon auf den Teppich übergegriffen, auch das Sofa fängt an zu glimmen. Aufquellender, orangefarbener Rauch steigt von der Bühne auf. Beat dagegen fühlt sich zunehmend besser, als wäre er nicht im Raum, in dem das geschieht, sondern getrennt durch eine Glasscheibe, auf einen Bildschirm starrend. Ihm wird nichts geschehen. Gleichzeitig spürt er die Hitze, der Rauch ist so stark, dass er nur schwer atmet, viele halten ein Kleidungsstück vor Mund und Nase. Eine Gruppe öffnet eines der Dachfenster und klettert nach draußen, ein älteres Paar schreit «Durchzug vermeiden, verrückt geworden?» und versucht, das Fenster zu schließen. Die größte Gefahr bei Hochhausbränden sei zu ersticken, meint Beat einmal gehört zu haben. Ein brennendes Stück Stellwand fällt herunter, bäumt sich auf und bildet eine kleine Höhle, in der Funken herabregnen. Der Hausmeister rennt vor der Bühne hin und her, zielt mit dem kleinen, roten Feuerlöscher auf das bewegliche, brennende Standbild – noch mehr Qualm, ohne dass sich an der Intensität des Brands etwas ändert. Wie kann es sein, dass immer noch keine Feuerwehr da ist? Das Sofa brennt nicht vollständig, einzelne Flammenbahnen ziehen sich wie Rüschen durch den Stoff, setzen ihm Krönchen auf, ihre feinen, beweglichen Zacken, geriffelten Linien, wie Börsenkurse, Zufallsschwankungen, nichts daran ist glatt oder gerade. Es hat etwas Beruhigendes, fast Meditatives. Als ein hochgewachsener Mann mit einer dunkelgrauen Plastikplane, zum Abdecken des Flügels gedacht, auf den Brandherd zuläuft, auf den Teppich einschlägt, spürt Beat Ärger. Doch durch die Bewegung und Luftzufuhr lodern die Flammeninseln noch heller, höher auf. Ein Flammenstück fliegt durch die Luft, Beat fühlt sich gut, der Mann lässt die Plane auf dem Teppich liegen und zieht sich zurück. Die ganze Stellwand biegt sich jetzt, beugt sich herunter und bildet eine lichterlohe Brücke. Da das Feuer sich allein auf der Bühne abspielt, könnte man es leicht für einen Zaubertrick oder Showeffekt halten. Beat geht näher hin, genießt die von der Feuerwand abgestrahlte Wärme, die sich überträgt, spürt sein warmes, strahlendes Gesicht, das Kitzeln im Bauch, leichtes Schweben. Wie die Flammenkörper die heimelige Wiesenteppich-Blümchentapete-Wohnecke langsam bis zur Unkenntlichkeit zerstören, immer weiter vordrängen, sich durchfressen und alle Oberflächen erst in aus sich heraus leuchtende, orangefarbene Flammen verwandeln, dann grauschwarze, erstarrte, formlose Materie zurücklassen – er würde es nicht zugeben, ist aber fast dankbar, Zeuge dieser Zerstörung, eines unerwarteten Brandopfers, sein zu dürfen. Geht es nur mir so?, er dreht sich um, natürlich fixieren auch andere Anwesende die lodernde Bühne wie einen Bildschirm, das Starren ihrer orange erleuchteten Gesichter, über die flackernde Schatten laufen, niemand erwidert seinen Blick. Ich bin jetzt da, denkt er, jetzt da, ich jetzt da, ich – als wäre alles genau richtig.
Ob wegen des zusätzlichen Fluchtwegs oder aus anderen Gründen – ein Großteil der Zuhörer hat mittlerweile den Saal verlassen. Er könnte einfach nach draußen gehen, aber – die Gegenstände scheinen sich von ihrem Hintergrund zu lösen, wirken wirklicher, als sie sind. Nicht zu leugnen, er fühlt sich von dem brennenden, in orangefarbenem Rauch stehenden, beweglichen Bühnenbild irgendwie erhoben. Die heller und dunkler werdenden Lichtflecken, aufspritzende Funken, Wärmeabstrahlung, Menschen, die um ein offenes Feuer stehen: All das ist Teil eines archaischen Rituals, an das er anknüpft, allein das saftige, aus sich selbst heraus leuchtende Orange, wo gibt es das sonst außer bei Feuer? Wie der Homo erectus vor einer Million Jahren Feuer in seinen Höhlen hegte, von Blitzen, Savannenbränden oder Vulkanausbrüchen mitgenommen in seine Höhle und auf Wanderungen, wie er es schützte, vielleicht der wertvollste Besitz –
Jemand fasst ihn fest an der Schulter. Beat reagiert erst nicht.
«Kommst du?»
Das ist Hennigs Stimme. Beat dreht sich um und sieht in das angespannte Gesicht seines Professors. Hennig redet auf ihn ein, seine Lippen bewegen sich irgendwie falsch. Beat starrt auf den Formen bildenden Mund, die sich biegende Zunge. «Bitte was?», fragt er, doch Hennigs Lippen laufen weiter, ohne dass Beat ein Wort oder auch nur dessen Stimme hört. Dann enden die Mundbewegungen, aber Hennigs Stimme ist plötzlich da. Bild und Ton wieder verschoben – das kann. Bitte nicht. Was, warum muss das –
Wie soll er Hennig, was überhaupt, nein! Ohne noch einen Blick auf die qualmende Bühne zu werfen, vorbei an Hennig rennen, sich gegen die zugefallene Tür stemmen, raus, nur nach draußen.
… drei Monate ist das her, und die Symptome sind nicht wieder aufgetreten. Beat hat sich nur daran erinnert wegen des brennenden Hochhauses auf der Titelseite der Regionalzeitung, die auf dem Esstisch seiner Mutter vor ihm liegt. Die Geschirrspülmaschine gluckert, er räumt die Zeitung beiseite. Als Kind, fällt ihm ein, saß er oft auf dem Boden vor der spülenden Maschine, hörte Wasser, das über Bergfelsen und -kanten läuft. Gern wäre er in das Gerät hineingestiegen, um nachzusehen, welche Landschaft sich darin befindet. Auch jetzt hört er an einer Wand Herunterprasselndes, hellblaue Sprenkel spritzen auf, zwischen engen Felswänden dreht sich Wasser, dann dunkelgrüne Flecken und Abtauchen, Heruntersaugen …
1
Ende September, Semesterferienende. Das Abschlussjahr an der Musikhochschule beginnt, eben zurückgekehrt steht Beat auf der Schwelle seines Mannheimer Zimmers. War es immer so klein? Es ist zu still, von draußen kommen keine Geräusche zu ihm. Die Wände eine bedrängende Begrenzung. Lautes, durch Rohre fließendes Wasser: endlich ein vertrautes Geräusch. In diesem Haus sind die Leitungen nicht schallisoliert, er mag dieses Herunterrauschen, es bringt ihn für Sekunden an einen unbestimmten Ort. Dann wieder still. Beat schreitet die drei Schritte durchs Zimmer, zur Stereoanlage mit überdimensionierten Lautsprechern, und schaltet das Radio an, eine weiche Stimme setzt ein. «Die Frage, ob sich Europa an der Rettung der Wall Street beteiligen will, stellt sich nicht mehr. Denn jetzt muss Europa sein eigenes Finanzsystem vor dem Zusammenbruch retten …» Schnell klappt er den Laptop auf, lässt den Tagesschau-Stream laufen, in einem weiteren Fenster öffnet er n-tv und auf dem Handy Deutschlandradio. Die Stimmen überlagern sich, die meisten weiblich, manche sind ihm vertraut, Hauptsache, er ist nicht allein: «Mit milliardenschweren Unterstützungsaktionen sind weitere Bankenzusammenbrüche» – «es sind längst keine normalen Zeiten mehr» – «wegen der internationalen Finanzkrise erst einmal verhindert worden» – «Rettungspaket vorerst gescheitert» – «hat US-Präsident George W. Bush die Einigung des Kongresses auf den Rettungsplan begrüßt» – «erstmals ein DAX-Konzern tief im Strudel» – «die dramatischen Ereignisse zeigen» – «Milliarden für Hypo Real Estate». Beat lässt sich auf das blaue Bettsofa fallen, die Wände seines Zimmers scheinen sich zu weiten, auszudehnen, auf die ganze Stadt, das Land, die Welt. Stimmen, Kommentare, Einschätzungen, er ist nicht mehr allein und nimmt daran teil: Was geschieht, liegt in seinem Zimmer. Und er wundert sich – die Stimmen zu dieser Finanzkrise klingen, als sei da etwas Großes, Beängstigendes im Gange, «gesamtwirtschaftlicher Schock», hört er einen Sprecher sagen. Diese Krise, ist sie wirklich eine Gefahr für Deutschland? Er spürt keine Sorge, auch wenn sich in letzter Zeit die Berichte häufen, und obwohl all das genau jetzt, in seinem eigenen Land passiert, erscheint es ihm virtuell: Durch die Straßen zweier Städte ist er gefahren heute und hat nichts bemerkt, keine Preisveränderungen, keine Schlangen vor den Bankautomaten, Geschäften, alle besuchen Bars, Konzerte, gehen feiern wie immer, auf der Straße spricht kaum jemand davon, doch durch die Medien kann er trotzdem etwas davon mitbekommen.
Er unterbricht die Tonspur des Handys und geht in den Flur mit Kochnische, nimmt ein Stück Tarte aus dem Kühlschrank und beißt hinein.
«Ich wollte nur kurz Bescheid geben, bin gut angekommen. Danke für den leckeren Kuchen!» Er bleibt mit dem Handy im Flur stehen, wo die Stimmen der Nachrichtensprecherinnen nur leise im Hintergrund zu hören sind.
«Kannst du dir ganz leicht selbst machen. Soll ich dir das Rezept schicken?»
«Nicht nötig», Beats Blick fällt auf die unbenutzte Kochnische. Die Kaffeemaschine, die seine Freunde ihm letztes Jahr schenkten, niemand von ihnen ist mehr in der Stadt.
«Hast du irgendetwas von dieser Wirtschaftskrise bemerkt, ich meine, außer dass sie andauernd in den Medien vorkommt?», sagt er, möchte gerne weiter mit ihr sprechen (und es gibt da ein Thema, über das sie reden sollten, doch während acht Wochen Semesterferien hat er es nicht geschafft, also …).
«Nein. Ich mache mir da auch keine Sorgen.»
«Kennst du irgendjemanden, der persönlich davon betroffen ist? Gibt es sie wirklich?»
«Du kannst ja mal deinen Vater fragen, ob er jetzt ein paar Aufträge weniger bekommt. Wie traurig. Aber wen interessiert das.»
Beat verschluckt sich und muss husten, zum ersten Mal seit Jahren hört er sie von sich aus über seinen Vater sprechen, der vor Jahren allein zurück in die Schweiz zog.
«Wen interessiert das», antwortet er, als der Hustenanfall vorbei ist. Tatsächlich spürt er kein Bedürfnis, ihn anzurufen.
«Dann viel Spaß beim Studieren, genieß dein Abschlussjahr», die Stimme seiner Mutter klingt zärtlich, als würden sie sich für längere Zeit voneinander verabschieden.
«Danke. Mach’s gut», sagt Beat leise.
«Du auch.»
Gut, dass ich gestern Abend endlich wieder ausgiebig geübt habe, fast drei Stunden ohne Pause, denkt er, als er am Morgen acht Stockwerke mit dem Aufzug nach unten fährt. In den Spiegelwänden sieht er seine dunkelbraunen Locken, teils wolkig ums Gesicht gelegt, teils chaotisch in alle Richtungen abstehend, das schwarze Hemd an einer Seite in die Jeans gesteckt, an der anderen darüberhängend. Es macht ihm nichts aus, vielleicht wie das Klischee eines verträumten Künstlers auszusehen, nicht ganz von dieser Welt, doch vermutlich würde ihn kaum jemand draußen für einen Schlagzeuger halten, wenn er nicht gerade eine Pauke über die Straße schleppt. Ein 1,63 Meter kleiner Körper, muskulöse Arme (als Schlagzeuger muss er natürlich regelmäßig trainieren), mehrere dunkle Muttermale über die Wangen gestreut (eine enge Freundin seiner Mutter erzählte mal, diese Anhäufung dunkler Muttermale sei typisch für sensible, eher introvertierte Menschen, die viel nachdenken. Was für ein Stuss, denkt Beat, muss aber leider zugeben, dass die Beschreibung ziemlich zutreffend ist – und dass dabei andere, genauso vorhandene Merkmale ignoriert werden. Stehen Muttermale etwa ebenso dafür, unpünktlich, neugierig, adrenalinliebend und fantasievoll zu sein? So würde Beat sich eher selbst beschreiben, keine Ahnung, ob es stimmt, darüber denkt er trotz seiner Muttermale lieber nicht allzu viel nach). Er zieht eine Grimasse, lächelt sich nun zu. Beat weiß, dass er eher unauffällig wirkt, einige Leute beschrieben ihm, dass sie nicht einmal gemerkt hatten, dass er im Raum war, bis zu dem Zeitpunkt, als er an ein Schlaginstrument ging und losspielte. Dann: wow – so erzählten sie es.
Während ihm der Übergang mit den Oktavsprüngen in Abes Variations on Dowland’s Lachrimae Pavana durch den Kopf spukt, die Arme im Kopf vor sich hin üben, wundert Beat sich, als er aussteigt, wie anders diese Semesterferien waren als die in den Jahren zuvor: Statt den Sommer wie ein fleißiger Musikstudent zu verbringen – Üben, Meisterkurs, Wettbewerb –, hat er sein altes Mountainbike aus dem Keller gepackt und zusammen mit einem Schulfreund die Alpen überquert, über den Reschenpass. Sie schliefen im Freien, aßen kaum etwas, fühlten sich freier als jemals sonst. (Über seine berufliche Zukunft dachte er kaum nach während der Überquerung, obwohl er sich das vorgenommen hatte.) Anschließend war er ein paar Tage mit einem befreundeten Hornisten eine italienische Hornistin in Verona besuchen. Auf den Stufen der Arena zu sitzen, Akkorde von Verdi-Opern zu hören und sich flüsternd zu unterhalten, war schön gewesen, bis die anderen beiden ein Paar wurden; Beat kam sich zunehmend fehl am Platz vor und reiste früher ab. Danach entspannte er mit seiner Mutter auf Kreta; zu heiß, um irgendetwas zu tun, selbst nachzudenken (manchmal mag ich das). Immerhin zwei Bücher gelesen, eine Biografie über John Cage und ein Sachbuch über die Entstehung des Kosmos. Da er seit Studienbeginn vor vier Jahren nicht mehr als eine Handvoll Bücher lesen konnte (keine Zeit, ich musste immer üben), ist das nicht schlecht …
Die Musikhochschule liegt nur zwei Häuser entfernt in seiner Straße. Den Weg über den grauen Büroparkplatz würde er nach vier Jahren täglichen Überquerens auch mit geschlossenen Augen finden. Und tatsächlich schließt er jetzt die Augen, will es versuchen. Eigentlich wenig Lust, dieselben Stücke zu spielen, die ich schon vor Jahren von Studenten hörte, damals viele Semester über mir, denkt er. In dem Moment röhrt aus der Tiefe einer entfernten Baugrube ein gedehnter, schleifender Ton, er bleibt vor Überraschung stehen, öffnet die Augen, vielleicht ein vom Kran gezogenes Stück Metallwand? Parallel hört er das spitze Zerschellen einer Glasscheibe – ein Unfall? –, helles Perlen von Stöckelschuhen auf dem Bürgersteig und ein tiefes Stöhnen von einem Zug des nahe gelegenen Hauptbahnhofs, während all das gebettet ist in das mehrstimmige Summen des Straßenverkehrs, das immer über dieser Stadt liegt. Wie ein Sekundenbruchstück aus einer nie gehörten Sinfonie? Als ob sein Oberkopf sich öffnet, leichtes Schweben und kribbelnde Finger: dass ich all diese Geräusche gleichzeitig wahrnehmen kann, wie sie zusammen einen wertvoll irisierenden Klang ergeben, ein aufgefächertes Panorama, das nicht aufhören soll. Die unerreichbare Erfüllung der Dinge, die sich in Lauten äußert? Dann ist es aber schon vorbei, ergeben die Geräusche nur noch eine belanglose Ansammlung von Stadtlärm, und er muss weitergehen.
Zwischen aufgereihten Firmenwagen kommt ihm der Moment in den Sinn, als er vor vier Jahren, nach der bestandenen Aufnahmeprüfung, voller Begeisterung über ebendiesen Büroparkplatz ging, ohne Eintrübung glücklich: dass er bald hier Musik studieren dürfte, bei dem renommierten Professor Hennig, den er gerade persönlich kennengelernt hatte, einem der wenigen Schlagzeugsolisten, der mit seinem Ensemble durch die ganze Welt tourt. Endlich von Menschen umgeben, die sich jeden Tag ausschließlich mit Musik beschäftigen, ohne etwas zu vermissen, ein Gefühl, als ob das richtige Leben beginnt, alles davor unbedeutend. Das Vorspiel hatte in einem überraschend kleinen Unterrichtsraum stattgefunden, sodass Beat dicht vor der Prüfungskommission stehen musste. Er genoss es, die monatelang vorbereiteten Stücke zu spielen, traf genau die richtigen Tempi, jeder Taktwechsel saß. Das Schönste aber war, als nach der Prüfung Professor Hennig persönlich vor die Tür kam, um ihm die Hand zu drücken und zu sagen, wie sehr er sich freue, «mit einem so begabten Studenten» in den nächsten Jahren zu arbeiten: «Wie du die Spannung in den Kantilenen gehalten hast im langsamen Satz von Bach – fantastisch. Und die heiklen Taktwechsel im Goldenberg, superpräzise, Kompliment. Außerdem ist es eine Freude, deine weichen Handgelenke zu sehen!» Beat wusste sofort, dass er hier studieren wollen würde. Schon als Jugendlicher an Wettbewerben wie Jugend musiziert teilgenommen und sie gewonnen, was ihm relativ leichtfiel, in sämtlichen Schulferien im Landes-, später Bundesjugendorchester gespielt: in Brahms’ erster Sinfonie an der Pauke hinter und über dem Orchester zu sitzen und mit jedem dunklen Schlag die pochende Ernsthaftigkeit des Lebens nicht nur zu spüren, sondern durch seine Schläge selbst hervorzurufen. Oder in Mahlers Sechster vor den Ohren aller den Hammer schlagen zu dürfen – die Musik wird immer langsamer, breitet sich aus, und die Entscheidung, wann du spielst, ist eine Hypothese, du musst im Vorfeld wissen, wann das Orchester auf dem Höhepunkt sein wird, und wenn ich den Hammer beschleunige, braucht’s vielleicht noch zwei, drei Zehntelsekunden. In dieser Zeit gibt es kein Zurück – die Empathie, das Hineinversetzen in die musikalische Situation. Viele kleine Erlebnisse bestärkten ihn in dem Gefühl, hier, in der Orchestermusik, spiele sich sein Leben ab. Dass seine Pauken nicht nur physisch das größte Instrument sind, sondern das ganze Orchester übertönen können, gab ihm Selbstsicherheit. Am Instrument und auf der Bühne habe ich mich wohler gefühlt, als mit Worten und im Gespräch etwas darzustellen, daran hat sich nichts geändert, denkt Beat auch jetzt. «Eigentlich passt Schlagwerk nicht richtig zu dir», sagte einmal ein Cellist zu ihm, ohne es böse zu meinen. Ein wenig stimmt Beat dem sogar zu. Vielleicht kein Zufall, dass ich oft mit Streichern befreundet bin, untypisch für Perkussionisten, die sich eher mit Blechbläsern und Schlagzeugern umgeben. Über die reine Lautstärke und Kraft konnte er sich wenig begeistern, stattdessen hat er seine Qualitäten als «sensibler Schlagzeuger» gepflegt, der differenziert, gefühlvoll und präzise mit den anderen Musikern zusammenspielt, jede Regung des Dirigenten wahrnimmt und in Bewegung übersetzt – kein Kunststück, da es ihm leichtfällt, sich Partituren zu merken, die Rhythmen der entscheidenden Stimmen auswendig zu wissen, sodass er jederzeit nach vorne schauen kann. Im Bundesjugendorchester wie auch im Hochschulorchester setzte der Dirigent ihn bald für die Solopauke ein; eine Position, um die ihn viele beneiden. (Niemandem sagt er, dass er heimlich die Geigerinnen und Cellisten bewundert mit ihren lang gezogenen Kantilenen, anschwellenden Tönen, ihrem Vibrato: Das ist auf keinem der vielen Schlaginstrumente möglich, die er beherrscht.) Beat hat die Hochschule erreicht. Schön, wieder hier zu sein: Alles ist so vertraut, als er durch den Hinterhof das ehemalige Bankgebäude betritt, vorbei an den von Bambusbäumchen umrahmten Bänken, auf denen am Morgen noch niemand ausruht. Beat freut sich auf die Klassenstunde, Professor Hennig und die anderen wiederzusehen.
Bongos, Tumba, Tomtom, Große Trommel und fünf Wood-Blocks sind um ihn herum aufgebaut. Die linke Hand spielt absteigende Linien aus Vierergruppen auf den Toms, die rechte die erst aufsteigende Fünfergruppe in entgegengesetzter Richtung auf dem Holzblock, dann vereinigen sich beide aufwärts. Beat mag diese Stelle, fühlt sich fast an, als ob sich die Gehirnhälften ineinanderschieben und losfliegen. Er hat das so oft geübt, muss quasi nichts mehr dafür tun, es nur geschehen lassen. Dann das lange Schlusstremolo zwischen höchstem Holzblock und tiefster Trommel – Himmel und Erde finden zusammen –, Fermate auf dem Tremolo, Höhepunkt des Chaos, Schluss. Beat sieht die Umgebung wieder klar, das Unterrichtszimmer, die Gesichter seiner Klasse und vorne Professor Hennig, wie meistens trägt er Kappe und Kapuzenpulli.
«Yes, yes, yes!», ruft Hennig, klatscht in die Hände und strahlt Beat an. Kann es sein, dass seine Augen leicht feucht sind? Er wirkt irgendwie ergriffen, obwohl das Stück, das Beat eben spielte, Xenakis’ Rebonds, überhaupt nicht anrührend, sondern wild und ziemlich virtuos ist. Er stellt sich neben Beat: «Du spielst wie ein Musiker, nicht wie ein Schlagzeuger. Die Linie, du kannst singen. So muss es sein. Im Leisen laut spielen. Energetisch, sodass die Musik groß wird und stark, ohne dass sie schreit.» Er nimmt die Schlägel und spielt eine kurze Phrase; wie immer klingt es extrem gut und irgendwie anders, ohne dass Beat den Unterschied exakt benennen könnte. Beat sieht zu den anderen hin, Özgür nickt heftig und zwinkert ihm zu.
«Spiel noch mal ab der Stelle, wo das Hauptthema zum zweiten Mal kommt, Takt …», fordert Hennig ihn auf, Beat weiß sofort, welche Stelle Hennig meint. «Da kannst du den Kontrast noch stärker herausarbeiten. Try to find the right play zone, dann erreichst du mehr Abstufungen in der Dynamik. Nimm den Schlägel noch steiler und spiel es mehr aus dem Handgelenk!»
Beat versucht es, bricht ab. Er schüttelt die Hände kurz aus und nimmt die Schlägel frisch in die Hand. Im zweiten Anlauf gelingt es richtig gut. Hennig hat recht, so bekommt die Stelle mehr Kontur. «Yes, yes», ruft er. Beat freut sich, plötzlich kommt die Melodie deutlicher heraus und es wirkt, als ob mehrere unterschiedliche Personen spielen. (Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen?)
«Und jetzt lehnst du dich zurück, wie ein Gentleman, yes! Achte auf dein Becken, die Füße.»
Beat trägt, zurückgelehnt und lässig um die im Halbkreis aufgebauten Instrumente tanzend, noch einmal eine längere Passage vor. Etwas hat sich verändert, gelöst.
Nur als sein Blick auf das aufgebrochene, marsrote Leder von Hennigs Sessel fällt und er merkt, dass es dieselbe Farbe wie die Felsen des darüberhängenden Landschaftsplakats hat (ist das Absicht? Ist es passiert?), ist er für einen Moment abgelenkt.
«That’s it! Volle Kontrolle, da ist nichts dem Zufall überlassen», ruft Hennig, «wer in dieser Klasse könnte das noch so spielen?»
Beat spürt, wie sein Gesicht wärmer wird, errötet. So herausgehoben zu werden, ist ihm unangenehm. Die anderen fangen jetzt aber selbst an zu klatschen, ein seltener Vorgang in der Klassenstunde. Die meisten lächeln ihm zu, Beat entspannt sich.
Bald ist die Stunde zu Ende, alle drängen zur Tür, auch Beat. «Das war faszinierend», «Wie waren deine Ferien?», «Hast dich ja lange nicht blicken lassen», «Bei Rebonds hattest du ein verrücktes Tempo drauf», «Kannst du mir bei meinem Griff helfen, bei dir sieht das so locker aus, ich kriege das nicht hin», sagt Özgür mit zusammengekniffenen Augen und bittet um eine Unterrichtsstunde. «Gern, kein Problem», antwortet Beat und bewegt sich mit den anderen in Richtung Treppe.
Nach wenigen Schritten drängt Özgür sich wieder neben ihn, spricht so leise, dass Beat ihn kaum versteht: «Deine Socken, ähm, verschiedene», es ist ihm sichtbar peinlich. «Oh! Danke. Passt schon», sagt Beat, läuft etwas schneller. (Eigentlich ist es ihm ziemlich egal, trotzdem unangenehm, darauf angesprochen zu werden.)
An der Treppe holt Hennig ihn ein, Beat bleibt stehen und die anderen gehen weiter. «Wenn du den Xenakis so im Vorspiel fürs Jahresstipendium bringst», sagt Hennig.
Das Auswahlvorspiel, Beat hatte es völlig vergessen. «Wann genau bin ich dran?», hoffentlich bemerkt Hennig nicht seine Überraschung.
«Um elf», Hennig verabschiedet ihn mit Faustcheck, «du machst das.»
«Vier heimische Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht. Acht Arten gelten als gefährdet bzw. stark gefährdet.» Da kein Überaum frei ist, sitzt Beat in der schmalen Abstellkammer und liest in einer Zeitung, die er verwaist im Foyer gefunden hat. Eigentlich müsste er üben. Aber bei Fledermäusen horcht er auf: Wie sie sich allein über das Hören im Raum orientieren, fasziniert ihn, seit er Kind war. Sie bilden sich eine innere Landkarte aus Schall, aus Lauten, die sie selbst ausstoßen. Die Übersetzung von sichtbarem Raum in etwas, das nur die Ohren wahrnehmen können. Auch dass sie in alten Häusern und Bäumen Unterschlupf finden, ist ihm sympathisch, in Ritzen, Fugen und Spalten. Jetzt aber ärgert er sich, dass sie ihre Lebensräume und Lieblingsnahrung, Nachtfalter, so unnötig verlieren … Eigentlich müsste er gerade üben. Dafür braucht er kein Instrument, mentales Üben ist auch wirksam. Beat kann sich die Bewegungsabläufe im Kopf vorstellen, die Stücke wachrufen und feststellen, wo es noch hakt, damit sein Professor nicht merkt, dass er den Sommer über kaum –
Er beginnt eine Bodypercussion-Aufwärmübung für die Unabhängigkeit der Arme, liest dann doch lieber weiter: «Auch der Klimawandel bedroht die Populationen: Durch die Hitze in den Sommermonaten stürben viele Jungtiere, noch bevor sie flügge werden.» Sind das nicht die wahren Probleme?, denkt er, und hier sorgen wir uns nur darum, wie viele Stunden wir heute üben. Wahrscheinlich gibt es kaum unpolitischere, weniger am Weltgeschehen interessierte Menschen als in der Musikhochschule. Wie er im ersten Semester mit einer aufgeblätterten Zeitung lesend im Foyer saß, fällt ihm ein, alle starrten ihn an, als täte er etwas Peinliches. «Ignorance is bliss», rief eine neuseeländische Studentin ihm zu, sie meinte es ernst: Wieso Zeitung lesen, wenn du während der Zeit üben kannst? Du musst üben. Du musst immer üben! – fast alle hier sehen es so, er dagegen empfindet die Konzentration zunehmend als Einengung, wäre für Abwechslung dankbar. Dabei gibt es in keinem anderen Studienfach mehr Wechsel: Pauke, Marimba, Vibrafon, Triangel, Trommel, Drumset … Ich kann jeden Tag ein anderes Instrument üben, sofern mein Professor damit einverstanden ist. Wenn trotzdem manchmal der Eindruck entsteht, dass etwas fehlt, was hat das zu bedeuten?
Als Beat auf die Bühne tritt, pulst Aufregung in seinen Bauch. Er ist weniger vorbereitet als sonst. Doch der Anblick der leeren Stuhlreihen des Kammermusiksaals entspannt ihn (so oft hier gespielt), und die Juroren – darunter Hennig und zwei Externe – sitzen weit entfernt bei den Türen. Sie nicken ihm freundlich zu. Beat beginnt mit dem langsamen Stück, Keiko Abes Variations on Dowland’s Lachrimae Pavana, schon im ersten Takt ist er ruhig und konzentriert. Angenehm, wie seine Arme die richtigen Töne finden; ohne sein Zutun gleiten sie über die kurz nachklingenden Stäbe, befinden sich immer am richtigen Ort. Die Balance aus Loslassen und Spannung, die Hendrik Hennig in vielen Unterrichtsstunden früherer Semester von ihm forderte, heute hat er sie erreicht, Beat sieht auf: Hennig lehnt sich zurück, beide Arme hinter dem Kopf verschränkt, lächelt selbstgefällig zu den anderen Juroren hinüber.
Wann ist ihm das Spielen je so leichtgefallen? Vielleicht ist es sogar gut, dass er in letzter Zeit weniger übte, macht es ihn lockerer? Sich ganz auf seinen Körper verlassen zu können, wie eine endlose, ablaufende Folge von Automatismen, unmöglich, dass Fehler geschehen. Er lässt die Melodie zwischen den Wirbeln hervortreten und achtet darauf, dass der Klang weich bleibt.





























