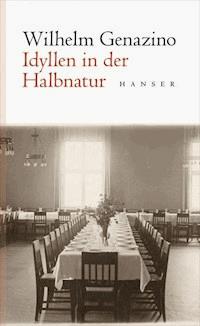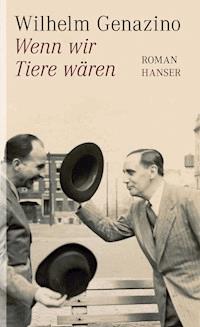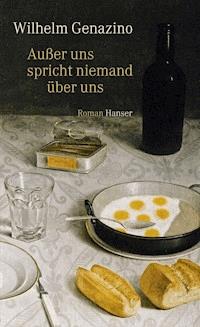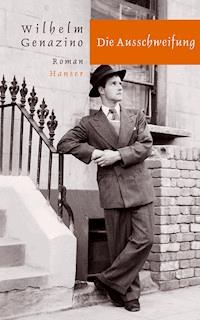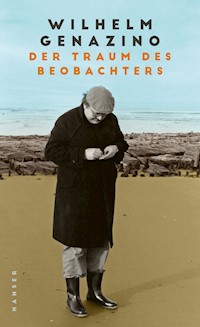Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist eine schwierige Sache, aber noch schwieriger ist die Liebe. Man hat nicht nur mit den eigenen Ansprüchen zu tun, sondern auch noch mit denen der Frau. Und die will eines Tages nicht mehr zusehen, wie der promovierte Philosoph und Provinzblattredakteur an ihrer Seite sich selbst ins Abseits manövriert. So überrascht es den Mann nicht, dass er sich eines Tages seinen Kram aus Sonjas Wohnung abholen soll und ihre Hochzeitsanzeige findet. Aber auch die Normalität ist keine Rettung, denn ein ordnungsgemäßer Ehemann macht Sonjas Leben zwar ordentlicher, aber auch unendlich langweiliger. Ein Happy End im Abseits – sollte man das für möglich halten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Wilhelm Genazino
Bei Regen im Saal
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24680-5
© Carl Hanser Verlag München 2014
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag Peter-Andreas Hassiepen, München © akg-images
Satz im Verlag
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
1
Ich wollte schnell zum Buffet, ein Glas Wein verlangen und mich dann in eine stille Ecke des Foyers verdrücken. Sogar hier, im Theater, fühlte ich meine Unruhe. Mein derzeit größter Wunsch war: Ich wollte einmal einen einfältigen Tag durchleben. Am liebsten wollte ich damit sofort beginnen. Der Wein kostete fünf Euro, ich reichte der Frau das Geld passend über die Theke. Ich stand in der Nähe einer hohen Glaswand und schaute auf die Straße hinunter. Obwohl ich mir die Hände gewaschen hatte, roch ich an meinen Fingern immer noch den Gummigeruch der Rolltreppenhandläufe. Der Geruch störte mich, aber ich wollte nicht noch einmal in die Toilette. Ich wollte über nichts nachdenken, machte mir aber trotzdem Gedanken, warum mir Gelassenheit manchmal gelang und manchmal nicht. Auf der Straße war kaum Verkehr. Ich war nicht sicher, ob ich nach dem Theater gleich nach Hause gehen würde. Das Theaterstück handelte von einer jungen Frau, die sich einbildete, sie sei eine Antilope geworden und werde demnächst als Antilope in einem Wald leben. Jetzt wollte die Frau ihre Freundin überreden, ebenfalls Antilope zu werden. Dann sollte die Freundin mit ihr in den Wald übersiedeln. Obwohl das Stück anregend und unterhaltsam war, empfand ich ein kleines Unbehagen. Es kam mir so vor, als hätte ich das Stück schon vor Jahren gesehen, was nicht der Fall war. Wahrscheinlich war ich mit vielen solcher Traumstücke vertraut, in denen verzweifelte Menschen das Unmögliche suchen und es nicht finden. Ich schaute immer noch auf die leere Straße hinunter und sagte mir: Man muss dort suchen, wo nichts geschieht. Nicht weit von mir wandelte eine blonde Frau mit einem Sektglas in der Hand. Ich kannte die Frau ein wenig und wunderte mich, sie im Theater anzutreffen. Sie arbeitete in der Bankfiliale, in der ich mein Konto hatte. Die Frau behandelte mich zuvorkommend und freundlich, obgleich sie mir stets unruhig und gehetzt erschien. Wahrscheinlich ähnelte sie mir, und es war mir unangenehm, die Ähnlichkeit zu bemerken. Offenbar war auch sie im Theater, weil sie hier ungestört ihre Zeit verbringen konnte. Vor etwa vierzehn Tagen war in der Bank ein etwa dreißigjähriger Mann vor mir an der Reihe. Die Bankfrau füllte für den Mann ein Auszahlungsformular aus und sagte kurz darauf ein wenig zu laut in den Schalterraum hinein: Ach so, Sie sind Analphabet. Der Mann nickte und sagte nichts. Sie schob ihm das Formular hin, und ich sah, wie der Mann dort, wo er hätte unterschreiben müssen, eine kurze Wellenlinie zog.
Ich hatte noch nie einen Analphabeten gesehen. Als er die Filiale verließ, ging ich eine Weile hinter ihm her. Von Zeit zu Zeit sagte ich mir: Schau, so sieht ein Analphabet aus. Ich brauchte eine Weile, bis ich mir eingestand, dass der Mann genauso aussah wie alle anderen auch. Der Wein war nicht besonders gut. Durch die Lichtreflexe der hohen Glaswände konnte ich weite Teile des Foyers überblicken. Die Frau aus der Bank hatte ich aus dem Blick verloren. Wenn ich ihr direkt begegnet wäre, wäre ich vermutlich versucht gewesen, mit ihr über das Theaterstück zu reden. So aber konnte ich unbehelligt mit mir selber herumempfindeln, ob ich schon nach dem Ende der Pause nach Hause gehen sollte oder nicht. Ich fand es nicht in Ordnung, dass ich vielleicht nicht mehr fähig war, ein Theaterstück bis zum Ende anzuschauen. Es war möglich, dass ich eine gewisse Unlust vor dem Wochenende empfand. Morgen war Freitag, und das bedeutete, dass ich früh zum Bahnhof eilte, um nach Karlsruhe zu fahren. Dort betrieb meine Tante Elli ein Schreibwarengeschäft. Tante Elli war die einzige Schwester meiner toten Mutter. Vor etwa einem halben Jahr hatte sie mich angerufen und gefragt, ob ich nicht an Wochenenden gelegentlich nach Karlsruhe fahren und ihr im Geschäft aushelfen könne. Meine praktisch veranlagte Freundin Sonja riet mir sofort zu. Schaden kann es nichts, sagte sie, was auch meine Mutter oft gesagt hatte. Es irritierte mich, wenn ich aus dem Mund von Sonja dieselben Botschaften hörte wie einst von meiner Mutter. Ich hatte eingewilligt, Tante Elli war dankbar. Das Schreibwarengeschäft war eine Art Überbleibsel aus den siebziger und achtziger Jahren. Man konnte bei Tante Elli nach wie vor einen einzelnen Radiergummi, zehn Briefumschläge und dreißig Blatt Schreibmaschinenpapier kaufen. Ich hatte keine Ahnung, ob der Laden noch rentabel und wie hoch der monatliche Umsatz war. Tante Elli redete darüber nicht und ich fragte nicht. Ich hielt es nicht für ausgeschlossen, dass ein plötzlich eintretender Konkurs Tante Ellis Geschäftsleben überraschend beenden würde. Tante Elli hatte das Bedürfnis, mich zu bezahlen, was ich wahrscheinlich nicht deutlich genug ablehnte. Ich ließ mir außerdem die Kosten Frankfurt – Karlsruhe erstatten. Übernachtungskosten fielen nicht an, weil ich die Nacht von Freitag auf Samstag auf einem übriggebliebenen Feldbett in den hinteren Winkeln des Ladens verbrachte. Tante Elli hatte mir angeboten, auf der Couch in ihrem Wohnzimmer zu schlafen. Aber die Welt der Häkeldeckchen und der Tortenböden und der Nähmaschinenhaube und der Erntebilder an den Wänden ging mir zu nah, was Tante Elli erstaunlicherweise zu verstehen schien.
Soeben läutete zum ersten Mal die Pausenklingel. Ich wusste immer noch nicht, ob ich mir den zweiten Teil des Stücks ansehen sollte oder nicht. In diesen Augenblicken entdeckte ich die Frau aus der Bank wieder. Sie saß allein in einem kleinen Sessel und verzehrte zwei kleine Brotschnitten. Sie kaute schnell, genierte sich aber offenbar nicht. Es verdutzte mich, dass jemand im festlichen Theater mitgebrachte Brote verspeiste. Über die Kränkung des Stilempfindens hinaus erschien mir die Frau souverän und auf ihre Weise unanfechtbar. Schließlich schlurften hier auch viele Jugendliche in Turnschuhen und T-Shirts herum, an denen ebenfalls niemand Anstoß nahm – außer mir vielleicht. Ich war dagegen, dass es nur noch eine Welt gab, in der Turnschuhe, Bluejeans und belegte Brote den Ton angaben. Dabei gefiel mir die Bankangestellte immer besser, sie sah jetzt fast aus wie ein Original von Edward Hopper. Die Art, wie sie nahezu reglos in einem Plastiksessel saß, kaute und dabei ihren dunkelgrünen Rock betrachtete, hob sie hervor. Sie war deutlich getrennt von den vielen Handwerker-Ehepaaren, die für einen Theaterabend immer noch ihre besten Sachen anzogen. Es war für mich fast ein Glückserlebnis, wenn in der Wirklichkeit plötzlich ein Kunstbild auftauchte. Es steigerte meine Erfahrung, dass die Frau den Namen Edward Hopper wahrscheinlich nie gehört hatte und von der Kunstähnlichkeit ihres bloßen Dasitzens nichts wusste. Sie faltete das Einwickelpapier der Brote zusammen und verstaute es in den Tiefen ihrer Handtasche.
Aus plötzlicher Dankbarkeit für die Entdeckung des Bildes wollte ich mir jetzt doch den zweiten Teil des Stückes ansehen. Ich wartete, bis die Bankangestellte sich erhob und vor mir in den Zuschauerraum ging. Sie saß nicht einmal weit von mir entfernt. Ich spekulierte, dass sie jetzt, im beginnenden Dunkel, eine weitere Brotschnitte auspackte, aber das geschah nicht. Eine Woche verging, ehe ich die Frau in der Bank wiedersah. Ich war dankbar, dass sie nichts von meinen Erlebnissen mit ihrem Bild wusste. In der Bank sah sie nicht aus wie ein Kunstwerk. Diese erstaunliche Herabsetzung lag vermutlich an der Gesamtschlichtheit der Bankfiliale. Weißes Neonlicht fiel in großen Mengen von der Decke herunter und machte die Leute und die Gegenstände blass. Es gab hier nichts außer ein paar Schreibtischen, Telefonen, Papierkörben, Bildschirmen. Die Gesichter der Angestellten wirkten, als hätten sie schon in ihrer Kindheit gewusst, dass sie sich eines Tages hier treffen würden.
Zwei Tage später kam Sonja. Sie war ein gütiger Mensch und verdiente außerdem gut. Wenn ich mich nicht täuschte (ich täuschte mich nicht), dann liebte sie mich, und wenn ich mich immer noch nicht täuschte (ich täuschte mich immer noch nicht), dann liebte ich sie ebenfalls. Wir hatten uns dessen schon öfter versichert, und jedes Mal freuten wir uns, dass wir unser Geständnis schon kannten. Sonja war Beamtin, sie arbeitete als Bereichsleiterin im Finanzamt II und war inzwischen unkündbar. Sie konnte nur noch aufsteigen, was sie gelegentlich tat. Sie vertrat die mich erstaunende These, dass sie, seit sie mit Leitungsaufgaben im Amt betraut war, immer weniger arbeitete. Auch sie hatte Bildschirme auf dem Schreibtisch, insgesamt vier Stück, hatte sie mir erzählt. Sie war dafür verantwortlich, dass die Arbeit der Behörde reibungslos ablief. Eingreifen musste sie, wenn sie bemerkte, dass in einzelnen Arbeitsbereichen Stockungen entstanden. Ihre Qualifikation bestand darin, sagte sie, dass sie die Behörde vollständig durchschaute. Ihr nicht bloß lustig gemeinter Lieblingssatz war: Mein Herrschaftswissen reicht bis in den Keller des Amtes.
Gemessen an Sonjas Verankerung in der realen Welt gehörte ich eher zu den Problemfällen. Ich hatte ein überlanges Philosophiestudium hinter mir und hatte dann über Kants Apodiktizität promoviert. Von Anfang an hatte ich gewusst, dass meine Promotion (Kant hätte gesagt) nur sittlichen Wert hatte oder, bösartiger formuliert, nichts weiter war als ein biografischer Zierat. Ein bisschen niederschmetternd war, dass ich mich auch darin noch irrte. Die Zeiten, in denen ein Doktortitel die Menschheit beeindruckte, waren lange vorbei. Ich hatte mir tatsächlich vorgestellt, dass ich in der akademischen Welt Karriere machen würde. Über diese Illusion konnte ich heute kaum sprechen, ohne mich zu genieren. Es war möglich, dass meine akademische Naivität einer der Gründe war, warum Sonja mich eines Tages zu lieben begann. Denn ein so schlichter, zuweilen fast schon einfältiger Mensch wie ich musste von einer starken realistischen Frau geliebt werden, damit weitere, größere Irrtümer unterblieben.
Wir hatten ausführlich zu Mittag gegessen, Sonja erzählte mir die neuesten Absurditäten aus ihrer Beamtenwelt. Sie fragte, wie es im Theater gewesen war, ich erzählte ihr von dem Theaterstück und verschwieg, dass ich mich gelangweilt hatte.
Wann gehst du zum Arzt? fragte sie plötzlich.
Mit dieser Frage hatte ich gerade in diesen ganz anderen Augenblicken nicht gerechnet.
Wahrscheinlich am Dienstag, sagte ich.
Hast du einen Termin? Oder nicht?
Ja, sagte ich, ich muss aber noch mal anrufen.
Also du hast keinen Termin? Mein Vater hatte jahrelang Schmerzen in der Brust, aber er ging nicht zum Arzt. Eines Tages hatte er einen Herzinfarkt, dann war es zu spät.
Ich merkte, Sonja war mit meinen Antworten nicht zufrieden, aber sie insistierte nicht. Es war gerade Samstag, und samstagnachmittags legten wir uns gewohnheitsmäßig ins Bett. Manchmal schliefen wir ein, manchmal nicht. Sonja suchte nach einer Wolldecke, woraus ich weiter schließen durfte, dass sie richtig schlafen wollte, aber sicher war auch das nicht. Sonja legte Bluse und Rock ab und griff zärtlich nach mir. Wenn sie, wie in diesen Augenblicken, ihren Kopf in das Kissen senkte, wurde ihr Hals ein wenig dicker, wie damals bei meiner Mutter. Meine Mutter war seinerzeit schon breit und füllig geworden und brauchte eine Weile, bis ihr liegender Körper rundum von den Rändern einer Wolldecke eingefasst war. Ich war damals ungefähr zwölf Jahre alt und schlich um sie herum. Ich bedauerte, dass sie sich nicht mehr von mir helfen ließ wie früher. Sie hatte gesagt, ich sei für das Einschieben des Wolldeckenrands unter ihren Körper inzwischen zu groß, was ich damals nicht verstand. Sonja warf sich die Wolldecke nur locker über den Körper. Ich liebkoste ihren Busen und beobachtete durch die gläserne Balkontür die Amseln. Sie schissen immer wieder in die vordere linke Ecke des Balkons, als hätten sie sich diese Ecke als gemeinsame Toilette auserkoren. Ich lag, auf meinen linken Ellbogen aufgestützt, dicht neben Sonja und schob ihre seitlich abgerutschten Brüste nach oben. Ich sah gern dabei zu, wie die Brüste wieder und wieder herabrutschten, sobald ich meine Hand entfernte. Nach einer Weile begann es zu regnen, und ich hörte das Auftreffen der anfangs schweren Tropfen auf den Blättern der im Garten stehenden Platane. Einmal umkreiste ein Polizeihubschrauber das Wohnviertel, und ich war froh, dass ich die Balkontür nicht geöffnet hatte. Der Hubschrauber galt vermutlich einer Demonstration, die für heute Nachmittag angekündigt war. In der Platane lebten viele Vögel, die durch den Lärm des Hubschraubers aufgeschreckt wurden. Die Gärten waren voneinander nicht mehr richtig getrennt. Die Gartenbesitzer fanden ihre Gärten nicht mehr so wichtig wie früher, sie pflegten sie nur unregelmäßig und gingen auch nicht gegen den allmählichen Verfall der Zäune vor. In den Gärten lebten inzwischen Eichhörnchen, Spechte, Eichelhäher, Krähen, Enten, ein paar Wildgänse und sogar Wiesel. Nein, Wiesel nicht. Die Wiesel erfand ich manchmal, wenn ich das Gefühl hatte, ich müsste übertreiben, damit man mir zuhörte. Was ein Wiesel ist und wie es aussieht, wusste ich nur, weil ich als Zwölfjähriger ganze Nachmittage lang in der Küche das Sanella-Album »Tiere in Wald und Flur« angeschaut hatte. Etwa in der Mitte des Gartens befand sich ein vernachlässigter Teich, an dessen Rändern Enten herumstanden und manchmal auch Wildgänse, die einmal herbeigeflogen waren und nicht mehr verschwanden. Die Gänse nährten sich hier, genau wie die Enten, auf den üppigen Grasflächen. Eine der Gänse, die ein wenig aggressiv war, biss manchmal nach den Enten, ehe sie sich ins Gras niederließ. In den Augenblicken, wenn sie ihren Körper in das Gras einbettete, erinnerte mich das Tier an meine Mutter. Auch sie brauchte sehr lange, um ihre richtige Ruhelage zu finden. Inzwischen war Sonja eingeschlafen. Es war mir klar, dass sie jetzt etwa zwei Stunden schlafen würde, wenn nicht länger. Sie brauchte das Wochenende tatsächlich, um sich von ihrer Arbeit zu erholen. Ich überlegte, ob ich das Bett verlassen und ein wenig spazieren gehen sollte. In der Nähe war ein kleiner Park, in dem sich Karnickel angesiedelt hatten. Ich musste über die Tiere lachen, was ich auch ohne Skrupel tat, obwohl ich mich fast bei jedem Lachen an einen Lehrer erinnerte, der den Kindern einschärfte, dass jedes Lebewesen seine göttliche Würde habe und deswegen nicht ausgelacht werden dürfe. Tiere könnten selbst nicht lachen und wüssten deswegen auch nicht, was das Lachen der Menschen bedeute. Nicht nur das Hoppeln der Karnickel wirkte komisch, sondern mehr noch der bei jedem Schritt nachgezogene Hinterleib. Ich nahm an, es war das scheinbare Auseinanderfallen des Körpers, was das Lachen auslöste.
Aber Sonja schätzte es nicht, wenn sie wie meine Mutter nach etwa zwei Stunden aufwachte und dann allein war. Also blieb ich im Bett und sorgte mich, dass ich diese Duldsamkeit vielleicht nicht für alle Zeit aufbringen würde. Ich knipste mein kleines Radio an und drehte den Ton sehr leise. Ein Sprecher sagte, dass es in den Bergen mildes und trockenes Wetter geben werde. Welche Berge? fragte ich mich tonlos. Ich kannte keine Berge, hier war alles flach, aber es musste irgendwo Berge geben. Sonja schimpfte mich manchmal wegen meines kleinen Radios. Ich wundere mich, dass du so ein kleines quietschendes Ding hast, sagte sie; Bauarbeiter auf den Gerüsten haben solche Radios, weißt du das nicht? Ich ging auf derlei Vorhaltungen nicht ein. Ich hielt es für ein gutes Zeichen, dass mich Sonja an meine Mutter erinnerte, was ich ihr nicht sagte. Ich fürchtete, es würde ihr nicht gefallen, jetzt schon meiner üppigen Mutter zu ähneln.
Nur weil Sonja es heftig wünschte, ging ich zum Arzt. Gleich zu Beginn stieß mir ein Missgeschick zu. Die Ärztin hatte angeordnet, dass ein EKG gemacht werden müsse, und beauftragte damit die Arzthelferin Marion, eine gutaussehende, wohlgeformte Frau, die mich in einen Nebenraum bat. Sie sagte, ich solle einen Ärmel meines Hemdes hochschieben, dann setzte sie sich mir gegenüber und sagte, ich solle den Arm strecken und eine Faust machen. Im Augenblick, als Marion die Kanüle ansetzte, schloss ich schreckhaft die Finger zu einer Faust zusammen, was nicht gelang, weil ich in der Hand plötzlich die rechte Brust beziehungsweise den BH von Marion fühlte, ein vermutlich seidenes Säckchen, welches das Zucken meiner Finger sofort an Marions Körper weiterleitete. Marion schien nicht zu bemerken, dass ihre rechte Brust momentweise in einer fremden Hand lag. Ich guckte leer in eine Ecke und wusste nicht, ob ich mich entschuldigen sollte. Marion war offenbar nicht irritiert. Die Ärztin untersuchte mich schnell und routiniert und sagte, ich solle noch einmal im Wartezimmer Platz nehmen. Im Wartezimmer hing ein Plakat, das eine hochschwangere Frau zeigte. Darunter stand: Grippeimpfung für Mutter und Kind. Die Brüste der Schwangeren waren ähnlich groß wie die Brüste meiner Mutter. Seit sie tot war, erinnerte ich mich oft an sie. Ich war heute dankbar, dass ich sie als Kind oft nackt gesehen hatte. Wahrscheinlich nahm sie damals an, dass ich noch keinerlei erotische Interessen hatte, was ein Irrtum war. Ich wartete oft vor der Badezimmertür, bis sie wieder erschien, meistens ganz oder überwiegend nackt, und in das Schlafzimmer ging, wo sie viel Zeit vor dem geöffneten Kleiderschrank verbrachte. Wenig später begann ich zu onanieren und benutzte das Bild meiner halbnackten Mutter als Leitbild meiner Phantasien. Mein merkwürdiger Vater, den ich als Kind nicht verstanden hatte, verwandelte sich allmählich in eine Figur, die ich mehr und mehr schätzte. Auf dem Pullover meines Vaters saß oft eine Motte, was ich ihm nicht sagte. Und wenn ihm die Motte den halben Pullover weggefressen hätte, ich hätte es ihm nicht gesagt. Ich musste ein bisschen lachen über die Nichtswürdigkeit meiner Erinnerungen. Dass ich überwiegend unfreundlich wirkende Erinnerungen an meine Eltern hatte, durfte ich Sonja nicht sagen. Sie war der Meinung, dass sich ein erwachsener Mann mit seinen Eltern ausgesöhnt haben musste, auch wenn die Eltern schrecklich gewesen waren.
Da öffnete sich die Tür des Wartezimmers. Die Ärztin erschien und sagte mir, dass sie bei mir nichts Auffälliges hatte feststellen können. Bitte rufen Sie nächste Woche an, dann erfahren Sie Ihre Blutwerte. In Ordnung, danke schön, sagte ich. Zwei Minuten später war ich draußen. Ich wunderte mich, wie unaufgeregt der Arztbesuch abgelaufen war. Die Unscheinbarkeit meiner Erlebnisse begann mich zu beunruhigen. Ohne besondere Absichten lief ich die Stresemannstraße entlang. Ich überlegte, ob ich Sonja anrufen sollte, um ihr das Ergebnis der Untersuchung mitzuteilen. Aber wahrscheinlich hatte sie schon vergessen, dass sie mich zur Ärztin geschickt hatte. Erst dieser Tage hatte sie gesagt: Ich erwarte ja immer irgendwelche Unglücke, aber dann stellt sich heraus, dass meine armselige Phantasie die Katastrophe ist, sonst nichts.
Links wurde eine kleine Grünanlage sichtbar. Ein Bettler lief umher und leuchtete mit einer modernen Stabtaschenlampe in die Tiefe der Abfallkörbe hinein. In einiger Entfernung sah ich plötzlich die Bankangestellte. Sie saß auf einem Mäuerchen und suchte etwas in ihrer Handtasche. Ich wollte ihr nicht begegnen und änderte meine Laufrichtung. Das heißt, vorher wollte ich sehen, was sie in ihrer Handtasche suchte. Es kam eine kleine Plastikbox zum Vorschein. Ich war bis zu den Schultern hinter einem Gebüsch verborgen. Die Angestellte öffnete die Box und entnahm ihr zwei Brotschnitten. Im Theater hatte sie auf die Plastikbox verzichtet, was ich sofort verstand; sie lag jetzt leer und geöffnet in ihrem Schoß. Ein winziger flüchtiger Ekel ging von ihr aus. Der Ekel war noch dazu unauffällig, beinahe zierlich, ein fast schmucker Alltagsekel, wie er vielen Haushaltsgegenständen anhaftet.
2
S