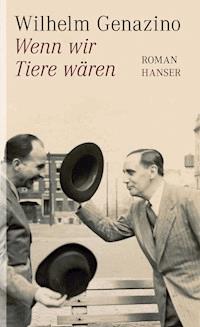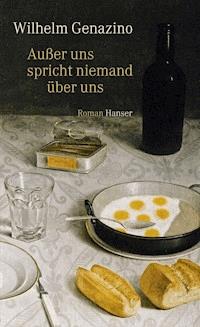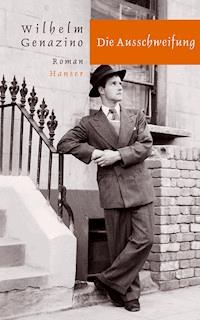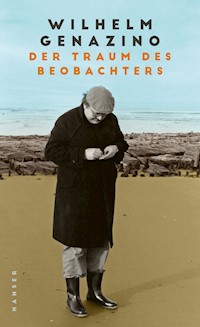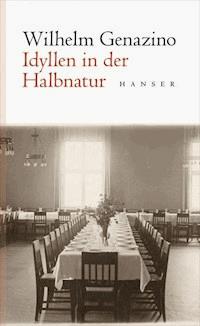
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt ist voller Merkwürdigkeiten, man muss nur hinsehen. Ein Mann verliert einen Schuh. Ein anderer Mann, Kleist, beschreibt seiner Braut auf Hunderten von Seiten, durch welche gründlichen Maßnahmen sie beide unfehlbar glücklich werden. Der Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino erzählt, wie er schreibt, wie er zum Schreiben kam und warum die Welt so merkwürdig und ohne Bücher kaum auszuhalten ist. In Prosastücken und Essays nähert er sich auf unverwechselbare Weise Büchern und Bildern, vor allem aber Menschen, seien sie nun Schriftsteller, deren berühmte Figuren oder auch jene Namenlosen, die irgendwann auf der Straße ihren Schuh verlieren. Und damit einen ungeschriebenen Roman erleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Wilhelm Genazino
Idyllen
in der
Halbnatur
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24108-4
© Carl Hanser Verlag, München 2012
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
I
Der verlorene Schuh
Ich habe noch nie mit eigenen Augen gesehen, wie ein Mann nachts oder tagsüber einen Schuh verliert, sich von diesem Missgeschick jedoch nicht beeindrucken lässt, sondern seinen Weg fortsetzt: einen Schuh in der Fremde zurücklassend. Ich habe auch noch nie eine Frau gesehen, die ihrer Stöckelschuhe von einer Minute zur nächsten überdrüssig geworden ist – und einen oder beide Schuhe ausgezogen und an irgendeiner windigen Ecke zurückgelassen hat.
Man muss solche Vorgänge für möglich und wirklich halten. Was man von ihnen immer wieder nur sieht, ist das letzte Glied der Handlungskette: ein einsamer Schuh, meist ziemlich mitgenommen, oft nass, weil schon seit Tagen herumliegend. Ebensolche Frauenschuhe, oft sogar paarweise und ordentlich nebeneinander stehend, auf Nimmerwiedersehen verlassen.
Oder verstoßen? Eine ernsthafte Dame, von Beruf Psychoanalytikerin, die ich mit dieser Frage konfrontierte, sagte: Es handle sich wahrscheinlich um Aussetzungen. Kleidungsstücke, so die Psychoanalytikerin, sind gefühlsmäßig hochbesetzte Objekte, die für bestimmte Körpererlebnisse oder Lebensabschnitte stehen, von denen sich die Betroffenen nur mit erheblichem inneren und/oder äußeren Aufwand lösen wollen oder müssen. Deswegen auch der Schau-Charakter der Trennung. Andere sollen sehen, wie schwer jemandem eine Ablösung gefallen ist. Das Objekt, der Schuh, ein symbolischer Darsteller, soll einen öffentlichen Niedergang erleben.
Das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen Fall zutreffend; gewiss aber nicht für die große Zahl herumliegender Schuhe. Ich habe diese Phantasie: Ein betrunkener Mann verliert beim Versuch, den Heimweg ohne fremde Hilfe zu schaffen, einen Schuh, ohne es zu bemerken. Für die Damenwelt fällt mir diese Variante ein: Irgendwo ist eine rasante Geburtstagsfeier im Gange; eine ebenfalls schon beschwipste Dame möchte ihre Freunde verblüffen, zieht einen oder beide Schuhe aus – und wirft sie in hohem Bogen aus dem Fenster. Ein Partygag. Die Gäste sind tatsächlich verblüfft, die Schuhe landen auf dem Bürgersteig, bleiben dort auch liegen und verwundern am nächsten Tag Leute wie mich, die wieder einmal nicht gesehen haben, wie so etwas geschehen konnte.
Rätselhaft ist der starke Eindruck, den herumliegende Schuhe auf die anderen Passanten machen, die niemals Schuhe verlieren. Im Gegenteil, die »anständigen«, skandalfreien Schuhträger erleben in solchen Augenblicken eine gewisse Stärkung ihres ordentlichen Lebensgefühls. Es ist, als wären herumliegende Schuhe kleine Denkmale, die uns daran erinnern, dass wir nicht einen halben Tag lang vom rechten Weg abkommen dürfen. Sonst droht uns ein Lebensgefühl, das Eugène Ionesco (in seinem Tagebuch) auf diesen Punkt gebracht hat: Wir alle fürchten uns vor der plötzlichen Entdeckung, dass unser Leben »verpfuscht« sein könnte.
Insofern sind herumliegende Schuhe, entgegen ihres harmlosen Aussehens, veritable Mini-Menetekel, schändlich, schmutzig, rätselhaft und sehr beeindruckend. Charlie Chaplin hatte von der Symbolkraft kaputter Schuhe ein tiefes Wissen. Der Held seiner frühen Stummfilme hatte stets äußerst erbarmungswürdige Treter an den Füßen. Sie waren (sind) so zerstört, dass sie jeden Augenblick auseinanderfallen können und deswegen mit Kordeln und Lumpen umwickelt sein mussten.
Einmal landen Charlies Schuhe sogar in seinem mit Spaghettis gefüllten Teller, und Charlie merkt es nicht, dass er die Schnürsenkel für Spaghetti hält und sie prompt mitverspeist. Diese berühmte Szene ist deswegen so unerhört, weil die Schuhe im Teller momentweise ihre symbolische Macht in die Wirklichkeit entlassen und die Zuschauer von der Angst befreien, die von herumliegenden Schuhen ausgeht – und ungehindert in den Geist ihrer Betrachter einwandert.
Der Schuhmacher, bei dem ich meine Schuhe neu sohlen lasse, verkauft einmal im Jahr von ihm reparierte, von ihren Besitzern aber nicht wieder abgeholte Schuhe für ein Taschengeld. Er selber hat keinen Verlust, weil er Schuhreparaturen nur noch gegen Vorauskasse annimmt. Er stellt die zwar gebrauchten, aber tadellos wieder hergerichteten Schuhe nebeneinander in sein Schaufenster. Aber kaum jemand schaut gebrauchte Schuhe an, niemand kauft gebrauchte Schuhe. Der Schuhmacher gibt trotzdem nicht auf. Er und ich schimpfen auf die Leute, die ihre Schuhe vergessen oder verschlampen oder gar – wer weiß – tatsächlich verstoßen.
Dabei fällt der Widerspruch auf, dass einige Menschen (nicht alle) gebrauchte Jacken oder Mäntel durchaus »ertragen« können, gebrauchte Schuhe jedoch nicht. Ich nehme an, dass der Mensch zu seinen Schuhen ein erzählerisches Verhältnis hat, in dem viele Widersprüche bis zur Selbstverstummung ausgetragen werden können. Zuweilen werden Schuhe geopfert, weil der Schuhträger das Gefühl hat, dass diese zuviel von ihm wissen. Immerhin kennen die Schuhe alle seine/ihre Wege innerhalb einer bestimmten Vergangenheit, für die ein Mensch nicht immer (eingebildete) Mitwisser haben möchte.
Ich erinnere mich gut, dass das Erzähl-Verhältnis zu meinen Schuhen einsetzte, als ich etwa zehn Jahre alt war. Meine Mutter ging mit mir in die Stadt und kaufte mir meine ersten Sandalen. Sie gefielen mir so gut, dass ich mich in sie verliebte. Ich trug sie nicht, weil ich verhindern wollte, dass sie zu schnell unansehnlich würden. Lieber nahm ich die Schuhe in der Wohnung in die Hand und schaute sie an. Eine Weile nahm ich die Schuhe sogar mit ins Bett; wenn sie ruhig neben meinem Kissen lagen und ich sie betrachtete, ging eine Art von Glück von ihnen aus.
Gerade diese Sandalen wirkten wenig später an meiner Selbsterziehung mit. Als ich sie zum ersten Mal an den Füßen hatte, regnete es lang und heftig. Mit sanfter Unaufhörlichkeit tastete sich der Regen bis zu den Zehen vor. Immer neue Regenfälle brachten mich fast zur Verzweiflung. Ich wusste nicht, wie ich verhindern sollte, dass meine neuen Sandalen innerhalb kurzer Zeit miserabel ausschauten. Ich weinte auf der Straße und war fassungslos. Ich konnte niemandem sagen, was mit mir los war; ich wusste es ja selbst nicht. Es war (vermutlich) das erste Auftauchen des Fatums: das Überschwemmtwerden durch ein rätselhaftes Schicksal.
Heute ist das Eindringen des Regens in meine Schuhe das Wiedereindringen meiner Kindheit in mich. Es dauert dann nie lange, bis mir verloren geglaubte Bilder und Details wieder und wieder einfallen. Ich gehe im Regen umher und bin gleichzeitig erwachsen und Kind. In dieser libellenartig hochgetriebenen Überempfindlichkeit macht es mir plötzlich Vergnügen, widrigen Verhältnissen standzuhalten und mich durch sie hindurchzukämpfen. Und das nur wegen ein Paar neuer Sandalen!
Insofern kommt der Idee der anfangs zitierten Psychoanalytikerin erhebliche Wahrheit zu. Schuhe sind Darsteller der Kämpfe unserer verinnerlichten Lebensmaximen. Verlassene Schuhe anziehen würde bedeuten, in eine übriggebliebene Lebenserzählung eines anderen Menschen einzusteigen; instinktiv empfinden wir davor ein Befremden und lassen die verlorenen Schuhe lieber mit sich allein. Gleichzeitig ist diese Barriere (nicht in eine fremde Schuh-Körper-Erzählung eindringen wollen) auch der Grund, warum wir so oft einzelne Schuhe in den Straßen herumliegen sehen: ihre Besitzer haben die Erzählung ihrer Schuhe nicht länger ertragen.
Dann habe ich doch noch mit eigenen Augen gesehen, wie ein Schuh (fast) verlorenging. Es war auf einem großen Spielplatz. Viele Kinder sprangen schreiend und johlend umher. Die Mütter saßen ringsum auf den Bänken und schauten dem Treiben zu. Plötzlich verlor ein umherrennender, etwa zehnjähriger Junge seinen linken Schuh. Der Junge und einige andere Kinder bemerkten das Missgeschick, aber der Junge zeigte keine Lust, sich den Schuh wieder anzuziehen. Er war viel zu sehr in sein ununterbrochenes Spiel vertieft. Und, was wichtiger war, er hatte schon bemerkt, dass ihm der verlorene Schuh eine amüsante Nebenrolle zuschob. Andere Kinder lachten über ihn, weil er ungehemmt mit dem Zwischenfall umgehen konnte. Der Junge war plötzlich so etwas wie ein kleiner Spielplatz-Clown geworden. Er verstärkte seine Rolle mit selbst erfundenen Faxen beim Gehen und Rennen. Es gefiel ihm, dass er für die anderen einen solchen Unterhaltungswert hatte. Die Mutter forderte ihn vom Spielplatzrand auf, seinen Schuh wieder anzuziehen. Er überhörte die Mutter beziehungsweise weigerte sich, ihren Anordnungen zu folgen. Da nahm die erboste Mutter den verlorenen Schuh an sich, schimpfte ihren Sohn und verließ mit diesem den Spielplatz. Auch jetzt, beim Abgang, humpelte der Junge gekünstelt davon. Er bemerkte nicht einmal, dass die anderen Kinder nicht mehr so sehr über ihn lachten wie zu Beginn der Szene.
So schön kann es sein, einen Schuh zu verlieren.
Von der Bruchbudenhaftigkeit des Schönen
Es zeichnet sich ab, dass der Kommerz der finale Antrieb der westlichen Zivilisation bleiben wird. Die Spezialisten, die heute allgemeine, öffentliche Schönheit hervorbringen könnten (Ingenieure, Stadtplaner, Architekten etc.), sind so stark, das heißt ausschließlich vom Zwang zur Rentabilität beherrscht, dass sie ihre eigentliche Aufgabe, die Vermehrung des Wohlgefallens, haben vergessen müssen. Ich nenne ein Beispiel aus der jüngsten Gegenwart. Vor kurzem ist das »größte Schiff der Welt«, die »Queen Mary«, in Dienst genommen worden. Das Schiff ist ein gewaltiger Koloss, ein Monster. Es ist gebaut worden von Leuten, die vergessen haben, wie ein schönes Schiff aussieht. Wer die Queen Mary an sich vorüberziehen lässt, hat plötzlich das Gefühl, es handelt sich gar nicht um ein Schiff, sondern um eine schwimmende Mietskaserne, bis ins Detail den an Land herumstehenden Vorbildern nachgebaut: hier wie dort erkennen wir die trübsinnige Wohnblock-Bauweise, die absolut phantasielos angeordneten Fensterreihen, die im Schachbrett-Stil die Horizontalen und die Vertikalen miteinander verbindet. Im Architektenjargon nennt man eine solche Front eine »streng gerasterte Lochfassade«. Knapper und elender kann man den Mangel nicht beschreiben.
Eigenartig ist, dass niemand die Ähnlichkeit zwischen Luxusdampfer und Mietskaserne auffällt. Das Fernsehen, unser stumpfes Medium, ist wie überall zur Stelle und betet die Superlative nach, die die Reederei gerne zum Besten gibt. Das sogenannte Schiff hat 157000 PS, es ist 345 Meter lang und 72 Meter hoch, es kann soundso viel tausend Passagiere aufnehmen – und so weiter. Niemand spricht aus, dass allein die Unmäßigkeit des Schiffes hässlich ist. Es kann niemand aussprechen, denn das Publikum ist genauso schönheitsvergessen wie die Erbauer des Schiffs. Es erinnert sich niemand mehr daran, dass ein schöner Ozeandampfer vor allem durch niedrige Deckaufbauten charakterisiert ist. Der Schiffsaufbau darf keinesfalls wuchtiger sein als der Schiffskörper. Die Mannschaftswohnräume und die Kabinen der Passagiere müssen in einer waagrechten Linie angelegt sein, ebenso die Offizierskammern, die Rettungsboote, die Speisesäle und die Vorratsräume. Die Schiffsaufbauten müssen eine sanft abgestufte Pyramide ergeben; einschließlich der Schornsteine, die sich in einem rhythmischen Abstand zueinander über die ganze Länge des Schiffs verteilen. Dieses Schönheitswissen ist zwar in jedem besseren Fachlexikon zu finden, aber man muss ein moderner, effizienter Schiffsplaner sein, um es komplett links liegenzulassen.
Fast noch schlimmer als die Schönheitsvergessenheit wirkt sich aus, dass die Leute, die heute Schönheit produzieren könnten, kein assoziatives Vermögen mehr haben. Sie fragen sich nicht mehr: Wie schaut das aus, was wir konstruieren? Ist es seinem eigenen Vorbild noch ähnlich – oder hat es die Verbindung zur schönheitsüberlieferten Form verloren? Der Grund der Hässlichkeit liegt darin, dass unsere Räume gezwungen werden, ihre Selbstähnlichkeit aufzugeben. Eine Wartehalle soll aussehen wie eine Bar, eine Bar soll aussehen wie eine Yacht, eine Yacht soll aussehen wie ein Salon, ein Salon soll aussehen wie ein Palast.
Schon oft ist mir aufgefallen, dass neue Architektur, wenn sie vorgestellt und eingeweiht wird, von Zeitgenossen durchweg bewundert und gerühmt wird. Man lobt die Kühnheit der Formen, die Modernität der Linienführungen, die Eigenart der Räume, die Intimität des Lichteinfalls (diese und viele andere Floskeln kann man dann hören und lesen), kurz: die Schönheit des ganzen Ensembles. Dann geschieht etwas Merkwürdiges. Kaum sind die so gepriesenen Neubauten ein paar Monate alt, wird Unmut laut. Die Leute, die noch vor kurzem ihre freudige Überraschung geäußert haben, sind jetzt anderer Meinung. Sie beklagen, dass das neue Rathaus (Kunsthaus, Wohnhaus, Schulhaus) an den Menschen vorbei geplant sei, dass es kalt und unsensibel ausschaut und dass der Neubau die Erfahrung der Fremdheit in der urbanen Welt nur verstärke.
Ich denke nicht, dass die Leute, die so widersprüchlich urteilen, Lügner sind. Sie fallen nur immer wieder darauf herein, dass das Neue, weil es sich formal von seinen Vorgängern abhebt, auch schon schön sei. Neue Architektur gehört zu den typischen Trugbildern jeder Saison. Ein oder zwei Jahre genügen, und der in den Himmel gehobene Theaterneubau in São Paulo oder Zürich ruft heimlich Mitleid hervor. Die Architekten haben wieder einmal so getan, als könne man neue Schönheit planen. Wirkliche Schönheit ist nichtintendierte Schönheit; sie verunglückt, wenn sie allzu sehr gewünscht wird. Um dieser Entdeckung innezuwerden, müssen wir von unserer hemmungslosen Subjektivität Gebrauch machen. Die moderne Subjektivität ist so frei wie nie zuvor. Sie verdankt ihre Freiheit ebenfalls einem ungeplanten Unglück, einem Unglück des Vorstellens und Wünschens.
Wir sind daran gewöhnt, dass in unseren Feuilletons wichtige Teile unserer Kultur immer neu verabschiedet werden. Immer wieder lesen und hören wir (zum Beispiel) vom Ende der Psychoanalyse, der Familie, der Lyrik, der Germanistik, des Romans, des Wohlfahrtsstaates, der Arbeitsgesellschaft – und beinahe endlos so weiter. Durch die dichte Abfolge der Abschiede bleibt undeutlich, ob die Totgesagten wirklich tot sind oder nur totgesagt werden sollen, ob sie in Wirklichkeit nie gestorben oder gar unsterblich sind, weil sie auf wundersam versteckte Weise weiterleben – und es nur dieses Kulturgerede ist, das nie wirklich gelebt hat.
Zu den Entschlafenen gehörten seit langer Zeit auch die Individualität, die Subjektivität und die Schönheit. Unsere Grabredner scheinen sich einig zu sein, jedenfalls nach dem herrschenden common sense der fortgeschrittenen Ästhetik, dass Subjektivität zur Konkursmasse untergegangenen Denkens gehört, dass es Individualität und mithin die private Empfindung von Schönheit nicht mehr geben kann. Gleichzeitig werden Schriftsteller, Komponisten, Maler (etwa bei Preisverleihungen) immer noch und immer wieder für ihre individuelle Handschrift gelobt, das heißt für ihre künstlerisch artikulierte Subjektivität, die doch nach allgemeiner Meinung mausetot ist.
Wie aber gehen verschwindende und gleichzeitig immer neu erscheinende Subjektivität zusammen? Wie sollen wir uns diese Aporie denken? Die Gleichzeitigkeit von Präsenz und Untergang von Subjektivität/Individualität/Schönheit bemerken wir auf zahllosen Gebieten. Ich greife willkürlich drei Beispiele heraus. 1. Viele Theologen glauben heute nicht mehr an das Überleben der Seele nach dem Tod, obgleich dieses Fortleben nach wie vor zum Kernbestand des christlichen Glaubens gehört. Aber es hat sich neben dem Fortlebensglauben die sogenannte »Ganztodlehre« ausgebreitet, die auch das Verlöschen der Seele nach dem Tod als gegeben hinnimmt. Was soll der Gottesmann jetzt glauben? Wenn die Theologen nicht ihre privat entscheidende Subjektivität hätten, könnten sie den Wissenszwiespalt auf diesem zentralen Gebiet nicht lange aushalten. Ähnlich verhält es sich in der Psychoanalyse mit dem von Freud auf die Welt gebrachten 2. Todestrieb. Ein solcher Trieb leuchtete vielen Analytikern auf Anhieb ein, jedenfalls zu Beginn der Psychoanalyse. Im Laufe der Entwicklung rückten viele Analytiker von der Idee eines solchen Triebs wieder ab. Heute verhält es sich mit dem Todestrieb ähnlich wie mit dem Fortleben der Seele: die einen glauben es, die anderen nicht – subjektiv. 3. In der heutigen Philosophie gilt, wie jeder weiß, die Metaphysik als obsolet. Wer auf sich hält, redet wie Jürgen Habermas vom ›nachmetaphysischen Denken‹. Gleichzeitig gibt es Philosophen (Dieter Henrich zum Beispiel), die an der Metaphysik nicht nur festhalten, sondern diese besonders stark machen. Es ist wieder nur die letzte Instanz der persönlich verantworteten Subjektivität, die angibt, was wahr sein könnte und was nicht.
Wer oder was hat recht, wer oder was hat unrecht? Das ungesicherte Wissen bringt durch sein permanentes Schwanken die Autonomie des Subjekts hervor. Und mehr als das: Die schiere Subjektivität, die uns nötigt, den Geltungsanspruch von etwas zu bejahen oder zu verneinen, ist selber ein Teil von Schönheit geworden. Es ist ein Moment von Wohlgefallen (Schönheit) darin, dass wir ein derart tonnenschweres Problem mit einer privaten Entscheidung überhaupt klären können. Der jahrhundertelange Diskurs, ob es Subjektivität/Individualität/Schönheit gibt oder nicht gibt, tritt mit einer solchen Entscheidung für immer in den Hintergrund. Er ist nicht mehr wichtig. In der Nachmoderne bin ich allein der Entscheider, ob es Schönheit für mich gibt oder nicht – und wenn ja: wo.
Meine Subjektivität ist, weil sie nicht mehr selbst beurteilt werden kann und muss, eine unangreifbare, weil immerzu flüchtige Instanz. Sie ist flüchtig, weil sie stets aufmerksam sein will, um Schönheit inmitten der unschönen Realität ausfindig zu machen. Auch ich verbringe wie wir alle erhebliche Lebenszeit im »Junk Space« (Rem Koolhaas), das heißt in den verworrenen Räumlichkeiten heutiger Großmärkte, Shopping-Malls, Fußgängerzonen, Flughäfen, Erlebnisparks und so weiter. Es ist eine Welt aus Zufällen und Zumutungen, zu denen mir jeder persönliche Text fehlt. Vermutlich ist die Textverlassenheit der Grund, warum ich diese Umgebungen sanft verhöhne oder höhnend beschreibe. Es ist schon eine Weile her, dass ich diese Sätze schrieb: »Was wir brauchen, ist eine Theorie der Verborgenheit. Der Grundgedanke könnte sein, dass das Subjekt die Gesellschaft beobachten darf, diese aber nicht das Subjekt.« Und ich habe diese kleine Erzählung hinzugefügt: »Danach bat ich Gesa, mir für eine Weile ihre Schuhe zu geben. Sie zog sie aus und gab sie mir. Ich zeichnete mit dem Kugelschreiber die Konturen der Abnutzung auf den Sohlen ihrer Schuhe nach. Der am meisten abgenutzte Fleck (ich habe ihn stark schraffiert) befand sich in der Mitte der Sohlen. Eines Tages werden die Strümpfe aus diesen Flecken herausschauen. Gesa sagt, sie will die Schuhe bis zu diesem Zeitpunkt tragen und dann zwei Objekte aus ihnen machen (…) Ich weiß nicht, wie man diese Kunst nennen kann. Am besten wird sein, sie trägt keinen Namen. Denn mit dem Namen ist auch gleich ein falsches Bild von ihr auf der Welt, mit dem falschen Bild kommt das falsche Staunen, und mit dem falschen Staunen ist auch das Publikum wieder da. Dabei geht es nur darum, sich ein paar Bereiche zu schaffen, die vor jedem Zugriff sicher sind. Es könnte die empfindlichste Kunst (Schönheit) werden, die es je gegeben hat. Es könnte dabei eine neue Verheimlichung des Menschen herauskommen; aber haben wir die nicht auch nötig?«
Das soll heißen: Im Zeichen der herrschenden Schönheitsvergessenheit muss jeder, der Schönheit immer noch will, seine eigenen Schönheitsobjekte auf die Welt bringen. Diese Schönheit ist überall zugänglich, sie kostet nichts, sie ist ungeeignet für Verwertung und Kommerz, sie kann nicht modern werden, sie ist durch Abwegigkeit vor allgemeinem Interesse geschützt, sie schließt niemanden aus, weil sie zu jedem spricht. Ich erzähle von einem Beispiel. Dieser Tage habe ich, inmitten von Junk Space, einen Geldbeutel gefunden. Er lag im Freien, halb zugedeckt von feuchten Blättern, Papierresten und Abfall. Wahrscheinlich hat ihn ein Dieb schnell geleert und dann weggeworfen. Schon der Fundort hat mich bewegt. Die Dinge überleben an ungenannten, unnennbaren, vielleicht unsagbaren, auf jeden Fall unsäglichen Orten. Sie werden (vielleicht) kurz vor ihrem endgültigen Verschwinden bemerkt und erhellen damit den Bruchbudencharakter des modernen Lebens. Ihre Schönheit ist weltabweisend und dadurch weltverstärkend. Ich hob den Geldbeutel auf und öffnete ihn. Plötzlich schaute mich hinter einer Klarsichtfolie das Foto einer Frau an. Ich hatte sofort das Gefühl: Sie ist tot und ich bin der letzte, der ihr Bild anschaut. Ich legte den Geldbeutel auf meine flache Hand und sah, dass er mir das Zittern kurz vor seiner Vernichtung zeigte. Moderne, privat entdeckte Schönheit hat viel mit modernem, privat erlittenem Tod zu tun. Wir Menschen (viele von uns) und die Dinge sterben nicht ordentlich, wir kommen um in den Umständen, wir werden (viele von uns) zermalmt, zerdrückt, zerquetscht, zerrieben. Schön an der Entdeckung der zerfetzten Dinge ist die Empfindung der Zerfetztheit des eigenen Denkens. Durch diese Parallelität gewinnen wir schöne Einblicke in die Behelfsmäßigkeit allen Lebens. Ich bezeugte das brüchige Ding (der Geldbeutel), das brüchige Ding bezeugte mich. Das Ding (der Geldbeutel) lag auf meiner Hand und gab den Raum frei für die Position der Schönheit. Aus Kants interesselosem Wohlgefallen ist in der Moderne eine interessierte Verbergung geworden.
Der Ungehorsam gegen die Tatsachen
An einem schönen Winterabend spazierte ich in Berlin rund um den Savigny-Platz. In etwa einer halben Stunde hatte ich in einer der wundervollen Buchhandlungen, die es dort gibt, eine Lesung. Ich schaute in die Auslagen der Geschäfte, traf zufällig einen befreundeten Schriftsteller, verspürte Hunger. Ein »richtiges« Abendessen wollte ich vor der Lesung nicht zu mir nehmen, aber eine kleine Beruhigung des Hungergefühls sollte schon sein. Also kaufte ich mir eine Bratwurst mit Brötchen und setzte meinen kleinen Spaziergang fort. Natürlich betrachtete ich vor allem die Schaufenster der Buchhandlungen, in denen oft Kostbarkeiten ausgestellt sind, die ich in den Schaufenstern der meisten anderen Buchhandlungen vermisse. Ich geriet vor die Schaufenster der wahrscheinlich schönsten Buchhandlung, die ich an diesem Abend habe entdecken können, der Romanischen Buchhandlung. Ich streckte den Kopf in die Höhe, um auch das makellose Parkett, die schönen Teppiche, das geschmackvolle Interieur zu bewundern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!