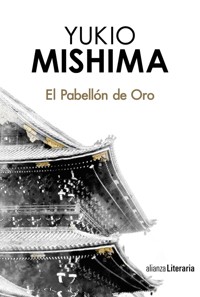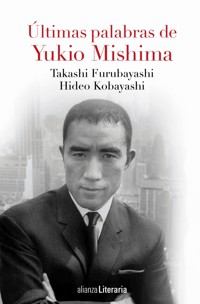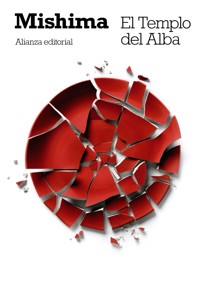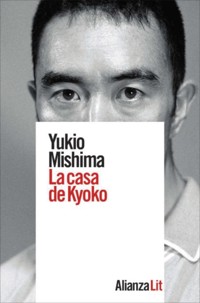12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kochan wächst, abgeschirmt von Jungen seines Alters, im imperialistischen Japan auf. Doch er merkt, dass er nicht das ist, was man von ihm erwartet: Nicht nur ist er körperlich schwächer als andere, er entwickelt auch eine Faszination für Tod, Gewalt, Sex und den männlichen Körper. Unter den strengen Blicken der japanischen Gesellschaft beginnt er, sich eine Maske zu formen, die sein wahres Selbst verbergen soll. Mehr noch: Er will sie sich als neue Identität aufzwingen. Das Mädchen Sonoko und die Heirat mit ihr soll alle, einschließlich ihn selbst, hinters Licht führen.
Yukio Mishimas autobiografischer Roman thematisiert offen, was es bedeutet, nicht dazuzugehören und sich Zwängen zu unterwerfen, die einen zerreißen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Yukio Mishima wurde 1925 in Tokio geboren und war Autor zahlreicher Romane, Dramen, Kurzgeschichten, Essays und Gedichte. Nobelpreisträger Yasunari Kawabata war sein Mentor. Sein Werk überschreitet bis heute inhaltliche und stilistische Grenzen und macht ihn zu einem der wichtigsten japanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Als politisch umstrittene Persönlichkeit beging Mishima 1970, nach einem gescheiterten Aufruf zur Wiedereinsetzung des japanischen Kaisers, rituellen Selbstmord.
ÜBER DAS BUCH
Kochan ist nicht nur körperlich schwächer als seine Mitschüler, auch seine Gefühle machen ihn zum Außenseiter. Während die anderen mit Frauengeschichten prahlen, entwickelt er eine Faszination für Tod, Gewalt und den männlichen Körper. Unter den strengen Blicken der japanischen Gesellschaft beginnt er, eine Maske zu formen, die sein wahres Selbst verbergen soll. Mehr noch: Er will sie sich als neue Identität aufzwingen. Die Beziehung zu dem Mädchen Sonoko soll alle, einschließlich ihn selbst, hinters Licht führen.
Yukio Mishimas autobiografischer Roman war bei seinem Erscheinen ein weltweiter Sensationserfolg. Er erzählt eindringlich, was es bedeutet, nicht dazuzugehören und sich Zwängen unterwerfen zu müssen, die einen zerreißen.
Die Schönheit ist eine unheimliche und furchtbare Sache! Unheimlich, weil sie unbestimmbar ist, man kann sie nicht bestimmen, weil Gott uns nichts als Rätsel aufgegeben hat. Ufer vereinen sich, sämtliche Widersprüche sind darin aufgehoben. Ich bin völlig ungebildet, Bruder, aber ich habe viel darüber nachgedacht. Furchtbar viele Geheimnisse! Viel zu viele Rätsel belasten den Menschen auf der Erde, er löse sie nach eigenem Gutdünken und steige trocken aus dem Wasser. Schönheit! Ich kann mich nicht damit abfinden, dass mancher sogar hochherzige und feinsinnige Mann mit dem Ideal der Madonna beginnt und mit dem Ideal Sodoms endet. Und noch unheimlicher ist, wenn jemand mit dem Ideal Sodoms im Herzen auch das Ideal der Madonna gelten lässt, und wenn sein Herz für dieses Ideal entflammt ist, wahr und wahrhaftig entflammt ist, wie in seinen jungen schuldlosen Jahren. Nein, der Mensch ist weit, viel zu weit sogar; ich hätte ihn enger gemacht! Man weiß nicht einmal, was das alles bedeutet, das ist es, hol’s der Teufel! Was dem Kopf eine Schande erscheint, erscheint dem Herzen als pure Schönheit. Ist denn in Sodom Schönheit? Glaub mir, dass sie für die überwältigende Mehrheit der Menschen gerade in Sodom beschlossen ist – kanntest du dieses Geheimnis oder nicht? Es ist entsetzlich, dass Schönheit nicht nur schrecklich, sondern auch geheimnisvoll ist. Hier ringt der Teufel mit Gott, und der Kampfplatz sind die Herzen der Menschen. Übrigens, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Hör zu, und nun zur Hauptsache.
Fjodor Dostojewskij, Die Brüder Karamasow
1
Lange Zeit habe ich behauptet, ich könnte mich an meine Geburt erinnern. Bei den Erwachsenen hat das immer für Gelächter gesorgt, doch letztlich glaubten sie, ich würde mich über sie lustig machen. Sie musterten den blassen Knaben, dessen Gesicht so gar nichts Kindliches an sich hatte, mit einem Blick leichten Abscheus. Als ich meine Behauptung einmal vor nicht so vertrauten Besuchern kundtat, unterbrach mich meine Großmutter, die fürchtete, man könnte mich für einen Idioten halten, und schickte mich nach draußen zum Spielen.
Meistens lachten die Erwachsenen und versuchten, mich mit wissenschaftlichen Erklärungen zu widerlegen. Damit auch ein Kind ihren Ausführungen folgen konnte, redeten sie mit theatralischem Eifer auf mich ein: Neugeborene hätten bei ihrer Geburt noch gar nicht die Augen geöffnet, und sollte dies ausnahmsweise doch einmal der Fall sein, gelangten sie mit Sicherheit zu keiner so klaren Anschauung, dass sie sich später daran erinnerten. »Hab ich nicht recht?«, sagten sie und schüttelten mich, zutiefst misstrauisch, wie ich noch immer war, an meinen schmalen Schultern. Sie schienen zu glauben, mir fast auf den Leim gegangen zu sein. Er ist zwar ein Kind, aber wir müssen auf der Hut sein, bestimmt will uns der Junge in eine Falle locken und uns »darüber« ausfragen. Warum fragt er denn nicht in kindlicher Unschuld: »Woher komme ich? Warum wurde ich geboren?« Also schwiegen die Erwachsenen und blickten mich mit einem dünnen Lächeln an, als fühlten sie sich zutiefst verletzt, auch wenn sie nicht wussten, warum.
Doch ihre Sorge war unbegründet. Ich hatte überhaupt nicht vor, etwas »darüber« zu erfahren. Ohnehin wäre ich nie auf die Idee gekommen, sie in eine Falle zu locken, ich hatte viel zu große Angst, sie zu kränken.
Aber all den Erklärungen zum Trotz, und obwohl sie über mich lachten, glaubte ich fest daran, mich an meine Geburt zu erinnern. Wahrscheinlich hatte mir jemand, der dabei gewesen war, davon erzählt, oder ich hatte mir alles ausgedacht. Eines aber, da war ich mir ganz sicher, hatte ich mit eigenen Augen genau gesehen: den Rand der Wanne, in der ich zum ersten Mal gebadet wurde. Es war eine nagelneue Holzwanne gewesen, und aus dem Innern hatte ich einen Lichtstrahl wahrgenommen, der auf ihren Rand fiel. Allein diese eine Stelle war in gleißendes Licht getaucht, sie schien wie aus Gold. Das Wasser schwappte mit seinen kleinen Zungen empor, als wollte es den Lichtfleck lecken, doch es gelang ihm nicht. Unter dem Wannenrand aber, vielleicht weil sich das Licht darin spiegelte oder sogar direkt dort einfiel, leuchtete das Wasser sanft, es sah aus, als würden kleine schimmernde Wellen unablässig mit ihren Köpfen aneinanderstoßen …
Was am stärksten gegen meine Erinnerung sprach, war, dass ich nicht tagsüber zur Welt gekommen bin. Ich wurde abends um neun Uhr geboren. Die Sonne konnte unmöglich geschienen haben. Als sie mich damit neckten, dass es sich wohl um das Licht einer elektrischen Lampe gehandelt haben müsse, verstieg ich mich problemlos in den absurden Gedanken, dass auch bei Nacht nur diese eine Stelle noch von der Sonne beschienen worden sein könnte. Und so hielt sich der im Licht flackernde Wannenrand in meiner Erinnerung als etwas, das ich tatsächlich beim ersten Bad nach meiner Geburt gesehen hatte.
Ich wurde zwei Jahre nach dem großen Erdbeben geboren.
Zehn Jahre zuvor war mein Großvater bei einem Korruptionsskandal in seiner Zeit als Kolonialgouverneur für die Schuld eines Untergebenen eingestanden und von seinem Posten zurückgetreten. (Ich will nichts schönreden, aber ich habe in meinem Leben, das erst halb so lang währt wie das seine, niemanden getroffen, der wie mein Großvater ein solch absolut törichtes Vertrauen in seine Mitmenschen an den Tag legte.) Danach ging es mit unserer Familie schnell bergab, doch alle schienen dabei vollkommen unbekümmert. Gigantische Schulden, Beschlagnahmungen, der Verkauf unseres Anwesens, begleitet von einer krankhaften Eitelkeit, die wie ein dunkler Trieb mit zunehmender Bedrängnis immer größere Ausmaße annahm.
So kam ich in einem alten Mietshaus in einem nicht sonderlich feinen Teil der Stadt zur Welt. Es war ein herrischer Bau von stumpfer Düsternis, verwirrend in der Struktur, oben vom Hang aus sah man zwei Stockwerke, von unten aus betrachtet waren es drei, es gab ein protziges schmiedeeisernes Tor, einen Vorgarten und einen westlich eingerichteten Salon, der fast so groß war wie eine Vorstadtkapelle. Es gab viele dunkle Zimmer und sechs Dienstmädchen. Zusammen mit meinen Großeltern und Eltern lebten zehn Personen in dem Haus, das knarrte wie eine alte Kommode.
Der Grund für unsere Schwierigkeiten lag in der Unternehmungslust meines Großvaters, in der Krankheit meiner Großmutter sowie ihrem Hang zu Verschwendung. Mein Großvater träumte von Gold und Reichtum und ließ sich häufig durch zwielichtige Bekannte zu weiten Reisen überreden. Meine Großmutter, die einer alten Familie entstammte, hasste und verachtete ihn. Sie besaß einen starrsinnigen und zugleich verrückten, poetischen Geist. Eine chronische Hirnneuralgie schädigte ihre Nerven zwar nicht direkt, aber zehrte ständig an ihnen, was ihren Verstand unnötig luzide machte. Wer hätte geahnt, dass ihre bis zum Tod andauernden manischen Schübe ein Andenken an die Laster waren, denen mein Großvater in seinen besten Jahren gefrönt hatte?
In dieses Haus also führte mein Vater seine zarte, hübsche Braut, meine Mutter.
Am Morgen des 14. Januar 1925 setzten bei meiner Mutter die Wehen ein. Abends um neun Uhr brachte sie einen kleinen Jungen zur Welt, der keine fünf Pfund wog.
Am Abend des siebten Tages wurde ich in cremefarbene Seidenwäsche, einen Unterkimono aus Flanell und einen Seidenkimono mit Kasuri-Muster gekleidet, mein Großvater schrieb vor der versammelten Familie meinen Namen auf Reispapier und legte es auf das Opfertischchen in der Tokonoma.
Als kleines Kind hatte ich blonde Haare, die aber so lange mit Olivenöl eingerieben wurden, bis sie sich schließlich dunkel färbten. Ich wohnte mit meinen Eltern im ersten Stock des Hauses. Doch am neunundvierzigsten Tag nach meiner Geburt kam meine Großmutter und riss mich unter dem Vorwand, es sei gefährlich, ein Kleinkind in einem der oberen Stockwerke aufzuziehen, meiner Mutter aus dem Arm. Ich wuchs im Zimmer meiner Großmutter auf, in dem, da es die ganze Zeit über verschlossen blieb, ein erstickender Geruch nach Krankheit und Alter hing. Ich schlief neben ihrem Krankenlager.
Ich war noch kein Jahr alt, als ich von der dritten Treppenstufe fiel und mich an der Stirn verletzte. Meine Großmutter war ins Theater gegangen, und meine Mutter nutzte die Gelegenheit und feierte währenddessen ausgelassen mit den Cousins und Cousinen meines Vaters. Als sie etwas aus dem oberen Stockwerk holen wollte, folgte ich ihr, verfing mich im Saum des Kimonos und stürzte die Treppe hinunter.
Meine Großmutter wurde aus dem Kabuki-Theater gerufen. Sie eilte sofort nach Hause, blieb dort im Eingang stehen, stützte sich auf den Stock in ihrer rechten Hand, starrte meinen Vater an, der ihr entgegengekommen war, und sagte in einem seltsam gefassten Ton, wobei sie jedes Wort einzeln artikulierte: »Ist er schon tot?«
»Nein.«
Mit festem Schritt wie eine Priesterin betrat meine Großmutter das Haus.
Am Neujahrsmorgen vor meinem vierten Geburtstag erbrach ich etwas in der Farbe von rötlichem Kaffee. Der Hausarzt kam und sagte, dass er für nichts garantieren könne. Man spritzte mir so viel Kampfer und Traubenzucker, bis ich aussah wie ein Nadelkissen. Für über zwei Stunden ließ sich mein Puls weder am Handgelenk noch am Oberarm messen. Alle standen um mich herum und betrachteten meinen Leichnam.
Das Totenhemd und mein Lieblingsspielzeug wurden gebracht, die Verwandten kamen. Nach etwa einer Stunde pinkelte ich. Der Bruder meiner Mutter, ein Arzt, sagte: »Er ist gerettet.« Der Urin sei ein Beweis dafür, dass das Herz wieder schlage. Kurze Zeit später pinkelte ich noch einmal. Meine Wangen färbten sich leicht, das Leben kehrte in meinen Körper zurück.
Diese Krankheit – eine Autointoxikation – wurde chronisch. Die Anfälle kamen in monatlichen Abständen, mal waren sie leichter, mal schwerer. Mehrmals war mein Zustand kritisch. Nach und nach entwickelte ich ein Bewusstsein für die Vorboten der Krankheit und wusste, ob sie den Tod bedeuten konnten oder ob dieser noch in weiter Ferne war.
Aus jener Zeit stammen meine ersten wirklichen Erinnerungen, Bilder, die mich in ihrer geheimnisvollen Deutlichkeit immer wieder heimgesucht haben.
Ich weiß nicht, wer mich an der Hand hielt, ob es meine Mutter war oder aber die Krankenschwester, das Dienstmädchen oder meine Tante. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Jahreszeit sich das Ganze abspielte. Die Nachmittagssonne hatte die Häuser am Hang in ein mattes Licht getaucht. An der Hand der Frau, an die ich mich nicht mehr erinnere, lief ich hoch zu unserem Haus. Eine Person kam uns von oben entgegen, woraufhin mich die Frau kräftig zur Seite zog und stehen blieb.
Es besteht kein Zweifel, dass dieses Bild mit jedem Mal, das ich mich daran erinnert habe, stärker und dichter wurde und an Bedeutung gewann. Denn inmitten der verschwommenen Szenerie sticht die Gestalt, die den Hügel herunterkommt, in ihrer übermäßigen Präzision heraus. Das ist nicht verwunderlich, da diese Szene eine meiner ersten Erinnerungen ist, die mich fast mein ganzes Leben lang verfolgt haben.
Es war ein junger Mann. Er trug vorn und hinten einen Jauchekübel, um seine Stirn hatte er ein schmutziges Handtuch gebunden, seine hübschen Wangen waren von einer gesunden Farbe, und seine Augen strahlten, während er sich mit den schweren Kübeln Schritt für Schritt den Weg nach unten bahnte. Es war der Latrinenreiniger, der den Kot aus den Gruben holte. Er trug Tabi mit Gummisohlen an den Füßen, dazu lange blaue Unterhosen. Mit meinen vier Jahren starrte ich den Mann mit ungewöhnlicher Aufmerksamkeit an. Hier offenbarte sich zum ersten Mal eine Macht, deren Bedeutung ich damals noch nicht kannte: Eine dunkle, geheimnisvolle Stimme rief nach mir. Dass sie sich als Erstes in der Person des Latrinenreinigers manifestierte, hatte etwas Allegorisches. Kot und Urin stehen ja als Symbol für die Erde. Es war zweifellos die böswillige Liebe der Mutter Erde, die nach mir rief.
Ich ahnte, dass es in dieser Welt ein Begehren gibt, das wie ein Brennen ist. Während ich zu dem verdreckten Mann aufsah, spürte ich das unstillbare Verlangen, so zu werden wie er. Ich erinnere mich noch genau, dass sich dieses Verlangen auf zwei Dinge richtete: Zum einen waren es seine blauen Unterhosen, zum anderen war es sein Beruf. In den blauen Hosen zeichnete sich seine untere Körperpartie deutlich ab. Mit ihren geschmeidigen Bewegungen schien sie direkt auf mich zuzukommen. Ich spürte eine unbeschreibliche Zuneigung für diese Unterhosen. Warum das so war, wusste ich nicht.
Sein Beruf … So wie andere Kinder von klein auf General werden wollen, überkam mich damals der Wunsch, Latrinenreiniger zu werden. Vielleicht waren die blauen Unterhosen der Grund für diese Sehnsucht, aber sie waren es sicher nicht allein. Dieses Verlangen wurde immer stärker und äußerte sich immer eigentümlicher.
Ich will damit sagen, dass mich angesichts seiner Arbeit die Sehnsucht nach einer Trauer überfiel, einer brennenden Trauer, unter der sich mein Körper winden würde. Ich spürte bei seiner Tätigkeit eine Tragik, und zwar in einer in höchstem Grade sinnlichen Bedeutung. Sie erweckte in mir das Gefühl der Hingabe, der Nachlässigkeit und des Vertrautseins mit Gefahren, eine bemerkenswerte Mischung aus dem Gefühl von Nichtigkeit und Vitalität; diese Emotionen überschwemmten mich mit meinen vier Jahren und schlugen mich in ihren Bann. Wahrscheinlich täuschte ich mich in der Arbeit des Latrinenreinigers. Vielleicht hatte man mir von einem anderen Beruf erzählt, ich aber hielt, durch die Kleidung des Mannes in die Irre geführt, an seiner Tätigkeit fest. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Denn schon bald übertrug sich dasselbe emotionale Motiv auf die Schaffner der mit Blumen geschmückten Straßenbahnen sowie auf die Fahrkartenknipser der U-Bahn, die mir das heftige Empfinden eines »tragischen Lebens« vermittelten, von dem ich nichts wusste und von dem ich in alle Ewigkeit ausgeschlossen sein würde. Dies galt besonders für die Fahrkartenknipser, bei denen sich der Geruch nach Gummi und Pfefferminz, der damals durch die U-Bahnhöfe schwebte, mit den Goldknöpfen an der Brust ihrer blauen Uniformen verband und mich erneut das Tragische erahnen ließ. Ich weiß nicht, warum, aber ich stellte mir ein Leben inmitten dieser Gerüche als »tragisch« vor. Es gab Orte, nach denen meine Sinne verlangten, zu denen mir aber der Zugang verwehrt blieb, dort gab es Leben, Ereignisse und Menschen, die nichts mit mir zu tun hatten, und all das bildete meine Definition des Tragischen. In meiner Trauer, für immer davon ausgeschlossen zu sein, träumte ich davon, mich in diese Menschen und ihre Leben zu verwandeln, es war, als wolle ich wenigstens mit meiner Trauer an ihren Leben teilhaben.
Wenn das stimmte, war das »Tragische« vielleicht nur die Projektion dieser vorausgeahnten Trauer, von all dem ausgeschlossen zu sein.
Es gibt noch eine weitere frühe Erinnerung.
Dabei handelt es sich um ein Bilderbuch, das ich selbst noch nicht lesen konnte. Da ich aber mit fünf Jahren Lesen und Schreiben gelernt habe, kann ich damals höchstens vier Jahre alt gewesen sein.
Ich besaß einige Bücher, aber für dieses hatte ich eine besondere Vorliebe, auch wenn es eigentlich nur ein Bild war, das mich so faszinierte. Beim Betrachten dieses Bildes vergaß ich die endlosen langweiligen Nachmittage, doch wenn jemand den Raum betrat, schlug ich hastig eine andere Seite auf, denn mich überkam ein plötzliches Schuldgefühl. Ich fühlte mich durch die Aufsicht der Krankenschwestern und Dienstmädchen gestört. Am liebsten hätte ich mich den ganzen Tag in dieses eine Bild versenkt. Immer, wenn ich die Seite aufschlug, klopfte mein Herz.
Auf dem Bild sah man einen Ritter auf einem Schimmel, über sich hielt er ein Schwert. Das Pferd schnaubte wütend mit den Nüstern, und mit seinen kräftigen Vorderläufen wirbelte es Staub auf. An der silbernen Rüstung haftete ein hübsches Wappen, unter dem Helm sah man ein anmutiges Gesicht. Der Ritter hielt sein gezücktes Schwert kühn in den blauen Himmel, als kämpfe er gegen den Tod oder zumindest gegen eine unheilvolle Macht, die dort durch die Lüfte flog. Ich war mir sicher, dass er im nächsten Moment getötet würde. Wenn ich schnell weiterblätterte, würde ich seinen Tod wahrscheinlich auf der nächsten Seite zu sehen bekommen. Vielleicht gingen die Bilder in solchen Büchern ja auch, ehe man sich’s versah, zum »nächsten Augenblick« über …
Einmal aber bemerkte die Krankenschwester, wie ich scheinbar beiläufig die Seite aufschlug und verstohlen den Blick darauf warf: »Kennt der junge Herr die Geschichte dieses Bildes?«, fragte sie mich.
»Nein, ich kenne sie nicht.«
»Der Ritter sieht aus wie ein Mann, nicht wahr? Tatsächlich aber ist es Jeanne d’Arc, eine Frau, die als Mann verkleidet für ihr Land in den Krieg zog.«
»Eine Frau?«
Ich war am Boden zerstört. Was bedeutete es, dass sich dieser hübsche Mann als Frau entpuppte? (Noch heute spüre ich einen tief verwurzelten und schwer zu erklärenden Abscheu gegen Frauen in Männerkleidern.) Es war die grausame Rache an meiner süßen Fantasie vom Tod des Ritters, zum ersten Mal in meinem Leben »rächte sich die Wirklichkeit«. Viele Jahre später stieß ich auf die Verse, mit denen Oscar Wilde den Tod des Ritters besingt:
Schön ist der Ritter, der erschlagen liegt
Drunten in Ried und Gras …
Ich schenkte dem Bilderbuch keine Beachtung mehr. Ich habe es nie wieder angerührt.
In seinem Roman Tief unten erzählt Huysmans, dass Gilles de Rais, »der bald darauf die raffiniertesten Grausamkeiten und subtilsten Verbrechen vollbrachte«, von den unglaublichen Taten Jeanne d’Arcs inspiriert worden sei und so zu seinem Mystizismus gefunden und diesen entfaltet hätte. Und obwohl mich die Jungfrau von Orléans eher gegenteilig beeinflusste und Abscheu in mir auslöste, hat sie auch in meinem Leben eine nicht unwichtige Rolle gespielt.
Ich erinnere mich an noch etwas.
Es ist der Geruch von Schweiß. Ein Geruch, der mich verfolgte, meine Sehnsüchte weckte und mich völlig in Beschlag nahm.
Wenn ich meine Ohren spitze, vernehme ich ganz vage und schwach ein bedrohliches Dröhnen. Hin und wieder mischt sich ein Horn hinein, und ein seltsam wehmütiges Singen nähert sich. Ich ziehe das Dienstmädchen am Arm, treibe es zur Eile an und versuche es so, in Richtung Tor zu zerren.
Die Soldaten kamen vom Exerzieren zurück und marschierten an unserem Tor vorbei. Sie mochten Kinder und schenkten mir immer ein paar leere Patronenhülsen. Meine Großmutter hatte mir verboten, die Hülsen anzunehmen, da sie gefährlich seien, und so wurde meine Freude noch durch die Freude des Geheimen vermehrt. Jedes Kind ist fasziniert vom schweren Schritt der Soldatenstiefel, den verschmutzten Uniformen und den unzähligen geschulterten Waffen. Mich aber zog besonders der Geruch nach Schweiß in den Bann, er war das heimliche Motiv, das sich hinter meiner Freude über die Patronenhülsen verbarg.
Der Schweißgeruch der Soldaten, ein Geruch wie der salzige Meereswind oder wie die Luft der goldverbrannten Küste, ein Geruch, der in meine Nasenlöcher schlug und mich berauschte. Vielleicht ist es der erste Geruch, an den ich mich erinnere. Er verband sich natürlich nicht unmittelbar mit sexueller Lust, aber er öffnete mir die Augen für das Schicksal der Soldaten, für die Tragik ihres Berufs, für ihren Tod, für die fremden Länder, die sie erwarteten, und ich spürte, wie in mir langsam, aber beharrlich eine sinnliche Begierde erwachte.
Dies waren die ersten seltsamen Erscheinungen, denen ich in meinem Leben begegnete. Von Beginn an standen sie in wahrhafter Perfektion vor mir. Es mangelte ihnen an nichts. Auch als ich später dem Ursprung meines Denkens und Handelns auf den Grund ging, entdeckte ich nichts, was ihnen fehlte.
Seit meiner frühen Kindheit bin ich in meinen Vorstellungen vom Leben nicht ein Mal von der Augustin’schen Prädestinationslehre abgewichen. Immer wieder quälten mich sinnlose Zweifel, sie tun es auch heute noch, doch wenn man in solchen Zweifeln eine Form der Versuchung zur Sünde sieht, so ließ ich mich in meinem Determinismus niemals beirren. Auch wenn ich sie noch nicht lesen konnte, hielt ich gleichsam die Speisekarte aller Ängste meines Lebens in den Händen. Ich musste nur noch die Serviette nehmen und mich zu Tisch setzen. Selbst die Tatsache, dass ich jetzt ein solch sonderbares Buch schreibe, war auf dieser Speisekarte genauestens vermerkt, ich muss es also schon von Anfang an gewusst haben.
In meiner Kindheit vermischen sich Zeit und Raum. Da waren die Neuigkeiten aus aller Welt, von denen die Erwachsenen berichteten, der Ausbruch eines Vulkans zum Beispiel oder die Revolte einer Armee. Außerdem gab es das, was vor meinen Augen geschah, die Anfälle meiner Großmutter oder das Gezänk in der Familie. Und dann waren da noch die fantastischen Geschehnisse aus der Welt der Märchen, in die ich mich in jener Zeit versenkte. Alle drei Bereiche schienen mir stets von gleichem Wert und von gleicher Ordnung zu sein. Ich dachte mir die Welt nicht komplizierter als ein Gebäude aus Holzklötzen, und die sogenannte »Gesellschaft«, in die auch ich demnächst aufgenommen werden würde, konnte unmöglich Schöneres bieten als die »Welt« meiner Märchenbücher. Es war mir zwar nicht bewusst, aber es hatte sich eine Grenze aufgetan. Und da sich all meine Fantasien an dieser Grenze stießen, waren sie von einer seltsam vollkommenen Verzweiflung durchdrungen, die einem leidenschaftlichen Verlangen glich.
Eines Abends lag ich in meinem Bett und sah, wie am Rande der Dunkelheit, die mich umgab, eine funkelnde Stadt auftauchte. Alles darin war merkwürdig still, doch voller Glanz und Geheimnisse. Wer diese Stadt besuchte, dem wurde ein geheimes Mal auf sein Antlitz gedrückt. Kehrten die Erwachsenen dann tief in der Nacht heim zu ihren Familien, blieb etwas in ihren Worten und Gesten zurück, eine Art Losung, etwas von der Art der Freimaurer, und in ihren Gesichtern lag eine glitzernde Müdigkeit, die sie davon abhielt, sich anzuschauen. So wie bei den Weihnachtsmasken, die an den Fingerspitzen Silberstaub hinterlassen, hatte ich das Gefühl, ich könnte, würde ich ihre Gesichter berühren, die Farben spüren, mit denen die nächtliche Stadt sie gezeichnet hatte.
Kurz darauf hob sich vor meinen Augen der Vorhang der Nacht. Auf der Bühne stand die Zauberin Tenkatsu Shokyokusai. (Sie war einmal in einem Theater in Shinjuku aufgetreten, und obwohl die Darbietungen des Zauberers Dante, der ein paar Jahre später auf derselben Bühne stand, ihre Künste um ein Vielfaches übertrafen, haben weder er noch der Zirkus Hagenbeck während der Weltausstellung einen so tiefen Eindruck in mir hinterlassen wie diese Tenkatsu.)
Sie hatte ihren üppigen Körper in ein Gewand gehüllt, das an das mannstolle Weib aus der Apokalypse gemahnte, und spazierte darin unbefangen auf und ab. Ihre wichtigtuerische Gelassenheit, die man oft bei Zauberern beobachtete und die an den Gestus adliger Exilanten erinnerte, ihr schwermütiger Liebreiz sowie das amazonenhafte Auftreten strahlten eine seltsam melancholische Harmonie aus, die von ihrer Aufmachung unterstrichen wurde: ihr falsches Gewand in seinem verwegen-billigen Glanz, ihr dick aufgetragenes Make-up im Stile einer Balladensängerin, der weiße Puder, der den Körper bis an die Zehenspitzen bedeckte, die wunderschönen protzigen und mit künstlichen Juwelen besetzten Armreife. Das feine Gewebe der Schatten, welche diese Unstimmigkeiten warfen, erzeugte einen eigenartigen Einklang.
Ich ahnte dunkel, dass der Wunsch, Tenkatsu zu werden, sich wesenhaft von dem unterschied, Schaffner einer mit Blumen geschmückten Straßenbahn zu werden. Der bedeutendste Unterschied bestand darin, dass dem Ersteren so gut wie jedes, so muss man schon sagen, Verlangen nach dem Tragischen fehlte. Bei meinem Wunsch, Tenkatsu werden zu wollen, spürte ich nicht die irritierende Mischung aus Sehnsucht und schlechtem Gewissen. Dennoch stahl ich mich eines Tages mit heftig klopfendem Herzen in das Zimmer meiner Mutter und öffnete die Kommode mit ihren Kleidern.
Ich zog den üppigsten und prächtigsten Kimono heraus, dazu einen Obi, auf dem mit Ölfarben gemalte scharlachrote Rosen prangten und den ich mir wie ein türkischer Würdenträger um die Hüften wickelte. Um den Kopf band ich mir ein Furoshiki aus Seidenkrepp. Als ich vor dem Spiegel stand, glühte mein Gesicht vor unbändiger Freude, so sehr ähnelte meine improvisierte Kopfbedeckung den Kappen der Seeräuber aus der Schatzinsel. Doch mein Werk war noch lange nicht beendet. Jede einzelne meiner Bewegungen und Handlungen musste, von den Finger- bis zu den Zehenspitzen, der Geburt eines Mysteriums würdig sein. Ich steckte einen Handspiegel in den Obi und schminkte mir mit dem weißen Puder leicht das Gesicht. Dann griff ich die lange silberne Taschenlampe, den Füller mit der altertümlichen Goldgravur und noch andere Dinge, die mir gefielen.
Als Nächstes stolzierte ich mit feierlichem Ernst in das Zimmer meiner Großmutter. Ich konnte meinen unbändigen Spaß und meine Freude nicht länger unterdrücken, sprang herum und rief: »Ich bin Tenkatsu. Schaut: Ich bin Tenkatsu.«
Meine Großmutter lag auf ihrem Krankenlager, auch meine Mutter sowie ein Gast und das Dienstmädchen waren anwesend. Aber ich nahm keinen von ihnen wahr. Meine Begeisterung war ganz und gar auf meinen Auftritt ausgerichtet, ich sah nur mich. Aber dann erblickte ich plötzlich das blasse und geistesabwesende Gesicht meiner Mutter. In dem Moment, als sich unsere Blicke trafen, sah sie zu Boden.
Ich verstand. Tränen traten mir in die Augen.
Doch was war es, das ich in diesem Moment verstand oder genötigt war zu verstehen? Deutete sich hier bereits das Thema meiner späteren Jahre an, war dies der Beginn einer »der Reue vorausgehenden Sünde«? Oder lehrte mich dieser Moment, wie hässlich Einsamkeit in den Augen der Liebe ist, und wie ich umgekehrt selbst Liebe zurückzuweisen vermochte?
Das Dienstmädchen schnappte mich und brachte mich fort in ein anderes Zimmer, wo sie mir im Handumdrehen – als würden einem Huhn die Federn gerupft, mein unsittliches Kostüm auszog.
Meine Lust an Verkleidungen steigerte sich noch, als ich begann Kinofilme zu schauen, und dauerte bis zu meinem neunten Lebensjahr.
Einmal ging ich mit meinem Hauslehrer ins Kino, um mir die Verfilmung der Oper Fra Diavolo anzusehen. Der Schauspieler, der den Diavolo darstellte, trug einen höfischen Rock, aus dessen Ärmeln Spitze flatterte, ein mir unvergesslicher Anblick. Als ich sagte, dass ich so etwas auch gern einmal anziehen und eine solche Perücke aufsetzen würde, lachte der Hauslehrer verächtlich. Aber ich wusste, dass er selbst im Zimmer der Dienstmädchen oft die Prinzessin Yaegaki nachahmte und die Mädchen damit zum Lachen brachte.
Nach Tenkatsu war es Kleopatra, die mich in ihren Bann zog. Irgendwann zu Jahresende – es hatte geschneit – nahm mich ein befreundeter Arzt auf mein Drängen hin mit in einen Film über die ägyptische Königin. Zu dieser Zeit im Jahr waren nur wenige Menschen im Kino. Der Arzt legte seine Füße auf die Brüstung und schlief ein. Allein und völlig gebannt sah ich zu, wie die Königin von Ägypten in einer von unzähligen Sklaven getragenen, altertümlich schwülstigen Sänfte in Rom einzog. Ihre schwermütigen Augen unter den dick geschminkten Lidern. Ihre übernatürlichen Kleider. Ihr halb nackter bernsteinfarbener Körper inmitten eines persischen Teppichs.
Ich war ganz versessen darauf, mich vor meinen beiden jüngeren Geschwistern als Kleopatra zu verkleiden, gab aber acht, dass meine Großmutter und meine Eltern nichts davon mitbekamen. (Allein dieses Vergehen bereitete mir beträchtliches Vergnügen.) Was aber erhoffte ich mir von meiner Verkleidung als Frau? Später setzte ich die gleichen Hoffnungen in Elagabal, den römischen Kaiser in Zeiten des Verfalls, Zerstörer der alten römischen Götter, jene dekadente kaiserliche Bestie.
Ich habe bisher von zweierlei Prämissen in meinem Leben berichtet: Die erste betraf den Latrinenreiniger, die Jungfrau von Orléans und den Schweißgeruch der Soldaten, die zweite die Zauberin Tenkatsu Shokyokusai und Kleopatra. Doch es gibt noch eine dritte Prämisse, von der ich erzählen muss.
Ich habe als Kind jedes Märchenbuch verschlungen, das mir in die Hände fiel, doch ich mochte nur die Prinzen, die Prinzessinnen mochte ich nicht. Am meisten liebte ich Prinzen, die getötet wurden oder die dem Tode geweiht waren. Ich liebte alle jungen Männer, die sterben mussten.
Eines aber verstand ich nicht: Warum mich von all den Märchen Hans Christian Andersens nur die Geschichte vom Rosenelf so tief beeindruckt hat, in welcher der schöne Jüngling in dem Moment, als er die Rose küsst, die ihm seine Liebste zum Andenken geschenkt hatte, von einem Schurken mit einem großen Messer erstochen und geköpft wird. Warum hat mich von all den Märchen Oscar Wildes nur Der Fischer und seine Seele fasziniert, in dem der Leichnam des jungen Fischers, in seinen Armen eine Meerjungfrau, ans Ufer gespült wird?
Natürlich mochte ich auch kindliche Geschichten. Ich mochte Andersens Die Nachtigall und auch viele Manga für Kinder. Aber Geschichten über Blut, Nacht und Tod übten einen weitaus größeren Reiz auf mich aus.
Hartnäckig verfolgten mich die Visionen getöteter Prinzen. Wer könnte mir erklären, warum mich der Gedanke an diese Prinzen in ihren eng anliegenden Beinkleidern in Kombination mit ihrem grausamen Ende so entzückte?
Vor allem das Bild in einem bestimmten ungarischen Märchen hielt mich lange gefangen. Es war in leuchtenden Farben und einem realistischen Zeichenstil. Der Prinz trug schwarze Beinlinge, einen rosenroten Rock mit Goldstickerei, darüber einen königsblauen Mantel mit purpurnem Futter, und um die Hüften hatte er einen grün-goldenen Gürtel geschlungen. Dazu trug er einen grün-goldenen Helm, ein purpurfarbenes Schwert und einen Köcher aus grünem Leder. In der linken mit einem weißen Lederhandschuh bekleideten Hand hielt er einen Bogen, seine Rechte ruhte auf dem Ast eines alten Baumes, und mit kühner und zugleich schwermütiger Miene blickte er in den furchterregenden Rachen eines Drachen, der sich im nächsten Moment auf ihn zu stürzen drohte. In seinem Antlitz stand die Entschlossenheit zu sterben. Wäre es dem Prinzen bestimmt gewesen, den Drachen zu besiegen, es hätte mich kaum gereizt. Glücklicherweise aber hatte das Schicksal den Tod des Prinzen bestimmt.
Leider war dieses Schicksal nicht vollkommen. Um seine jüngere Schwester zu retten und die hübsche Elfenkönigin zu heiraten, musste der Prinz sieben tödliche Prüfungen bestehen, doch dank der magischen Kräfte des Diamanten, den er in seinem Munde trug, wurde er sieben Mal wieder zum Leben erweckt und genoss am Ende das Glück seiner erfolgreichen Taten. Auf dem Bild war die Szene unmittelbar vor seinem ersten Ende dargestellt. Danach wird er »von einer großen Spinne gefangen, die ihm ihr Gift in den Körper spritzt und ihn gierig verspeist«, er ertrinkt, verbrennt, wird von Hornissen gestochen und von einer Schlange gebissen, er wird in eine Grube geworfen und von den unzähligen dort eingepflanzten Schwertern aufgespießt, er wird »von großen Felsbrocken erschlagen, die wie ein Platzregen auf ihn niederprasseln«.
Der Tod durch den Drachen wird besonders ausführlich geschildert.
Der Drache fraß ihn gleich mit viel Geknirsch. Als er so in kleine Stücke zermalmt wurde, hielt es der Prinz vor Schmerzen kaum aus, doch er erduldete alles standhaft, bis er ganz zerfetzt war, dann nahm er plötzlich seine eigentliche Gestalt an und sprang dem Drachen flink aus dem Maul. Nicht der kleinste Kratzer war an ihm. Der Drache aber brach an Ort und Stelle zusammen und verschied.
Ich las die Passage bestimmt hundert Mal. Sie schien mir fehlerhaft, ein Fehler, den ich nicht hinzunehmen bereit war, der Satz nämlich: Nicht der kleinste Kratzer war an ihm. Ich fühlte mich von dem Autor verraten, ich glaubte, er habe einen entscheidenden Irrtum begangen.