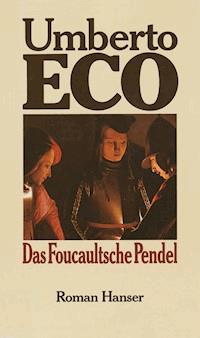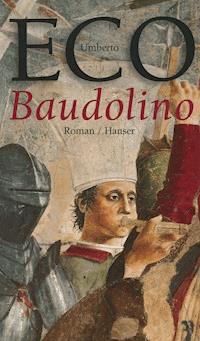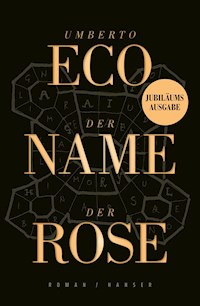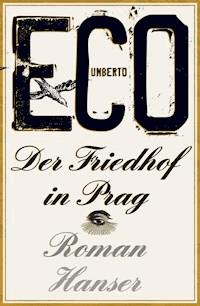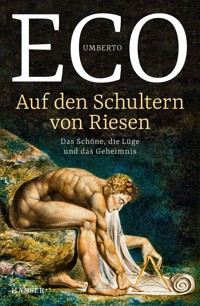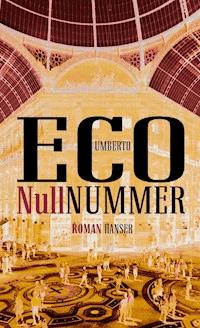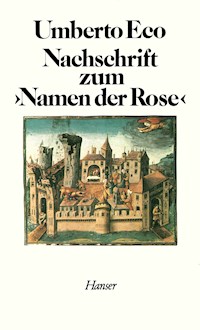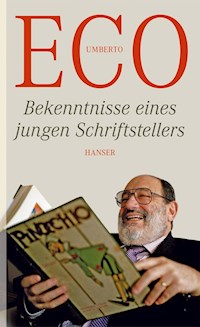
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sein erster Roman "Der Name der Rose" wurde ein Welterfolg. Jetzt, vor seinem achtzigsten Geburtstag, blickt Umberto Eco zurück auf seine Karriere als Theoretiker und Romancier. Warum sind wir zu Tränen gerührt vom Unglück einer Figur? In welchem Sinne "existieren" Anna Karenina, Gregor Samsa und Leopold Bloom? Auf seiner Reise zu den eigenen kreativen Methoden erzählt Eco, wie er seine Romane geschrieben hat: Am Anfang stehen Szenen und Bilder, dann eine Epoche, ein Ort, eine Stimme. Zugleich Mittelalterforscher, Philosoph und Experte für moderne Literatur, beeindruckt Eco vor allem, wenn er sich den Wurzeln der Geschichte zuwendet. Der "junge Schriftsteller" ist heute ein Meister, der über die Kunst des Romans und die Kraft der Worte aus langer Erfahrung spricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Sein erster Roman "Der Name der Rose" wurde ein Welterfolg. Jetzt, vor seinem achtzigsten Geburtstag, blickt Umberto Eco zurück auf seine Karriere als Theoretiker und Romancier. Warum sind wir zu Tränen gerührt vom Unglück einer Figur? In welchem Sinne "existieren" Anna Karenina, Gregor Samsa und Leopold Bloom? Auf seiner Reise zu den eigenen kreativen Methoden erzählt Eco, wie er seine Romane geschrieben hat: Am Anfang stehen Szenen und Bilder, dann eine Epoche, ein Ort, eine Stimme. Zugleich Mittelalterforscher, Philosoph und Experte für moderne Literatur, beeindruckt Eco vor allem, wenn er sich den Wurzeln der Geschichte zuwendet. Der "junge Schriftsteller" ist heute ein Meister, der über die Kunst des Romans und die Kraft der Worte aus langer Erfahrung spricht.
Umberto Eco
Bekenntnisse eines jungen Schriftstellers
Richard Ellmann Lectures in Modern Literature
Aus dem Englischen von Burkhart Kroeber
Carl Hanser Verlag
Inhalt
1. Von links nach rechts schreiben
2. Autor, Text und Interpreten
3. Bemerkungen über fiktive Personen
4. Meine Listen
Anmerkungen
Personenregister
1
Von links nach rechts schreiben
Diese Vorlesungsreihe trägt den Titel Bekenntnisse eines jungen Romanciers, und gewiss kann man fragen, warum, da ich auf die Achtzig zugehe. Aber wie es der Zufall wollte, habe ich meinen ersten Roman, Der Name der Rose, 1980 publiziert, das heißt, ich habe meine Karriere als Romancier erst vor achtundzwanzig Jahren begonnen. Daher betrachte ich mich als einen noch ziemlich jungen und sicher vielversprechenden Romancier, der bisher nur fünf Romane vorgelegt hat und in den nächsten fünfzig Jahren noch viele schreiben wird. Dieses work in progress ist noch unabgeschlossen (sonst wäre es nicht in progress), doch ich hoffe, ich habe genügend Erfahrungen gesammelt, um ein paar Worte über die Art meines Schreibens zu sagen. Im Geist der Richard Ellmann Lectures werde ich mich dabei eher auf meine Fiktion konzentrieren als auf meine Essays und akademischen Schriften, obwohl ich mich hauptberuflich als Akademiker betrachte und das Romanschreiben als Amateur betreibe.
Schon als Kind begann ich Romane zu schreiben. Als erstes schrieb ich immer den Titel hin, meist angeregt von den Abenteuerbüchern jener Tage, die recht ähnlich den heutigen Fluch der Karibik-Filmen waren. Danach entwarf ich die Illustrationen, die alle zehn Seiten eingefügt werden sollten, und dann begann ich das erste Kapitel zu schreiben. Aber da ich immer in Blockschrift schrieb, um die Druckbuchstaben in den Büchern zu imitieren, war ich schon nach wenigen Seiten ganz erschöpft und gab auf. So war jedes meiner damaligen Bücher ein unvollendetes Meisterwerk, wie Schuberts Unvollendete.
Mit sechzehn begann ich natürlich Gedichte zu schreiben, wie jeder andere Teenager. Ich weiß nicht mehr, ob es der Drang nach Poesie war, der das Erwachen meiner ersten (unerklärten und platonischen) Liebe bewirkte, oder umgekehrt. Die Mischung war jedenfalls ein Desaster. Doch wie ich einmal geschrieben habe, wenn auch in Form einer paradoxen Sentenz, die eine meiner fiktiven Personen äußert: Es gibt zwei Arten von Dichtern: gute, die ihre Gedichte mit achtzehn verbrennen, und schlechte, die ihr Leben lang weiter Gedichte schreiben.1
Was ist kreatives Schreiben?
Als ich auf die Fünfzig zuging, fühlte ich mich nicht frustriert durch den Umstand, dass mein Schreiben kein »kreatives« war, wie viele Wissenschaftler es tun.2
Ich habe nie verstanden, warum Homer als ein kreativer Autor betrachtet wird und Platon nicht. Warum soll ein schlechter Dichter ein kreativer Autor sein, während ein guter wissenschaftlicher oder Sachbuchautor keiner ist?
Im Französischen gibt es eine Unterscheidung zwischen écrivain – jemand, der »kreative« Texte verfasst, wie ein Romancier oder ein Dichter – und écrivant, worunter man einen Schreiber versteht, der Fakten notiert, so wie ein Bankangestellter oder ein Polizist, der einen Kriminalfall berichtet. Aber was für eine Art Schreiber ist ein Philosoph? Wir könnten sagen, ein Philosoph ist ein professioneller Autor, dessen Texte sich mit anderen Worten wiedergeben oder übersetzen lassen, ohne dabei ihre ganze Bedeutung zu verlieren, während die Texte von kreativen Autoren nicht mit allen Nuancen übersetzt oder paraphrasiert werden können. Doch obwohl es zweifellos schwierig ist, Gedichte und Romane zu übersetzen, haben neunzig Prozent der Leser in aller Welt die Romane Krieg und Frieden oder Don Quijote in Übersetzungen gelesen, und ich denke, ein übersetzter Tolstoi ist oft originalgetreuer als jede englische Übersetzung von Heidegger oder Lacan. Ist Lacan also »kreativer« als Cervantes?
Der Unterschied lässt sich auch nicht in Begriffen der gesellschaftlichen Funktion eines gegebenen Textes ausdrücken. Galileis Texte sind gewiss von größter philosophischer und wissenschaftlicher Bedeutung, aber an italienischen Gymnasien werden sie als Beispiele für feines kreatives Schreiben studiert – als stilistische Meisterwerke.
Angenommen, Sie sind Bibliothekar und beschließen, die sogenannten kreativen Texte in Raum A zu stellen und die sogenannten wissenschaftlichen in Raum B. Würden Sie Einsteins Aufsätze mit Edisons Briefen an seine Sponsoren zusammentun und »Oh, Susanna!« mit Hamlet?
Jemand hat vorgeschlagen, »nichtkreative« Autoren wie Linné und Darwin wollten wahre Informationen über Wale oder Affen liefern, während »kreative« wie Melville und Burroughs, wenn sie über einen weißen Wal schrieben oder von Tarzan bei den Affen erzählten, nur vorgaben, die Wahrheit zu sagen, tatsächlich aber nichtexistente Wale und Affen erfanden und kein Interesse an den realen hatten. Können wir zweifelsfrei sagen, dass Melville, als er die Geschichte eines nichtexistenten Wals erzählte, nicht die Absicht hatte, etwas Wahres über Leben und Tod zu sagen, oder über menschlichen Stolz und Starrsinn?
Es ist problematisch, einen Autor als »kreativ« zu bezeichnen, bloß weil er uns Dinge erzählt, die den Tatsachen nicht entsprechen. Ptolemäus hat etwas Unrichtiges über die Bewegung der Erde gesagt. Sollten wir daraus schließen, dass er kreativer als Kepler war?
Der Unterschied liegt eher in der Art, wie Autoren auf die Interpretation ihrer Texte reagieren können. Wenn ich zu einem Philosophen, einem Wissenschaftler oder Kunstkritiker sage: »Sie haben das und das geschrieben«, kann der Autor immer erwidern: »Sie haben meinen Text falsch verstanden, ich habe genau das Gegenteil geschrieben.« Wenn aber ein Literaturkritiker eine marxistische Interpretation von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit vortrüge – etwa indem er behauptete, auf dem Gipfel der Krise der dekadenten Bourgeoisie habe die totale Hingabe an das Reich der Erinnerung den Künstler zwangsläufig von der Gesellschaft isoliert –, so könnte Proust zwar unzufrieden mit dieser Interpretation sein, würde es aber schwer haben, sie zurückzuweisen.
Wie wir in einer späteren Vorlesung sehen werden, haben kreative Autoren – als vernünftige Leser ihres eigenen Werks – zweifellos das Recht, eine an den Haaren herbeigezogene Interpretation anzufechten. Aber im allgemeinen müssen sie ihre Leser respektieren, da sie ihren Text sozusagen wie eine Flaschenpost in die Welt hinausgeworfen haben.
Wenn ich einen Text über Semiotik veröffentlicht habe, verbringe ich meine Zeit damit, bei Kritiken entweder anzuerkennen, dass ich mich geirrt habe, oder zu beweisen, dass diejenigen, die ihn nicht so verstanden haben, wie ich ihn gemeint habe, ihn falsch verstanden haben. Wenn ich dagegen einen Roman veröffentlicht habe, fühle ich mich im Prinzip moralisch verpflichtet, die Interpretationen der Leser nicht anzufechten (und ihnen keine nahezulegen).
Dies ist deshalb so – und hier können wir den wirklichen Unterschied zwischen kreativem und wissenschaftlichem Schreiben finden –, weil man in einem theoretischen Aufsatz gewöhnlich eine bestimmte These beweisen oder eine Antwort auf ein spezifisches Problem geben will. Während man in einem Gedicht oder Roman das Leben in seiner ganzen Unauslotbarkeit darzustellen versucht. Man möchte eine Reihe von Widersprüchen in Szene setzen, um sie deutlich und brennend zu machen. Kreative Autoren fordern ihre Leser auf, nach einer Lösung zu suchen. Sie bieten keine fertigen Formeln an (außer es handelt sich um kitschige, sentimentale Autoren, die billige Tröstungen anzubieten versuchen). Dies ist der Grund, warum ich seinerzeit, als ich Interviews über meinen gerade veröffentlichten ersten Roman gab, unter anderem sagte, manchmal könne man als Erzähler etwas ausdrücken, was man als Philosoph nicht sagen kann.
So war ich bis 1978 ganz zufrieden damit, ein Philosoph und Semiotiker zu sein. Einmal schrieb ich sogar mit einem Anflug von platonischer Arroganz, dass ich Dichter und Künstler im allgemeinen als Gefangene ihrer eigenen Lügen betrachtete, als Nachahmer von Nachgeahmtem, während ich als Philosoph Zugang zu den wahren platonischen Welten der Ideen hätte.
Man könnte sagen, dass viele Gelehrte – Kreativität beiseite – den Drang zum Geschichtenerzählen verspüren und mit Bedauern feststellen müssen, dass sie kein Talent dazu haben – weshalb die Schubladen so vieler Universitätsprofessoren voller unpublizierter schlechter Romane sind. Doch bei mir war es so, dass ich meine heimliche Leidenschaft für das Erzählen in all den Jahren auf zweierlei Weise befriedigt hatte: zum einen, indem ich mich oft im mündlichen Erzählen übte und meinen Kindern Geschichten erzählte (so dass ich es als Verlust empfand, als sie größer wurden und von Märchen zu Rockmusik übergingen); zum anderen, indem ich aus jedem philosophischen Aufsatz eine Erzählung machte.
Als ich meine Doktorarbeit über das Problem der Ästhetik bei Thomas von Aquin vorlegte – ein sehr kontroverses Thema, da die Gelehrten damals glaubten, es gebe in dem riesigen Werk dieses Kirchenlehrers gar keine Reflexionen über Ästhetik –, warf mir einer meiner Prüfer eine Art »narrative Täuschung« vor. Er sagte, ein reifer Forscher gehe, wenn er etwas zu erforschen beginne, durch trial and error vor, indem er eine Reihe von Hypothesen aufstelle und verwerfe; am Ende jedoch sollten alle diese Versuche und Irrtümer verdaut sein und nur die Ergebnisse der Forschung vorgelegt werden. Ich dagegen, sagte er, erzählte die Geschichte meiner Forschung, als sei sie ein Detektivroman. Der Einwand war freundlich gemeint und brachte mich auf den Gedanken, dass alle Forschungsergebnisse auf diese Weise »erzählt« werden müssten. Jedes wissenschaftliche Buch muss eine Art whodunnit sein – der Bericht über eine Quest nach dem heiligen Gral. Und ich denke, ich habe es in allen meinen späteren akademischen Werken so gehalten.
Es war einmal
Im Frühjahr 1978 sagte mir eine Freundin, die für einen kleinen Verlag arbeitete, sie sei dabei, eine Reihe von Nicht-Romanciers (Philosophen, Soziologen, Politiker usw.) zu bitten, für eine Anthologie jeweils eine kurze Detektivgeschichte zu schreiben. Aus den eben genannten Gründen erwiderte ich, dass mir an kreativem Schreiben nichts liege und ich mir sicher sei, nicht das geringste Talent zum Verfassen guter Dialoge zu haben. Am Ende sagte ich provokativ (ich weiß nicht, warum), wenn ich einen Kriminalroman zu schreiben hätte, würde er mindestens fünfhundert Seiten lang werden und in einem mittelalterlichen Kloster spielen. Meine Freundin erwiderte, sie sei nicht auf unlesbare Schwarten erpicht, und damit war unser Gespräch zu Ende.
Kaum war ich wieder zu Hause, durchsuchte ich meine Schubladen und fand eine Skizze vom Vorjahr – ein Blatt Papier, auf dem ich mir einige Namen von Mönchen notiert hatte. Mir dämmerte, dass im geheimsten Teil meiner Seele die Idee zu einem Roman schon aufgekeimt war, ohne dass ich es bemerkt hatte. An diesem Punkt kam mir der Gedanke, dass es schön wäre, einen Mönch zu vergiften, während er dabei ist, ein geheimnisvolles Buch zu lesen, und das war alles. So begann ich den Namen der Rose zu schreiben.
Als das Buch dann erschienen war, wurde ich oft gefragt, warum ich beschlossen hätte, einen Roman zu schreiben, und die Gründe, die ich angab (die je nach meiner Stimmung wechselten), waren vermutlich alle wahr – soll heißen, sie waren alle falsch. Hinterher wurde mir klar, was die einzige richtige Antwort gewesen wäre: An einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens hatte ich den Drang verspürt, es zu tun, und ich denke, das ist eine ausreichende und vernünftige Erklärung.
Wie ich schreibe
Wenn ich in Interviews gefragt werde: »Wie schreiben Sie Ihre Romane?«, antworte ich gewöhnlich kurz angebunden: »Von links nach rechts.« Mir ist aber klar, dass dies keine befriedigende Antwort ist und einiges Erstaunen in arabischen Ländern sowie in Israel hervorrufen kann. Hier habe ich nun Zeit für eine ausführlichere Antwort.
Während der Arbeit an meinem ersten Roman habe ich ein paar Dinge gelernt. Erstens: »Inspiration« ist ein schlechtes Wort, das trickreiche Autoren gebrauchen, um künstlerisch respektabel zu erscheinen. Wie der alte Spruch sagt: Genie ist zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration. Es heißt, der französische Dichter Lamartine habe oft beschrieben, unter welchen Umständen eines seiner besten Gedichte entstanden sei: Es sei ihm dank einer plötzlichen Erleuchtung druckfertig eingefallen, während er in einer stürmischen Nacht durch den Wald spazierte. Nach seinem Tod fand man in seinem Arbeitszimmer eine imposante Anzahl von Versionen jenes Gedichts, das er etwa zehn Jahre lang immer wieder umgeschrieben hatte.
Die ersten Kritiker, die den Namen der Rose besprachen, meinten, er sei zwar unter dem Einfluss einer leuchtenden Inspiration geschrieben worden, doch wegen seiner begrifflichen und sprachlichen Schwierigkeiten sei er nur etwas für die happy few. Als das Buch dann überraschend erfolgreich war, mit Millionen verkauften Exemplaren, schrieben dieselben Kritiker, um einen so populären und unterhaltsamen Bestseller zu fabrizieren, hätte ich zweifellos ein geheimes Rezept mechanisch befolgt. Später sagten sie dann, der Schlüssel zur Erklärung des Erfolgs sei ein Computerprogramm gewesen – wobei sie vergaßen, dass die ersten PCs mit brauchbarer Textverarbeitung zu Beginn der achtziger Jahre auf den Markt kamen, als mein Roman bereits gedruckt war. In den Jahren 1978–79 gab es auch in den Vereinigten Staaten nur sehr kleine Heimcomputer von Firmen wie Tandy, auf denen man kaum mehr als gerade mal einen Brief schreiben konnte.
Etwas später, als mir dieses ständige Gerede von Computerprogrammen immer mehr auf die Nerven ging, habe ich mich hingesetzt und das wahre Rezept zum Schreiben eines computergefertigten Bestsellers formuliert:
Erstens braucht man selbstredend einen Computer, der eine intelligente Maschine ist, die für einen denkt – was für viele vorteilhaft wäre. Es genügt ein Programm von wenigen Zeilen, das auch ein Kind schreiben kann. Dann füttert man den Computer mit dem Inhalt einiger hundert Romane, wissenschaftlicher Werke, der Bibel und des Korans sowie etlicher Telefonbücher (sehr nützlich für die Namen der handelnden Personen). Sagen wir rund 120.000 Seiten. Danach randomisiert man das Ganze mit einem anderen Programm, d.h. man verquirlt alle diese Texte miteinander unter Beigabe eines Zusatzbefehls, zum Beispiel der Eliminierung sämtlicher Buchstaben e – um so außer einem Roman auch noch ein Lipogramm à la Perec zu erhalten. Nun gibt man den Befehl Print, und da man alle e’s eliminiert hat, kommen etwas weniger als 120.000 Seiten heraus. Nachdem man sie mehrmals sorgfältig gelesen und die wichtigsten Stellen unterstrichen hat, lädt man sie auf einen Lkw und fährt sie zu einer Müllverbrennungsanlage. Dann setzt man sich mit einem Kohlestift und gutem Papier unter einen Baum, läßt die Gedanken schweifen und schreibt zwei Zeilen, zum Beispiel: »Der Mond steht hoch am Himmel / der Wald raschelt und rauscht.« Vielleicht kommt noch nicht gleich ein Roman heraus, sondern eher ein japanisches Haiku, aber das Entscheidende ist, einmal angefangen zu haben.3
Um von slow inspiration zu sprechen, den Namen der Rose zu schreiben hat mich bloß zwei Jahre gekostet, aus dem einfachen Grund, dass ich keinerlei Recherchen über das Mittelalter anzustellen brauchte. Wie schon gesagt, hatte ich meine Doktorarbeit über mittelalterliche Ästhetik geschrieben und auch spätere Studien dem Mittelalter gewidmet. Im Laufe der Jahre hatte ich eine Vielzahl romanischer Abteien, gotischer Kathedralen und so weiter besucht. Als ich mich entschloss, den Roman zu schreiben, war es, als öffnete ich einen großen Schrank, in dem ich jahrzehntelang meine mediävistischen Zettelkästen gestapelt hatte. All dieses Material stand mir zur Verfügung, und ich brauchte nur auszusuchen, was ich davon verwenden wollte. Bei den späteren Romanen war es anders (obwohl ich natürlich, wenn ich ein bestimmtes Thema wählte, auch damit schon eine gewisse Vertrautheit hatte). Deshalb brauchte ich für meine späteren Romane sehr viel Zeit – acht Jahre für Das Foucaultsche Pendel, sechs für Die Insel des vorigen Tages und noch einmal sechs für Baudolino. Für Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana brauchte ich nur vier Jahre, weil es darin um meine Lektüre als Kind in den dreißiger und vierziger Jahren geht und ich eine Menge altes Material nutzen konnte, das ich zu Hause hatte, alte Comicstrips, Schallplatten, Magazine und Zeitungen – kurz, meine ganze Sammlung von Memorabilia, Nostalgia und Trivia.
Eine Welt erbauen
Was tue ich während der Jahre meiner literarischen Schwangerschaft? Ich sammle Dokumente, besuche Orte und zeichne Karten; ich notiere den Grundriss von Gebäuden oder vielleicht den Aufriss eines Schiffes, wie bei der Insel des vorigen Tages, und ich skizziere die Gesichter von Figuren. Für den Namen der Rose hatte ich Porträts aller Mönche gemacht, die ich auftreten lassen wollte. Ich verbringe diese vorbereitenden Jahre in einer Art Zauberschloss – oder, wenn Sie so lieber wollen, in einem Zustand autistischer Einkapselung. Niemand weiß, was ich tue, nicht einmal meine Familienmitglieder. Ich erwecke den Eindruck, als machte ich einen Haufen verschiedener Dinge, aber ich bin immer darauf fokussiert, Ideen, Bilder und Wörter für meine Geschichte zu sammeln. Wenn ich, während ich über das Mittelalter schreibe, ein Auto auf der Straße vorbeifahren sehe und vielleicht von seiner Farbe beeindruckt bin, halte ich den Eindruck in meinem Notizbuch fest oder präge ihn mir gut ein, und später spielt diese Farbe vielleicht eine Rolle bei der Beschreibung von, sagen wir, einer Miniatur.
Als ich das Foucaultsche Pendel plante, verbrachte ich viele Abende bis zur Schließung in den Korridoren des Pariser Conservatoire des Arts et Métiers, wo einige der wichtigsten Szenen des Romans spielen. Um Casaubons nächtlichen Gang durch Paris zu beschreiben, vom Conservatoire zur Place de Vosges und dann bis zum Eiffelturm, bin ich mehrere Male nachts zwischen zwei und drei Uhr mit einem Taschenrecorder durch die Stadt gelaufen und habe alles, was ich sah, auf Band gesprochen, um nicht die Straßennamen und die Kreuzungen zu verwechseln.
Bei der Vorbereitung für die Insel des vorigen Tages bin ich natürlich in die Südsee gereist, genau zu der geographischen Position, von der ich erzählen wollte, um die Farben des Meeres und des Himmels, der Fische und der Korallen an verschiedenen Tageszeiten zu sehen. Aber ich habe auch zwei bis drei Jahre damit verbracht, Zeichnungen und Modelle von Schiffen der Epoche zu studieren, um zu wissen, wie groß eine Kabine oder ein Verschlag im Unterdeck sein konnte und wie man vor der einen zum anderen gelangte.
Nach der Publikation des Namens der Rose war der erste Filmregisseur, der mir eine Verfilmung vorschlug, Marco Ferreri. Er sagte zu mir: »Es scheint, als hätten Sie Ihren Roman direkt für ein Drehbuch entworfen, denn die Dialoge haben immer genau die richtige Länge.« Zuerst verstand ich nicht, warum. Dann erinnerte ich mich, dass ich, bevor ich zu schreiben begann, Hunderte von Labyrinthen und Plänen von Abteien gezeichnet hatte, so dass ich wusste, wie lange es dauerte, wenn zwei Personen von einem Ort zu einem anderen gingen und dabei miteinander redeten. So diktierte der Grundriss meiner fiktiven Welt die Länge der Dialoge.
Auf diese Weise lernte ich, dass ein Roman nicht bloß ein sprachliches Phänomen ist. In Dichtungen sind die Worte schwierig zu übersetzen, da es auf ihren Klang ankommt, nicht nur auf ihren bewusst vieldeutigen Sinn, und es ist die Wortwahl, die den Inhalt bestimmt. In erzählender Literatur haben wir die umgekehrte Situation: Es ist das Universum, das der Autor erbaut hat, mit den Ereignissen, die darin vorkommen, das den Rhythmus, den Stil und sogar die Wortwahl diktiert. In der erzählenden Literatur gilt die lateinische Regel Rem tene, verba sequentur – »Hast du die Sache, so folgen die Worte« –, während wir in der Dichtung sagen können: »Hast du die Worte, so folgt das Thema.«
Erzählende Literatur ist zunächst und vor allem eine kosmologische Angelegenheit. Um etwas zu erzählen, beginnt man als eine Art Demiurg, der eine Welt erschafft – eine Welt, die so präzise wie möglich sein muss, damit man sich vollkommen frei und sicher in ihr bewegen kann.
Ich befolge diese Regel so genau, dass ich zum Beispiel, als ich im Foucaultschen Pendel darlegen wollte, dass die beiden Verlage Manuzio und Garamond in zwei rückwärtig aneinanderstoßenden Gebäuden residieren, die mit einem Durchgang verbunden sind, lange Zeit damit verbracht habe, Pläne dieses Durchgangs zu zeichnen und mir zu überlegen, wie er aussehen könnte und ob da nicht ein paar Stufen sein müssten, um den Niveauunterschied zwischen den Gebäuden zu kompensieren. Im Roman erwähne ich diese Stufen nur kurz, und der Leser steigt sie hinauf, ohne sie groß zu beachten (glaube ich). Aber für mich waren sie fundamental, und wenn ich sie nicht gezeichnet hätte, wäre ich nicht fähig gewesen, meine Geschichte fortzusetzen.
Es heißt, Luchino Visconti habe es in seinen Filmen ähnlich gehalten. Wenn das Drehbuch verlangte, dass zwei Personen ein Gespräch vor einer Schatulle voller Juwelen führen, bestand er darauf, dass sich in der Schatulle echte Juwelen befanden, auch wenn sie gar nicht geöffnet wurde. Sonst hätten die Personen weniger überzeugend gespielt.
Die Leser des Foucaultschen Pendels müssen den genauen Grundriss der beiden aneinandergrenzenden Verlagshäuser nicht kennen. Obwohl die Struktur der Welt eines Romans – die räumliche Umgebung der Ereignisse und Personen – für den Autor von grundlegender Bedeutung ist, muss sie für den Leser oft undeutlich bleiben. In Der Name der Rose gibt es allerdings vorne und hinten im Buch einen Plan der Abtei. Das ist eine augenzwinkernde Anspielung auf die vielen altmodischen Kriminalromane, die einen Plan des Tatorts enthalten (zum Beispiel ein Pfarrhaus oder ein Landschloss), eine Art ironisches Realismus-Zeichen, als »Beweis«, dass die Abtei tatsächlich existiert hat. Aber ich wollte meinen Lesern auch deutlich vor Augen führen, wie meine Figuren sich durch die Klosteranlage bewegten.
Bei der Insel des vorigen Tages fragte mich mein deutscher Verleger, ob es nicht hilfreich wäre, in ähnlicher Weise einen Plan mit dem Grundriss des Schiffes einzufügen. Ich besaß einen solchen Plan und hatte viel Zeit damit verbracht, ihn zu zeichnen, ganz wie beim Plan der Abtei in Der Name der Rose. Doch bei der Insel wollte ich, dass der Leser ein bisschen verwirrt würde – so wie der Held, der sich im Labyrinth jenes Schiffes nicht zurechtfindet, auch weil er es oft im Alkoholrausch erkundet. Daher musste ich meine Leser durcheinanderbringen, während ich den eigenen Kopf klar behielt und mich beim Schreiben stets auf Räume bezog, die ich bis zum letzten Millimeter genau berechnet hatte.
Ideen-Keimzellen
Eine andere oft gestellte Frage ist: »Welche rohe Idee oder detaillierte Vorstellung haben Sie im Kopf, wenn Sie zu schreiben beginnen?« Erst nach meinem dritten Roman wurde mir richtig klar, dass sich jeder meiner Romane aus einer Ideen-Keimzelle entwickelt hat, die kaum mehr als ein Bild war. In der Nachschrift zum ›Namen der Rose‹ schrieb ich, der Anstoß zum Schreiben dieses Romans sei mein »Drang, einen Mönch zu vergiften« gewesen. Tatsächlich hatte ich nie den Drang, einen Mönch zu vergiften – ich meine, ich hatte nie den Drang, überhaupt jemanden zu vergiften, weder einen Mönch noch sonst irgendwen. Ich war bloß fasziniert vom Bild eines Mönches, der vergiftet wird, während er in einer Bibliothek ein Buch liest. Vielleicht erinnerte ich mich an eine Erfahrung, die ich als Sechzehnjähriger gemacht hatte: Beim Besuch eines Benediktinerklosters (Santa Scolastica in Subiaco) war ich durch die mittelalterlichen Kreuzgänge gewandert und in eine düstere Bibliothek gelangt, wo ich aufgeschlagen auf einem Lesepult die Acta Sanctorum fand. Beim Blättern in diesem riesigen Band, während ringsum tiefe Stille herrschte und nur ein paar wenige Lichtstrahlen durch die farbigen Fenster einfielen, muss ich so etwas wie einen Schauder empfunden haben. Mehr als dreißig Jahre später tauchte nun dieser Schauder aus meinem Unbewussten wieder auf.
Dies war die Bild-Keimzelle. Der Rest kam nach und nach, als ich mich bemühte, diesem Bild einen Sinn zu geben. Und er kam von allein, schrittweise, während ich in meinen seit fünfundzwanzig Jahren gesammelten mediävistischen Zettelkästen stöberte, die ich zu ganz anderen Zwecken angelegt hatte.
Beim Foucaultschen Pendel war es komplizierter. Nach dem Namen der Rose hatte ich das Gefühl, in meinen ersten (und vielleicht letzten) Roman alles hineingelegt zu haben, was ich – auch indirekt – über mich zu sagen hatte. Gab es noch etwas anderes, das wirklich zu mir gehört und über das ich schreiben konnte? Zwei Bilder kamen mir in den Sinn.
Das erste war das des nach Léon Foucault benannten Pendels. Ich hatte es erstmals vor über dreißig Jahren in Paris gesehen und war sehr beeindruckt gewesen – auch so ein Schauder, der lange in den Tiefen meiner Seele begraben gewesen sein musste. Das zweite war ein Bild von mir selbst als dreizehnjähriger Bub, der bei einem Begräbnis antifaschistischer Partisanen die Trompete spielte. Eine wahre Geschichte, die ich immer wieder erzählt hatte, weil ich sie so schön fand – und auch weil mir, als ich später Joyce las, klarwurde, dass ich etwas erlebt hatte, was er (in Stephen Hero) eine Epiphanie nennt.
So beschloss ich, eine Geschichte zu erzählen, die mit dem Pendel anfängt und mit einem kleinen Trompeter auf einem Friedhof an einem sonnigen Vormittag endet. Doch wie sollte ich vom Pendel zur Trompete gelangen? Diese Frage zu beantworten hat mich acht Jahre gekostet, und die Antwort ist der Roman.
Bei der Insel des vorigen Tages bin ich von einer Frage ausgegangen, die mir ein französischer Journalist gestellt hatte: »Warum können Sie so gut Räume beschreiben?« Ich hatte nie auf meine Beschreibung von Räumen geachtet, aber beim Nachdenken über diese Frage wurde mir klar, was ich schon gesagt habe – nämlich dass man, wenn man jede Einzelheit einer fiktiven Welt zeichnet, sie in ihrer Räumlichkeit gut beschreiben kann, da man sie ja vor Augen hat. In der Antike gab es eine literarische Gattung namens Ekphrasis, die darin bestand, ein gegebenes Bild (ein Gemälde oder ein Standbild) so genau zu beschreiben, dass selbst diejenigen, die es noch nie vor Augen gehabt hatten, es so klar sehen konnten, als ob sie es vor sich hätten. Wie Joseph Addison in The Pleasures of the Imagination (1712) schrieb: »Worte, wenn sie gut gewählt sind, haben eine so große Kraft in sich, dass eine Beschreibung oft eine lebendigere Vorstellung gibt als der Anblick der Dinge selbst.« Es heißt, als die Laokoon-Gruppe 1506 in Rom entdeckt wurde, hätten die Leute sie sofort als die berühmte griechische Statuengruppe erkannt, weil Plinius der Ältere sie so gut in seiner Naturalis Historia beschrieben hatte.
Also warum nicht eine Geschichte erzählen, in welcher der Raum eine wichtige Rolle spielt? Außerdem (sagte ich mir) hatte ich in meinen beiden ersten Romanen zuviel über Klöster und Museen gesprochen, das heißt über geschlossene kulturelle Räume. Ich sollte einmal versuchen, über offene natürliche Räume zu schreiben. Und wie konnte ich einen Roman mit weiten Räumen füllen, mit Natur und sonst gar nichts? Indem ich meinen Helden als Schiffbrüchigen auf eine einsame Insel versetzte.
Zur selben Zeit war ich fasziniert von einer dieser Weltzeit-Uhren, die für jeden Punkt der Erde die Ortszeit angeben und auch die Datumslinie auf dem hundertachtzigsten Meridian anzeigen. Jeder weiß, dass es diese Linie gibt, denn jeder hat irgendwann einmal Jules Vernes In achtzig Tagen um die Erde gelesen, aber wir denken nicht oft daran.
Gut, mein Schiffbrüchiger müsste sich also westlich dieser Linie befinden und eine Insel im Osten sehen, auf der es einen Tag früher ist. Er dürfte nicht auf der Insel selbst gestrandet sein, sondern müsste sich irgendwo in Sichtweite von ihr befinden, und er dürfte nicht schwimmen können, so dass er gezwungen ist, auf die nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich ferne Insel zu blicken.
Meine Uhr zeigte mir einen dieser schicksalsträchtigen Punkte bei den Aleuten-Inseln, aber ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte, jemanden dort stranden zu lassen. Konnte mein schiffbrüchiger Held auf einer Ölplattform gelandet sein? Außerdem muss ich, wie ich schon sagte, wenn ich über einen bestimmten Ort schreiben will, dort gewesen sein, und die Vorstellung, mich in eine so kalte Region zu begeben, war alles andere als berückend.
Als ich dann aber in meinem Atlas weiterblätterte, entdeckte ich, dass die Datumslinie auch durch den Archipel der Fidschi-Inseln verläuft. Die Inseln im Südpazifik weckten reiche Assoziationen an Robert Louis Stevenson. Viele dieser Länder sind den Europäern im 17. Jahrhundert bekannt geworden; die Barockzeit kannte ich ziemlich gut – es waren die Tage der Drei Musketiere und des Kardinals Richelieu. Ich brauchte bloß anzufangen, und bald konnte der Roman auf eigenen Füßen gehen.
Hat der Autor einmal eine bestimmte narrative Welt entworfen, so ergeben sich die Worte von selbst, und es sind die, welche diese bestimmte Welt erfordert. Daher folgt der Stil im Namen der Rose dem der mittelalterlichen Chronisten, die präzise, naiv und manchmal auch platt erzählten (ein bescheidener Mönch im 14. Jahrhundert schrieb nicht wie Joyce und schwelgte nicht in Erinnerungen wie Proust). Und da ich außerdem ja behauptete, meine Geschichte aus einer neugotisch-französischen Übersetzung eines mittelalterlichen Textes zu übertragen, war mein stilistisches Modell nur indirekt das Latein der mittelalterlichen Chronisten und eher das ihrer modernen Übersetzer.
Im Foucaultschen Pendel musste eine Vielzahl von Sprachen ins Spiel kommen: die gebildet-archaisierende von Aglié, die pseudo-dannunzianisch-faschistische Rhetorik von Ardenti, die desillusioniert und ironisch literarische Sprache in Belbos geheimen files (die wirklich postmodern sind mit ihrem frenetischen Dauergebrauch literarischer Zitate), die kaufmännische und zugleich kitschig aufgeblasene von Garamond und die kalauernden Dialoge der drei Lektoren mit ihren unverantwortlichen Phantasien, in denen sich gelehrte Bezugnahmen mit pennälerhaften Wortspielen mischen. Aber diese »sprunghaften Registerwechsel« waren nicht Folge einer einfachen Stilwahl, sondern vorgegeben durch die jeweilige Art von Welt, in der das Geschehen spielte, und durch die Psychologie der Figuren.
Bei der Insel des vorigen Tages war der bestimmende Faktor die kulturelle Epoche: die Barockzeit. Sie beeinflusste nicht nur den Stil, sondern sogar die Struktur des Dialogs zwischen Erzähler und Hauptfigur, in dem der Leser als Zeuge und Mitwisser ihres Konflikts angerufen wird. Diese Art von metanarrativer Wahl ergab sich aus der Tatsache, dass meine Figuren natürlich in einem barocken Stil reden sollten, ich selbst aber nicht gut so schreiben konnte. Daher brauchte ich einen Erzähler mit vielen Stimmungen und Funktionen, der sich bald über die verbalen Ausschweifungen seiner Protagonisten erbost, bald ihnen zum Opfer fällt und bald sie auch abzumildern sucht, indem er den Leser bittet, sie zu entschuldigen.
Bisher habe ich gesagt, dass (a) mein Ausgangspunkt eine Ideen-Keimzelle oder ein Bild ist und (b) die Konstruktion der narrativen Welt den Stil des Romans bestimmt. Mein vierter Ausflug in die Fiktion, Baudolino, widerspricht diesen beiden Prinzipien. Was die Ideen-Keimzelle angeht, so hatte ich mindestens zwei Jahre lang viele – und wenn man zu viele Ideen-Keimzellen hat, ist das ein Zeichen dafür, dass sie keine Keimzellen sind. An einem bestimmten Punkt beschloss ich, dass mein Protagonist ein Junge aus meiner Heimatstadt Alessandria sein sollte, die im 12. Jahrhundert gegründet und von Kaiser Friedrich Barbarossa belagert worden war. Überdies sollte mein Baudolino der Sohn jenes legendären Gagliaudo sein, der Barbarossa mit einer List, einer Lüge, einer schlauen Täuschung davon abhielt, die Stadt Alessandria einzunehmen – und wenn Sie wissen wollen, was für eine List das war, lesen Sie das Buch.
Baudolino