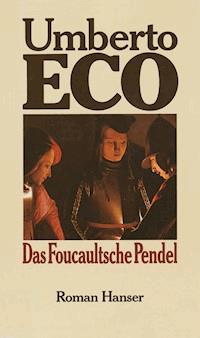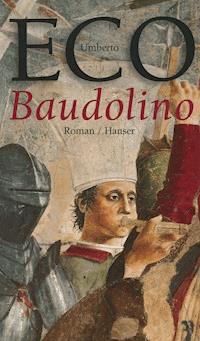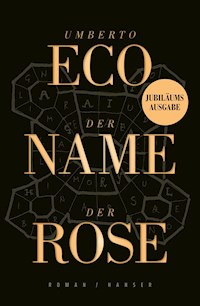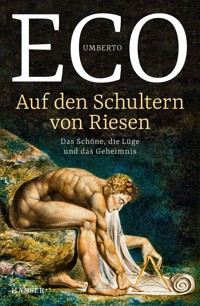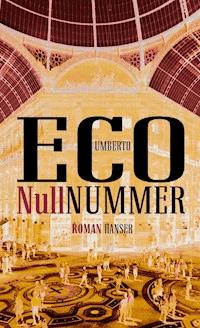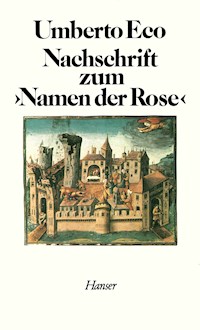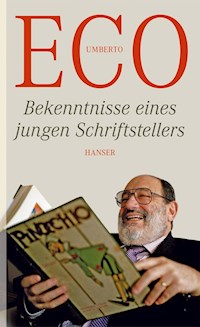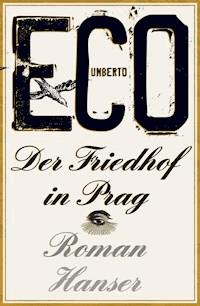
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Italiener Simone Simonini lebt in Paris, und er erlebt aus nächster Nähe eine dunkle Geschichte: geheime Militärpapiere, die der jüdische Hauptmann Dreyfus angeblich an die deutsche Botschaft verkauft, piemontesische, französische und preußische Geheimdienste, die noch geheimere Pläne schmieden, Freimaurer, Jesuiten und Revolutionäre - und am Ende tauchen zum ersten Mal die Protokolle der Weisen von Zion auf, ein gefälschtes „Dokument“ für die „jüdische Weltverschwörung“, das dann fatale Folgen haben wird. Umberto Eco, der Meister des historischen Romans, erzählt die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, in der wir jedoch unser eigenes wiedererkennen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hanser eBook
UMBERTO ECO
Der Friedhof
in Prag
Roman
Deutsch von
Burkhart Kroeber
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
Il Cimitero di Praga bei Bompiani in Mailand.
Die Übersetzung wurde durch ein Stipendium
des Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
ISBN 978-3-446-23829-9
© RCS Libri S.p.A. Bompiani, Milano 2010
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2011
2. E-Book-Auflage 2017
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Inhalt
1. Der Passant, der an jenem grauen Morgen
2. Wer bin ich?
3. Chez Magny
4. Großvaters Zeiten
5. Simonini als Carbonaro
6. Im Dienst der Dienste
7. Mit den Tausend
8. Die »Ercole«
9. Paris
10. Dalla Piccola ist perplex
11. Joly
12. Eine Nacht in Prag
13. Dalla Piccola erkennt sich nicht wieder
14. Biarritz
15. Dalla Piccola redivivus
16. Boullan
17. Die Tage der Kommune
18. Protokolle
19. Osman-Bey
20. Russen?
21. Taxil
22. Der Teufel im 19. Jahrhundert
23. Zwölf gut verbrachte Jahre
24. Eine nächtliche Messe
25. Klarheit gewinnen
26. Die Endlösung
27. Abgebrochenes Tagebuch
Anhang
Unnötige Hintergrundinformationen
Postume Fakten
Bildnachweis
Weil spektakuläre Szenen notwendig sind, ja den Hauptteil einer historischen Erzählung ausmachen, haben wir die Hinrichtung von hundert öffentlich gehängten Bürgern, diejenige von zwei lebendig verbrannten Klosterbrüdern sowie das Auftauchen eines Kometen eingefügt, lauter Ereignisse, die jedes soviel wie hundert Turniere zählen und den Vorteil haben, den Geist des Lesers weiter denn je von der Hauptsache abzulenken.
Carlo Tenca, La ca’ dei cani (1840)
1. Der Passant, der an jenem grauen Morgen
Der Passant, der an jenem grauen Morgen im März 189734 auf eigene Gefahr die Place Maubert überquert hätte – »la Maub«, wie sie im Ganovenmilieu genannt wurde (einst Zentrum des universitären Lebens im Mittelalter, Treffpunkt der Studenten, die an der Fakultät der Freien Künste am Vicus Stramineus, heute Rue du Fouarre, studierten, dann Pranger-, Folter- und Hinrichtungsstätte für Jünger des freien Denkens wie Étienne Dolet) –, wäre in eines der wenigen Viertel von Paris gelangt, das von den Planierungen des Barons Haussmann verschont geblieben war, ein Gewirr übelriechender Gassen, zerschnitten vom Lauf der Bièvre, die damals dort aus den Eingeweiden der Metropole herauskam, in denen sie so lange eingepfercht gewesen war, um sich fiebernd, gurgelnd und voller Würmer in die nahe Seine zu ergießen. Von der Place Maubert, die heute durch den Boulevard Saint-Germain verunstaltet wird, gelangte man damals in eine Vielzahl enger Sträßchen wie der Rue Maître-Albert, der Rue Saint-Séverin, der Rue Galande, der Rue de la Bûcherie und der Rue Saint-Julien-le-Pauvre bis hinüber zur Rue de la Huchette, in denen es allerlei schmutzige kleine Hotels gab, meist geführt von Auvergnaten, Wirten mit einer legendären Habgier, die für die erste Nacht einen ganzen Franc nahmen und für die folgenden vierzig Centimes (plus zwanzig Sous, wenn man auch ein frisches Laken wollte).
Wäre unser Passant dann in jene Straße eingebogen, die später Rue Frédéric-Sauton heißen sollte, aber damals noch Rue d’Amboise hieß, so hätte er etwa in ihrer Mitte, zwischen einem als Bierlokal getarnten Bordell und einer Taverne, in der man, zu billigstem Wein, für zwei Sous speisen konnte (was schon damals sehr wenig war, aber gerade soviel, wie die Studenten der nahen Sorbonne es sich leisten konnten), rechts eine Sackgasse gefunden, die schon damals Impasse Maubert hieß, aber bis 1865 Cul-de-sac d’Amboise genannt wurde und in früheren Jahren einen tapis-franc beherbergt hatte (so hieß im Jargon des Milieus eine Spelunke, eine Kaschemme untersten Ranges, die gewöhnlich von einem Exhäftling geführt und von frisch aus dem Knast Entlassenen frequentiert wurde), und die auch deshalb zu traurigem Ruhm gelangt war, weil sich dort im 18. Jahrhundert das Laboratorium dreier berühmter Giftmischer befunden hatte, die eines Tages tot darin aufgefunden worden waren, erstickt von den Ausdünstungen der Substanzen, die sie auf ihren Brennern destilliert hatten.
In der Mitte dieser Sackgasse tat sich ganz unbeachtet das Schaufenster eines Trödlerladens auf, dessen Auslage ein verblasstes Firmenschild als Brocantage de Qualité anpries – ein nicht sehr transparentes Schaufenster, wegen des dicken Staubes, der auf den Scheiben lag, die im übrigen auch nur wenig von der ausgestellten Ware und dem Inneren zeigten, da jede von ihnen, eingefasst von einem hölzernen Rahmen, kaum mehr als zwanzig Zentimeter hoch und breit war. Neben diesem Schaufenster hätte unser Passant eine Tür erblickt, die immer geschlossen war, und neben dem Draht einer Klingel ein Schildchen, auf dem zu lesen stand, dass der Eigentümer vorübergehend abwesend sei.
Wäre jedoch, was selten geschah, die Türe offen gewesen, so hätte der Eintretende im ungewissen Licht jenes Raumes, verteilt auf wenige schiefe Regale und einige ebenso wacklige Tische, eine Anhäufung von Gegenständen gesehen, die auf den ersten Blick begehrenswert aussehen mochten, bei genauerem Hinsehen sich jedoch als ganz und gar unbrauchbar für jeden ehrlichen Handel erwiesen, auch wenn sie zu ebenso verschlissenen Preisen angeboten würden. So zum Beispiel zwei verbogene Feuerböcke, die jeden Kamin geschändet hätten, eine Pendeluhr aus teilweise abgesplitterter blauer Emaille, verblichene Kissen, die vielleicht einmal in lebhaften Farben bestickt waren, hohe Blumenständer mit Putten aus angestoßener Keramik, schwankende Tischchen in unklarem Stil, ein Briefkartenkörbchen aus verrostetem Eisen, undefinierbare Schachteln mit Brandmalerei, abscheuliche Fächer aus Perlmutt mit chinesischen Motiven, eine Halskette offenbar aus Bernstein, zwei weiße Leinenschühchen mit glasdiamantbesetzten Schnallen, eine angeschlagene Napoleonbüste, Schmetterlinge unter gesprungenem Glas, Früchte aus buntem Marmor unter einer einst durchsichtigen Glasglocke, Kokosnüsse, alte Alben mit bescheidenen Blumenaquarellen, ein paar gerahmte Daguerreotypien (die zu jener Zeit noch gar nicht den Reiz einer Antiquität hatten) – so dass einer, der plötzlich, verruchterweise von einem dieser elenden Überreste alter Pfändungen verarmter Familien angezogen, den misstrauisch blickenden Eigentümer gefunden und ihn nach dem Preis gefragt hätte, mit einer Summe konfrontiert worden wäre, die selbst den verrücktesten Sammler antiquarischer Missbildungen entwaffnet hätte.
Und wäre der Besucher schließlich kraft eines Passierscheins durch eine zweite Türe geschritten, die das Innere des Ladens von den oberen Stockwerken des Gebäudes trennte, und hätte die Stufen einer knarzenden Wendeltreppe erklommen, wie sie charakteristisch für jene schmalen Pariser Häuser ist, deren Fassaden kaum breiter als ihre Haustüren sind (jedenfalls dort, wo sie sich schräg und schief aneinanderreihen), so wäre er in einen weiträumigen Salon getreten, der nicht den Plunder des Erdgeschosses zu beherbergen schien, sondern eine Sammlung ganz andersartiger Objekte: ein dreibeiniges Empiretischchen, dessen Beine mit Adlerköpfen verziert waren, einen Spieltisch, gestützt von einer geflügelten Sphinx, einen barocken Wandschrank, ein Bücherregal aus Mahagoniholz, auf dem sich an die hundert in kostbares Maroquinleder gebundene Bücher reihten, einen Schreibtisch von jener Sorte, die man die »amerikanische« nennt, mit Rollverschluss und vielen Schubfächern wie ein Sekretär. Und wäre der Besucher ins Nebenzimmer gegangen, so hätte er dort ein luxuriöses Himmelbett vorgefunden, eine rustikale Étagère mit Porzellanfiguren aus Sèvres, einer türkischen Wasserpfeife, einer großen Alabasterschale, einer Kristallvase, und an der Wand dahinter Paneele mit mythologischen Szenen, zwei große Ölbilder, auf denen die Musen der Geschichte und der Komödie zu sehen waren, sowie verschiedentlich an den Wänden arabische Barrakane, andere orientalische Tücher aus Kaschmirwolle, eine antike Feldflasche für Pilger, auch eine Waschschüssel auf einem schmiedeeisernen Ständer mit einer Zwischenetage voller Toilettengegenstände aus kostbaren Materialien – kurzum, ein bizarres Ensemble kurioser und teurer Objekte, das vielleicht nicht von einem besonders kohärenten und raffinierten Geschmack zeugte, wohl aber von einem Wunsch nach demonstrativ ausgestellter Opulenz.
Zurück im vorderen Salon, hätte der Besucher vor dem einzigen Fenster, durch das jenes bisschen Licht eindrang, das die Impasse erhellte, am Tisch sitzend einen älteren Herrn im Morgenrock wahrgenommen, der, soweit der Besucher es über seine Schulter spähend hätte erkennen können, gerade dabei war zu schreiben, was wir nun zu lesen uns anschicken und was der ERZÄHLER bisweilen zusammenfassen wird, um die Geduld des LESERS nicht allzusehr zu strapazieren.
Auch möge der LESER jetzt nicht erwarten, dass der ERZÄHLER ihm gestehe, wie überrascht er in dem Schreibenden einen schon früher Genannten wiedererkannt habe, denn da ja diese Geschichte eben jetzt erst beginnt, ist vorher noch niemand genannt worden, und selbst der ERZÄHLER weiß noch nicht, wer dieser geheimnisvolle Schreiber ist, und nimmt sich vor, es gemeinsam mit dem LESER zu erkunden, während beide ihm zudringlich über die Schulter spähen und die Zeichen verfolgen, welche die Feder des Fraglichen auf das Papier kritzelt.
2. Wer bin ich?
24. März 1897
Es bereitet mir eine gewisse Verlegenheit, mich ans Schreiben zu machen, als würde ich meine Seele entblößen auf Anordnung – nein, Gott bewahre! sagen wir: auf Anraten – eines deutschen Juden (oder eines österreichischen, aber das kommt auf dasselbe hinaus). Wer bin ich? Vielleicht frage ich mich besser nach den Leidenschaften, die ich vielleicht noch habe, als nach den Tatsachen meines Lebens. Wen liebe ich? Mir kommen keine geliebten Gesichter in den Sinn. Ich weiß, dass ich die gute Küche liebe. Beim bloßen Aussprechen des Namens »La Tour d’Argent« erfasst mich ein Zittern am ganzen Leibe. Ist das Liebe?
Wen hasse ich? Die Juden, möchte ich sagen, aber die Tatsache, dass ich so eilfertig auf die Anregungen jenes österreichischen (oder deutschen) Doktors eingehe, spricht eher dafür, dass ich nichts gegen die verdammten Juden habe.
Über die Juden weiß ich nur das, was mich mein Großvater gelehrt hat: »Sie sind das gottlose Volk par excellence«, erklärte er mir. »Sie gehen von der Idee aus, dass sich das Gute hier auf Erden verwirklichen muss, nicht im Jenseits. Daher tun sie alles, um diese Welt zu erobern.«
Die Jahre meiner Kindheit waren beherrscht und verdunkelt von ihrem Phantom. Der Großvater beschrieb mir jene lauernden Augen, die einen so falsch ansehen, dass man unwillkürlich erbleicht, jenes schleimige Lächeln, jene hyänengleich über die Zähne zurückgezogenen Lippen, jene schweren, verderbten, verrohten Blicke, jene vom Hass eingegrabenen Falten zwischen Nase und Lippen, die niemals zur Ruhe kommen, jene Hakennase gleich dem Schnabel eines exotischen Vogels… Und das Auge, ah, das Auge… Fiebrig rollt es mit seiner Pupille in der Farbe gerösteten Brotes und enthüllt Krankheiten der von den Sekreten eines achtzehn Jahrhunderte währenden Hasses zerfressenen Leber, beugt sich über tausend winzige Runzeln, die mit dem Alter zunehmen, doch schon mit zwanzig Jahren scheint der Jude verwelkt wie ein Greis. Wenn er lächelt, ziehen sich seine dicken Lider zu einem schmalen Schlitz zusammen, was manche für ein Zeichen von Schläue halten, was aber eines von Lüsternheit sei, wie mein Großvater präzisierte… Und als ich groß genug war, um zu verstehen, erklärte er mir, dass der Jude nicht nur eitel ist wie ein Spanier, ignorant wie ein Kroate, gierig wie ein Levantiner, undankbar wie ein Malteser, unverschämt wie ein Zigeuner, dreckig wie ein Engländer, schmierig wie ein Kalmücke, herrisch wie ein Preuße und lästerlich wie ein Piemontese aus Asti, sondern auch ehebrecherisch aus unbezähmbarer Geilheit – was von der Beschneidung kommt, die sie erektionsfreudiger macht, bei monströser Diskrepanz zwischen der Zwergwüchsigkeit ihres Körperbaues und dem Schwellvermögen dieses ihres halbverstümmelten Auswuchses.
Von den Juden habe ich Nacht für Nacht geträumt, jahrelang.
Zum Glück bin ich niemals einem begegnet, abgesehen von der kleinen Nutte aus dem Turiner Ghetto, als ich ein Junge war (aber wir haben nicht mehr als zwei Worte gewechselt), und von diesem österreichischen Doktor (oder deutschen, aber das kommt auf dasselbe hinaus).
Die Deutschen habe ich kennengelernt, und ich habe sogar für sie gearbeitet: die denkbar niedrigste Stufe der Menschheit. Ein Deutscher produziert im Durchschnitt doppelt soviel Fäkalien wie ein Franzose. Hyperaktivität der Verdauungsfunktion zu Lasten der des Hirns, die ihre physiologische Unterlegenheit zeigt. Zur Zeit der Barbareneinfälle übersäten die germanischen Horden ihre Wege mit unsinnigen Haufen fäkaler Materie. Infolgedessen konnte ein französischer Reisender auch in früheren Jahrhunderten sofort an der abnormen Größe der Exkremente neben der Straße erkennen, ob er die elsässische Grenze schon überschritten hatte. Und wenn’s nur das wäre: Typisch für den Deutschen ist auch die Bromhidrose, das heißt der unangenehme Schweißgeruch, und es ist bewiesen, dass bei einem Deutschen der Urin zwanzig Prozent Stickstoff enthält, während es bei den anderen Rassen nur fünfzehn sind.
Der Deutsche lebt in einem Zustand permanenter Verdauungsbeschwerden wegen seines exzessiven Bierkonsums und jener Schweinswürste, mit denen er sich vollstopft. Ich habe sie gesehen, eines Abends während meiner einzigen Reise nach München, in einer von jenen Schenken, die an profanierte Kathedralen erinnern, verraucht wie ein englischer Hafen, nach Speck und Schweinefett riechend, wie sie da dicht an dicht nebeneinandersitzen, sogar je zwei und zwei, sie und er, die Hände fest um jene Bierhumpen geklammert, die jeder allein den Durst einer Herde Dickhäuter stillen würden, Nase an Nase in einem tierischen Liebesdialog, wie zwei Hunde, die sich beschnuppern, mit ihrem brüllenden Gelächter, ihrer trüben gutturalen Heiterkeit, Gesichter und Leiber glänzend von einem immerwährenden Fett, das sie salbt wie das Öl die Haut der antiken Gladiatoren.
Sie nehmen den Mund voll mit ihrem Geist, was zwar im doppelten Sinne spiritus heißt, aber den Geist des Bieres meint, der sie von Jugend auf verblödet, was erklärt, warum jenseits des Rheins nie etwas Interessantes in der Kunst produziert worden ist, außer ein paar Gemälden mit abstoßenden Fratzen und Gedichten von tödlicher Langeweile. Zu schweigen von ihrer Musik – ich spreche gar nicht von diesem lärmenden und pathetischen Wagner, der jetzt auch die Franzosen so besoffen macht, aber nach dem wenigen, was ich gehört habe, sind auch die Kompositionen ihres Bach total unharmonisch und kalt wie eine Winternacht, und die Symphonien dieses Beethoven sind eine Orgie von Ungehörigkeit und Flegelei.
Ihr maßloser Bierkonsum macht sie unfähig, sich auch nur die geringste Vorstellung von ihrer Vulgarität zu machen, aber der Gipfel dieser Vulgarität ist, dass sie sich gar nicht schämen, Deutsche zu sein. Sie haben einen verfressenen und lüsternen Mönch wie Luther ernst genommen (kann man im Ernst eine Nonne heiraten?), bloß weil er die Bibel ruiniert hat, indem er sie in ihre Sprache übersetzte. Wer war es noch gleich, der gesagt hat, die Deutschen hätten die beiden großen europäischen Drogen missbraucht, den Alkohol und das Christentum?
Sie halten sich für tief, weil ihre Sprache unklar ist, ihr fehlt die clarté der französischen Sprache, sie sagt nie exakt das, was sie sollte, so dass kein Deutscher jemals weiß, was er sagen wollte – und dann verwechselt er diese Undeutlichkeit mit Tiefe. Es ist mit den Deutschen wie mit den Frauen, man gelangt bei ihnen nie auf den Grund. Unglücklicherweise hat mein Großvater mich diese ausdruckslose Sprache mit ihren Verben, die man beim Lesen angestrengt mit den Augen suchen muss, weil sie nie da stehen, wo sie sollten, als Kind zu lernen gezwungen, was angesichts seiner Austrophilie kein Wunder war. Und so habe ich diese Sprache hassen gelernt, ebenso wie den Jesuiten, der täglich ins Haus kam, um sie mir mit Stockschlägen auf die Finger beizubringen.
Seitdem jener Gobineau über die Ungleichheit der Rassen geschrieben hat, scheint es, wenn jemand schlecht über ein anderes Volk spricht, dass er sein eigenes für überlegen hält. Ich habe keine Vorurteile. Seit ich Franzose geworden bin (was ich bereits zur Hälfte durch meine Mutter war), habe ich begriffen, wie sehr meine neuen Landsleute faul, betrügerisch, nachtragend, eifersüchtig und so maßlos eingebildet sind, dass sie alle anderen für Barbaren halten und keinerlei Tadel ertragen. Aber ich habe auch begriffen, dass man, um sie dazu zu bringen, einen Makel ihrer Rasse einzuräumen, bloß schlecht über ein anderes Volk zu sprechen braucht, etwa indem man sagt: »Wir Polen haben diesen oder jenen Fehler«, denn da ein Franzose niemals hinter anderen zurückstehen will, nicht einmal im Schlechten, reagiert er sofort mit einem »O nein, wir in Frankreich sind noch schlimmer«, und schon zieht er ausgiebig über seine eigenen Landsleute her, bis er merkt, in welche Falle er gegangen ist.
Sie lieben ihresgleichen nicht, selbst wenn sie von ihnen profitieren. Niemand ist so ruppig wie ein französischer Gastwirt, der sich benimmt, als hasste er seine Kunden (was er vielleicht auch tut) und als wünschte er sich, sie wären nicht da (was er bestimmt nicht tut, denn der Franzose ist überaus habgierig). Ils grognent toujours – sie grunzen immer. Frag sie was, und du kriegst ein sais pas, moi zu hören, dazu pusten sie durch die Lippen, als würden sie furzen.
Sie sind böse. Sie töten aus Langeweile. Sie sind das einzige Volk, das seine Angehörigen jahrelang damit in Atem gehalten hat, sich gegenseitig den Kopf abzuschlagen, und ein Glück, dass Napoleon dann ihre Wut auf andere Rassen umgelenkt hat, indem er sie in Reih und Glied aufstellte und zur Zerstörung Europas aussandte.
Sie sind stolz darauf, einen Staat zu haben, den sie für mächtig halten, aber sie verbringen ihre ganze Zeit damit, ihn zu Fall zu bringen: Niemand ist so gut im Barrikadenbauen wie die Franzosen, aus jedem Anlass und bei jeder Gelegenheit, oft sogar ohne zu wissen warum, einfach mitgerissen vom Pöbel. Der Franzose weiß nicht recht, was er will, außer dass er sehr genau weiß, dass er nicht will, was er hat. Und um das zu sagen, fällt ihm nichts anderes ein, als Lieder zu singen.
Sie glauben, dass alle Welt französisch spricht. Vor ein paar Jahren war das sehr schön zu sehen bei diesem Lucas, einem Genie – dreißigtausend falsche Dokumente, Autographen auf echtem altem Papier, das er sich besorgte, indem er die Vorsatzblätter alter Bücher aus der Bibliothèque Nationale herausschnitt, mit gekonnter Imitation der verschiedenen Handschriften, wenn auch nicht so gut, wie ich es gekonnt hätte… Ich weiß nicht, wie viele davon er zu Höchstpreisen an diesen Strohkopf von Chasles verkauft hatte (ein großer Mathematiker, heißt es, und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, aber ein großer Trottel). Und nicht nur der, sondern viele seiner Kollegen Akademiker fanden es ganz in Ordnung, dass Leute wie Caligula, Cleopatra oder Julius Cäsar ihre Briefe angeblich auf Französisch geschrieben hatten und dass auch die Korrespondenz zwischen Pascal, Newton und Galileo auf Französisch geschrieben war, obwohl doch jedes Kind weiß, dass die Gelehrten jener Zeit auf Latein miteinander korrespondierten. Die französischen Gelehrten hatten keine Ahnung davon, dass andere Völker anders als französisch sprachen. Inhaltlich stand in den falschen Briefen, dass Pascal die universale Schwerkraft zwanzig Jahre vor Newton entdeckt habe, und das genügte, um jene von nationalem Dünkel zerfressenen Sorbonnarden für alles andere blind zu machen.
Vielleicht kommt diese Ignoranz von ihrem Geiz – dem nationalen Laster, das sie für eine Tugend halten und Sparsamkeit nennen. Nur in Frankreich hat man sich eine ganze Komödie über einen Geizigen ausdenken können. Um nicht von Père Grandet zu sprechen.
Den Geiz sieht man an ihren staubigen Wohnungen, an ihren nie renovierten Tapeten, an ihren Badewannen aus der Zeit ihrer Vorfahren, an ihren engen hölzernen Wendeltreppen, die sie einbauen, um den schmalen Raum pedantisch auszubeuten. Verschneidet, wie man es bei Pflanzen tut, einen Franzosen mit einem Deutschen (womöglich jüdischer Herkunft), und ihr habt, was wir haben: die Dritte Republik…
Dass ich Franzose geworden bin, lag daran, dass ich es nicht mehr ertragen konnte, Italiener zu sein. Als gebürtiger Piemontese fühlte ich mich wie die Karikatur eines Galliers, aber mit bornierteren Vorstellungen. Die Piemontesen schrecken vor jeder Neuerung zurück, alles Unerwartete macht ihnen Angst, um sie bis nach Sizilien zu treiben – dabei waren unter den Garibaldinern nur sehr wenige Piemontesen – brauchte es zwei Ligurier, einen Schwärmer wie Garibaldi4 und einen Unglücksbringer wie Mazzini. Und reden wir nicht von dem, was ich entdeckt hatte, als ich nach Palermo geschickt worden war (wann ist das gewesen? ich muss es rekonstruieren). Nur dieser eitle Pfau Dumas3 liebte jene Völker, vielleicht weil sie ihn mehr verehrten als die Franzosen, die ihn immer noch als einen Mischling ansahen. Er gefiel den Sizilianern und Neapolitanern, die selber so etwas wie Mulatten waren, nicht wegen des Fehltritts einer einzelnen liederlichen Mutter, sondern aufgrund der Geschichte von Generationen, Ergebnis der Kreuzung von zwielichtigen Levantinern, verschwitzten Arabern und degenerierten Ostgoten, die jeder das Schlechteste von ihren hybriden Vorfahren mitgebracht hatten, von den Sarazenen die Trägheit, von den Schwaben die Wildheit, von den Griechen die Inkonsequenz und die Gewohnheit, sich in endlose Palaver zu verlieren, bis ein Haar in vier Teile gespalten war. Im übrigen braucht man bloß die Gassenjungen in Neapel zu sehen, wie sie die Fremden betören, indem sie sich mit Spaghetti strangulieren, die sie sich mit den Fingern in die Gurgel stopfen, wobei sie sich mit verdorbener Tomatensoße bekleckern. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, glaube ich, aber ich weiß es.
Der Italiener ist treulos, verlogen, feige, verräterisch, ihm liegt der Dolch mehr als der Degen, das Gift mehr als das Medikament, er ist glatt wie ein Aal beim Verhandeln und kohärent nur im Seitenwechsel bei jeder Drehung des Windes – ich habe gesehen, wie es den bourbonischen Generälen ergangen ist, kaum dass die Abenteurer Garibaldis und die piemontesischen Generäle aufgetaucht waren.
Es liegt daran, dass die Italiener sich immer am Vorbild der Priester orientieren, der einzigen echten Regierung, die sie je hatten, seit dieser perverse letzte römische Kaiser von den Barbaren sodomisiert worden war, weil das Christentum den Stolz der antiken Rasse gebrochen hatte.
Die Priester… Wie habe ich sie kennengelernt? Im Haus des Großvaters, glaube ich, ich erinnere mich dunkel an flüchtige Blicke, schlechte Zähne, schweren Atem, schwitzende Hände, die mich im Nacken zu streicheln versuchten. Ekelhaft. Als Müßiggänger gehören sie zu den gefährlichen Klassen, wie die Diebe und die Vagabunden. Priester oder Mönch wird man nur, um im Müßiggang leben zu können, und den Müßiggang garantiert ihnen ihre Anzahl. Wären die Priester nur, sagen wir, einer auf tausend Seelen, dann hätten sie so viel zu tun, dass sie nicht auf der faulen Haut liegen und Kapaune schmausen könnten. Und von den faulsten Priestern sucht sich die Regierung immer die dümmsten aus und ernennt sie zu Bischöfen.
Man hat sie ständig um sich, sobald man auf die Welt gekommen ist und getauft wird, man trifft sie in der Schule wieder, wenn man Eltern hat, die bigott genug sind, ihnen ihre Kinder anzuvertrauen, dann kommt die erste Kommunion und der Katechismus und die Firmung; den Priester hat man am Hochzeitstag vor sich, wenn er einem sagt, was man im Schlafzimmer tun soll, und am Tag danach in der Beichte, wenn er fragt, wie oft man es getrieben hat, um sich hinter seinem Gitter daran erregen zu können. Sie sprechen voller Abscheu vom Sex, aber jeden Tag sieht man sie aus einem inzestuösen Bett aufstehen, ohne sich auch nur die Hände gewaschen zu haben, und so gehen sie ihren Herrn essen und trinken, um ihn dann später zu kacken und zu pissen.
Sie sagen andauernd, dass ihr Reich nicht von dieser Welt sei, und nehmen sich alles, was sie nur raffen können. Die Zivilisation wird nicht vollendet sein, solange nicht der letzte Stein der letzten Kirche den letzten Priester erschlagen hat und die Erde frei ist von diesem Gezücht.
Die Kommunisten haben den Gedanken verbreitet, dass die Religion das Opium des Volkes sei. Das stimmt, denn sie dient dazu, die Versuchungen der Untertanen zu zügeln, und wenn es die Religion nicht gäbe, wären doppelt so viele Menschen auf den Barrikaden, während es in den Tagen der Kommune zu wenige waren, so dass man sie ohne viel Mühe erledigen konnte. Aber nachdem ich diesen österreichischen Doktor über die Vorteile der kolumbianischen Droge habe reden hören, würde ich sagen, dass die Religion auch das Kokain der Völker ist, denn sie treibt die Völker seit jeher zu Kriegen und Massakern an Ungläubigen, und das gilt für Christen, Muselmänner und andere Götzenanbeter, und während die Neger in Afrika sich damit begnügten, einander gegenseitig zu massakrieren, haben die Missionare sie bekehrt und zu Kolonialsoldaten gemacht, die bestens geeignet sind, an vorderster Front zu sterben und die weißen Frauen zu vergewaltigen, wenn sie in eine Stadt kommen. Die Menschen tun das Böse nie so vollständig und begeistert, wie wenn sie es aus religiöser Überzeugung tun.
Am schlimmsten von allen sind sicher die Jesuiten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihnen ein paar Streiche gespielt zu haben, oder vielleicht waren sie es, die mir etwas angetan haben, ich erinnere mich nicht mehr genau. Vielleicht waren es auch ihre leiblichen Brüder, die Freimaurer. Die Freimaurer sind wie die Jesuiten, nur ein bisschen konfuser. Diese haben wenigstens eine eigene Theologie und wissen sie zu gebrauchen, jene haben zu viele davon und verlieren leicht die Übersicht. Von den Freimaurern hat mir mein Großvater erzählt. Zusammen mit den Juden haben sie dem französischen König den Kopf abgeschlagen. Und in Italien haben sie die Carbonari hervorgebracht, die ein bisschen dümmere Freimaurer waren, denn mal ließen sie sich füsilieren und mal ließen sie sich enthaupten, weil sie es nicht geschafft hatten, eine funktionierende Bombe zu bauen, oder sie wurden zu Sozialisten, Kommunisten und Kommunarden. Alle an die Wand. Gut gemacht, Monsieur Thiers!
Freimaurer und Jesuiten. Die Jesuiten sind Freimaurer in Frauenkleidern.
Ich hasse die Frauen, nach dem wenigen, was ich von ihnen weiß. Jahrelang haben mich jene brasseries à femmes umgetrieben, in denen sich Übeltäter aller Arten und Sparten versammeln. Schlimmer als die Freudenhäuser. Die haben wenigstens noch Schwierigkeiten, sich zu etablieren, weil die Nachbarn dagegen sind, während diese Bierlokale überall eröffnet werden können, da sie ja, wie es heißt, nur eben Lokale zum Biertrinken seien. Aber getrunken wird dort nur im Erdgeschoss, und in den oberen Stockwerken wird Hurerei getrieben. Jedes dieser Lokale hat ein Thema, und die Kostüme der Mädchen richten sich danach, hier findet man deutsche Kellnerinnen, dort vor dem Justizpalast Serviererinnen in Advokatenrobe. Im übrigen genügen bereits die Namen, wie Brasserie du Tire-cul, Brasserie des belles marocaines oder Brasserie des quatorze fesses, unweit der Sorbonne. Fast alle werden von Deutschen betrieben – auch eine Art, die französische Moral zu untergraben. Allein zwischen dem fünften und sechsten Arrondissement gibt es mindestens sechzig solche Lokale, in ganz Paris sind es fast zweihundert, und alle sind auch für Jugendliche offen. Erst kommen die Jungs aus Neugier, dann aus Lüsternheit, und am Ende holen sie sich einen Tripper – wenn’s gut geht. Befindet sich das Lokal in der Nähe einer Schule, gehen die Schüler nach dem Unterricht hin, um durch die Tür nach den Mädchen zu linsen. Ich gehe hin, um zu trinken. Und um von innen durch die Tür nach den Schülern zu linsen, die von außen hereinlinsen. Und nicht nur nach den Schülern. Man lernt viel über die Gewohnheiten und Frequentationen der Erwachsenen, was immer nützlich sein kann.
Am meisten amüsiert mich, die Natur der verschiedenen wartenden Zuhälter an den Tischen zu erkennen. Einige von ihnen sind Ehemänner, die von den Reizen ihrer Frauen leben, und die sitzen gut gekleidet, rauchend und kartenspielend zusammen, und der Wirt oder die Bedienungen sprechen von ihnen als vom Tisch der Gehörnten. Aber im Quartier Latin gibt es auch viele gescheiterte Ex-Studenten, die immer fürchten, dass jemand ihnen ihre Einnahmequelle wegschnappt, und die ziehen oft das Messer. Am ruhigsten sind die Diebe und Mörder, sie kommen und gehen, weil sie sich um ihre Diebes- und Mördergeschäfte kümmern müssen, und sie wissen, dass die Mädchen sie nicht verraten werden, weil sie sonst am nächsten Tag in der Bièvre treiben würden.
Es gibt auch Perverse, die sich damit beschäftigen, verdorbene junge Männer oder gar Frauen für schmutzigere Dienste zu gewinnen. Sie suchen sich ihre Kunden am Palais-Royal oder auf den Champs-Élysées und locken sie mit konventionellen Angeboten. Im Zimmer lassen sie dann ihre Komplizen als Polizisten verkleidet eindringen, diese drohen dem Kunden in Unterhose, ihn zu verhaften, er bettelt um Gnade und zückt ein Bündel Scheine.
Wenn ich diese Lokale betrete, verhalte ich mich vorsichtig, denn ich weiß, was mir passieren könnte. Sieht ein Kunde wohlhabend aus, macht der Wirt ein Zeichen, eines der Mädchen nähert sich ihm und bringt ihn dazu, nach und nach alle anderen an seinen Tisch einzuladen und teure Getränke für sie zu bestellen (aber in Wahrheit trinken sie, um nüchtern zu bleiben, anisette superfine oder cassis fin, farbiges Wasser, für das der Kunde einen hohen Preis bezahlt). Dann versuchen sie, ihn zum Kartenspiel zu überreden, und natürlich geben sie einander Zeichen, so dass er verliert und das Essen für alle bezahlen muss, auch für den Wirt und dessen Frau. Und wenn er aufhören möchte, schlagen sie vor, von nun an nicht mehr um Geld zu spielen, sondern so, dass bei jeder Runde, die er gewinnt, eines der Mädchen sich etwas ausziehen muss… Und bei jedem Dessous, das fällt, kommt etwas von diesem ekligen weißen Fleisch zum Vorschein, von diesen schwellenden Brüsten, diesen dunklen Achselhöhlen mit ihrem säuerlichen Geruch, der mich entnervt…
In den Oberstock bin ich nie gegangen. Jemand hat gesagt, Frauen seien bloß ein Ersatz für das einsame Laster, das lediglich mehr Phantasie verlange. Also kehre ich nach Hause zurück und träume nachts von ihnen, ich bin ja nicht aus Stein, und schließlich sind sie es, die mich provoziert haben.
Ja, ja, ich habe den Doktor Tissot gelesen, ich weiß, dass sie auch von weitem Schaden anrichten. Wir wissen nicht, ob die animalischen Säfte und die Genitalflüssigkeit dasselbe sind, aber bestimmt haben diese beiden Liquide eine gewisse Ähnlichkeit, und nach langen nächtlichen Ergüssen schwinden einem nicht nur die Kräfte, sondern der Leib magert ab, das Gesicht wird blass, das Gedächtnis lässt nach, die Sicht verschwimmt, die Stimme wird rauh, der Schlaf wird von unruhigen Träumen geplagt, man bekommt Augenschmerzen und rote Flecken im Gesicht, manche spucken kalkweißes Zeug, bekommen Herzklopfen, Erstickungs- und Ohnmachtsanfälle, andere klagen über Verstopfung oder immer dünneren Durchfall. Und schließlich erblindet man.
Vielleicht sind das ja Übertreibungen, als Bub hatte ich das Gesicht voller Pusteln, aber das war wohl typisch für mein Alter, vielleicht bereiten sich alle Jungen dieses Vergnügen und manche so ausgiebig, dass sie sich Tag und Nacht unzüchtig berühren. Heute jedenfalls kann ich es mir dosieren, mein Schlaf ist nur unruhig, wenn ich in einem Bierlokal war, und es geht mir nicht so wie vielen anderen, dass ich Erektionen hätte, sobald ich nur einen Rock auf der Straße sehe. Die Arbeit hält mich vom Sittenverfall ab.
Aber warum philosophiere ich hier, statt die Ereignisse zu rekonstruieren? Vielleicht weil ich nicht nur wissen muss, was ich bis gestern getan habe, sondern auch, wie ich im Innern bin. Vorausgesetzt, dass ich ein Inneres habe. Manche behaupten, die Seele sei nur das, was man tut, aber wenn ich jemanden hasse und dieses Gefühl kultiviere, bei Gott, dann heißt das doch wohl, dass es ein Inneres gibt! Wie sagte der Philosoph? Odi ergo sum.
Vor kurzem hat es unten geklingelt, ich fürchtete schon, da sei so ein Dummkopf, der etwas kaufen wolle, aber der Betreffende sagte, Tissot habe ihn geschickt – wieso habe ich ausgerechnet dieses Erkennungswort gewählt? Er wollte ein eigenhändiges Testament, unterzeichnet von einem gewissen Bonnefoy zugunsten eines gewissen Guillot (der wohl er selber war). Er hatte das Briefpapier mitgebracht, das Bonnefoy zu benutzen pflegt oder pflegte, sowie eine Probe seiner Handschrift. Ich ließ ihn ins Studio hinauf, wählte die passende Feder und Tinte und fabrizierte das Dokument aus dem Stand, ohne auch nur geübt zu haben. Perfekt. Als hätte der Mann die Tarife gekannt, zahlte er mir ein der Hinterlassenschaft angemessenes Honorar.
Ist dies also mein Metier? Eine schöne Tätigkeit, aus dem Nichts einen notariellen Akt zu erzeugen, einen echt aussehenden Brief zu verfassen, ein kompromittierendes Geständnis zu formulieren, ein Dokument zu erschaffen, das jemanden ins Verderben stürzen wird. Die Macht der Kunst… Darauf gönne ich mir einen Besuch im Café Anglais.
Ich muss ein Nasengedächtnis haben, aber mir ist, als hätte ich seit Jahrhunderten nicht mehr den Geruch dieses Menus genossen: soufflés à la reine, filets de sole à la Vénitienne, escalopes de turbot au gratin, selle de mouton purée bretonne… Und als Entrée poulet à la portugaise oder pâté chaud de cailles oder homard à la parisienne oder alles zugleich, und als Plat de résistance, nun, nehmen wir canetons à la rouennaise oder ortolans sur canapés, und als Entremet aubergines à l’espagnole, asperges en branches, cassolettes princesse… Beim Wein weiß ich nicht recht, vielleicht Château-Margaux oder Château-Latour oder Château-Lafite, kommt auf den Jahrgang an. Und zum Abschluss eine bombe glacée.
Gutes Essen hat mich schon immer mehr befriedigt als Sex. Vielleicht eine Folge meiner Erziehung durch Priester.
Immer ist mir, als hätte ich etwas wie eine Wolke im Kopf, die mich daran hindert, Rückschau zu halten. Warum tauchen in meinem Gedächtnis auf einmal die kleinen Fluchten zum Bicerin wieder auf, die ich mir im Gewand von Pater Bergamaschi geleistet habe? Pater Bergamaschi hatte ich völlig vergessen. Wer war das? Es gefällt mir, die Feder einfach laufen zu lassen, wie mein Instinkt es befiehlt. Diesem österreichischen Doktor zufolge müsste ich auf diese Weise zu einem wirklich schmerzhaften Punkt in meinen Erinnerungen gelangen, der erklären würde, warum ich auf einmal so vieles ausgelöscht habe.
Gestern, an dem Tag, den ich für Dienstag, den 22. März, gehalten hatte, war mir beim Erwachen, als ob ich noch sehr genau wüsste, wer ich bin: Hauptmann Simonini2, geschlagene siebenundsechzig Jahre alt, aber gut erhalten (mein Leibesumfang ist gerade so, dass man mich als einen stattlichen Herrn bezeichnen kann), mit einem Titel, den ich in Frankreich zur Erinnerung an meinen Großvater angenommen hatte, unter Berufung auf vage militärische Jugendsünden in den Reihen der garibaldinischen Truppen, was einem in diesem Lande, in dem Garibaldi höher geschätzt wird als in Italien, ein gewisses Prestige einbringt. Simon Simonini, geboren in Turin, der Vater Turiner, die Mutter aus Frankreich (oder genauer aus Savoyen, aber zur Zeit ihrer Geburt war Savoyen von Frankreich annektiert).
Noch im Bett liegend, habe ich vor mich hin phantasiert… Bei den Problemen, die ich mit den Russen hatte (mit Russen?), sollte ich mich lieber nicht in meinen bevorzugten Restaurants sehen lassen. Ich könnte mir selbst etwas kochen. Es entspannt mich, ein, zwei Stündchen zu werkeln, um mir einen Leckerbissen zuzubereiten. Zum Beispiel côtes de veau Foyot – das Fleisch mindestens vier Zentimeter dick, doppelte Portion, versteht sich, zwei mittelgroße Zwiebeln, fünfzig Gramm Brosamen, fünfundsiebzig Gramm geriebenen Gruyère, fünfzig Gramm Butter, die Brosamen zu Paniermehl zerreiben und mit dem Gruyère vermischen, die Zwiebeln schälen und klein hacken, vierzig Gramm Butter in einer kleinen Kasserolle schmelzen lassen, während in einer anderen bei kleiner Hitze die Zwiebeln in der restlichen Butter brutzeln, den Boden eines Topfes mit der Hälfte der Zwiebeln bedecken, das Fleisch salzen und pfeffern und auf die Zwiebeln legen, dann oben mit dem Rest der Zwiebeln garnieren, das Ganze mit einer ersten Schicht Paniermehl und Käse bedecken und dabei das Fleisch gut auf den Boden der Pfanne drücken, die geschmolzene Butter darübergießen und leicht mit der Hand eindrücken, dann eine zweite Schicht Paniermehl mit Käse draufpacken, bis eine Art Kuppel entsteht, erneut geschmolzene Butter dazugeben und alles mit Weißwein und Brühe übergießen, bis etwa die mittlere Höhe des Fleisches erreicht wird. Das Ganze nun etwa eine halbe Stunde brutzeln lassen und nach Bedarf weiter mit Wein und Brühe anfeuchten. Mit geröstetem Blumenkohl anrichten.
Es dauert ein Weilchen, aber die Freuden der guten Küche beginnen bereits vor denen des Gaumens, und zubereiten heißt immer auch Vorfreude genießen, so wie ich es tat, als ich mich wohlig im Bett räkelte. Die Dummen brauchen eine Frau neben sich unter der Decke, oder einen Knaben, um sich nicht so allein zu fühlen. Sie ahnen nicht, dass das Wasser, das einem im Munde zusammenläuft, viel besser ist als eine Erektion.
Ich hatte alles im Hause, bis auf den Gruyère und das Fleisch. Für das Fleisch gab es an anderen Tagen den Metzger an der Place Maubert, aber der hat, aus welchen Gründen auch immer, am Dienstag geschlossen. Ich kannte jedoch einen anderen, zweihundert Meter weiter am Boulevard Saint-Germain, und ein kleiner Spaziergang würde mir sicher nicht schaden. So zog ich mich an, und bevor ich hinausging, klebte ich mir vor dem Spiegel über der Waschschüssel den gewohnten schwarzen Schnauzer und meinen schönen Kinnbart an. Dann setzte ich mir die Perücke auf und kämmte sie säuberlich zu einem Mittelscheitel, nicht ohne den Kamm leicht anzufeuchten. Ich schlüpfte in den Gehrock und steckte mir die silberne Uhr mit ihrer gut sichtbaren Kette in die Westentasche. Um wie ein pensionierter Hauptmann zu erscheinen, spiele ich gern beim Reden mit einer kleinen Schildpattdose voll rautenförmiger Lakritzebonbons, deren Deckel auf der Innenseite das Porträt einer hässlichen, aber gut gekleideten Frau erkennen lässt, sicher einer teuren Verstorbenen. Ab und zu stecke ich mir ein Bonbon in den Mund und schiebe es mit der Zunge von einer Seite zur anderen, was mir erlaubt, langsamer zu sprechen – und dann folgt der Zuhörer den Bewegungen meiner Lippen und achtet nicht so genau auf das, was ich sage. Das Problem ist, den Eindruck von jemandem zu erwecken, der mit einer weniger als mediokren Intelligenz begabt ist.
Ich ging auf die Straße hinaus und bog vorn um die Ecke, bemüht, nicht vor dem Bierlokal stehenzubleiben, aus dem schon am frühen Morgen das schrille Gekeife seiner liederlichen Weiber ertönte.
Die Place Maubert ist nicht mehr jene Cours des Miracles, die sie war, als ich vor fünfunddreißig Jahren hier ankam. Damals wimmelte sie von zwielichtigen Gestalten – von fliegenden Händlern, die wiederaufbereiteten Tabak anboten, groben aus Zigarrenstummeln und Pfeifenböden, feinen aus Zigarettenkippen, den groben für einen Franc zwanzig das Pfund, den feinen für einen Franc fünfzig bis fünfundsiebzig (wobei dieses Geschäft nicht viel einbringen konnte, da keiner dieser fleißigen Kippensammler, wenn er einen größeren Teil seiner Tageseinnahmen in einer Kneipe gelassen hatte, dann wusste, wo er in der Nacht schlafen sollte); von Zuhältern, die, nachdem sie sich bis mindestens mittags im Bett geräkelt hatten, den Rest des Tages rauchend an eine Mauer gelehnt verbrachten wie gutsituierte Pensionäre, um dann bei Einbruch der Dämmerung in Aktion zu treten wie Hirtenhunde; von Dieben, die sich gezwungen sahen, einander gegenseitig zu beklauen, da kein guter Bürger (außer ein paar Nichtstuern vom Lande) es gewagt hätte, diesen Platz zu überqueren – auch ich wäre eine gute Beute gewesen, hätte ich nicht einen militärisch strammen Gang vorgelegt und dazu meinen Stock geschwungen, außerdem kennen mich die örtlichen Taschendiebe, einige grüßen mich sogar und nennen mich Capitaine, sie denken wohl, dass ich irgendwie zu ihrer Unterwelt gehöre, und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus –, sowie von Prostituierten mit verwelkten Reizen, denn wenn sie noch reizvoll gewesen wären, hätten sie ihren Beruf in den brasseries à femmes ausgeübt, aber sie boten sich nur noch den Lumpensammlern, den Gaunern und den stinkenden Tabakhändlern an – doch wenn ein gutgekleideter Herr mit Gehstock und steifem Zylinder daherkam, konnten sie es wagen, ihn zu berühren oder gar am Arm zu packen, und dabei kamen sie einem so nahe, dass man diesen schrecklichen Geruch ihrer Armut wahrnahm, der sich mit ihrem Schweißgeruch mischte, und das wäre eine allzu unangenehme Erfahrung gewesen (davon wollte ich nachts nicht träumen), und so schwang ich, wenn ich eine von ihnen näherkommen sah, meinen Stock heftig im Kreise, wie um mir einen unzugänglichen Schutzraum zu schaffen, was sie sofort verstanden, denn sie waren es gewohnt, herumkommandiert zu werden, und vor einem Stock hatten sie Respekt.
Und schließlich trieben sich in dieser Menge auch die Spitzel der Polizei herum, die hier ihre mouchards oder Zuträger rekrutierten oder wertvolle Informationen über geplante Streiche aufschnappten, wenn jemand zu laut mit jemand anderem darüber sprach, weil er meinte, dass es im allgemeinen Lärm nicht zu hören sei. Aber man erkannte sie auf den ersten Blick an ihren übertrieben schurkischen Galgengesichtern. Kein echter Schurke sieht wie ein Schurke aus. Nur sie.
Heute fährt sogar die Straßenbahn über den Platz, und man fühlt sich nicht mehr im eigenen Hause, auch wenn man die Individuen, die einem nützlich sein können, schon noch findet, sofern man sie zu erkennen weiß – an eine Mauerecke gelehnt, auf der Schwelle des Café Maître-Albert oder in einer der Seitengassen. Aber schließlich ist Paris ohnehin nicht mehr das, was es einmal war, seit man an jeder Ecke diesen Bleistiftanspitzer von Eifelturm in der Ferne aufragen sieht.
Genug, ich bin kein sentimentaler Nostalgiker, und es gibt andere Orte, wo ich noch finden kann, was ich brauche. Gestern morgen brauchte ich Kalbfleisch und Käse, und dafür war die Place Maubert immer noch gut.
Als ich den Käse eingekauft hatte, kam ich bei meinem gewohnten Metzger vorbei und sah, dass er offen hatte.
»Seit wann haben Sie dienstags offen?« fragte ich, als ich eintrat.
»Aber heute ist doch Mittwoch, Capitaine«, antwortete er lachend. Verwirrt entschuldigte ich mich und murmelte etwas von nachlassendem Gedächtnis im Alter, worauf er erwiderte, ich sei doch noch jung und es könne jedem passieren, dass er sich im Datum vertut, wenn er zu früh aufgewacht ist. Ich wählte das Fleisch und bezahlte, ohne auch nur einen Moment um Rabatt zu feilschen – nur so gewinnt man die Achtung von Kaufleuten.
Mit der Frage im Kopf, welchen Tag wir hatten, kehrte ich nach Hause zurück. Ich wollte mir gerade den Bart abnehmen, wie ich es stets tue, wenn ich allein bin, und trat ins Schlafzimmer. Und erst in diesem Augenblick fiel mir etwas Ungewöhnliches auf: Am Kleiderhaken neben der Kommode hing ein schwarzes Gewand, eine unverkennbar priesterliche Soutane. Und als ich näher trat, sah ich, dass auf der Kommode eine kastanienbraune, fast blonde Perücke lag.
Ich fragte mich gerade, welchem Schmierenkomödianten ich in den letzten Tagen Gastfreundschaft gewährt hatte, als mir bewusst wurde, dass ja auch ich maskiert war, denn Bart und Haupthaar, die ich trug, waren nicht meine. War ich demnach einer, der sich mal als wohlhabender Gentleman und mal als Geistlicher kostümierte? Aber wieso hatte ich dann jede Erinnerung an meine zweite Natur ausgelöscht? Oder verkleidete ich mich aus irgendeinem Grund (vielleicht um einer Verhaftung zu entgehen) mit Bart und Perücke und ließ gleichzeitig jemanden bei mir wohnen, der sich als Priester verkleidete? Und wenn dieser falsche Priester (denn ein echter hätte sich keine Perücke aufgesetzt) bei mir wohnte, wo schlief er dann, es gab doch nur ein Bett in meiner Wohnung? Oder wohnte er gar nicht bei mir, sondern hatte sich gestern aus irgendeinem Grunde zu mir geflüchtet, um sich dann seiner Verkleidung zu entledigen und Gott weiß wohin zu gehen, um Gott weiß was zu tun?
Ich fühlte eine Leere im Kopf, als wäre da etwas, woran ich mich erinnern müsste, aber nicht konnte, wie wenn es zu den Erinnerungen eines anderen gehörte. Ja, ich glaube, von den Erinnerungen eines anderen zu sprechen ist hier der richtige Ausdruck. Im selben Augenblick hatte ich das Gefühl, ein anderer zu sein, der sich von außen beobachtete. Jemand beobachtete Simonini, der auf einmal das Gefühl hatte, nicht mehr genau zu wissen, wer er war.
Ruhe und Vernunft bewahren, sagte ich mir. Für einen, der unter dem Vorwand, Trödlerware zu verkaufen, falsche Dokumente herstellt und sich entschlossen hat, in einem der eher verrufenen Viertel von Paris zu leben, war es nicht unwahrscheinlich, dass er einem in unsaubere Machenschaften verstrickten Zeitgenossen Unterschlupf gewährt hat. Aber dass ich vergessen haben könnte, wem ich Unterschlupf gewährt habe, das klang mir nicht normal.
Unwillkürlich sah ich mich um, und plötzlich kam mir mein eigenes Haus wie ein fremder Ort vor, der womöglich noch andere Geheimnisse barg. Ich fing an, es zu erkunden, als wäre es das eines anderen. Wenn man aus der Küche tritt, liegt rechts das Schlafzimmer und links der Salon mit den gewohnten Möbeln. Ich zog die Schubladen am Schreibtisch auf, die mein Arbeitswerkzeug enthielten, die Federn, die Fläschchen mit den verschiedenen Tinten, noch weiße (oder vergilbte) Papierbögen in diversen Formaten und Alterungsstufen; auf den Regalen standen außer den Büchern die Schachteln, die meine Dokumente enthielten, sowie eine Art Tabernakel aus antikem Nussholz. Ich versuchte mich gerade zu erinnern, wozu es diente, als es unten klingelte. Ich ging hinunter, um einen Störenfried zu verjagen, aber da erblickte ich eine Alte, die mir bekannt vorkam. Sie sagte durchs Fenster: »Tissot schickt mich«, und so musste ich sie hereinlassen – wieso zum Teufel habe ich bloß ausgerechnet dieses Erkennungswort gewählt?
Sie kam herein, schlug eine Art Tuch auf, das sie an die Brust gedrückt hielt, und zeigte mir eine Handvoll Hostien.
»Der Abbé Dalla Piccola hat gesagt, Sie wären interessiert.«
Ich antwortete fast mechanisch »sicher« und fragte nach dem Preis. Zehn Francs pro Stück, sagte die Alte.
»Sie sind verrückt«, rief ich aus, dem Instinkt des Händlers folgend.
»Verrückt sind Sie, Sie mit Ihrem verrückten Wunsch, schwarze Messen zu feiern! Meinen Sie, es ist leicht, in drei Tagen in zwanzig Kirchen zu laufen, an der Kommunion teilzunehmen, nachdem man nüchtern zu bleiben versucht hat, sich hinzuknien mit den Händen vor dem Gesicht und zu versuchen, die Hostie aus dem Mund herauszubekommen, ohne dass sie nass wird, sie in einen Beutel zu tun, den ich an der Brust trage, und alles, ohne dass der Pfarrer oder die Nachbarn es merken? Um gar nicht von dem Sakrileg zu reden und von der Hölle, die mich erwartet. Also, wenn Sie die wollen, das sind zwanzig Stück, macht zweihundert Francs, oder ich gehe zu Abbé Boullan.16«
»Abbé Boullan ist tot, Sie sind offenbar schon länger nicht mehr Hostien besorgen gegangen«, antwortete ich wiederum fast mechanisch. Dann beschloss ich, angesichts meines verwirrten Kopfes lieber meinem Instinkt zu folgen, ohne lange zu überlegen.
»Na ja, lassen wir das. Also gut, ich nehme sie«, sagte ich und bezahlte. Und in dem Moment begriff ich, dass ich die geweihten Oblaten in das Tabernakel in meinem Studio legen musste, um auf interessierte Kunden zu warten. Ein Geschäft wie jedes andere.
Kurz, alles erschien mir normal und alltäglich. Und doch war mir, als spürte ich rings um mich den Geruch von etwas Unheilvollem, das sich mir entzog.
Ich ging wieder ins Studio hinauf und bemerkte, dass hinter einem Vorhang an der Rückwand eine Tür war. Schon beim Öffnen wusste ich, dass ich in einen Korridor treten würde, der so dunkel war, dass man eine Lampe brauchte. Der Korridor glich dem Kostümmagazin eines Theaters oder dem Hinterzimmer eines Trödlers am Carreau du Temple. An den Wänden hingen die verschiedensten Kostüme, für Bauern, Köhler, Laufburschen, Bettler, zwei weitere Soutanen, eine Soldatenuniform, und jeweils daneben die passenden Schuhe und Kopfbedeckungen. Ein Dutzend Köpfe aus Draht, ordentlich auf einem Wandbrett aufgereiht, trug ebenso viele Perücken. Weiter hinten stand eine pettineuse ähnlich dem Schminktisch in Schauspielergarderoben, übersät mit allerlei Döschen, Lippenstiften, schwarzen und blauen Schminkstiften, Hasenpfoten, Puderquasten, Pinseln und Bürsten.
Am Ende machte der Korridor einen Knick nach rechts, und dort gab es eine weitere Tür, die in ein Zimmer führte, das heller als meine Räume war, da das Licht aus einer Straße hereinfiel, die nicht die enge Impasse Maubert sein konnte. Und tatsächlich, als ich an eines der Fenster trat, sah ich, dass es die Rue Maître-Albert war.
Von diesem Zimmer führte eine schmale Treppe zur Straße, und das war schon alles. Es handelte sich um eine Ein-Zimmer-Wohnung, halb Studio, halb Schlafzimmer, mit einfachen dunklen Möbeln, ein Tisch, ein Betpult, ein Bett. Neben dem Ausgang befand sich eine kleine Küche und an der Treppe ein WC mit Waschbecken.
Es war offenbar das Pied-à-terre eines Geistlichen, mit dem ich eine gewisse Vertrautheit haben müsste, da unsere Wohnungen miteinander kommunizierten. Doch obwohl mich das alles an etwas zu erinnern schien, hatte ich tatsächlich den Eindruck, dieses Zimmer zum ersten Mal zu sehen.
Ich trat an den Tisch und erblickte einen Stoß Briefe mit ihren Umschlägen, alle an dieselbe Person adressiert: an den hochwürdigsten oder sehr hochwürdigen Monsieur l’Abbé Dalla Piccola. Neben den Briefen lagen einige Bögen, beschrieben mit einer feinen, verschnörkelten, fast weiblichen Handschrift, sehr verschieden von meiner. Entwürfe für Briefe ohne besondere Bedeutung, Danksagungen für ein Geschenk, Bestätigungen eines Treffens. Obenauf aber lag ein Bogen mit sehr fahrig hingekritzelten Zeilen, als hätte der Schreibende sich nur rasch etwas notiert, um darüber nachzudenken. Ich las mit einiger Mühe:
Alles scheint unwirklich. Als wäre ich ein anderer, der mich beobachtet. Aufschreiben, um sicher zu sein, dass es stimmt.
Heute ist der 22. März
Wo sind die Soutane und die Perücke?
Was habe ich gestern abend gemacht? Mir ist, als hätte ich Nebel im Kopf.
Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wohin die Tür hinten im Zimmer führt.
Ich habe einen Korridor entdeckt (noch nie gesehen?), der voller Kleider, Perücken, Pasten und Schminke ist, wie Schauspieler sie gebrauchen.
Am Haken hing eine gute Soutane, und auf einem Wandbord habe ich nicht nur eine gute Perücke gefunden, sondern auch falsche Wimpern. Mit einer fahlgelben Haut und leicht geröteten Wangen bin ich wieder der geworden, der ich zu sein glaube, bleich und leicht fiebrig. Asketisch. Das bin ich. Ich wer?
Ich weiß, dass ich der Abbé Dalla Piccola bin. Oder genauer: der, den die Welt als Abbé Dalla Piccola kennt. Aber offensichtlich bin ich es nicht, denn um wie er auszusehen, muss ich mich ja verkleiden.
Wohin führt dieser Korridor? Angst, bis ans Ende zu gehen.
Diese Notizen wiederlesen. Wenn geschrieben steht, was da geschrieben steht, ist es mir wirklich passiert. Den geschriebenen Dokumenten vertrauen.
Hat mir jemand einen Trank verabreicht? Boullan? Der wäre dazu fähig. Oder die Jesuiten? Oder die Freimaurer? Was habe ich mit denen zu tun?
Die Juden! Ja, die könnten es gewesen sein.
Ich fühle ich mich nicht mehr sicher hier. Jemand könnte nachts eingedrungen sein, sich meine Kleider geholt und, schlimmer noch, in meinen Papieren herumgewühlt haben. Womöglich geht jemand in Paris umher, der sich erfolgreich als Abbé Dalla Piccola ausgibt.
Ich muss nach Auteuil fliehen. Vielleicht weiß Diana weiter. Wer ist Diana?
Hier endeten die Notizen des Abbé Dalla Piccola, und ich fand es merkwürdig, dass er ein so vertrauliches Dokument nicht mitgenommen hatte, er musste sehr aufgeregt gewesen sein. Und damit endete auch, was ich über ihn erfahren konnte.
Ich ging zurück in die Wohnung an der Impasse Maubert und setzte mich an meinen Arbeitstisch. Auf welche Weise überkreuzte sich das Leben des Abbé Dalla Piccola mit meinem?
Natürlich konnte ich nicht umhin, die nächstliegende Hypothese aufzustellen: Abbé Dalla Piccola und ich sind ein und dieselbe Person, und wenn dem so wäre, würde sich alles erklären, die beiden miteinander verbundenen Wohnungen und sogar, dass ich als Dalla Piccola verkleidet in Simoninis Wohnung gekommen wäre, die Soutane und die Perücke abgelegt hätte und dann zu Bett gegangen wäre. Alles bis auf ein kleines Detail: Wenn Simonini identisch mit Dalla Piccola war, warum wusste ich dann nichts von Dalla Piccola und fühlte mich nicht als Dalla Piccola, der nichts von Simonini wusste? Ja, um Dalla Piccolas Gedanken und Gefühle kennenzulernen, hatte ich erst seine Notizen lesen müssen! Und wenn ich identisch mit Dalla Piccola wäre, hätte ich in Auteuil sein müssen, in jenem Hause, von dem er alles zu wissen schien und ich (Simonini) überhaupt nichts. Und wer war Diana?
Es sei denn, ich wäre manchmal Simonini, der Dalla Piccola vergessen hat, und manchmal Dalla Piccola, der Simonini vergessen hat. Das wäre nichts Neues. Wer war es, der mit mir über Fälle von Persönlichkeitsspaltung gesprochen hatte? Ist das nicht die Krankheit, an der Diana leidet? Aber wer ist Diana?
Ich nahm mir vor, methodisch vorzugehen. Ich wusste, dass ich ein Notizbuch führte, in das ich meine Termine eintrug, und da fand ich folgende Einträge:
21. März, Messe
22. März, Taxil15
23. März, Guillot wg. Testament Bonnefoy
24. März, zu Drumont?17
Wieso ich am 21. März zur Messe gehen sollte, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich gläubig bin. Wer gläubig ist, glaubt an etwas. Glaube ich an etwas? Mir scheint nein. Also bin ich ungläubig. Das ist Logik. Aber lassen wir das. Manchmal geht man aus vielen Gründen zur Messe und der Glaube spielt gar keine Rolle.
Sicherer war, dass der Tag, den ich für Dienstag gehalten hatte, Mittwoch, der 23. März war, und tatsächlich ist da ja dieser Guillot gekommen, um sich von mir das Testament Bonnefoy machen zu lassen. Es war der 23., und ich hatte gedacht, es sei der 22. gewesen. Was war am 22. März geschehen? Wer oder was war Taxil?
Dass ich dann am heutigen Donnerstag einen Drumont aufsuchen sollte, kam jetzt nicht mehr in Frage. Wie kann ich mich mit jemandem treffen, wenn ich nicht einmal mehr weiß, wer ich selber bin? Ich muss mich irgendwo verstecken, bis ich Klarheit darüber gewonnen habe. Drumont… Ich redete mir ein, sehr gut zu wissen, wer das sei, aber wenn ich ihn mir vorzustellen versuchte, war mein Kopf wie von zuviel Wein benebelt.
Stellen wir ein paar Hypothesen auf, sagte ich mir. Erstens: Dalla Piccola ist ein anderer, der aus mysteriösen Gründen oft in meine Wohnung kommt, die durch einen mehr oder minder geheimen Korridor mit der seinen verbunden ist. Am Abend des 21. März ist er zu mir in die Impasse Maubert gekommen, hat seine Soutane dort abgelegt (aber warum?) und ist dann zum Schlafen in seine Wohnung gegangen, wo er am nächsten Morgen ohne Gedächtnis aufgewacht ist. So wie ich zwei Tage später ohne Gedächtnis aufgewacht bin. Aber was hätte ich dann am 22. März so Einschneidendes erlebt oder getan, dass ich am Morgen des 23. ohne Gedächtnis aufgewacht bin? Und wieso sollte Dalla Piccola sich bei mir ausgezogen haben, um dann ohne Soutane in seine Wohnung zu gehen – und zu welcher Uhrzeit? Mich schauderte bei dem Gedanken, dass er die erste Hälfte der Nacht in meinem Bett verbracht haben könnte… Mein Gott, es stimmt, dass die Frauen mir Abscheu einflößen, aber mit einem Priester wäre es noch schlimmer. Ich bin keusch, aber nicht pervers…
Oder aber, zweitens, Dalla Piccola und ich sind ein und dieselbe Person. Da ich die Soutane in meiner Wohnung gefunden habe, hätte ich nach der Messe (am 21.) in die Impasse Maubert gekommen sein können, gekleidet als Dalla Piccola (wenn ich zu einer Messe gehen musste, war es glaubwürdiger, als Abbé hinzugehen), um mich dann der Soutane und der Perücke zu entledigen und später zum Schlafen in die Wohnung des Abbé zu gehen (und zu vergessen, dass ich die Soutane bei Simonini gelassen hatte). Am nächsten Morgen, also am Dienstag, dem 22., als Dalla Piccola aufgewacht, hätte ich nicht nur mein Gedächtnis verloren, sondern auch die Soutane nicht zu Füßen des Bettes vorgefunden. Als Dalla Piccola, ohne Gedächtnis, hätte ich eine Ersatzsoutane im Korridor gefunden und alle Zeit gehabt, am selben Tage nach Auteuil zu fliehen, um mich jedoch gegen Ende des Tages eines anderen zu besinnen, wieder Mut zu fassen und am späten Abend nach Paris zurückzukehren, in die Wohnung an der Impasse Maubert zu gehen, dort die Soutane an den Haken im Schlafzimmer zu hängen und am Mittwochmorgen, erneut ohne Gedächtnis, aber als Simonini aufzuwachen, in der Meinung, es sei noch Dienstag. Infolgedessen, sagte ich mir, hatte Dalla Piccola den 22. März vergessen und einen ganzen Tag aus seinem Gedächtnis gelöscht, um am 23. als ein gedächtnisloser Simonini aufzuwachen. Nichts Außergewöhnliches nach dem, was ich von diesem Doktor an der Klinik in Vincennes – wie hieß er noch gleich? – erfahren hatte.
Bis auf ein kleines Problem. Ich las noch einmal meine Notizen: Wenn es so gewesen wäre, hätte Simonini am 23. morgens in seinem Schlafzimmer nicht eine, sondern zwei Soutanen vorfinden müssen: die, die er in der Nacht des 21., und die, die er in der Nacht des 22. dort gelassen hatte. Aber da war nur eine.
Doch nein, was bin ich für ein Dummkopf! Dalla Piccola war am Abend des 22. aus Auteuil in die Rue Maître-Albert zurückgekommen, hatte dort seine Soutane abgelegt, war dann in die Wohnung an der Impasse Maubert hinübergegangen, um dort zu schlafen, war am nächsten Morgen (dem 23.) als Simonini aufgewacht und hatte nur eine Soutane am Haken vorgefunden. Zwar hätte ich, wenn es so gewesen wäre, als ich an jenem Morgen in Dalla Piccolas Wohnung eingedrungen war, dort die Soutane vorfinden müssen, die er am Abend des 22. abgelegt hatte. Aber er hätte sie ja auch wieder in den Korridor zurückbringen können, in dem er sie gefunden hatte. Ich brauchte bloß nachzusehen.
So ging ich mit der Lampe und nicht ohne ein bisschen zu zittern erneut in den Korridor. Wenn Dalla Piccola nicht ich gewesen wäre, sagte ich mir, dann hätte ich sehen können, wie er am anderen Ende des Korridors auftauchte, womöglich ebenfalls mit einer Lampe in der Hand… Zum Glück ist das nicht geschehen. Und am Ende des Korridors fand ich die Soutane am Haken hängen.
Und doch, und doch… Wenn Dalla Piccola aus Auteuil zurückgekehrt wäre und, nachdem er die Soutane an den Haken gehängt hätte, durch den ganzen Korridor bis zu meiner Wohnung gegangen wäre und sich ohne zu zögern in mein Bett gelegt hätte, dann doch wohl deshalb, weil er sich beim Nachhausekommen daran erinnert hatte, dass er ich war, und wusste, dass er bei mir ebenso gut schlafen konnte wie bei sich, da wir ja ein und dieselbe Person waren. Also war Dalla Piccola schlafen gegangen im Bewusstsein, Simonini zu sein, während Simonini am nächsten Morgen erwachte, ohne zu wissen, dass er Dalla Piccola war. Mit anderen Worten, erst verliert Dalla Piccola sein Gedächtnis, dann findet er es wieder, schläft darüber ein und gibt seinen Gedächtnisverlust an Simonini weiter.
Gedächtnisverlust… Dieses Wort, das einen Ausfall des Erinnerungsvermögens bezeichnet, hat mir so etwas wie eine Bresche im Nebel der vergessenen Zeit geöffnet. Über Fälle von Gedächtnisverlust sprach ich beim Essen im Magny, vor mehr als zehn Jahren. Dort war es, wo ich mit Bourru und Burot darüber sprach, mit Du Maurier und mit diesem österreichischen Doktor.
3. Chez Magny
25. März 1897, frühmorgens
Chez Magny… Ich weiß, dass ich ein Liebhaber der guten Küche bin, und nach dem, was ich von jenem Restaurant in der Rue de la Contrescarpe-Dauphine in Erinnerung habe, zahlte man dort nicht mehr als zehn Francs pro Kopf, und die Qualität entsprach dem Preis. Aber man kann ja nicht jeden Tag ins Foyot gehen. Früher gingen viele ins Magny, um von weitem berühmte Schriftsteller wie Gautier oder Flaubert zu bewundern, und noch früher jenen schwindsüchtigen polnischen Pianisten, der von einer Entarteten ausgehalten wurde, die in Hosen herumlief. Ich hatte eines Abends mal reingeschaut und war sofort wieder gegangen. Künstler sind unerträglich, auch von weitem, sie blicken dauernd umher, um zu sehen, ob man sie erkennt.
Dann hatten die »Großen« das Magny verlassen und waren ins Brébant-Vachette am Boulevard Poissonnière umgezogen, wo man besser aß und mehr zahlte, aber carmina dant panem, wie man sieht. Und als das Magny sich sozusagen purifiziert hatte, bin ich seit Anfang der achtziger Jahre öfter hingegangen.
Ich hatte gesehen, dass Wissenschaftler dort aßen, zum Beispiel berühmte Chemiker wie Berthelot und viele Ärzte von der Salpêtrière. Das Hospital liegt nicht gerade um die Ecke, aber vielleicht fanden es diese Mediziner schön, einen kurzen Spaziergang durch das Quartier Latin zu machen, anstatt in den riesigen gargottes zu essen, wohin die Angehörigen der Kranken gehen. Unterhaltungen von Ärzten sind interessant, weil sie immer die Schwächen eines anderen betreffen, und im Magny redeten alle sehr laut, um den Lärm zu übertönen, so dass ein gespitztes Ohr immer etwas Interessantes zu hören bekam. Lauschen heißt nicht, etwas Bestimmtes erfahren zu wollen. Alles, auch das scheinbar Belanglose, kann sich eines Tages als nützlich erweisen. Worauf es ankommt, ist, etwas zu wissen, von dem die anderen nicht wissen, dass man es weiß.
Während die Literaten und Künstler immer an großen Tischen zusammensaßen, speisten die Wissenschaftler lieber allein, wie ich. Doch wenn man ein paarmal am Nachbartisch gesessen hat, macht man allmählich Bekanntschaft. Meine erste Bekanntschaft war Dr. Du Maurier, ein hässliches Individuum, bei dem man sich fragte, wie ein Psychiater (das war er) mit einem so abstoßenden Gesicht seinen Patienten Vertrauen einflößen konnte. Es war das Neid und Missgunst ausdrückende Gesicht eines Mannes, der sich als ewigen Zweiten sah. Tatsächlich leitete er eine kleine Nervenklinik in Vincennes, aber er wusste nur zu gut, dass sein Institut nie den Ruhm und die Einnahmen der Klinik des berühmteren Dr. Blanche genießen würde – auch wenn er sarkastisch knurrte, vor dreißig Jahren sei dort ein gewisser Nerval eingeliefert worden (seines Erachtens ein bedeutender Dichter), den die Pflege in der hochberühmten Klinik von Blanche zum Selbstmord getrieben habe.