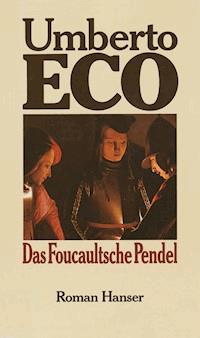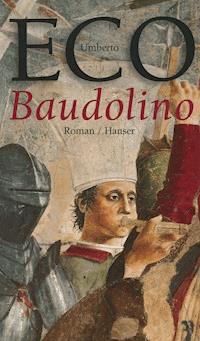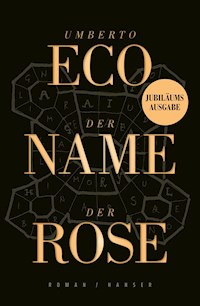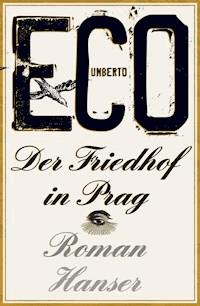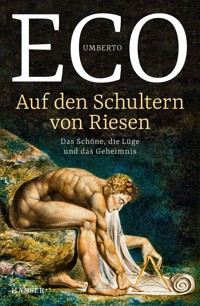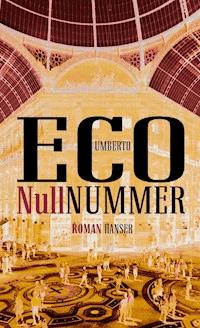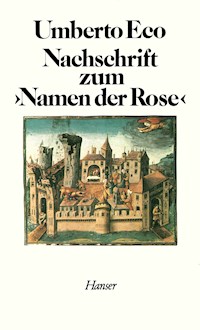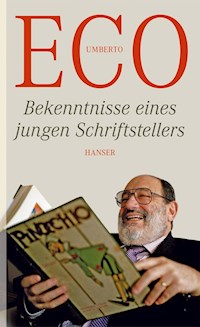Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1643, und in Europa tobt der Dreißigjährige Krieg. Wider Willen wird Roberto de La Grive zum Entdeckungsreisenden auf der Suche nach dem Nullmeridian, dem zur exakten Navigation notwendigen Fixpunkt der Erde. Ein Orkan spült ihn auf ein verlassen vor den Fidschii-Inseln treibendes Forschungsschiff. Auf diesem schwimmenden Naturalienkabinett findet er einen skurrilen Schicksalsgenossen und viel Zeit, sich die eigene unheilvolle Liebes-, Lebens- und Doppelgängergeschichte zu phantasieren. Historisches Panorama, Liebesgeschichte und Abenteuerroman - Eco erfindet den gewaltigen Kosmos eines ganzen Jahrhunderts neu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 824
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
UMBERTO ECO
DIE INSEL
DES VORIGEN
TAGES
Roman
Aus dem Italienischen
von Burkhart Kroeber
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel L'isola del giorno prima bei Bompiani in Mailand.
ISBN 3-446-23908-1
© R.C.S. Libri & Grandi
Opere S.p.A. Mailand 1994
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 1995/2011
Satz: Reinhard Amann, Aichstetten
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
INHALT
1. Daphne 7
2. Von denen Begebenheiten im Monferrat 26
3. Das Serail der Überraschungen 42
4. Demonstrierte Befestigung 51
5. Das Labyrinth der Welt 58
6. Große Kunst des Lichts und der Schatten 69
7. Pavane Lachryme 76
8. Die kuriose Lehre der Schöngeister jener Zeit 83
9. Das Aristotelische Fernrohr 92
10. Reformierte Land- und Gewässerkunde 104
11. Die Kunst der Weltklugheit 114
12. Die Leidenschaften der Seele 120
13. Die Karte der Zärtlichkeit 132
14. Traktat der Wissenschaft von den Waffen 137
15. Horologia oscillatoria 152
16. Diskurs über das sympathetische Pulver 158
17. Die begehrte Wissenschaft von den Längengraden 182
18. Unerhörte Kuriositäten 202
19. Das Narrenschiff 208
20. Scharfsinn und Kunst der Erfindung 231
21. Heilige Theorie der Erde 244
22. Die Flammenfarbene Taube 272
23. Allerley kunstreiche Maschinen 282
24. Dialog über die hauptsächlichsten Weltsysteme 298
25. Technica Curiosa 326
26. Emblematisches Lust-Cabinet 342
27. Die Geheimnisse des Meeres-Flusses 358
28. Vom Ursprung der Romane 366
29. Die Seele Ferrantes 371
30. Von der Liebeskrankheit oder Erotischen Melancholie 387
31. Brevier der Politiker 394
32. Der Garten der Lüste 406
33. Unterirdische Welten 410
34. Monolog über die Vielzahl der Welten 421
35. Trost der Seefahrenden 434
36. Ars moriendi 446
37. Paradoxe Exerzitien über das Denken der Steine 465
38. Über Natur und Ort der Hölle 479
39. Ekstatische Himmelsreise 492
40. Kolophon 501
Is the Pacifique Sea my Home?
(John Donne, Hymne to God my God)
Stolto! a cui parlo? Misero! Che tento?
Racconto il dolor mio
a l'insensata riva
a la mutola selce, al sordo vento...
Ahi, ch'altro non risponde
che il mormorar de l'onde!*
(Giambattista Marino, »Eco«, La Lira, 3, XIX)
*Tor! Zu wem spreche ich? Elender! Was versuche ich?
Ich erzähle mein Leid
der gefühllosen Küste
dem stummen Stein, dem tauben Wind ...
Ach, und es antwortet nichts
als das Murmeln der Wellen!
1
DAPHNE
Und doch erfüllt mich meine Demütigung mit Stolz, und da zu solchem Privilegio verdammt, erfreue ich mich nun gleichsam einer verabscheuten Rettung: Ich glaube, ich bin seit Menschengedenken das einzige Wesen unsrer Gattung, das schiffbrüchig ward geworfen auf ein verlassenes Schiff.
So, in unverbesserlichem Manierismus, Roberto de La Grive, vermutlich im Juli oder August 1643.
Seit wie vielen Tagen war er auf den Wellen getrieben, an ein Brett gebunden, tagsüber mit dem Gesicht nach unten, um nicht von der Sonne geblendet zu werden, den Hals unnatürlich verrenkt, um kein Wasser in den Mund zu bekommen, verätzt von der Salzlauge, sicherlich fiebernd? Die Briefe lassen es nicht erkennen, sie lassen an eine Ewigkeit denken, aber es kann sich um höchstens zwei Tage gehandelt haben, sonst hätte er nicht überlebt unter der Peitsche des sengenden Phöbus (wie er bilderreich klagt) – er, der sich als so kränklich beschreibt, ein Nachttier aus angeborener Schwäche.
Er war nicht imstande, die Zeit zu messen, aber ich glaube, das Meer hatte sich nach dem heftigen Sturm, der ihn von Bord der Amarilli gefegt hatte, recht bald wieder beruhigt, und das als Rettungsfloß dienende Brett, das ihm der Matrose maßgeschneidert hatte, dürfte ihn, von den Passatwinden über ein heiteres Meer getrieben in einer Jahreszeit, in der südlich des Äquators ein äußerst milder Winter herrscht, nicht allzu weit gebracht haben, ehe die Strömung es in die Bucht trieb.
Es war Nacht, er war eingenickt und hatte nicht bemerkt, dass er auf das Schiff zutrieb, bis das Brett mit einem leichten Erzittern an den Bug der Daphne gestoßen war.
Doch als er dann im Licht des Vollmonds erkannte, dass er unter einem Bugspriet dümpelte, direkt unter einem Vorderkastell, von welchem unweit der Ankerkette eine Strickleiter hing (die Jakobsleiter!, hätte Pater Caspar gesagt), waren alle seine Lebensgeister sofort wieder da. Es muss die Kraft der Verzweiflung gewesen sein: Er überlegte, ob er noch Atem genug hatte, um zu schreien (aber seine Kehle war ein einziges trocknes Brennen) oder sich von den Stricken zu befreien, die ihn mit bläulichen Striemen gezeichnet hatten, und den Aufstieg zu versuchen. Ich glaube, in solchen Momenten kann ein Sterbender zu einem Herkules werden, der die Schlangen in der Wiege erwürgt. Robertos Aufzeichnung des Geschehens ist unklar, aber da er am Ende auf dem Vorschiff war, muss er sich irgendwie die Leiter hinaufgequält haben. Vielleicht hatte er sie Stück für Stück erklommen, nach jeder Sprosse erschöpft innehaltend, hatte sich dann über die Bordwand fallen lassen, war über die Taue gekrochen, hatte die Tür zum Vorderkastell offen gefunden ... Und der Instinkt muss ihn im Dunkeln an jenes Fass geführt haben, zu dessen Rand er sich dann hinaufzog, um eine Tasse an einer kleinen Kette zu finden. Er hatte getrunken, so viel er konnte, und war gesättigt zu Boden gesunken, vielleicht gesättigt im vollen Wortsinne, denn jenes Wasser musste so viele ertrunkene Insekten enthalten haben, dass es ihm Trank und Speise in einem lieferte.
Danach muss er vierundzwanzig Stunden geschlafen haben, denn es war Nacht, als er wieder erwachte, doch nun wie neugeboren. Es war also wieder Nacht und nicht noch.
Er aber dachte gewiss, dass es noch dieselbe Nacht war, andernfalls hätte ihn, wenn inzwischen ein ganzer Tag vergangen wäre, doch irgendwer finden müssen. Das Mondlicht, das vom Deck her eindrang, beleuchtete den Raum so hell, dass er jetzt klar zu erkennen war als die Kombüse des Schiffs mit ihrem über dem Herd aufgehängten Kessel.
Es gab zwei Türen, eine zum Bugspriet und eine nach hinten zum Deck. Roberto trat an die zweite und erblickte auf dem fast taghell erleuchteten Deck die sauber zusammengerollten Taue, die Ankerwinde, die Masten mit den eingerollten Segeln, einige Kanonen an den Geschützpforten und die Silhouette des Achterkastells. Er rief etwas, aber keine lebende Seele antwortete. Er blickte über die Bordkante und sah an Steuerbord, etwa eine Meile entfernt, das Profil einer Insel mit Palmen am Ufer, die sich im Wind bewegten.
Die Küste bildete eine Bucht, ein Halbrund zwischen zwei kleinen Vorgebirgen, gesäumt von einem weißen Sandstrand, der in der bleichen Dunkelheit glänzte, aber wie jeder Schiffbrüchige hätte Roberto nicht sagen können, ob es eine Insel oder Festland war.
Er wankte zur anderen Bordwand hinüber und sah – aber diesmal weit entfernt, fast am Horizont – die Gipfel eines anderen Profils, das ebenfalls von zwei Vorgebirgen begrenzt war. Sonst überall Meer, so dass man den Eindruck gewinnen konnte, das Schiff sei auf einer Reede vor Anker gegangen, zu der es durch eine breite Meerenge gelangt war, welche die beiden Küsten trennte. Roberto kam zu dem Schluss, dass es sich, wenn nicht um zwei Inseln, sicher um eine Insel vor einer größeren Landmasse handelte. Ich glaube nicht, dass er noch andere Hypothesen erwog, da er noch nie von Buchten gehört hatte, die so groß waren, dass man in ihnen den Eindruck gewinnen konnte, sich zwischen zwei Zwillingsfestländern zu befinden. So hatte er, da er nichts von riesigen Kontinenten wusste, ins Schwarze getroffen.
Es war keine schlechte Lage für einen Schiffbrüchigen: die Füße auf festem Boden und Land in Reichweite. Aber Roberto konnte nicht schwimmen, er sollte bald feststellen, dass es auf dem Schiff kein Beiboot gab, und das Brett, auf dem er gekommen war, hatte die Strömung längst fortgetrieben. Daher mischte sich in seine Erleichterung, dass er dem Tod entgangen war, die Bestürzung über die dreifache Einsamkeit: des Meeres, der nahen Insel und des Schiffes. »He, niemand an Bord?«, muss er versucht haben in allen ihm bekannten Sprachen zu rufen, wobei ihm aufging, wie schwach er war. Stille. Als ob an Bord alles tot wäre, schrieb er. Und nie hatte er sich – er, der so großzügig mit Gleichnissen war – so unverblümt ausgedrückt. Oder quasi, aber dieses Quasi ist es, wovon ich sprechen möchte, und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Dabei habe ich ja schon angefangen. Ein Mann treibt entkräftet auf dem Ozean, und die nachsichtigen Wellen werfen ihn auf ein Schiff, das verlassen scheint. Verlassen, als wäre die Mannschaft erst kürzlich von Bord gegangen, denn als Roberto sich in die Kombüse zurückschleppt, findet er eine Lampe und Zündzeug, als hätte sie der Koch dort bereitgestellt, ehe er schlafen ging. Aber die beiden Kojen, die sich eine über der anderen neben dem Kamin befinden, sind leer. Roberto zündet die Lampe an, schaut sich um und entdeckt große Mengen von Lebensmitteln: getrockneten Fisch und Zwieback mit nur wenig Schimmel, der sich leicht abschaben lässt. Der Fisch sehr salzig, aber Wasser gibt es nach Belieben.
Er muss bald wieder zu Kräften gekommen sein, jedenfalls war er gut bei Kräften, als er darüber schrieb, denn er verbreitet sich – hochliterarisch – über die Wonnen seines Festmahls, nie habe Olymp dergleichen bei seinen Gelagen genossen, süße Ambrosia für mich aus den Tiefen des Meeres, das Ungeheuer, des Tod mir nun Leben geworden ... Dies aber schrieb Roberto an die Dame seines Herzens:
Sonne meines Schattens, Licht meiner Nächte,
warum hat der Himmel mich nicht zermalmt in jenem Sturme, den er so wütend entfacht? Wozu dem gefräßigen Meere diesen meinen Leib entreißen, wenn meine Seele dann in dieser geizigen und dazu trostlosen Einsamkeit auf grässliche Weise Schiffbruch erleiden sollte?
Vielleicht, wenn der barmherzige Himmel mir keine Hilfe sendet, werdet Ihr nie diesen Brief lesen, den itzo ich schreibe, und verbrannt wie eine Fackel vom Licht dieser Meere werde ich mich vor Euren Augen verdunkeln, denn eine Selene, die ach! Zu viel vom Licht ihrer Sonne genossen, während sie ihre Reise hinter der letzten Krümmung unseres Planeten vollendet, beraubt der Hilfe durch die Strahlen des sie beherrschenden Astrums, verdünnt sich erst zum Bildnis der Sichel, die den Lebensfaden abschneidet, und löst sich alsdann, eine matter und matter werdende Leuchte, zur Gänze in jenem großen wächsernen Himmelsschild auf, in dem die ingeniöse Natur heroische Devisen und rätselhafte Embleme ihrer Geheimnisse bildet. Eures Blickes beraubt, bin ich blind, da Ihr mich nicht sehet, und stumm, da Ihr nicht zu mir redet, und ohne Gedächtnis, da Ihr nicht meiner gedenket.
Und ich lebe nur, brennende Trübnis und düstere Flamme, als vages Phantasma, welches mein Geist, immer gleich gestaltend in diesem widrigen Streit der Gegensätze, so gern dem Euren darbieten würde. Mein Leben rettend in dieser hölzernen Burg, in dieser schwimmenden Festung, in diesem Gefängnis des Meeres, das vor dem Meer mich bewahrt, bestraft von des Himmels Gnade, verborgen in diesem tiefuntersten Sarkophage, der offen für alle Sonnen, in diesem unterirdischen Luftschiff in diesem unüberwindlichen Kerker, der mich allseits zur Flucht ermuntert, verliere ich langsam die Hoffnung, Euch eines Tages wiederzusehen.
Signora, ich schreibe Euch, um Euch, als unwertes Zeichen der Huldigung, die welke Rose meiner Trostlosigkeit anzubieten. Und doch erfüllt mich meine Demütigung mit Stolz, und da zu solchem Privilegio verdammt, erfreue ich mich nun gleichsam einer verabscheuten Rettung: Ich glaube, ich bin seit Menschengedenken das einzige Wesen unsrer Gattung, das schiffbrüchig ward geworfen auf ein verlassenes Schiff.
Aber ist das überhaupt möglich? Nach dem Datum auf diesem ersten Brief zu schließen, müsste Roberto sich gleich nach seiner Ankunft ans Schreiben gemacht haben, kaum dass er Papier und Feder in der Kapitänskajüte gefunden hatte. Dabei muss es doch einige Zeit gedauert haben, bis er wieder zu Kräften kam, denn er war geschwächt wie ein verwundetes Tier. Oder ist es vielleicht eine kleine Liebeslist: Zuerst versucht er sich klarzumachen, wohin er geraten ist, dann schreibt er und tut so, als wäre es vorher. Warum aber, wo er doch weiß, vermutet, fürchtet, dass seine Briefe nie ankommen werden, und sie nur schreibt, um sich zu quälen (um sich qualvoll zu trösten, würde er sagen, aber wir wollen versuchen, uns nicht von ihm die Hand führen zu lassen)? Es ist schon schwierig genug, die Taten und Gefühle eines Menschen zu rekonstruieren, der zwar sicher vor echter Liebe brennt, aber bei dem man nie weiß, ob er das ausdrückt, was er empfindet, oder das, was die Regeln des Liebesdiskurses ihm vorschreiben – doch was wissen wir schon vom Unterschied zwischen empfundener und ausgedrückter Leidenschaft und welche der beiden vorausgeht? Also sagen wir, er schrieb für sich, es war nicht Literatur, er saß wirklich da und schrieb wie ein Jüngling, der einem unmöglichen Traum nachhängt, die Seite mit Tränen tränkend, aber nicht wegen der Abwesenheit der geliebten Person, die schon als Anwesende reines Bild für ihn war, sondern aus Gerührtheit über sich selbst, verliebt in die Liebe ...
Das könnte schon einen Roman ergeben, aber noch einmal, wo beginnen?
Ich denke, er hat diesen ersten Brief erst später geschrieben und sich zunächst umgesehen – und was er dabei entdeckt hat, wird er in späteren Briefen schildern. Aber auch hier wieder, wie übersetzt man das Tagebuch eines Menschen, der durch treffende Metaphern sichtbar machen will, was er schlecht sieht, während er nachts mit leidenden Augen umhergeht?
Roberto wird sagen, dass er sein Augenleiden seit jenem Tag hatte, als er während der Belagerung von Casale den Streifschuss an der Schläfe abbekam. Und das kann auch so gewesen sein, aber an anderer Stelle legt er nahe, dass seine Augen wegen der Pest immer schlechter geworden seien. Er war sicherlich von zarter Konstitution und auch etwas hypochondrisch, wenngleich mit Verstand; die Hälfte seiner Lichtscheu muss an schwarzer Galle gelegen haben und die andere Hälfte an einer Form von Reizung, die womöglich durch die Präparate des Herrn d'Igby noch verschärft worden war.
Es scheint gesichert, dass er die Reise auf der Amarilli nur unter Deck zurückgelegt hatte, wenn man bedenkt, dass die Rolle des Lichtscheuen, wenn nicht ohnehin seine Natur, so doch zumindest diejenige war, die er spielen musste, um die Machenschaften im Kielraum verfolgen zu können. Mehrere Monate lang im Dunkeln oder im Licht einer Kerze – und dann die Zeit auf dem Brett, geblendet von der fast äquatorialen Tropensonne. Als er auf der Daphne landet, muss er, ob krank oder nicht, das Licht gehasst haben, er verbringt die erste Nacht in der Kombüse, erholt sich ein bisschen und nimmt in der zweiten Nacht eine erste Inspektion der Örtlichkeit vor, danach geht alles Weitere fast wie von selbst. Das Tageslicht macht ihm Angst, nicht nur seine Augen ertragen es nicht, auch die Verbrennungen, die er auf dem Rücken gehabt haben muss, machen es ihm unerträglich, und so verkriecht er sich im Dunkeln. Der schöne Mond, den er in jenen Nächten beschreibt, gibt ihm wieder Mut, tagsüber ist der Himmel wie überall, nachts entdeckt er an ihm neue Sternbilder (heroische Devisen und rätselhafte Embleme), und es ist wie im Theater: Roberto gelangt zu der Überzeugung, dass dies für lange Zeit sein Leben sein wird, vielleicht bis zum Tod, er schafft sich schreibend seine Signora neu, um sie nicht zu verlieren, und er weiß, dass er nicht viel mehr verloren hat, als was er schon hatte.
So flüchtet er sich in seine Nachtwachen wie in einen Mutterschoß und beschließt, nun erst recht die Sonne zu meiden. Vielleicht hatte er von jenen Auferstandenen aus Ungarn, Livland oder der Walachei gelesen, die von Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung ruhelos umgehen, um sich beim ersten Hahnenschrei wieder in ihre Gräber zu legen – eine Rolle, die ihn reizen könnte ...
Roberto muss seine Inspektion des Schiffes in der zweiten Nacht begonnen haben. Er hatte nun lange genug gerufen, um sicher zu sein, dass sich außer ihm niemand an Bord befand. Aber er hätte, und das fürchtete er, Tote finden können, irgendwelche Zeichen, die das Fehlen von Lebenden zu erklären vermochten. So bewegte er sich mit Vorsicht voran, und aus den Briefen geht nicht recht hervor, in welche Richtung, denn er benennt das Schiff, seine Teile und die Gegenstände an Bord nur ungenau. Einige sind ihm vertraut, denn er hat ihre Namen von den Matrosen der Amarilli gehört, andere sind ihm unbekannt, und er beschreibt sie so, wie sie ihm erscheinen. Aber auch die bekannten Dinge muss er vom einen französisch, vom anderen holländisch, vom dritten englisch benannt gehört haben – was dafür spricht, dass die Besatzung der Amarilli aus Abenteurern der sieben Meere zusammengewürfelt war. So nennt er den Höhenmesser gelegentlich staffe, wie er es wohl von Doktor Byrd gehört hatte; man versteht nur mit Mühe, wie er sich einmal auf dem Achterkastell oder dem hinteren Aufbau befinden kann und ein andermal auf dem hinteren gagliardo, was von französisch galliard kommt und dasselbe heißt; die Geschützpforten nennt er sabordi, von französisch sabords, was ich ihm gern erlauben will, denn es erinnert mich an die Seefahrergeschichten, die ich als Kind gelesen habe; er spricht von einem parrocchetto, was für uns ein Segel am Fockmast, also ein Vormarssegel wäre, aber da für die Franzosen perruche das Besansegel ist, das sich hinten am Besanmast befindet, weiß man nicht genau, was er meint, wenn er schreibt, er sei »unter der parrucchetta« gewesen. Ganz zu schweigen, dass er den Besanmast zuweilen nach Art der Franzosen artimone nennt, womit sich die Frage erhebt, was er dann meinen mag, wenn er mizzana schreibt, was für die Franzosen der Fockmast ist (nicht aber für die Engländer, deren mizzenmast, genau wie unsere mezzana, eben der Besanmast ist). Und wenn er von einer gronda spricht, meint er sicherlich keine Dachtraufe, sondern wahrscheinlich das, was die Seeleute ein »Speigatt« nennen, das heißt ein Abflussloch in der Bordwand. Deshalb treffe ich hiermit eine Entscheidung: Ich werde herauszufinden versuchen, was er gemeint hat, und werde dann die uns geläufigsten Ausdrücke nehmen. Und wenn ich mich dabei einmal irre, ist es nicht schlimm: An der Geschichte ändert sich nichts.
Nach diesen Prämissen halten wir also fest, dass Roberto in jener zweiten Nacht, nachdem er einen Vorrat an Lebensmitteln in der Kombüse gefunden hatte, sich im Mondlicht an die Überquerung des Mitteldecks machte.
An den Bug und die nach oben gewölbten Seiten denkend, die er undeutlich in der vorigen Nacht gesehen hatte, das schlanke Deck, die Form des Achterkastells und das schmale Rundheck mit denen der Amarilli vergleichend, kam Roberto zu dem Schluss, dass auch die Daphne eine holländische Fleute oder Fluite war, auch Fluyt, Flûte, Fliete, Flyboat oder Fliebote genannt, also eines jener Handelsschiffe mittlerer Größe, die für gewöhnlich mit etwa zehn Kanonen bestückt waren, zur Entlastung des Gewissens im Falle eines Piratenangriffs, und die mit einer zwölfköpfigen Besatzung auskamen, aber dazu noch viele Passagiere aufnehmen konnten, wenn man auf die (ohnehin kargen) Bequemlichkeiten verzichtete und die Schlafstätten so eng zusammenpferchte, dass es kein Durchkommen mehr gab – und dann großes Sterben durch Miasmen aller Art, wenn nicht genügend Eimer da waren ... Eine Fleute also, aber größer als die Amarilli und mit einem Deck, das auf ein einziges Gitterwerk reduziert schien, als wäre der Kapitän entschlossen gewesen, bei jeder etwas größeren Sturzwelle Wasser zu fassen.
Jedenfalls war es ein Vorteil, dass die Daphne eine Fleute war, denn so konnte Roberto sich mit einer gewissen Ortskenntnis auf ihr bewegen. Zum Beispiel wusste er nun, dass auf dem Oberdeck die große Schaluppe hätte stehen müssen, in der die ganze Mannschaft Platz fand, und die Tatsache, dass sie nicht da war, ließ darauf schließen, dass die Mannschaft anderswo war. Was Roberto jedoch nicht beruhigte, denn eine Mannschaft überlässt ihr Schiff niemals unbewacht der Gewalt des Meeres, auch wenn es mit eingerollten Segeln in einer ruhigen Bucht vor Anker liegt.
An jenem Abend war er gleich zum Achterkastell hinaufgestiegen und hatte die Tür mit einem gewissen Zögern geöffnet, als müsse er jemanden um Erlaubnis bitten ... Neben der Ruderpinne befand sich der Kompass, auf dem er sah, dass die Meerenge zwischen den beiden Küsten genau in nordsüdlicher Richtung verlief. Dahinter kam, was wir heute die Messe nennen würden, ein Raum in Form eines L, und eine weitere Tür führte in die Kapitänskajüte mit ihrem breiten Fenster über dem Ruder und den seitlichen Türen zur Galerie. Auf der Amarilli war der Kommandoraum nicht identisch mit dem Schlafraum des Kapitäns gewesen, hier aber schien es, als habe man Platz sparen wollen, um Raum für etwas anderes zu gewinnen. Und tatsächlich fand sich, während links der Messe zwei kleine Offizierskajüten lagen, rechts neben ihr ein weiterer Raum, der fast noch größer als der des Kapitäns war, mit einer kleinen Kochstelle in der Ecke, aber sonst als Arbeitsraum eingerichtet.
Der Tisch war überladen mit Karten, die Roberto zahlreicher vorkamen, als sie zur Navigation eines Schiffes gebraucht wurden. Es schien der Arbeitsplatz eines Wissenschaftlers zu sein: Außer den Karten gab es verschieden eingestellte Fernrohre, ein schönes Nocturlabium aus Kupfer, das rotgolden schimmerte, als wäre es eine Lichtquelle in sich, eine auf der Tischplatte befestigte Armillarsphäre, weitere Papiere voller Zahlenkolonnen und ein Pergament mit kreisförmigen Zeichnungen in Schwarz und Rot, das Roberto, weil er Kopien davon auf der Amarilli gesehen hatte (die aber schlechter gemacht waren), als eine Reproduktion der Mondfinsternis-Tafeln des Regiomontanus erkannte.
Dann war er in den Kommandoraum zurückgekehrt: Wenn man auf die Galerie hinaustrat, konnte man die Insel sehen, man konnte – schrieb Roberto – mit Luchsaugen ihre Stille fixieren. Mit anderen Worten, die Insel war nach wie vor da.
Er musste fast nackt auf das Schiff gelangt sein; ich denke, er wird sich als erstes, verklebt vom Salzwasser, wie er war, in der Kombüse gewaschen haben, ohne sich zu fragen, ob das dort befindliche Wasser das einzige an Bord war, danach wird er in einer Truhe einen schönen Rock des Kapitäns gefunden haben, vielleicht den, der für den Tag der Rückkehr aufbewahrt worden war. Vielleicht hat er sich auch ein wenig aufgeplustert in seinem Kommandantenrock, und in Stiefel zu schlüpfen muss ihm das Gefühl gegeben haben, wieder ganz in seinem Element zu sein. Nur in diesem Zustand kann ein gutgekleideter Mann von Welt – und nicht ein ausgemergelter Schiffbrüchiger – offiziell von einem verlassenen Schiff Besitz ergreifen und das, was Roberto nun tat, nicht als einen Übergriff, sondern als ein Recht betrachten: Er suchte auf dem Tisch und fand, aufgeschlagen und wie unverrichteter Dinge liegengelassen, neben Gänsekiel und Tintenfass, das Logbuch. Auf der ersten Seite las er sofort den Namen des Schiffes, aber das Weitere war eine unverständliche Folge von Wörtern wie anker, passer, sterre-kyker, roer, und es half ihm wenig zu wissen, dass der Kapitän ein Flame war. Immerhin enthielt die letzte Zeile ein Datum, das nur wenige Wochen zurücklag, und nach ein paar unverständlichen Worten stand da unterstrichen in gutem Latein: quae dicitur pestis bubonica.
Endlich eine Spur, ein Ansatz zu einer Erklärung: Auf dem Schiff war eine Epidemie ausgebrochen! Roberto war darüber nicht weiter beunruhigt: Er hatte seine Pest vor dreizehn Jahren gehabt, und wie jeder weiß, hat jemand, der die Krankheit einmal überstanden hat, eine Art Gnade erworben, als ob es diese Schlange nicht wagte, ein zweites Mal in die Lenden dessen zu fahren, der sie einmal gebändigt hat.
Andererseits erklärte dieser Hinweis nicht viel und ließ Raum für andere Beunruhigungen. Es konnte zwar sein, dass alle an der Epidemie gestorben waren, aber dann hätte man doch, verstreut auf dem Deck, die Leichen der letzten finden müssen, wenn anzunehmen war, dass sie den vorher Gestorbenen ein frommes Seemannsbegräbnis hatten zuteil werden lassen.
Allerdings fehlte ja auch die Schaluppe: Demnach könnten die letzten, oder auch alle, davongefahren sein. Was macht ein Schiff mit Pestkranken zu einem so bedrohlichen Ort, dass man ihn nur noch fliehen kann? Ratten vielleicht? Es schien Roberto, als könne er in der schwer lesbaren Schrift des Kapitäns ein Wort wie rottenest (Rattennest?) entziffern – und sofort war er herumgefahren und hatte die Lampe hochgehalten in der Erwartung, etwas an den Wänden huschen zu sehen und jenes Quieken zu hören, das ihm auf der Amarilli das Blut hatte gefrieren lassen. Mit Schaudern erinnerte er sich, wie er einmal nachts aus dem Schlaf gefahren war, weil ihm ein pelziges Wesen das Gesicht gestreift hatte, was ihn so entsetzt hatte aufschreien lassen, dass Doktor Byrd herbeigestürzt war. Alle hatten sich hinterher über ihn lustig gemacht: Auch ohne Pest gibt es auf einem Schiff so viele Ratten wie Vögel in einem Wald, und daran muss sich gewöhnen, wer zur See fahren will.
Aber hier gab es keine Spur von Ratten, jedenfalls nicht im Achterkastell. Vielleicht hatten sie sich allesamt in der Bilge versammelt, unten im Schiffsbauch, und warteten dort mit ihren roten Augen im Dunkeln auf frisches Menschenfleisch? Roberto beschloss, der Frage sofort nachzugehen. Wenn es normale Ratten in normaler Anzahl waren, würde er mit ihnen leben können. Und was sonst sollten sie auch sein – fragte er sich und wollte sich's nicht beantworten.
Er fand eine Büchse, ein Schwert und ein Jagdmesser. Er war Soldat gewesen: Die Büchse war eine leichte Muskete, eine von jenen calivers, wie die Engländer sagten, die man ohne Stützgabel anlegen konnte; er vergewisserte sich, dass Schloss und Pfanne in Ordnung waren, mehr um sicherzugehen, als um sich daranzumachen, eine Rattenhorde mit Kugeln niederzustrecken, außerdem schob er sich auch das Messer in den Gürtel, das gegen Ratten nicht viel hilft.
Sodann beschloss er, den ganzen Schiffsrumpf von vorne bis hinten zu untersuchen. Aufs Vorschiff zurückgekehrt, stieg er über eine schmale Treppe, die am Ansatz des Bugspriets hinunterführte, in die Speisekammer, wo er genügend Lebensmittel für eine lange Reise vorfand. Und da sie sich unmöglich über die ganze Dauer der bisherigen Reise so gut hätten halten können, musste die Mannschaft sie erst vor kurzem in einem gastlichen Hafen an Bord genommen haben.
Es gab Körbe mit frisch geräucherten Fischen, Pyramiden von Kokosnüssen und Fässer mit fremdartig geformten, aber essbar aussehenden Knollen, die sich offenbar über lange Zeit aufbewahren ließen. Dazu Früchte von jener Art, wie sie Roberto nach den ersten Landungen in tropischen Häfen an Bord der Amarilli hatte auftauchen sehen, auch sie widerstandsfähig gegen den Zahn der Zeit, schuppig und stachelig, aber mit einem scharfen Geruch, der gut geschütztes Fleisch und zuckersüße verborgene Säfte versprach. Und aus irgendwelchen Produkten der Inseln musste auch jenes in Säcken gelagerte graue, nach Tuffstein riechende Mehl gewonnen worden sein, mit dem wahrscheinlich das Brot gebacken war, dessen Geschmack an jene faden Knollen erinnerte, welche die Indianer der Neuen Welt Kartoffeln nannten.
An der Rückwand entdeckte er auch ein knappes Dutzend Fässchen mit Zapfhahn. Er probierte ein wenig vom ersten, und es war frisches Wasser, das erst kürzlich abgefüllt und mit Schwefel versetzt worden war, damit es länger trinkbar blieb. Es war nicht sehr viel, aber wenn man bedachte, dass auch die Früchte seinen Durst stillen konnten, würde Roberto ziemlich lange auf dem Schiff bleiben können. Dennoch steigerten diese Entdeckungen, die ihn lehrten, dass er auf dem Schiff jedenfalls nicht Hungers sterben würde, seine Unruhe nur noch mehr – wie es melancholischen Gemütern ja häufig ergeht, für die jedes Anzeichen von Glück nur Vorzeichen schlimmster Folgen ist.
Als Schiffbrüchiger auf einem verlassenen Schiff zu landen ist schon recht unnatürlich, aber wenn das Schiff dann wenigstens richtig verlassen wäre, verlassen von Gott und den Menschen als ein unbrauchbares Wrack ohne alle natürlichen oder künstlichen Gegenstände, die es zu einer annehmbaren Behausung machen, dann wäre das noch in der Ordnung der Dinge und der Seefahrerchroniken; jedoch es so vorzufinden, so hergerichtet wie zum Empfang eines willkommenen und erwarteten Gastes, fast wie ein verlockendes Angebot – das schmeckte allmählich nach Schwefel, sehr viel mehr als das Wasser. Roberto fielen gewisse Märchen ein, die ihm seine Großmutter erzählt hatte, und andere in eleganterer Prosa, die er in den Pariser Salons hatte vorlesen hören, Märchen, in denen Prinzessinnen, die sich im Wald verirrt haben, in ein Schloss kommen und reich möblierte Zimmer mit Himmelbetten und Schränken voll prächtiger Kleider vorfinden, oder sogar Speisesäle mit gedeckten Tischen ... Und man weiß ja, im letzten Saal erwartet sie dann die schweflige Offenbarung des bösen Geistes, der seine Fallstricke ausgelegt hat.
Versehentlich stieß er an eine Kokosnuss im Unterbau der Pyramide, das Gebäude geriet aus dem Gleichgewicht, und die borstigen Früchte stürzten ihm lawinenartig entgegen wie Ratten, die still am Boden gelauert hatten (oder wie Fledermäuse, die sich kopfunter an die Balken einer Decke hängen), bereit, an ihm emporzuspringen und sein schweißüberströmtes Gesicht zu beschnuppern.
Er musste sich vergewissern, dass keine Zauberei im Spiel war: Auf der Reise hatte er gelernt, was man mit den überseeischen Früchten macht. Das Messer wie ein Beil benutzend, öffnete er mit einem Hieb eine Nuss, trank den Saft, zerbrach die Schale und nagte das Manna ab, das sich an der Innenseite verbarg. Es schmeckte so wunderbar süß, dass sich der Eindruck eines Hinterhalts noch verstärkte. Vielleicht, sagte er sich, war er schon der Illusion erlegen und schon in die Falle gegangen: Er labte sich an den Kokosnüssen und biss mit Nagezähnen hinein, schon war er dabei, die Eigenschaften der Nager zu übernehmen, bald würden seine Hände dünn und krumm und krallenbewehrt geworden sein, sein Leib würde sich mit einem grauen Flaum überziehen, sein Rücken würde sich buckeln, und er würde aufgenommen in die sinistre Apotheose der haarigen Bewohner dieses Acheronkahns.
Aber – und um mit dieser ersten Nacht zu enden – noch eine andere Schreckensmeldung sollte den Erforscher des Schiffs überraschen. Als hätte der Zusammenbruch der Nusspyramide schlafende Kreaturen geweckt, vernahm er plötzlich hinter der Trennwand, die den Vorratsraum vom Rest des Unterdecks abteilte, wenn nicht ein Quieken, so doch ein Piepsen und Glucksen und Füßescharren. Mithin gab es wirklich einen Hinterhalt, nächtliche Wesen beratschlagten sich irgendwo im Verborgenen.
Roberto überlegte, ob er sich, die Büchse im Anschlag, sofort in jenes Armageddon stürzen sollte. Das Herz schlug ihm bis zum Halse, er bezichtigte sich der Feigheit und sagte sich, ob in dieser Nacht oder in einer anderen, früher oder später würde er sich IHNEN stellen müssen. Er suchte nach Ausreden, überlegte hin und her und stieg wieder an Deck, und zum Glück sah er das erste Licht der Morgendämmerung schon wächsern auf dem Metall der Kanonen liegen, die bisher von den Reflexen des Mondlichts umspielt worden waren. Der Tag brach an, sagte er sich erleichtert, dessen Licht zu fliehen er sich geradezu verpflichtet fühlte.
Gleich einem aus dem Grab Auferstandenen aus Ungarn eilte er über das Deck, um ins Achterkastell zurückzugelangen, stürzte in die Kapitänskajüte, die er nun als die seine betrachtete, verriegelte die Tür, schloss die Ausgänge auf die Galerie, legte die Waffen in Reichweite und rüstete sich zum Schlaf, um nicht die Sonne zu sehen, jene Henkerin, die mit der Axt ihrer Strahlen die Schatten köpft.
Erregt träumte er seinen Schiffbruch, und er träumte ihn als ein Mann von Geist, der auch in den Träumen und dort vor allem dafür zu sorgen hat, dass die Satzperioden das Gemeinte verschönern, dass die Hervorhebungen es verlebendigen, die geheimnisvollen Verknüpfungen es verdichten, die Betrachtungen es vertiefen, die Emphasen es erheben, die Anspielungen es verschleiern und die Verwandlungen es verfeinern.
Ich stelle mir vor, dass es zu jener Zeit auf jenen Meeren mehr Schiffe gab, die Schiffbruch erlitten, als solche, die heil nach Hause zurückkehrten; doch wer die Erfahrung zum ersten Mal machte, dem musste sie eine Quelle wiederkehrender Alpträume werden, und die Gewohnheit des schönen Ausschmückens musste sie malerisch wie das Jüngste Gericht erscheinen lassen.
Seit dem Abend zuvor war die Luft gleichsam an Katarrh erkrankt, und es schien, als ob es dem tränenschweren Auge des Himmels schon nicht mehr gelänge, den Anblick der Wellenfläche auszuhalten. Die Malerhand der Natur hatte die Horizontlinie grau gefärbt und umriss in der Ferne unbestimmte Provinzen.
Roberto, dessen Eingeweide die drohende Eruption schon voraussehen, wirft sich auf sein Lager, das nun von einer zyklopischen Amme gewiegt wird, sinkt in Schlaf zwischen wirren Träumen, die er zu träumen träumt in dem Traum, über den er spricht, und kosmische Epenfülle des Staunens empfängt er im Schoße – cosmopea di stupori accoglie in grembo. Er erwacht vom Bacchanal des Donners und vom Geschrei der Matrosen, dann brechen Wasserfluten über sein Bett herein, Doktor Byrd kommt gelaufen und schreit, er solle an Deck gehen und sich gut festhalten an irgendetwas, sei's auch nur ein wenig fester als er selbst.
Auf Deck Verwirrung, Schreie, Leiber emporgehoben wie von der Hand Gottes und ins Meer geschleudert. Eine Weile klammert sich Roberto ans Besansegel (wenn ich ihn recht verstehe), dann zerreißt das Segel, von Blitzen getroffen, die Gaffel beginnt den gebogenen Lauf der Sterne zu imitieren, und Roberto wird unter den Hauptmast geschleudert. Dort wirft ihm ein gutherziger Matrose, der sich an den Mast gebunden hat und ihm daher nicht Platz machen kann, ein Seil zu und schreit, er solle sich an eine Tür binden, die es am Achterkastell aus den Angeln gehoben und an den Mast geschleudert hat, und es war ein Glück für Roberto, dass diese Tür dann mit ihm als Parasiten zur Bordwand gerutscht ist, denn inzwischen ist der Mast in der Mitte zerbrochen, und eine herabfallende Rahe hat den Kopf des Helfers zertrümmert.
Durch einen Spalt in der Bordwand sieht Roberto – oder träumt er gesehen zu haben – Schwärme von Schatten, gehäuft zu Blitzen, die zuckend durch die Wogengefilde irren: cicladi d'ombre accumulate a lampi che scorrono errando per i campi ondosi, was mir ein bisschen zu viel an Nachgiebigkeit gegenüber dem Zeitgeschmack des preziösen Zitates scheint. Aber sei's drum, die Amarilli neigt sich auf der Seite des zum Schiffbruch bereiten Schiffbrüchigen, und Roberto gleitet auf seinem Türblatt in einen Abgrund, über dem er, während er in ihn hinabsinkt, den Ozean wahrnimmt, der frei sich erhebt, um Steilhänge vorzutäuschen, im Delirium des Schauens sieht er gefallene Pyramiden aufragen und findet sich wieder als Wasserkomet, dahinrasend auf der Umlaufbahn jenes Wirbels von flüssigen Himmeln. Jede Woge glitzert in schimmernder Rastlosigkeit, hier windet eine Dampfsäule sich empor, dort gurgelt ein Strudel und reißt eine Quelle auf. Bündel ekstatischer Meteore bilden den Gegengesang zur aufrührerischen und in Donnergetöse zerborstenen Luft, der Himmel ist ein Flimmern von fernsten Lichtern im Wechsel mit tiefster Finsternis, und Roberto schreibt, er habe schäumende Alpen gesehen in schlüpfrigen Furchen, die den Schaum zu Garben verwandelt hätten, und der Ceres Früchte seien in Blüte gestanden zwischen funkelnden Saphiren, und von Zeit zu Zeit seien rotglühende Opale hervorgebrochen, als habe die tellurische Tochter Proserpina das Kommando übernommen und ihre fruchttragende Mutter vertrieben.
Und zwischen röhrenden wilden Tieren, die ihn umkreisen, während silberne Salze aufbrodeln in erregter Wallung, hört er mit einem Mal auf, das Schauspiel zu bewundern, um ein fühlloser Mitspieler darin zu werden, denn er fällt in Ohnmacht und weiß nichts mehr von sich. Erst später wird er träumend vermuten, es habe sein Brett, sei's dank einer mitleidigen Verfügung des Himmels, sei's durch den Instinkt des Schwimmkörpers, sich jener wilden Gigue angepasst und sei wie hinabgesunken, so auch naturgemäß wieder aufgestiegen, um sich allmählich in einer Sarabande zu beruhigen (denn im Aufruhr der Elemente kehren sich auch die Regeln jeder höfischen Tanzfolge um), und dann habe es ihn in immer weiteren Kreisen vom Nabel des Strudels entfernt, in welchem, als Drehkreisel in den Händen der Kinder des Äolus, die Amarilli versank, den Bugspriet zum Himmel gerichtet. Und mit ihr jedes andere lebende Wesen in ihrem Bauche: der Jude, dem es bestimmt war, das irdische Jerusalem, das er nun nie mehr erreichen sollte, im himmlischen Jerusalem zu finden, der Malteserritter, der nun für immer auf die ersehnte Insel Escondida verzichten musste, der Doktor Byrd mit seinen Jüngern sowie auch – durch eine barmherzige Natur endlich den Bemühungen der medizinischen Kunst entzogen – jener arme Hund mit der ewig schwärenden Wunde, wovon ich freilich noch nicht zu sprechen Gelegenheit hatte, da Roberto erst später darüber schreiben wird.
Insgesamt aber, denke ich, hatten der Traum und der Sturm den Schlaf Robertos genügend aufgewühlt, um ihn auf eine sehr kurze Zeit zu beschränken, der ein erregter und kampflustiger Wachzustand gefolgt sein muss. Jedenfalls hatte Roberto dann in der Erwägung, dass es draußen Tag war, ermuntert durch die Tatsache, dass wenig Licht durch die trüben Fenster des Achterkastells eindrang, und im Vertrauen darauf, dass er über eine innere Treppe ins Unterdeck gelangen würde, neuen Mut gefasst, hatte die Waffen genommen und war mit verwegener Bangigkeit darangegangen, den Ursprung jener nächtlichen Geräusche zu erkunden.
Oder vielmehr, er war noch nicht gleich gegangen. Ich bitte um Vergebung, aber es ist Roberto, der sich in seinen Briefen an die Signora widerspricht – ein Zeichen dafür, dass er nicht säuberlich der Reihe nach berichtet, was ihm widerfahren ist, sondern den Brief wie eine Erzählung zu schreiben versucht oder eher wie eine Kladde, eine Materialsammlung für das, was später Brief und Erzählung werden könnte. Jedenfalls schreibt er, ohne sich schon zu entscheiden, was er später davon verwenden wird, er beschreibt sozusagen die Figuren seines Schachspiels, ohne schon festzulegen, wie er sie bewegen und welche Züge er mit ihnen machen wird.
In einem Brief behauptet er, dass er hinausgegangen sei, um sich unter Deck umzusehen. In einem anderen schreibt er jedoch, er habe, kaum von der morgendlichen Helle geweckt, ein fernes Konzert vernommen. Es waren Töne, die sicherlich von der Insel kamen. Zuerst hatte Roberto an eine Horde von Eingeborenen gedacht, die sich in lange Kanus drängten, um das Schiff zu erreichen, und hatte die Büchse fester umklammert, aber dann war ihm das Konzert weniger kriegerisch vorgekommen.
Auf der Amarilli, wo er tagsüber nie an Deck gegangen war, hatte er die Passagiere von lodernden Morgenröten erzählen hören, von Morgenröten, die geradezu Feuer spien, als sei die Sonne begierig, die Welt zu verbrennen. Nun aber sah er, ohne dass die Augen ihm tränten, Pastellfarben: der Himmel geflockt mit dunklen, blass perlgrau geränderten Wölkchen, während ein Hauch, eine Ahnung von Rosa emporstieg hinter der Insel, die türkisgrün erschien wie hingetuscht auf ein rauhes Papier.
Doch diese fast nordische Farbenpalette genügte, um ihn erkennen zu lassen, dass jenes Profil, das ihm in der Nacht so homogen vorgekommen war, aus den Umrissen eines bewaldeten Hügels bestand, der steil zur Küste abfiel, und dass der Hang mit hochstämmigen Bäumen bewachsen war, bis hinab zu den Palmen, die den weißen Strand säumten.
Allmählich wurde der Sand immer leuchtender, und längs der Ränder gewahrte man an den Seiten etwas wie große Spinnen, die sich eingesponnen hatten und ihre skelettartigen Gliedmaßen ins Wasser streckten. Roberto verstand sie aus der Ferne als »wandernde Pflanzen«, aber im selben Moment ließ ihn das nun doch zu gleißend gewordene Leuchten des Sandes zurückfahren.
Er entdeckte jedoch, dass, wenn ihm die Augen versagten, das Gehör ihn nicht im Stich lassen konnte, und so verließ er sich ganz aufs Gehör, schloss den Fensterflügel bis auf einen Spalt und horchte auf die Geräusche vom Lande.
Obwohl er an die Morgendämmerungen in seinen piemontesischen Hügeln gewöhnt war, begriff er, dass er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich die Vögel singen hörte, jedenfalls hatte er noch nie so viele von ihnen auf so verschiedene Weisen singen hören.
Zu Tausenden begrüßten sie den Aufgang der Sonne; ihm schien, als erkenne er zwischen dem Krächzen der Papageien die Nachtigall, die Amsel, die Lerche und eine unendliche Vielzahl von Schwalben, ja sogar den durchdringenden Ton der Zikaden und der Grillen, wobei er sich fragte, ob es wirklich Tiere jener vertrauten Arten waren, die er da hörte, und nicht irgendwelche nur bei den Antipoden lebenden Vettern von ihnen ... Die Insel war nicht nahe, und doch hatte er den Eindruck, als brächten die Töne einen Geruch von Orangenblüten und Basilikum mit sich, ja als wäre die Luft über der ganzen Bucht regelrecht duftgeschwängert – und hatte Herr d'Igby ihm nicht erzählt, dass er auf einer seiner Reisen die Nähe des Landes an den vom Wind herbeigewehten Geruchsatomen erkannt habe?
Doch während Roberto schnuppernd auf jene unsichtbare Vielfalt lauschte, als blickte er von den Zinnen einer Burg herab oder durch die Schießscharten einer Festung auf eine Armee, die sich lärmend im Halbkreis aufstellte zwischen dem Hang des Hügels, der vorgelagerten Ebene und dem Fluss, der die Mauern schützte, schien ihm, als habe er all das schon einmal gesehen, was er sich da horchend vorstellte, und angesichts der Unermesslichkeit, die ihn von allen Seiten umlagerte, fühlte er sich tatsächlich belagert, und fast hätte er unwillkürlich die Büchse angelegt. Er war in Casale, und vor ihm erstreckte sich die spanische Armee: mit dem Lärm ihrer Trosswagen, dem Klirren ihrer Waffen, den Tenorstimmen der Kastilier, dem Geschrei der Neapolitaner, dem rauhen Grunzen der Landsknechte, und im Hintergrund Trompetensignale, die gedämpft herüberklangen, und das dumpfe Krachen von Arkebusen, poff, paff, ta-pumm, wie die Böllerschüsse auf einem Heiligenfest.
Gleichsam als wäre sein Leben zwischen zwei Belagerungen verlaufen, deren eine das Abbild der anderen war, mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt, da der Kreis jener beiden erlebnisreichen Lustren sich schloss, der Fluss zu breit und ebenfalls kreisförmig war – so dass er jeden Ausfall unmöglich machte –, durchlebte Roberto noch einmal die Tage von Casale.
2
VON DENEN BEGEBENHEITEN
IM MONFERRAT
Über seine sechzehn Lebensjahre vor jenem Sommer 1630 lässt Roberto nur wenig durchblicken. Episoden aus der Vergangenheit führt er nur an, wenn sie ihm irgendeinen Zusammenhang mit seiner Gegenwart auf der Daphne zu haben scheinen, und der Chronist seiner eigenwilligen Chronik muss zwischen den Zeilen lesen. Hielte man sich an seine Usancen, erschiene er wie ein Autor, der, um die Entlarvung des Mörders hinauszuzögern, dem Leser nur spärliche Hinweise gibt. Daher werde ich mir Indizien zusammenstehlen wie ein Denunziant.
Die Signori Pozzo di San Patrizio, eine Familie aus kleinem piemontesischen Landadel, besaßen das ausgedehnte Landgut La Griva am Rand des Gebietes von Alessandria (damals Teil des Herzogtums Mailand und folglich spanisches Territorium), aber aus Gründen der politischen Geographie oder auch aus Neigung verstanden sie sich als Vasallen des Marchese von Monferrat. Der Vater – der mit seiner Gattin Französisch sprach, mit den Bauern Dialekt und mit den Fremden Italienisch – redete mit Roberto auf unterschiedliche Weise, je nachdem, ob er ihm einen besonderen Degenstoß beibrachte oder ihn zu einem Ritt über die Felder mitnahm und dann auf die Vögel schimpfte, die ihm die Ernte verdarben. Im übrigen verbrachte der Junge seine Zeit allein, ohne Freunde, indem er von fernen Ländern träumte, wenn er gelangweilt durch die Weinberge strich, von Falkenzucht, wenn er Schwalben jagte, von Kämpfen mit Drachen, wenn er mit den Hunden spielte, und von vergrabenen Schätzen, wenn er die Räume des familieneigenen Schlösschens oder Kastellchens erkundete. Den Anstoß zu diesen Streifzügen der Phantasie gaben ihm die Romane und Ritterepen, die er verstaubt im Südturm vorfand.
Er war also nicht unbelesen, und er hatte sogar einen Hauslehrer, wenn auch nur in den Wintermonaten. Einen Karmelitermönch, von dem es hieß, er sei im Orient gereist und habe sich dort – wie Robertos Mutter erschauernd und sich bekreuzigend raunte – zum Muselmann machen lassen. Einmal im Jahr kam er mit einem Knecht und vier Mulis, die mit Büchern und anderem Papierkram bepackt waren, und blieb dann drei Monate auf dem Gut. Was er seinem Schüler beibrachte, weiß ich nicht, aber als Roberto nach Paris kam, machte er keine schlechte Figur, und jedenfalls lernte er rasch, was er hörte.
Von diesem Karmeliter weiß man nur eines sicher, und es ist kein Zufall, dass Roberto darauf anspielt. Eines Tages hatte der alte Pozzo sich beim Degenputzen geschnitten, und sei's, dass die Klinge rostig war, sei's, dass er sich an einer besonders empfindlichen Stelle verletzt hatte, die Wunde schmerzte ihn sehr. Da hatte der Karmeliter den Degen genommen, hatte ihn mit einem Pulver bestreut, das er in einem Döschen bei sich führte, und sofort hatte der alte Pozzo geschworen, es gehe ihm besser. Tatsache ist, dass die Wunde bereits am folgenden Tag zu vernarben begann.
Der Karmeliter hatte sich über das allseitige Erstaunen gefreut und gesagt, das Geheimnis jener Substanz habe ihm ein Araber enthüllt und es handle sich um ein noch viel wirksameres Mittel als das, welches die christlichen Spagiriker unguentum armarium, Waffensalbe, nannten. Auf die Frage, warum das Pulver nicht auf die Wunde gestreut werden müsse, sondern auf die Klinge, von der sie verursacht worden sei, hatte er gesagt, das eben sei die Wirkungsweise der Natur, zu deren stärksten Kräften die universale Sympathie gehöre, die das Handeln aus der Entfernung lenke. Und hatte hinzugefügt, wenn die Sache schwer zu glauben erscheine, brauche man nur an den Magneten zu denken, der bekanntlich ein Stein sei, der Metallspäne anziehe, oder an die großen Eisenberge, die den Norden unseres Planeten bedeckten und so die Kompassnadel anzögen. In gleicher Weise ziehe die Waffensalbe, wenn sie auf die Klinge gestrichen werde, jene Eigenschaften des Eisens an, welche der Degen in der Wunde gelassen habe, wo sie die Heilung verhinderten.
Jeder, der so etwas in der Kindheit erlebt hat, bleibt davon sein Leben lang gezeichnet, und wir werden bald sehen, wie Robertos Schicksal durch sein Interesse für die Anziehungskraft von Pulvern und Salben bestimmt worden ist.
Im übrigen war es nicht dieser Vorfall, der Robertos Kindheit am stärksten geprägt hatte. Es gab da noch einen anderen, und genauer gesagt war es kein einzelner Vorfall, sondern eine fast wie ein Kehrreim wiederholte Episode, die der Knabe in argwöhnischer Erinnerung behalten hatte. Wie es scheint, pflegte nämlich der Vater, der seinem Sohn gewiss sehr zugetan war, auch wenn er ihn mit der wortkargen Grobheit behandelte, die den Menschen jenes Landstriches eigen ist, ihn bisweilen – und gerade in seinen ersten fünf Lebensjahren – plötzlich hoch in die Luft zu heben und ihm stolz zuzurufen: »Du bist mein Erstgeborener!« Eigentlich nichts weiter Seltsames, nur eine lässliche Sünde der Redundanz, da Roberto sein einziger Sohn war. Hätte sich dann Roberto, als er größer wurde, nur nicht zu erinnern begonnen (oder sich eingeredet, sich zu erinnern), dass seine Mutter angesichts dieser väterlichen Freudenbekundungen eine Mischung aus Unruhe und Beglücktheit an den Tag legte, als hätte der Vater zwar gut daran getan, jenen Ausruf zu tun, aber als wäre dadurch in ihr eine alte, gleichsam schon eingeschlafene Angst wieder aufgeweckt worden. Robertos Phantasie hatte sich lange mit dem Ton jenes Ausrufs beschäftigt, um schließlich zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Vater den bewussten Satz nicht wie eine selbstverständliche Feststellung ausgesprochen hatte, sondern wie eine neuartige Investitur, indem er das »du« so betonte, als wollte er sagen: »Du und nicht irgendein anderer bist mein erstgeborener Sohn.«
Nicht irgendein anderer oder nicht jener andere? In Robertos Briefen finden sich immer wieder Hinweise auf einen anderen, dessen Existenz ihn wie eine Obsession verfolgte, und die Idee scheint ihm genau damals gekommen zu sein, als er sich eingeredet hatte – und worüber konnte ein kleiner Junge nachgrübeln, der sich allein zwischen Schlosstürmen voller Fledermäuse, zwischen Weinbergen, Eidechsen und Pferden herumtrieb, weil ihn der Umgang mit den gleichaltrigen Bauernjungen verlegen machte, und der, wenn er nicht den Märchen der Großmutter zuhörte, denen des Karmeliters lauschte? –, irgendwo habe er einen nicht anerkannten Bruder, der von übler Wesensart sein musste, wenn ihn der Vater verstoßen hatte. Roberto war erst zu klein und dann zu schamhaft gewesen, um sich zu fragen, ob dieser Bruder ein Halbbruder väter- oder mütterlicherseits war (und in jedem Fall wäre auf einen der beiden Elternteile der Schatten einer alten, unverzeihlichen Verfehlung gefallen): Er war einfach ein Bruder; sicherlich war er selbst, Roberto, irgendwie schuld an seiner Verstoßung gewesen (vielleicht auf übernatürliche Weise), und darum hegte der Verstoßene sicherlich einen Hass auf ihn als den Vorgezogenen.
Der Schatten dieses feindlichen Bruders (den er gleichwohl gerne kennengelernt hätte, um ihn zu lieben und sich von ihm lieben zu lassen) hatte seine Nächte als Kind beunruhigt; später, als Heranwachsender, hatte er in der Bibliothek alte Bücher durchgeblättert, um, in ihnen versteckt, was weiß ich, ein Porträt zu finden, eine Geburtsurkunde, ein enthüllendes Geständnis. Er war auf den Dachboden gestiegen, um alte Truhen zu öffnen, die voller Kleider der Urgroßeltern waren, Schachteln mit angelaufenen Medaillen oder mit einem maurischen Dolch, und hatte mit erstaunten Fingern Hemdchen aus feinem Leinen befühlt, die sicher einst einem kleinen Kind gehört hatten, aber wer weiß, ob vor Jahren oder vor Jahrhunderten.
Mit der Zeit hatte er diesem verlorenen Bruder auch einen Namen gegeben, Ferrante, und hatte begonnen, ihm kleine Vergehen zuzuschreiben, die ihm zu Unrecht vorgeworfen worden waren, wie den Diebstahl einer Süßigkeit oder die unerlaubte Befreiung eines Hundes von seiner Kette. Ferrante, begünstigt durch seine Verstoßung, handelte in seinem Rücken, und er, Roberto, versteckte sich hinter Ferrante. Und langsam verwandelte sich die Gewohnheit, dem inexistenten Bruder all das anzulasten, was Roberto nicht getan haben konnte, in die Unart, ihm auch das anzulasten, was Roberto tatsächlich getan hatte und nun bereute.
Nicht dass Roberto die anderen belog; aber auf diese Weise gelang es ihm, während er stumm und mit zusammengebissenen Zähnen die Strafe für seine Vergehen auf sich nahm, sich von seiner Unschuld zu überzeugen und sich als Opfer einer Ungerechtigkeit zu fühlen.
Einmal zum Beispiel hatte Roberto, um eine neue Axt auszuprobieren, die soeben geliefert worden war (zum Teil aber wohl auch aus Trotz über irgendein erlittenes Unrecht), einen kleinen Obstbaum gefällt, den sein Vater erst kurz zuvor gepflanzt hatte, mit großen Hoffnungen auf künftige Früchte. Als ihm die Schwere seiner dummen Tat aufgegangen war, hatte er sich schreckliche Konsequenzen ausgedacht, mindestens einen Verkauf an die Türken, die ihn lebenslänglich auf ihren Galeeren rudern lassen würden, und hatte sich entschlossen, die Flucht zu versuchen, um sein Leben als Bandit in den Bergen zu beenden. Auf der Suche nach einer Rechtfertigung war er bald zu der Überzeugung gelangt, dass kein anderer als Ferrante das Bäumchen umgehackt haben konnte.
Dann aber rief der Vater, als er das Delikt entdeckt hatte, alle Jungen des Gutes zusammen und sagte, um zu verhindern, dass sein Zorn sich unterschiedslos über alle ergieße, solle der Schuldige lieber gestehen. Da wurde Roberto von einer mitleidserfüllten Großmut erfasst: Wenn er Ferrante beschuldigen würde, hätte der Ärmste eine neuerliche Verstoßung zu gewärtigen, im Grunde spielte er ja nur den Bösen, um sein Waisendasein zu kompensieren, verletzt vom Schauspiel seiner Eltern, die einen anderen mit ihren Liebesbezeugungen überhäuften ... Und so war Roberto vorgetreten und hatte zitternd vor Furcht und Stolz gesagt, er wolle nicht, dass irgendein anderer an seiner Stelle beschuldigt werde. Es wurde, obwohl es keines war, als Geständnis genommen. Der Vater sagte unter allerlei Räuspern, während er sich den Schnurrbart zwirbelte und die Mutter ansah, das Verbrechen sei zwar überaus schwer und die Bestrafung mithin unvermeidlich, aber er könne auch nicht umhin zuzugeben, dass der junge »Signor della Griva« den Traditionen der Familie Ehre mache und dass ein Ehrenmann sich so zu verhalten habe, auch wenn er erst acht Jahre alt sei. Dann hatte er sein Urteil gesprochen: Roberto werde Mitte August nicht an dem Besuch bei den Vettern in San Salvatore teilnehmen dürfen, was zwar eine schmerzliche Strafe war (in San Salvatore gab es den Weinbauern Quirino, der Roberto auf einen Feigenbaum von schwindelerregender Höhe zu heben verstand), aber gewiss nicht so schlimm wie die Galeeren des Sultans.
Uns kommt die Geschichte einfach vor: Der Vater ist stolz, einen Sprössling zu haben, der nicht lügt, er sieht die Mutter mit schlechtverhohlener Befriedigung an und verhängt eine milde Strafe, um den Schein zu wahren. Aber Roberto hatte damals noch lange über der Sache gebrütet und war schließlich zu der Überzeugung gelangt, dass Vater und Mutter sicher geahnt hatten, dass Ferrante der Schuldige war, so dass sie den brüderlichen Heroismus des vorgezogenen Sohnes zu schätzen wussten und sich erleichtert fühlten, das Familiengeheimnis nicht lüften zu müssen.
Mag sein, dass ich es bin, der hier karge Indizien ausspinnt; Tatsache ist, dassdie Anwesenheit jenes abwesenden Bruders in dieser Geschichte noch eine Rolle spielen wird. Wir werden Spuren jenes kindlichen Spiels noch im Verhalten des erwachsenen Roberto wiederfinden – oder jedenfalls in seinem Verhalten zu der Zeit, als wir ihm auf der Daphne begegnen, in einer Lage, die wohl jeden aus der Fassung gebracht hätte.
Aber ich schweife ab; wir müssen noch klären, wie Roberto zur Belagerung von Casale gelangt war. Und hier empfiehlt es sich, der Phantasie freien Lauf zu lassen und sich vorzustellen, wie es gewesen sein könnte.
In La Griva trafen die Neuigkeiten nicht besonders rasch ein, aber seit mindestens zwei Jahren wusste man, dass die Erbfolgefrage im Herzogtum Mantua allerlei Übel im Monferrat nach sich zog, und eine halbe Belagerung hatte es schon gegeben. Um es kurz zu sagen – und die Geschichte ist von anderen schon erzählt worden, wenn auch fragmentarischer –, im Dezember Anno 1627 starb Herzog Vincenzo II. von Mantua, und um das Sterbebett dieses alten Liederjans, der keine Söhne zu zeugen vermocht hatte, war es zu einem Ballett von vier Thronprätendenten gekommen, sekundiert von ihren Agenten und Protektoren. Sieger war der Marquis von Saint-Charmont geworden, der dem Sterbenden hatte einreden können, dass die Erbschaft einem Vetter vom französischen Zweig gebühre, dem Herzog von Nevers, Charles de Gonzaga. In den letzten Zügen liegend, veranlasste oder erlaubte der alte Vincenzo, dass dieser Charles in großer Eile seine Nichte Maria Gonzaga ehelichte, und sterbend vererbte er ihm das Herzogtum.
Nun war jedoch dieser Nevers ein Franzose, und das Herzogtum, das er geerbt hatte, umfasste auch die Markgrafschaft Monferrat mit ihrer Hauptstadt Casale, der bedeutendsten Festung in Oberitalien. Zwischen dem spanisch beherrschten Mailand und den Ländereien der Savoyer gelegen, erlaubte es die Kontrolle des oberen Po, der Transitwege von den Alpen nach Süden einschließlich der Straße von Mailand nach Genua, und wie ein Pufferkissen schob es sich zwischen Frankreich und Spanien – während keine der beiden Mächte sich auf jenes andere Pufferkissen verlassen konnte, welches das Herzogtum von Savoyen darstellte, in dem Carlo Emanuele I. ein Spiel zu spielen beliebte, das doppelt zu nennen großmütig wäre. Wenn das Monferrat an Nevers fallen würde, wäre es so, wie wenn es an Richelieu fallen würde; kein Wunder also, dass Spanien es lieber an jemand anderen fallen sähe, zum Beispiel an den Herzog von Guastalla. Außerdem hatte auch der Herzog von Savoyen einen gewissen Anspruch auf das Erbe. Da jedoch ein Testament vorlag und eindeutig den Nevers als Erben benannte, blieb den anderen Prätendenten nur noch die Hoffnung, dass der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der formell der Lehnsherr des Herzogs von Mantua war, die Erbfolge nicht genehmigte.
Aber die Spanier waren ungeduldig, und in der Erwartung, dass der Kaiser eine Entscheidung treffe, war Casale schon einmal belagert worden, damals von Gonzalo de Córdoba, und nun wurde es erneut belagert, diesmal von einer imposanten Armee aus Spaniern und Kaiserlichen unter dem Befehl des erfahrenen Generals Ambrogio Spinola. Die französische Garnison rüstete sich zum Widerstand in Erwartung einer französischen Entsatzarmee, die allerdings noch im Norden beschäftigt war, so dass Gott allein wusste, ob sie rechtzeitig eintreffen würde.
Dies war, mehr oder minder, der Stand der Dinge, als der alte Pozzo etwa Mitte April die jüngsten Mitglieder seiner Familie und die aufgewecktesten seiner Bauern vor dem Schloss versammelte, sämtliche auf dem Gut vorhandenen Waffen unter ihnen verteilte, seinen Sohn Roberto rief und vor allen die folgende Rede hielt, die er sich während der Nacht zurechtgelegt haben musste: »Leute, hergehört. Dies unser Landgut La Griva hat seinen Tribut seit jeher dem Marchese von Monferrat entrichtet, was seit einiger Zeit so ist, als wenn's der Herzog von Mantua wäre, der nun dieser Herr von Nevers geworden ist, und wer mir jetzt kommt und sagt, dass der Nevers weder ein Mantuaner noch ein Monferriner ist, der kriegt von mir einen Tritt in den Hintern, alldieweil ihr allesamt ignorante Lackel seid, die von diesen Dingen kein' Deut verstehn, also seid lieber still und lasst euern Herrn machen, der wenigstens noch weiß, was Ehre ist. Alldieweil euch aber die Ehre einen feuchten Dreck wert ist, müsst ihr wissen, dass, wenn die Kaiserlichen in Casale einrücken, die fackeln nicht lange, eure Weinstöcke gehn zugrunde, und von euren Frauen wolln wir lieber nicht reden. Drum auf zur Verteidigung von Casale! Ich zwinge niemanden. Gibt's unter euch einen elenden Nichtsnutz, der andrer Meinung ist, soll er's sagen, dass ich ihn aufhäng' dorten an jener Eiche.« Keiner der Anwesenden konnte schon die Radierungen von Callot kennen, auf denen man Trauben von Leuten wie sie an den Ästen anderer Eichen hängen sieht, aber es musste etwas in der Luft liegen: Alle schwenkten ihre Musketen oder Piken oder Knüppel mit oben drangebundenen Sicheln und riefen: »Vivat Casale! Nieder mit den Kaiserlichen!« Wie ein Mann.
»Mein Sohn«, sprach der alte Pozzo zu Roberto, während sie durch das Hügelland ritten an der Spitze ihres kleinen Heeres, das ihnen zu Fuß folgte, »dieser Nevers ist keins meiner Eier wert, und Don Vincenzo, als der ihm sein Herzogtum vermacht hat, hat außer dem Schwanz auch den Grips nicht mehr hochgekriegt, den er freilich auch vorher nicht hochgekriegt hatte. Aber er hat's nun mal dem Nevers vermacht und nicht diesem Stiesel von Guastalla, und die Pozzos waren seit jeher Vasallen der rechtmäßigen Herren von Monferrat. Ergo wird nach Casale gegangen, und wenn's sein muss, wird dort auch gestorben, bei Gott, man kann doch nicht einem Herrn treu sein, solang alles gutgeht, und ihn dann im Stich lassen, wenn er bis zum Hals in der Scheiße sitzt! Aber freilich, am Leben bleiben ist besser, also Augen auf!«
Der Marsch jener Freiwilligen von der Grenze des Alessandrinischen in das kaum zwanzig Meilen entfernte Casale war gewiss einer der längsten, die die Geschichte kennt. Der alte Pozzo hatte eine an sich exemplarische Überlegung angestellt: »Ich kenne die Spanier«, hatte er gesagt, »das sind Leute, die sich's gerne leichtmachen. Drum werden sie auf Casale durch die Ebene im Süden ziehen, wo man besser mit Karren, Geschützen und anderen Vehikeln durchkommt. Wenn wir also kurz vor Mirabello nach Westen abbiegen und den Weg durch die Hügel nehmen, brauchen wir zwar ein paar Tage länger, aber wir bleiben unbehelligt und sind immer noch vor ihnen da.«
Dummerweise hatte Spinola kompliziertere Vorstellungen von der Art, wie man eine Belagerung vorbereitet. Als er im Südosten von Casale begann, die Ortschaften Valenza und Occimiano besetzen zu lassen, hatte er schon einige Wochen zuvor den Herzog von Lerma, Ottavio Sforza, und den Grafen von Gemburg mit etwa siebentausend Infanteristen in die Hügel westlich der Stadt geschickt mit dem Auftrag, so rasch wie möglich die Kastelle von Rosignano, Pontestura und San Giorgio einzunehmen, um jede mögliche Hilfeleistung seitens der französischen Armee zu unterbinden, derweil in einer Zangenbewegung von Norden her der Gouverneur von Alessandria, Don Geronimo Augustín, mit weiteren fünftausend Mann den Po nach Süden überschritt. Und alle hatten sich längs der Route verteilt, die Pozzo für so prächtig menschenleer hielt. Als er es dann von einigen Bauern erfuhr, konnte der wackere Edelmann seinen Kurs nicht mehr ändern, denn im Osten standen inzwischen ebenso viele Kaiserliche wie im Westen.
So sagte er bloß: »Wir beugen uns nicht. Ich kenne die Gegend besser als sie, wir schlupfen da mittendurch wie die Marder.« Was freilich Beugen oder Biegungen und Umwege in großer Zahl erforderte. Dabei trafen sie sogar auf die Franzosen aus Pontestura, die sich inzwischen ergeben hatten und denen man, vorausgesetzt, dass sie nicht nach Casale zurückgingen, gestattet hatte, sich an die ligurische Küste durchzuschlagen, um von dort per Schiff nach Frankreich zurückzukehren. Pozzo und seine Leute begegneten ihnen in der Nähe von Otteglia, und beinahe hätten die beiden Trupps das Feuer aufeinander eröffnet, da sie einander wechselseitig für Feinde hielten; von ihrem Kommandanten erfuhr er dann, dass eine der Kapitulationsbedingungen in Pontestura darin bestanden hatte, die dortigen Getreidevorräte an die Spanier zu verkaufen, dass aber diese das Geld an die Casaler geschickt hatten.
»Die Spanier sind noble Herren, mein Sohn«, sagte Pozzo, »und es ist ein Pläsier, gegen sie zu kämpfen. Zum Glück sind wir ja nicht mehr in den Zeiten von Karl dem Großen gegen die Mauren, als die Kriege noch ein einziges Schlägst-du-mich-tot-schlag-ich-dich-tot waren. Dies hier sind Kriege zwischen Christenmenschen, bei Gott! Die andern sind jetzt in Rosignano beschäftigt, wir umgehen sie im Rücken, schlupfen zwischen Rosignano und Pontestura durch und sind in drei Tagen in Casale.«