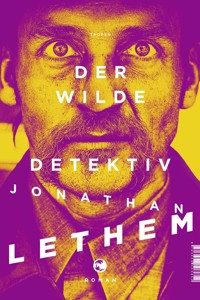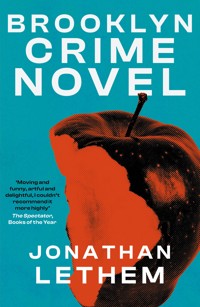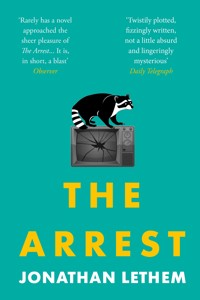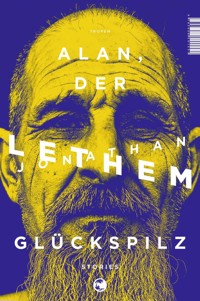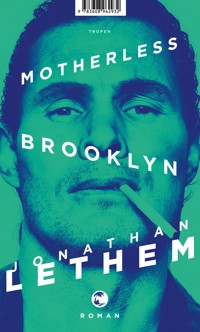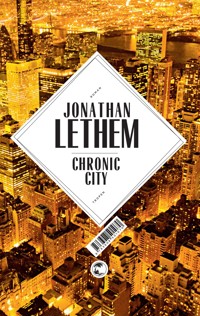17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Witzig und befreiend fordert »Bekenntnisse eines Tiefstaplers« konventionelles Wissen heraus und eröffnet tiefe Einblicke in die kaleidoskopische Natur der künstlerischen Praxis, die Rolle des Schriftsteller im Kulturbetrieb und die Art, wie eigene Lebenserfahrung die geistigen Obsessionen prägt. Dabei sind Inspiration von außen und Plagiarismus für Jonathan Lethem die entscheidenden Einflüsse jeglicher Kunst. Diese Idee verfolgt er sowohl in seinem berühmten Essay »Die Ekstase des Zitats« als auch in seinen Reflexionen über Autoren von Philip K. Dick bis Bret Easton Ellis oder wenn er große Musiker wie James Brown ins Studio begleitet. Frei nach dem Motto: Mein iTunes und mein eReader, c´est moi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
TROPEN SACHBUCH
AUS DEM AMERIKANISCHENVONGREGOR HENS
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.tropen.de
Tropen
Aus dem Amerikanischen von Gregor Hens
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel
»The Ecstasy of Influence« in erweiterter Fassung im
Verlag Doubleday, New York
© 2011 by Jonathan Lethem
© 2012 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlag: Herburg Weiland, München
Datenkonvertierung: Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung Stuttgart
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50318-0
E-Book: ISBN 978-3-608-10336-6
Der Text dieses E-Books entspricht der 1. Auflage 2012 der Printausgabe.
Inhalt
I. Mein ursprünglicher Plan
Mein ursprünglicher Plan - Erster Teil
Geschichten aus dem Modernen Antiquariat
Bücher, die sie lasen
Verderben in Wendover
Der Zelig des Skandals: Bret, Donna und die anderen
II. Dick, Calvino, Ballard: Science-Fiction und die Postmoderne
Mein ursprünglicher Plan - Zweiter Teil
Der verrückte Freund (Philip K. Dick)
Was ich bei der Science-Fiction-Tagung lernte
Das Beste von Calvino: Gegen den Vollständigkeitswahn
Die Postmoderne als Liberty Valance. Notizen zu einem Ritualmord
Die Forderung der Zeit (J. G. Ballard)
III. Plagiate
Einflussekstase
Das Nachleben der »Einflussekstase«
IV. Gegen die »Popkultur«
Gegen die »Popkultur«
»Supermen!« – Eine Einführung
Die fünf deprimiertesten Superhelden
Verfilmungen (Spider-Man)
Alles kaputt (Die Kunst der Finsternis)
Am Ende der Fahnenstange: Marlon Brando
Der Hintern von Donald Sutherland oder Filmsex für Leute, die noch Sex haben
Auszeiten (Knut)
Reklame für Norman Mailer
Termiten und weiße Elefanten: Positionen im Leben eines Schriftstellers im 21. Jahrhundert
V. Dylan, Brown und Punk
Das Genie des James Brown
People Who Died
Das Haar in der Suppe
Über Architektur tanzen oder Die fünften Beatles
Interview mit Dylan
VI. Was von meinem Plan geblieben ist
Was von meinem Plan geblieben ist
Für Richard Parks
Der Wahrheitssinn des Künstlers. – Der Künstler hat in Hinsicht auf das Erkennen der Wahrheiten eine schwächere Moralität als der Denker; er will sich die glänzenden, tiefsinnigen Deutungen des Lebens durchaus nicht nehmen lassen und wehrt sich gegen nüchterne, schlichte Methoden und Resultate. Scheinbar kämpft er für die höhere Würde und Bedeutung des Menschen; in Wahrheit will er die für seine Kunst wirkungsvollsten Voraussetzungen nicht aufgeben, also das Phantastische, Mythische, Unsichere, Extreme, den Sinn für das Symbolische, die Überschätzung der Person, den Glauben an etwas Wunderartiges im Genius: er hält also die Fortdauer seiner Art des Schaffens für wichtiger als die wissenschaftliche Hingebung an das Wahre in jeder Gestalt, erscheine diese auch noch so schlicht.
FRIEDRICH NIETZSCHE, Menschliches, Allzumenschliches
Die Vorstellung, dass die Kunst einen teuren Brocken eines stark reglementierten Gebiets darstellt, muss das Talent eines jeden modernen Malers bedrücken …
MANNY FARBER, »White Elephant Art vs. Termite Art«
Bestimmt haben Sie in Ihrem Eifer unvorstellbare, durch Tatsachen nicht zu rechtfertigende Versprechen gegeben, was durchaus einen Wert hat, aber hat sie jemals jemand eingefordert?
ANDER MONSON, »The Essay Vanishes«
Twist away the gates of steelUnlock the secret voice –
DEVO, »Gates of Steel«
In jedem Buch steckt ein Buch.
RICHARD G. STERN
Mein ursprünglicher Plan – Erster Teil
Mich gibt es nur, weil sie ausgestiegen sind. Ich lernte gleich zu Beginn, dass es besser ist zu gehen, als sich feuern zu lassen. Meine Mutter brach ihr Studium ab und schloss sich der Gegenkultur an. Der Legende der Judith Lethem nach war dies ein brillanter Schachzug, der nicht bereut werden durfte, allerdings erinnere ich mich an ein Gespräch über eine Werbung des Empire State College, das einen Studienabschluss im Fach Lebenserfahrung versprach. Demos, Selbsterfahrungsgruppen, Sozialarbeit, Drogenerfahrung, das hätten sie ihr alles angerechnet. Die Werbung für dieses Studium fand sich auf einem Streichholzheftchen. Mein Vater, ein Fulbright-Stipendiat, hatte Malerei an der Columbia University und in Paris studiert. Als er fertig war, schlug er eine Professur aus und arbeitete eine Weile als Schreiner. Den kommerziellen Galerien in Manhattan zeigte er die kalte Schulter, er vertraute sich lieber einer Künstlerkooperative in Brooklyn an. Damals tauchte man ab, um die Welt neu zu erfinden. Man verschwand in Dachstuben und schrieb, bis das Feuer des Prometheus aus den Manuskripten schlug. Man trampte nach San Francisco. Die Vorstellungen der Beat-Generation lagerten in den tiefsten Schichten meiner Persönlichkeit, dabei hatte ich schon früh das Interesse an Kerouacs Romanen verloren. Die erste Arbeitsanweisung, die auf dem Schreibtisch deines Lebens landet, sind deine Eltern, die Akte ist so dick, dass du kaum drübergucken kannst. Wenigstens die Hälfte des erforschten Universums hatte vollständig aufs Studium verzichtet. Es war, so ging die Legende der Judith Lethem (die vermutlich nur in meinem Kopf existierte), »die schlauere Hälfte«. Die Mauern ihres Märchenschlosses bestanden aus Regalwänden. Später stellte ich fest, dass viele der Bücher in diesen Regalen den Eintrag Richard Lethem, Columbia University auf dem Vorsatzblatt trugen.
Noch heute gratuliert man mir dazu, dass ich, anders als die meisten Mitstreiter meiner Generation, nicht in die Mühlen universitärer Schreibprogramme geraten bin. Ich müsste mich in solchen Momenten zum Verteidiger all jener aufschwingen, die mit allen Mitteln, seien sie noch so schmerzhaft und furchtbar, versuchen, Schriftsteller zu werden. Wenn ich vor Studenten des Kreativen Schreibens spreche, rührt mich oftmals ihre Hingabe. Doch statt einer Verteidigung biete ich nur Schweigen, denn ich würde vor Scham vergehen, wenn ich erklären müsste, warum ich nicht einmal mitbekommen hatte, dass man als angehender Schriftsteller einen ganz bestimmten Weg zu gehen hat. Ich verstand das System erst, als es für mich zu spät war, denn ich war benebelt von einer anderen Geschichte, die fünfzig Jahre alt und längst nicht mehr aktuell war. Schriftsteller, dachte ich, wird man so: Man jobbt in einer Buchhandlung, bis man seinen ersten Roman vorlegen kann.
Geschichten aus dem Antiquariat
Aufschließen
Mit fünfzehn erlebte ich meinen ersten Karrieresprung. Hatte ich bis dahin nur den gestrichenen Dielenboden fegen und die Ware auf den bunt zusammengewürfelten, grob gezimmerten Regalen in Ordnung bringen dürfen, hatten sie mich immer nur zu Steve’s Restaurant rübergeschickt, um Kaffee (»nicht zu stark«, in Pappbechern, die mit dem Abbild des Parthenon geschmückt waren) zu holen sowie scharf angeröstete Mais-Muffins, durfte ich nun allein den Laden aufschließen. Und zwar samstags und sonntags. Es war ein kleines Antiquariat auf der Atlantic Avenue, neben Teppiche Kalfian. Gegenüber war ein Reifenhändler, sonst war auf der Straße überhaupt nichts los. Heute sieht es dort ganz anders aus. Wir werden niemals erfahren, was uns die Sanierungswelle gebracht hätte, wir waren mit unserem exzentrischen kleinen Antiquariat zwanzig oder dreißig Jahre zu früh.
Michael war ein Langschläfer, und es fiel ihm von Mal zu Mal schwerer, sich aufzuraffen, um einem leeren Geschäft vorzustehen. Die Lösung dieses Problems war ich, der Junge von nebenan, der nur um der Anerkennung willen für die Erwachsenen »schuftete«, auch wenn ich eigentlich nichts tat, als zu lesen, mich im wohnzimmerartigen Lager umzusehen und ein Spiel zu spielen, das ich »Gott der Bücher« nannte. Meine »Bezahlung« bestand darin, dass ich mir ein paar Bücher mitnehmen durfte. Ich war ständig damit beschäftigt, einen Stapel im hinteren Teil des Flurs zu pflegen, bis ich schließlich genug verdient hatte, um die Bücher in meinem Rucksack verschwinden zu lassen. In einer Vitrine bewahrten wir außerdem die Sonderausgaben auf, darunter zwei, die ich unbedingt haben musste. Es dauerte Monate, bis ich genug angespart hatte: Hamlet, die Korrespondenz von Henry Miller und Michael Fraenkel, unbeschnitten und mit rotem Bändchen, sowie eine signierte Ausgabe von Bernard Wolfes geheimnisvollem Roman Limbo. (Den Wolfe besitze ich heute noch, doch ich habe vergessen, wie mir der Miller-Fraenkel abhandengekommen ist.)
Immer um elf, nachdem ich mir Tee geholt hatte (keinen Kaffee, aber einen gerösteten Mais-Muffin), zerrte ich den Wagen mit den klaubaren Taschenbüchern auf den Bürgersteig und stellte ihn vor das Schaufenster. Dann pflanzte ich mich hinter den massiven alten Schreibtisch, der aus Überwachungsgründen gleich rechts neben der Tür stand, und wartete auf den ersten Kunden. Manchmal wartete ich über eine Stunde. Da wir keine Heizung hatten, trug ich in der kalten Jahreszeit stets Schal und Mütze und rieb die Handschuhe aneinander, ungeduldig, dass die ersten Sonnenstrahlen ins Schaufenster fielen und den vorderen Teil des Ladens aufwärmten. Das Wechselgeld lag in der obersten Schublade in einer Zigarrenkiste, und beim einzigen Mal, dass ich kurz meinen Posten verließ, eine Minute, nicht länger, wurde die Kiste ausgeräumt. Meine Schuld, ich weiß, aber Michael schüttelte nur den Kopf, er wusste, dass Diebstahl in diesem Viertel einfach dazugehörte. Der Vorfall sprach nicht gegen mich, sondern gegen die Geschäftslage, und es dauerte nicht lange, bis er mit seinem kleinen Laden nach Manhattan umzog, in ein Untergeschoss auf der Vierundachtzigsten Straße, Upper East Side – der Laden war halb so groß wie in Brooklyn und brachte hundertmal mehr ein.
Lovecraft im Keller
Den Laden auf der Livingston Street in Brooklyn gab es seit den Dreißiger- oder frühen Vierzigerjahren, so genau wusste das niemand, der damalige Chef hatte ihn in den Siebzigern übernommen. Dieser Mann hasste Bücher. Der Laden war eine Katastrophe. Uralte Bücher verkannter Qualität waren in tiefen Schichten unter den zweifelhaften Ankäufen der letzten Jahrzehnte begraben, und der Chef, der sich durch das – aus seiner Sicht undurchschaubare – Antiquariatsgeschäft verunsichert fühlte, rettete sich damit, dass er jede neue Bibelausgabe ins Angebot nahm und Bücher über Traumdeutung und kistenweise gebrauchte Ausgaben von Playboy und Penthouse verkaufte sowie Übungsbücher für die Prüfungen zur Aufnahme in den Öffentlichen Dienst. Es gab Typen, die erst das Buch Feuerwehr kauften und dann, nachdem sie durch die Prüfung gefallen waren, Müllabfuhr oder Gefängniswärter. Der Laden war lang und schmal und hatte eine sehr hohe Decke. Mit Leitern erreichten wir das obskure Material, das auf den oberen Regalen in fünf, sechs Metern Höhe lagerte. Einen muffigen, schimmeligen Keller gab es auch, er war immer abgeschlossen, und es hieß, er stecke voller Schätze, die die früheren Eigentümer zurückgelassen hätten, darunter eine große Sammlung seltener Ausgaben aus der Hinterlassenschaft von H. P. Lovecraft.
Der Chef, der aus seiner Not heraus junge Leute anstellte, die sich besser mit Büchern auskannten als er, vertraute niemandem, er befürchtete, dass wir Bücher verkannten Werts aus dem Laden schmuggelten. Und so war es ja auch. Er hatte deshalb verschiedene absurde Regeln aufgestellt. Wir durften nicht mehr als zwei Bücher pro Woche kaufen, auch nicht zum vollen Preis. Ich war also gezwungen, Strohmänner einzusetzen, Freunde, die hereinkamen und taten, als würden sie mich nicht kennen. Ich drückte ihnen Bücher in die Hand, die sie für mich kauften. Es war auch untersagt, länger als eine oder zwei Minuten im Keller zu bleiben. Wenn uns der Chef hinunterschickte, um bestimmte Dinge zu holen – Glühbirnen oder Tüten, niemals Bücher –, blieb er oben an der Treppe stehen, rieb sich nervös die Hände und trieb uns mit lauten Rufen an. Blieben wir zu lange unten, befürchtete er gleich, wir würden die Schätze heben, die in den Regalen des stockfinsteren Kellerlabyrinths standen, Bücher, deren Wert er nur erahnen konnte, während wir eine ziemlich genaue Vorstellung hatten. Und so war es ja auch. Ansonsten ließ er uns niemals allein, nicht für eine einzige Minute.
Doch einmal stand ich früh auf, da ich um sieben mit einem Kollegen, der später mein Mitbewohner wurde, verabredet war. Wir verbrachten einige Stunden vor der Ankunft des Chefs damit, uns einen Überblick über die Bestände zu verschaffen. Die Mühe lohnte sich kaum, wir fanden nur fünf oder sechs interessante Bücher, nichts Besonderes, vor allem fanden wir keine Spur von einem Lovecraft-Schatz. Ein paar Wochen später kündigten wir und zogen weiter.
Paloma Picasso
Mein Mitbewohner machte mittlerweile die Spätschicht in einer Buchhandlung Ecke Broadway und Achtzigste. Es war ein hoher, schmaler Laden mit einer zentralen Treppe, oben befanden sich die Sonderausgaben, unter der Treppe stand ein Karton mit gebrauchten Schallplatten. Ich war seine Aushilfe und für den Ladenschluss am Freitag und Sonntag zuständig. Am Wochenende zwischen sieben und zehn war am meisten los, Pärchen schlenderten nach dem Kino oder nach dem Essen herein, die Kasse klingelte. Dagegen war in der letzten Stunde, besonders sonntags zwischen elf und zwölf, praktisch nichts los. Es war ein solcher Sonntag, ich saß an der Kasse und las. Außer mir befand sich in dem Laden noch eine Gestalt mit einem ewig langen Hals. Sie trug Haute Couture und stapelte ein Kunstbuch nach dem anderen auf dem Arm, mehrmals trat sie an den Tresen, um ihre Bild- und Fotobände abzuladen, nur um darauf erneut in den Regalen zu verschwinden. Der teure Stapel wuchs immer weiter an, und ich begann, mich für die Situation zu interessieren, ich hatte das vage Gefühl, dass eine verschwörerische Verbindung zwischen uns entstand, die ich sexy fand. Ohne ein Wort zu sagen, gab sie mir dann ihre Identität preis, und zwar genau wie in einer Fernsehwerbung, die damals sehr bekannt war: Sie zahlte mit ihrer Kreditkarte.
Chris Butler
Der winzige Buchladen in der Bergen Street hielt sich vielleicht ein halbes Jahr, und als die Eigentümer, ein Hippie und seine Hippiefreundin (in die ich mich verschossen hatte), dichtmachen wollten, war ich drauf und dran, ihn zu kaufen. Wenn ich ihn zusätzlich als Wohnung nutzte, so meine Überlegung, würde er sich vielleicht tragen, und ich könnte mir auf diese Weise leisten, allein in der Stadt zu leben. Ich träumte davon, den ganzen Tag in meinem Laden zu sitzen und zu schreiben – ruhig genug war es ja. Doch dann zog ich nach Kalifornien und blieb ein ganzes Jahrzehnt dort. Der Laden, der die Größe eines begehbaren Kleiderschranks hatte, wurde später in eine Videothek umgewandelt, dann in einen Hot-Dog-Stand.
Lange, ruhige Nachmittage verbrachte ich dort, zwei Ereignisse sind mir im Gedächtnis geblieben: Ich saß am Tresen und hörte den Sender WBAI, als der Jazz-Schlagzeuger Philly Joe Jones starb. Bizarrerweise starb ein weiterer Jazz-Schlagzeuger, Papa Joe Jones, keine achtundvierzig Stunden später. Der Discjockey spielte die Stücke der beiden Joe Jones’, er sprach in würdigem Ton über ihre Bedeutung, doch nicht ein einziges Mal erwähnte er den absurden Zufall, dass sie den gleichen Namen trugen. Ich hatte vorher weder vom einen noch vom anderen Schlagzeuger je etwas gehört.
Und: Eines Tages kam Chris Butler herein, der Songwriter der Band The Waitresses, und wollte sich mit mir unterhalten. Ich weiß nicht mehr, wie er mir zu verstehen gab, wer er war, ich bin mir aber sicher, dass ich nur zu bereit, vielleicht sogar verzweifelt bereit war, mich auf einen Kunden einzulassen, der offenbar ein solcher Hipster war.
Die gebieterische Autorin
Eines Nachmittags trat eine gebieterische Memoirenschreiberin mittleren Alters in die Buchhandlung auf der Solano Avenue in Berkeley, ein Laden von der Größe eines Supermarkts. Vier Regalwände voller antiquarischer Bücher zogen sich tief in den Raum, wo Restexemplare und neue Bücher in Stapeln auf Tischen lagen, wo Kästen voller Schallplatten standen und das Zeitschriftenregal so hoch war, dass wir einen Spiegel installieren mussten, um es zu überwachen. Vier oder fünf von uns arbeiteten jeweils im Laden, zwei an der Kasse.
Sie brachte einen ganzen Hofstaat mit, verschiedene ortskundige Helfer und die ein oder andere literarische Eskorte folgten ihr, Hofschranzen, die fragten, ob wir Bücher der Autorin vorrätig hätten. Wir begannen, uns über den Anspruch lustig zu machen, mit dem diese Leute auftraten. Wir waren zwar nur einfache Verkäufer, aber wenn wir im Laden waren, gehörte er doch irgendwie uns, und so nahmen wir uns das Recht heraus, jeden, der zur Tür hereinkam, einer scharfen Beurteilung zu unterziehen. Einer von uns machte eine unhöfliche Bemerkung gegenüber der Memoirenschreiberin, und jemand sprang ihr bei mit dem Satz: »Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es zu tun haben?«
Eine weitere Besonderheit dieses Buchladens war, dass wir immer wieder die Spitzel der Rechteverwertungsgesellschaft ASCA P abwehren mussten, mormonisch gekleidete Männer und Frauen, die Klemmbretter in den Händen hielten und nicht aufhörten, unangenehme Fragen zu stellen. Wir sollten dafür bezahlen, dass wir die gebrauchten Platten aus den Ramschkästen hinterm Tresen auflegten. Natürlich konnte man die Musik im ganzen Laden hören, doch wir stellten uns stur und behaupteten, dass wir sie allein zum persönlichen Vergnügen abspielten und dass die Kunden eher dazu neigten, sich über die Musik zu beschweren, was sogar der Wahrheit entsprach. Wenn sie endlich gingen, kicherten wir hinter vorgehaltener Hand, fasziniert von der Seelenlosigkeit bürokratischer Langweiler.
Conlon Nancarrow
Ein gebeugter, gebrechlicher Mann mit einem eleganten Spitzbart kam eines Tages in den Laden auf der Solano und sah sich die Schallplatten an. Er wurde von einem Typen aus Berkeley begleitet, den wir als einen etwas eitlen, semiprominenten Experimentalmusiker kannten. Der Name, der auf dem Scheck stand, den der alte Herr mit zitternder Hand ausfüllte, war Conlon Nancarrow, der legendäre Avantgarde-Künstler, der seine Kompositionen, die für menschliche Pianisten zu schnell waren, im mexikanischen Exil auf Notenrollen konserviert hatte. Ich stieß einen kurzen Freudenschrei aus, als ich den Namen las, und rief nach unserem Platteneinkäufer, der im hinteren Teil des Ladens sein Versteck hatte. Zum Glück hatten wir einige von Conlon Nancarrows LPs, Restbestände, die er mit einem silbernen Filzschreiber signierte.
Bücherdiebe
Irgendwann wurde unter den Buchhändlern in Berkeley bekannt, dass sich eine Bande von Bücherdieben auf die teuersten Bildbände spezialisiert hatte und diese weiterverkaufte, ein leichtes, schnelles Geschäft. Unsere Bücher waren bereits in anderen Läden aufgetaucht und wir hatten uns ohne unser Wissen mitschuldig gemacht, als wir Bücher aus anderen Buchhandlungen unseres Viertels angekauft hatten. Die Diebe, so hieß es, waren schmierig, exzentrisch und schwul – was uns, die Belegschaft von der Solano Avenue, in höchste Alarmbereitschaft versetzte.
Es dauerte nicht lange, bis wir die Bande in unserem Laden entdeckten, es waren zwei Männer und eine Frau, sie stromerten durch die hinteren Regalreihen. Wir verständigten uns mit Handzeichen, bildeten einen vier oder fünf Personen starken Trupp und stellten uns ihnen entgegen, berauscht von Adrenalin und Empörung. Wir führten sie in ein Hinterzimmer, wo die Diebe bedrückt ihre Beute aus Mänteln und Taschen zogen und auf den Tisch legten, es waren sechs oder sieben schwere Bildbände. Staunend ob dieser Dreistigkeit, dieser Maßlosigkeit, stotternd und taub vor Wut und Selbstgerechtigkeit fuhren wir sie an: Ihr wollt unkonventionell sein, ihr tut, als würden euch Bücher etwas bedeuten, und zwingt uns Angestellte in die Rolle von Polizisten? War das nicht ein besonderer Vertrauensbruch, die Verletzung einer Art Übereinkunft? Bücherdiebe, die aussahen wie Gema-Mormonen, das wäre etwas anderes gewesen. Aber diese hier sahen aus wie wir selbst, unbedarft, ungepflegt, hip – sie sahen aus wie Typen, die in Modernen Antiquariaten jobbten. Wir schickten sie fort und beglückwünschten uns, blieben aber verunsichert. Ich habe noch nie in einer Buchhandlung gearbeitet, in der sich die Belegschaft nicht gelegentlich bediente, wir glaubten immer, dass wir ein größeres Anrecht auf die Ware hatten als die zahlende Kundschaft. Und einer der besten, engagiertesten Menschen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe, ein Buchhändler aus Überzeugung, ist später sogar im Gefängnis gelandet. Er wurde verurteilt, weil er mit unmäßigem Eifer, so der Richter, aussortierte antiquarische Bücher und Manuskripte aus einer Universitätsbibliothek gerettet hatte.
Eldridge Cleaver, Greg Bear, Joseph McBride
In einer weiteren Buchhandlung in Berkeley – in palastartigen Räumlichkeiten auf vier Stockwerken mitten auf der zum Campus führenden Telegraph Avenue – war man an berühmte Kundschaft beinahe schon gewöhnt. Wer an der Universität zu tun hatte, fand sich früher oder später in diesem Laden wieder, der in den Sechzigern von einer Legende der kalifornischen Antiquariatsszene gegründet worden war. Auf der dritten Etage, bei den Geisteswissenschaften, stöberten berühmte Gelehrte, bei den Raritäten und Kunstbüchern im obersten Stock begegneten sich Künstler, Fotografen und weltbekannte Sammler. Wir selbst waren in gewissem Sinn berühmt, zumindest waren wir berüchtigt für die Arroganz, mit der wir unsere Kunden behandelten. Obwohl wir uns im freundlichen Kalifornien befanden, erlaubten wir uns, wie New Yorker Buchhändler die Nasen zu rümpfen und kurze, scharfe Befehle zu bellen. Unser Gründervater, eine Art Totem, kam immer noch in den Laden. Meistens saß er vorn beim Ankauf, ein Turm von einem Mann wie Pere Ubu, und versprühte nach Zigarren schmeckende Speicheltröpfchen, wenn er über die minderwertige Ware schimpfte, die ihm angeboten wurde. Er aß mit schmutzigen Fingern Dim Sum, bis ihm die scharfe Sauce über das Kinn in den Kragen lief, wo sie den Rest des Nachmittags verbrachte. Zu den heruntergekommenen Figuren, die immer wiederkamen, um ein paar zerfledderte Bücher loszuschlagen, gehörte auch Eldridge Cleaver in seinen letzten Lebensjahren. Wenn seine Bücher nicht angenommen wurden, nuschelte er etwas und sah gedemütigt auf den Boden.
An einem ruhigen Tag trat Greg Bear, Präsident der Vereinigung amerikanischer Science-Fiction-Autoren, an die Kasse, um etwas zu bezahlen. Er war groß und schwer wie ein König. Ich erkannte ihn – mal wieder, weil ich seinen Namen auf der Kreditkarte sah. Ich kam mir sehr clever vor, als ich ihm verriet, dass ich zahlendes Mitglied seines Verbands sei – ich hatte damals drei oder vier Erzählungen in Science-Fiction-Zeitschriften veröffentlicht –, und natürlich konnte er nicht wissen, wer ich war. Trotzdem sah er mich mit großen Augen an und breitete die Arme aus: Greg Bear wollte mich an seine breite Bärenbrust drücken. Ihm war wohl die große sozialistische Wahrheit offenbart worden, dass es überall, selbst an der Kasse eines Antiquariats, kleine Leute gab, die der Armee der Science-Fiction-Autoren zugeführt werden konnten.
An einem Freitagabend arbeitete ich allein an der Kasse, als ein bärtiger Mann in Begleitung einer Frau aus dem dritten Stock herunterkam. Sie kamen aus der Filmabteilung und trugen einen Paloma-Picasso-artigen Stapel nur noch antiquarisch erhältlicher Filmbücher vor sich her. Sein Scheckheft wies ihn als Joseph McBride aus, den Biographen von John Ford, Orson Welles und Frank Capra. Ich wusste, dass er lange Nachmittage in diversen Filmstudios verbracht hatte, um Welles und Howard Hawks bei der Arbeit zuzusehen und ihnen Fragen zu stellen. » Der Joseph McBride?«, rief ich aus, und bevor McBride mir noch antworten konnte, runzelte die Frau die Stirn und sagte trocken: »Also so hat das bisher noch niemand ausgedrückt.«
Ladenschluss
Es war eine Menge Arbeit, abends den Laden auf der Telegraph Avenue zu schließen. Wir mussten alle vier Etagen überprüfen und das Zwischengeschoss – Habe ich das Zwischengeschoss schon erwähnt? Seine Stadionatmosphäre? –, um die hartnäckigen Nichtkäufer zu verscheuchen und die Obdachlosen, die den Abend im Laden verbrachten. Wir konnten noch so oft durchs Treppenhaus hinaufrufen, dass wir schließen wollten, sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende mussten wir die Lichter in einer Reihenfolge ausmachen, die dazu erdacht war, die Kunden in Richtung Ausgang zu treiben, ein System, das der Notbeleuchtung im Flugzeug nachempfunden war. Immer wieder hatten wir Ärger mit Leuten, die es sich irgendwo zwischen den Regalen gemütlich gemacht hatten und mit Empörung auf die Information reagierten, dass sie sich in einer Buchhandlung befänden und dass diese Buchhandlung gleich zugemacht würde. Als ich eines Abends einen Mann mithilfe des Lichtschalters aus dem dritten Stock exilierte, geriet er in eine solche Rage, dass er mich einen verweichlichten Oberschichtsprössling schimpfte. Ich hatte damals lange Haare. Der Versuch, mich auf diese Weise zu beleidigen, ging dermaßen daneben – ich jobbte für ein paar Dollar die Stunde! –, dass ich in Gelächter ausbrach. Erst viel später verstand ich, dass sein unbeholfener Angriff eine Variation unseres eigenen, trotzigen Klassenbewusstseins war: Ich liebe den Laden mehr als du, und deshalb gehört er mir.
Der Ladenschluss auf der Solano Avenue, in einem eher bürgerlichen Teil von Berkeley, ging friedlicher vonstatten. »Wir schließen in fünf Minuten«, kündigte ich an, dann senkte ich die Nadel auf das letzte Lied von Bob Dylans Bringing It All Back Home, das mit den folgenden Worten beginnt:
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast …
Bücher, die sie lasen
Die Hippie-Eltern wussten zwar nicht, wohin mit sich, sie vergeudeten ihre Zeit mit Dreiecksbeziehungen und LPs und Antikriegsdemos, aber Analphabeten waren sie nicht. Es mag den ein oder anderen Totalaussteiger gegeben haben, der in die Berge gezogen war und dessen Lektüre nur aus dem Whole Earth-Katalog und der Anleitung zum Müßiggang bestand, vielleicht noch einer ölverschmierten Reparaturanleitung für den V W-Bus, aber die städtischen Hippies, die lasen Bücher, in der Tat. Man fand diese Bücher unten im Gästeklo und auf Nachttischen, man konnte zusehen, wie sie an Feiertagen aus Geschenkpapier gewickelt wurden, wie die Entdeckungen weitergereicht wurden, als wären sie Joints: Love’s Body von Norman O. Brown, Ehepaare von John Updike, Ich bin o.k., du bist o.k. von Thomas Harris, Ein Platz für Hot Dogs von Tom Robbins, Knoten von R. D. Laing. Und den Hite Report. Und Marshall McLuhan und Timothy Leary, Carlos Castaneda, Theodore Rosyak, Anaïs Nin, Philip Slater, Richard Buckminster Fuller. Das waren ihre Bestseller, die Bücher, die ihre Welt ausmachten, wie, sagen wir, Malcolm Gladwell, Deepak Chopra, Mitch Albom, Alice Sebold und American Psycho und Die Kunst, den Mann fürs Leben zu finden unsere Welt ausmachen. Es ist aus heutiger Sicht ein großes Durcheinander, die Titel widersprechen sich und haben so wenig miteinander gemein wie die Lieder aus zehn Jahren Hitparade oder die größten Kinohits des Jahrzehnts. Nur dass es in jedem dieser Bücher, ohne Ausnahme, um Suche und Aufbruch ging! Diese Leute damals gaben sich nicht mit dem Zurückliegenden ab, sie machten sich auf den Weg und hatten keine Angst vor dem Unbekannten. Sie waren nicht nur bereit für die Erweiterung ihres kulturellen und sozialen Erlebens, des Körperlichen, der Kunst und der Familie, sondern auch für eine Erweiterung nach innen, einem größeren Inneren. Das kollektive Gehirn der damaligen Zeit hatte einige zusätzliche Windungen. Wollten wir die Welt unserer Hippie-Eltern zum Leben erwecken, müssten wir es den Archäologen nachtun, wir müssten ihre Selbsterfahrungen ausgraben. Im Anschluss müssten wir uns gewissenhaft wie Leser mit ihnen auseinandersetzen, nur so könnten wir einem Weltgeist gerecht werden, der in einem tiefen Ozean aus Zeit versunken ist wie die Titanic. Dies wäre schlicht unmöglich. Selbst die Hippie-Eltern, die später fern vom Wrack aus dem Wasser gezogen wurden, wären dazu nicht in der Lage. Die Bücher sind – wenn sie nicht längst in Kartons verstaut im Keller gelandet sind, oder bei der Heilsarmee, die auch nichts mit ihnen anzufangen weiß – wie winzige Grabsteine, man sollte versuchen, sie zu entziffern. Uns Hippie-Kindern versprachen sie etwas, sie öffneten den Blick, selbst wenn sie uns bedrohlich erschienen, undurchsichtig wie Talismane. Womit wir gar nicht so falsch lagen. Die Bücher der Hippie-Eltern sind wieder im Geheimnisvollen versunken. Die Hippie-Eltern haben sie längst vergessen, wenn sie sie überhaupt jemals gelesen haben, und als wir so weit waren, uns in sie zu vertiefen, hatten wir schon unsere eigenen.
Den folgenden Text finde ich ärgerlich. Er entstand, bevor ich erfasst hatte, dass ein Essay einen Zweck verfolgen sollte, und begnügt sich mit dem Anekdotischen, öffnet den Blick nicht. Es ist damit ein wenig wie mit dem Trampen, die Reise wird überbewertet – es wäre halt schön, wenn man auch mal ankäme. Doch das Selbstporträt in diesem Text ist unbeabsichtigt ehrlich, wie ein Foto, das die Figur genau in dem Moment einfängt, da sie sich hinter dem eigenen Charme wegzuducken sucht.
Verderben in Wendover
Ich bin ein schwarzer Punkt in der Wüste, ein winziges Satzzeichen, das eine gerade Linie zieht auf einem gigantischen weißen Blatt Papier, schweißgebadet, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, und bereue alles. Es ist der Hochsommer 1984, ich befinde mich an einem absoluten Tiefpunkt. Bitte, malen Sie sich die Szene aus: Eine Streife auf der Route 80 außerhalb von Wendover, Nevada, hatte mich nach Utah zurückgeschickt, eine Meile quer durch die Wüste, es war Mittag, die Sonne brannte erbarmungslos. Damit Sie verstehen, wie ich in diese Lage geraten war, muss ich zuerst erklären, dass ich nicht richtig eingeschätzt hatte, inwiefern Trampen in Neuengland etwas anderes war als Trampen in den Wüsten und Gebirgen des Westens. Um der Geschichte gerecht zu werden, spule ich einige Wochen zurück zu einer kleinen Landstraße in der Nähe von Chatham, New York. Ich war mit einem Hippie namens Melvin in einem orangefarbenen Käfer unterwegs.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!