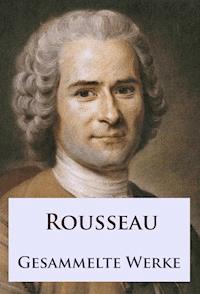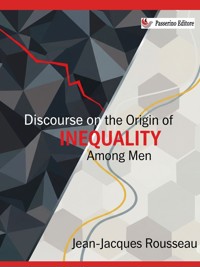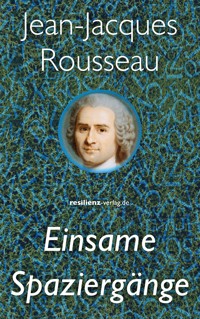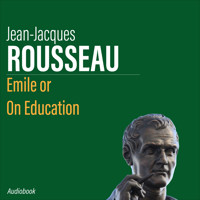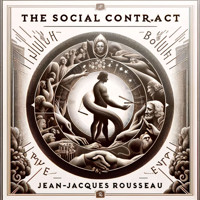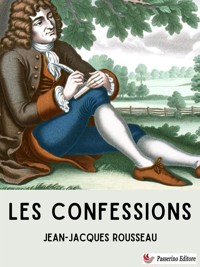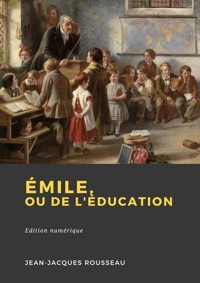Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Die Schriften der Kirchenväter
- Sprache: Deutsch
Ab 1763 verfasste Rousseau eine ganze Reihe kürzerer und längerer autobiografischer Texte, darunter seine 1765-1770 geschriebenen, später berühmt gewordenen Confessions (Die Bekenntnisse), die erst posthum publiziert wurden. Darin schildert er auch intime Details aus seinem Leben sowie eigene Verfehlungen. Vor allem diese Schrift begründete die Untergattung der "selbstentblößenden" Autobiografie. Den Titel wählte er in Anlehnung an den der Confessiones des Augustinus von Hippo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1388
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rousseau's Bekenntnisse
Jean-Jacques Rousseau
Inhalt:
Jean Jacques Rousseau – Biografie und Bibliografie
Rousseau's Bekenntnisse
Erster Theil
Erstes Buch.
1712 – 1719
1719 – 1723
1723 – 1728
Zweites Buch.
1728 – 1731
Drittes Buch.
1728 – 1731
1731 – 1732
Viertes Buch.
1731 – 1732
1732
Fünftes Buch
1732 – 1736
Sechstes Buch.
1736
1737 – 1741
Zweiter Theil
Siebentes Buch.
1741
1742
1743 – 1744
1745 – 1747
1747 – 1749
Achtes Buch.
1749
1750 – 1752
1752
1753
1754 – 1756
Neuntes Buch.
1756
1757
Zehntes Buch.
1758
1759
1760
Elftes Buch.
1761
1762
Zwölftes Buch.
1762
1763
1764
1765
Bekenntnisse, J. J. Rousseau
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634377
www.jazzybee-verlag.de
Jean Jacques Rousseau – Biografie und Bibliografie
Berühmter franz. Schriftsteller und Philosoph, geb. 28. Juni 1712 in Genf, gest. 2. Juli 1778 in Ermenonville (Oise). Seine Mutter, die Tochter eines evangelischen Predigers, starb schon bei seiner Geburt, und der Vater, Uhrmacher und Tanzlehrer, kümmerte sich nicht viel um die Erziehung seines Sohnes, der in seiner Lesewut alle Bücher verschlang, deren er habhaft werden konnte, am liebsten aber die Romane des 17. Jahrh. und Plutarchs Lebensbeschreibungen las. Man brachte ihn zuerst in das Bureau eines Anwalts, dann zu einem Kupferstecher in die Lehre. Aber sein unsteter Sinn und harte Züchtigungen infolge seiner schlechten Streiche trieben ihn aus Genf; nach mehrtägigem umherirren kam er nach Consignon zu dem katholischen Geistlichen, der ihn nach Annecy an Frau v. Warens (s. d.) empfahl. Diese, eine junge, liebenswürdige, aber äußerst schwache und gutmütige Frau, die ihren Mann verlassen hatte, war kurz vorher zum Katholizismus übergetreten und bemühte sich, den 16jährigen R. ebenfalls zu bekehren; sie sandte ihn nach Turin in ein Bekehrungshaus, wo er bald darauf den Protestantismus abschwor (23. Aug. 1728). In Turin wurde er Bedienter bei einer vornehmen Dame, von der er jedoch bald wieder entlassen wurde wegen des Verdachts, einen Diebstahl begangen zu haben, und kehrte nach einigen Irrfahrten 1730 zu Frau v. Warens zurück. Im April 1731 schloß er sich eine Zeitlang einem Hochstapler an, gelangte nach vielen Abenteuern bis nach Paris, kehrte dann aber 1732 zu Frau v. Warens zurück, die inzwischen nach Chambéry verzogen war. Mit seiner Freundin verlebte er dort acht glückliche Jahre, schwelgend im Genuß der schönen Natur, hauptsächlich aber mit ernsten Studien beschäftigt. Hier las er die englischen, deutschen und französischen Philosophen, studierte Mathematik und Latein, vertiefte seine religiösen Anschauungen und versuchte sich in Lustspielen und Opern. Wegen eines Herzleidens reiste er 1737 auf zwei Monate ins Bad nach Montpellier; als er dann nach seiner Rückkehr bei Frau v. Warens einen andern Liebhaber findet und mit diesem ihre Gunst nicht teilen will, wie sie es ihm vorschlägt, verläßt er ihr Haus (sie hatte im Sommer 1738 das Landgut Les Charmettes gepachtet), geht als Hauslehrer nach Lyon und 1741 nach Paris, um sein neues System, Noten durch Zahlen auszudrücken, der Akademie zu unterbreiten. Als diese seine Entdeckung zurückwies, nahm R. die Stelle eines Sekretärs beim französischen Gesandten in Venedig, dem Grafen Montaigu, an, einem geizigen, brutalen Mann, bei dem er nur 18 Monate aushielt. Nach Paris zurückgekehrt, trat er in lebhaften Verkehr mit Diderot, Grimm, d'Alembert, Holbach, Frau v. Epinay u.a., und schon damals rühmte man seine geistvolle Unterhaltung und spottete über sein unbeholfenes Benehmen und seine maßlose Eitelkeit. In dieser Zeit knüpfte er auch sein Verhältnis mit Thérèse Levasseur an, einer Arbeiterin ohne jede Schulbildung und so beschränkt, daß sie weder die Monatsnamen erlernen, noch den Wert der einzelnen Geldmünzen behalten konnte. Trotzdem lebten beide glücklich in einer Vereinigung, deren festester Kitt die Macht der Gewohnheit war, und die erst 25 Jahre später durch die Ehe geheiligt wurde. Sie schenkte ihm fünf Kinder, die er alle ins Findelhaus brachte, eine Herzlosigkeit, die er mit vielen Sophistereien zu entschuldigen versuchte. Inzwischen war er ein berühmter Mann geworden. Seine Abhandlung über die Verderblichkeit der Bildung (»Discours sur les sciences et les arts«, 1750), eine Antwort auf eine von der Akademie zu Dijon gestellte Preisfrage, war von dieser mit dem Preis ausgezeichnet worden. Von nun an trat er in bewußten Gegensatz zu der Zivilisation, die er für alle menschlichen Laster und besonders für seine eignen Verirrungen verantwortlich machte. Er verschmähte es jetzt auch, von der Schriftstellerei zu leben, und empfahl sich trotz des heftigen Widerspruchs seiner Geliebten und ihrer Mutter als Notenabschreiber in der sichern Erwartung, daß es einem berühmten Mann an Aufträgen nicht fehlen würde, worin er sich auch nicht täuschte. Auch auf dem Theater errang er nun einen glänzenden Erfolg mit der Oper »Le devin du village« (1752). Im Jahre 1753 erschien seine »Lettre sur la musique française«, mit der er durch seine Parteinahme für die italienische Musik einen heftigen Sturm gegen sich erregte. Seine zweite größere Schrift war wiederum von der Akademie zu Dijon angeregt und handelte von dem Ursprung und den Gründen der Ungleichheit unter den Menschen (»Discours sur l'inégalité parmi les hommes«, 1753); auch diese Schrift enthält die heftigsten Anklagen gegen die Gesellschaft. In dieser Zeit machte er eine Reise nach Genf, wo er glänzend empfangen wurde und (1. April 1754) zum Calvinismus zurücktrat; er nannte sich von nun an mit Vorliebe »Citoyen de Genéve«. Seit 1756 bewohnte er auf eine Einladung der Frau v. Epinay ein Gartenhäuschen im Walde von Montmorency, das berühmte, später umgebaute »Ermitage«. Hier, in der Einsamkeit, inmitten einer herrlichen Natur, hoffte er ein glückliches und ruhiges Leben führen zu können; aber seine häusliche Misere, seine heftige, sinnliche Leidenschaft für die Gräfin d'Houdetot und besonders sein krankhaftes Mißtrauen und seine nervöse Reizbarkeit, die den Bruch mit seinen besten Freunden, Grimm, Diderot und Frau v. Epinay, herbeiführte, machte den Aufenthalt dort unmöglich; er bezog Montmorency. Hier lebte er auf dem Lustschloß Montlouis, das ihm der Herzog von Luxembourg zur Verfügung stellte, von 1757–62, und wenn auch sein Gemüt nicht gesundete, so sind hier doch seine berühmtesten Werke vollendet worden: Die »Lettre à d'Alembert contre les spectacles« (1758), »Julie, ou la Nouvelle Héloïse« (Februar 1761), »Du contrat social, ou principes du droit politique« (deutsch, Berl. 1873) und »Émile, ou de l'éducation« (deutsch unter anderm von E. v. Sallwürk, mit Anmerkungen, nebst Biographie von Th. Vogt, 3. Aufl., Langensalza 1893, 2 Bde.; von Wattendorff, 2. Aufl., Münst. 1906), beide Frühjahr 1762 erschienen. Aber auch er teilte das Geschick aller Propheten. Aus Frankreich verbannt, wo das Parlament die Verbrennung des »Émile« und die Verhaftung des Verfassers dekretiert hatte, in seiner Vaterstadt, wo man seine Schriften öffentlich verbrannt hatte, geächtet, mußte er 1762 in dem damals preußischen Neuchâtel, im Dorf Môtiers-Travers, eine Zuflucht suchen; günstig nahm ihn der Gouverneur des Ländchens, der Marschall George Keith, auf. Von hier schrieb er seine Streitschrift an den Erzbischof von Paris und die berühmten »Lettres de la montagne«, worin er die Glaubensfreiheit gegen Kirche und Polizei in Schutz nahm als Antwort auf Tronchins »Lettres de la campagne«, die das Verhalten der Genfer Regierung gegen R. rechtfertigen sollten. Doch die Intrigen seiner Feinde ließen ihn auch hier nicht ruhen. Auf Anstiften des protestantischen Geistlichen machten die fanatisierten Bauern einen Angriff auf sein Haus und vertrieben ihn aus ihrem Dorf (September 1765). Auch von der Petersinsel im Bieler See, wohin er sich geflüchtet, wurde er verjagt; schon wollte er sich auf die Einladung Friedrichs II. nach Berlin begeben, als er den dringenden Bitten Humes, nach England überzusiedeln, nachgab. Aber auch dort war seines Bleibens nicht lange; sein Menschenhaß, der durch die Leiden der letzten Jahre allmählich in Verfolgungswahn ausgeartet war, vielleicht auch einige Rücksichtslosigkeiten seines Gastgebers, besonders aber wohl der Anstoß, den die englische Gesellschaft an seinem Verhältnis zu Thérèse nahm, führte bald den Bruch herbei. Schon 1. Mai 1767 landete er in Frankreich, erhielt 1770 die Erlaubnis, nach Paris zurückzukehren, wo er in der Rue Plâtrière (die jetzt seinen Namen trägt) eine Wohnung bezog, und vollendete dort die schon in England begonnenen »Confessions« (deutsch von L. Schücking, Hildburgh. 1870; von E. Hardt, Berl. 1906), worin er mit einer oft empörenden Offenheit und Rücksichtslosigkeit gegen sich und andre sein ganzes Leben der Welt darlegte. In langer armenischer Kleidung wandelte er damals melancholisch unter den Parisern umher, trieb Musik und Botanik und nährte sich vom Notenschreiben, bis er im Mai 1778 vom Marquis v. Girardin die Einladung erhielt, in Ermenonville, unweit Paris, ein stilles Landhaus zu beziehen. Dort ist er bald nachher gestorben. 1794 wurden seine Gebeine (von Ermenonville) feierlich im Panthéon beigesetzt, von wo sie unter der Restauration heimlich wieder entfernt worden sein sollen; seine Landsleute aber errichteten auf der nach ihm benannten Rousseauinsel in Genf ihrem größten Bürger ein Denkmal; im Panthéon zu Paris wurde ihm 1889 ein Standbild errichtet. Sein Bildnis s. Tafel »Klassiker der Weltliteratur II« im 12. Bd. Außer den angeführten Werken schrieb R.: »De l'imitation théâtrale« (1764); das Melodrama »Pygmalion«, das Berquin in Verse brachte (vgl. Istel, J. J. R. als Komponist seiner lyrischen Szene;Pygmalion', Leipz.1901); die Abhandlung über die »Vertu la plus nécessaire aux héros« (1769); ein »Dictionnaire de musique« (1767); »Lettres sur la botanique« (deutsch, Leipz.1903); »Dialogues«, Briefe etc. Mehrere Schriften erschienen erst nach seinem Tode, wie »Émile et Sophie, ou les solitaires«, eine schwächliche Fortsetzung des »Èmile«; und die »Confessions«, die vervollständigt wurden durch eine Art Tagebuch: »Les rêveries du promeneur solitaire«, die gegen seinen ausdrücklichen Wunsch schon drei Jahre nach seinem Tode veröffentlicht wurden.
Mehr als Voltaire bestimmte R. die geistige Physiognomie des alternden 18. Jahrh. Aufgewachsen in einer Stadt, die durch harte Kämpfe gegen Gewalt und Übermut frei und groß geworden, in der strenge calvinistische Zucht wahre und tiefe Frömmigkeit nicht ausschloß, mit einem Herzen voll glühender Liebe zur Natur, deren Großartigkeit und Lieblichkeit in ihm einen begeisterten Lobredner fand, trefflich gewappnet mit dem geistigen Rüstzeug des philosophischen Jahrhunderts, ein scharfer Denker, von der feurigsten Beredsamkeit, daneben von einer Betonung des eignen Ich, von einer Selbstsucht und Überhebung, die in ihrer Übertreibung geradezu widerwärtig wirken: so unternimmt er es, die moralischen und politischen Verhältnisse umzuformen, indem er den glänzenden Schleier, der die Fäulnis und das Elend des sozialen Lebens verhüllte, mit kühner Faust zerriß und vollständige Umkehr predigte, die Rückkehr zur natürlichen Empfindung und zur reinen Bürgertugend. Seine Hauptwerke geben uns ein anschauliches Bild seines Systems. Wenn er in der Abhandlung über die Verderblichkeit der Bildung nachwies, daß mit dem Fortschreiten der Kultur der Verfall der Sitten Hand in Hand gegangen sei, daß Irrtum und Vorurteil unter dem Namen Philosophie die Stimme der Vernunft und der Natur erstickt hätten, so zeichnet er im »Émile« das Ideal eines Bürgers und die Mittel, das Kind zu einem solchen zu erziehen. Fern von der Welt und dem verderblichen Einfluß der Gesellschaft soll die Seele des Kindes sich bilden; da der Mensch von Natur gut ist, so braucht nur Irrtum und Laster fern gehalten zu werden; dann wird er von selbst Wissenschaft und Kunst und zuletzt auch Gott finden lernen. Den Glanzpunkt des »Émile« bildet das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars; hier bekennt R. in herrlicher Sprache das tiefe Bedürfnis eines wahren, natürlichen Gefühls nach Religion, nach dem Gotte, dessen Allmacht und Größe seine Werke jeden Tag aufs neue verkünden. Der ungeheure Einfluß, den dieses Buch, das Naturevangelium der Erziehung, wie es Goethe nennt, auf die Zeitgenossen ausübte, ging weit über Frankreichs Grenzen hinaus; Pestalozzi sucht und findet seinen Ruhm in der praktischen Durchführung von Rousseaus Ideen, ohne indes seinen Maßlosigkeiten und Absonderlichkeiten zu folgen. Wie diese beiden Schriften der Afterbildung der Zeit das Ideal wahrer Bildung gegenüberstellen, so versuchen die »Abhandlung über die Ungleichheit unter den Menschen« und der »Gesellschaftsvertrag« die soziale Frage zu lösen. Das erstere Werk unterzieht die bestehenden sozialen Verhältnisse einer vernichtenden Kritik. Weil die Zivilisation den Menschen unglücklich mache, so müsse man zu einem Naturzustand zurückkehren, der dem der Wilden, ja dem der Tiere möglichst gleichkomme. Aus dem Begriff des Eigentums habe sich die Ungleichheit entwickelt, aus der Vereinigung zu gegenseitigem Schutz die Regierung, aus der Erblichkeit der Regierung der Despotismus und die Entartung. Aber ein Despot sei nur so lange Herr, als er die Macht habe, und die Revolution, die einen Herrscher vernichte, sei ebenso gerechtfertigt wie das Schalten und Walten des Herrschers über Leben und Eigentum seiner Untertanen. Diesen leidenschaftlichen, oft unrichtigen und meist übertriebenen Deduktionen gegenüber entwickelt er im »Contrat social« die Grundsätze seines politischen Systems. Die ersten Worte: »Der Mensch ist frei geboren«, bilden den Grundtext des ganzen Buches. Seine Freiheit gibt der Mensch nicht auf, wenn er eine Gesellschaft, einen Staat bildet; darum ist die Gesellschaft allein der Souverän, der Gesamtwille das höchste Gesetz. Der Zweck aber der Gesetze ist Freiheit und Gleichheit. Das Merkwürdigste ist, daß er seiner Republik eine Staatsreligion verleiht, und daß er Andersgläubige verbannt, Abtrünnige mit dem Tode bestraft wissen will. Wie diese Theorien sich in der Praxis ausnehmen, zeigten der Konvent und Robespierre; ein viel höherer Grad von Tyrannei war die notwendige Konsequenz solcher Lehren. Der »Contrat social« hatte einen großartigen Erfolg: der französischen Revolution diente er als Grundbuch; Polen und Korsen stellten an R. die Anforderung, ihnen Verfassungen zu geben. Aber das Geheimnis dieses Erfolgs liegt nicht bloß in der Kühnheit der Ideen, sondern ebensosehr in der vollendeten Form, dem prophetischen Ton, der Sicherheit seiner Logik, der Heftigkeit seiner Angriffe. Nicht geringen Widerhall in den Herzen der Jugend, besonders auch der deutschen, fand die »Neue Heloïse«. Hier zeigt er sich als wahrer Dichter, nicht bloß in den Naturschilderungen, die, wie diejenigen der »Confessions«, von bestrickendem Zauber sind, sondern hauptsächlich in der Darstellung einer tiefen, echten Liebe, der zartesten Empfindung und der glutvollsten Leidenschaft. Juliens Fehltritt aber ist nicht nur unmoralisch, sondern stört auch die Harmonie des Werkes, und wenig gelungen ist die moralisierende Fortsetzung des Romans. Der Einfluß Rousseaus war in Literatur und Kultur so gewaltig, daß er auch heute noch unser Leben bis in seine Tiefen erregt.
Unter den zahlreichen Gesamtausgaben der Werke Rousseaus heben wir hervor: die von Du Peyrou besorgte (Genf u. Par. 1782, 35 Bde.), mit den »Œuvres posthumes« (1782–83, 12 Bde.); die von Villenave und Depping (1817, 8 Bde.); von Musset-Pathay, mit Biographie und Anmerkungen (1823–1826, 23 Bde.); von Hachette (1865, 13 Bde.; neugedruckt 1900 ff.). Die beste Ausgabe des »Contrat social« mit allen Varianten gab Dreyfus-Brisac (Par. 1895). Von deutschen Übersetzungen nennen wir die von Cramer (Berl. 1786–99, 11 Bde.) und die von Ellissen, G. Julius, K. Große, Marx etc. (Leipz. 1843–45, 10 Bde.). Eine Auswahl gab in deutscher Übersetzung Heusinger (Stuttg. 1898, 6 Bde.). Einen Band »Lettres inédites« gab Bosscha (Amsterd. 1858) heraus, andre Briefe Streckeisen-Moulton (»Œvres et correspondences inédites de J. J. R.«, Par. 1861, dann in »R., ses amis et ses ennemis«, das. 1865, 2 Bde.; neue Ausg. 1904), Usteri (Zürich 1886), H. de Rothschild (Par. 1892); »Fragments inédits« veröffentlichte Jansen (Berl. 1882).
Vgl. Musset-Pathay, Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. R. (Par. 1827); Saint-Marc Girardin in der »Revue des Deux Mondes« 1852 bis 1856 (von Bersot herausgegeben: »J. J. R., sa vie et ses ouvrages«, 1875, 2 Bde.); die Biographien von Morin (Par. 1851), Brockerhoff (Leipz.1863–74, 3 Bde.), Th. Vogt (Wien 1870), John Morley (2. Aufl., Lond. 1886), H. G. Graham (zuletzt das. 1899), Mahrenholtz (Leipz.1889), Beaudouin (Par. 1892, 2 Bde.), Chuquet (das. 1893, 3. Aufl. 1906); Moreau, J. J. R. et le siècle philosophe (das. 1870); Desnoiresterres, Voltaire et R. (das. 1874); Braillard, Marc-Monnier u.a., J. J. R. jugé par les Genevois d'aujourd'hui (Genf 1878); Jansen, R. als Musiker (Berl. 1884), R. als Botaniker (das. 1885) und Documents sur J. J. R., 1762 à 1765 (Genf 1885); J. Buy, Origines des idées politiques de R. (das. 1889); Grand-Carteret, R. jugé par les Français d'aujourd'hui (Par. 1890); Texte, J, J. R. et les origines du cosmopolitisme littéraire (das. 1895); Léo Claretie, J. J. R. et ses amies (das. 1896); Mugnier, Mad. de Warens et J. J. R. (das. 1890, neue Ausg. 1904); Eug. Ritter, La famille et la jeunesse de J. J. R. (das. 1896); Windenberger, Essai sur le système de politique étrangère de R. (das. 1899); Compayré, J. J. R. et l'éducation de la nature (das. 1901); Pougin, J. J. R. musicien (das. 1901); Nourrisson, J. J. R. et le Rousseauisme (das. 1903); Louis Thomas, La dernière phase de la pensée religieuse de R. (das. 1904); W. H. Hudson, R. and naturalism in life and thought (Edinb. 1903); Brédif, im caractère intellectuel et moral de J. J. R. (Par. 1906); Sibiril, Histoire médicale de R. (Bordeaux 1900).Von deutschen Werken vgl. noch: E. Schmidt, Richardson, R. und Goethe (Jena 1875); Borgeaud, Rousseaus Religionsphilosophie (Leipz. 1883); O. Schmidt, R. und Byron (Oppeln 1890); Haymann, J. J. Rousseaus Sozialphilosophie (Leipz. 1898); Liepmann, Die Rechtsphilosophie des J. J. R. (Berl. 1898); Höffding, R. und seine Philosophie (2. Aufl., Stuttg. 1902); Möbius, Rousseaus Krankheitsgeschichte (Leipz. 1889, und im 1. Bd. der »Ausgewählten Werke«, 1904). Seit 1905 erscheint in Genf die ihm gewidmete Zeitschrift »Annales de la Société Jean Jacques R.«
Rousseau's Bekenntnisse
Erster Theil
Erstes Buch.
1712 – 1719
Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keinen Nachahmer finden werde. Ich will der Welt einen Menschen in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen, und dieser Mensch werde ich selber sein.
Ich allein. Ich verstehe in meinem Herzen zu lesen und kenne die Menschen. Meine Natur ist von der aller, die ich gesehen habe, verschieden; ich wage sogar zu glauben, nicht wie ein einziges von allen menschlichen Wesen geschaffen zu sein. Bin ich auch nicht besser, so bin ich doch anders. Ob die Natur recht oder unrecht gethan hat, die Form, in der sie mich gegossen, zu zerbrechen, darüber wird man sich erst ein Urtheil bilden können, wenn man mich gelesen hat.
Möge die Posaune des jüngsten Gerichtes ertönen, wann sie will, ich werde mit diesem Buche in der Hand vor dem Richterstuhle des Allmächtigen erscheinen. Ich werde laut sagen: Hier ist, was ich gethan, was ich gedacht, was ich gewesen. Mit demselben Freimuthe habe ich das Gute und das Schlechte erzählt. Ich habe nichts Unrechtes verschwiegen, nichts Gutes übertrieben, und wenn ich mir etwa irgend eine unschuldige Ausschmückung habe zu Schulden kommen lassen, so muß man das meiner Gedächtnisschwäche zu Gute halten, um deren willen ich gezwungen war, hier und da eine Lücke auszufüllen. Ich habe als wahr das voraussetzen können, was meines Wissens wahr sein konnte, nie jedoch das, von dessen Unwahrheit ich überzeugt war. Ich habe mich so dargestellt, wie ich war, verächtlich und niedrig, wann ich es gewesen; gut, edelmüthig, groß, wann ich es gewesen: ich habe mein Inneres enthüllt, wie du selbst, o ewiges Wesen, es gesehen hast. Versammle um mich die unzählbare Schaar meiner Mitmenschen, damit sie meine Bekenntnisse hören, über meine Schwächen seufzen, über meine Schändlichkeiten erröten. Möge dann jeder von ihnen seinerseits zu den Füßen deines Thrones sein Herz mit dem gleichen Freimuth enthüllen, und schwerlich wird dann auch nur ein einziger wagen, zu dir zu sprechen: Ich war besser als jener Mensch!
Ich bin im Jahre 1712 zu Genf von der Bürgerin Susanne Bernard, Ehefrau des Bürgers Isaak Rousseau geboren. Da der dem letzteren zugefallene Antheil an dem sehr mäßigen Vermögen seiner Eltern, in welches sich fünfzehn Geschwister zu theilen hatten, sich fast auf nichts belief, so sah sich mein Vater zur Erwerbung seines Lebensunterhaltes lediglich auf das Uhrmacherhandwerk angewiesen, in welchem er große Geschicklichkeit besaß. Meine Mutter, Tochter des Predigers Bernhard, war reicher, denn sie zeichnete sich durch Klugheit und Schönheit aus. Nicht ohne Mühe hatte mein Vater deshalb ihre Hand erhalten. Ihre Liebe zu einander hatte fast mit ihrem Leben begonnen; schon im Alter von acht bis neun Jahren lustwandelten sie alle Abende zusammen in den Weingärten; mit zehn Jahren konnten sie nicht mehr ohne einander leben. Seelenverwandtschaft und Übereinstimmung der Charaktere befestigte dann noch in ihnen das Gefühl, welches die Gewohnheit erzeugt hatte. Beide, gefühlvoll und liebebedürftig, warteten nur auf den Augenblick, in einem andern die nämliche Anlage zu finden, oder dieser Augenblick wartete vielmehr auf sie selbst, und jedes von ihnen verschenkte sein Herz an das erste, welches bereit war, es anzunehmen. Das Schicksal, welches sich ihrer Leidenschaft entgegenzustellen schien, gab derselben nur neue Nahrung. Der junge Mann, der nicht in den Besitz seiner Geliebten gelangen konnte, verzehrte sich vor Schmerz; sie überredete ihn, einige Zeit das Vaterland zu verlassen, um sie zu vergessen. Er ging auf die Wanderschaft, aber vergebens und kehrte verliebter als je zurück. Auch sie, an der sein Herz hing, hatte ihm Liebe und Treue bewahrt. Nachdem sie diese Probe bestanden hatten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich ewig zu lieben. Sie schworen es sich, und der Himmel segnete ihren Schwur.
Gabriel Bernard, der Bruder meiner Mutter, verliebte sich in eine der Schwestern meines Vaters, aber sie gab ihm ihr Jawort nur unter der Bedingung, daß ihr Bruder die Hand seiner Schwester erhielte. Die Liebe brachte alles in Ordnung, und die beiden Hochzeitsfeste wurden an demselben Tage gefeiert. So wurde mein Onkel der Gatte meiner Tante, und ihre Kinder wurden in doppelter Beziehung meine Geschwisterkinder. In jeder der beiden Familien wurde gegen Ende des Jahres ein Kind geboren. Dann trat noch einmal eine Trennung ein.
Mein Onkel Bernard war Ingenieur; er ließ sich anwerben und diente unter dem Prinzen Eugen im Reiche und in Ungarn. Bei der Belagerung und in der Schlacht von Belgrad zeichnete er sich aus. Mein Vater reiste dagegen nach der Geburt meines einzigen Bruders nach Konstantinopel, wohin er als Uhrmacher des Serails berufen war. Während seiner Abwesenheit wurden der Schönheit, dem Geiste und den Talenten meiner Mutter vielfache Huldigungen dargebracht. Am eifrigsten machte ihr Herr de la Closure, der französische Resident, den Hof. Seine Leidenschaft muß in der That groß gewesen sein, da er noch dreißig Jahre später von Rührung ergriffen wurde, als er mir von ihr erzählte. Um sich aller dieser Umwerbungen zu erwehren, hatte meine Mutter noch eine größere Stütze als ihre Tugend allein: sie liebte ihren Gatten zärtlich, und drängte ihn zurückzukehren. Er ließ alles im Stich und kehrte heim. Ich wurde die traurige Frucht dieser Rückkehr. Zehn Monate später wurde ich als ein schwächliches und kränkliches Kind geboren. Ich kostete meiner Mutter das Leben, und meine Geburt war mein erstes Unglück.
Ich habe nicht erfahren, wie mein Vater diesen Verlust ertrug, so viel aber weiß ich, daß er sich nie darüber tröstete. Er glaubte sie in mir wieder zu sehen, ohne deswegen vergessen zu können, daß ich sie ihm geraubt hatte. So oft er mich umarmte, merkte ich an seinen Seufzern, wie an seiner krampfhaften Umschlingung, daß sich ein bitterer Kummer seinen Liebkosungen, die dadurch nur um so zärtlicher wurden, beigesellte. Wenn er zu mir sagte: »Jean Jacques, laß uns von deiner Mutter reden,« so antwortete ich ihm: »Du hast also Lust zu weinen, Vater,« und dieses Wort allein entlockte ihm schon Thränen. »Ach,« sagte er dann seufzend, »gieb sie mir wieder, tröste mich über sie, fülle die Lücke aus, die sie in meinem Herzen gelassen hat! Würde ich dich so lieben, wenn du nur mein Sohn wärest?« – Vierzig Jahre nach ihrem Verluste ist er in den Armen einer zweiten Frau gestorben, aber mit dem Namen der ersten auf den Lippen und mit ihrem Bilde auf dem Grunde seines Herzens.
So waren die Urheber meiner Tage. Von allen Gaben, mit denen der Himmel sie ausgestattet hatte, ist ein gefühlvolles Herz, die einzige, welche sie mir hinterließen; während es aber für sie die Quelle des Glückes gewesen war, wurde es für mich die Quelle des Unglücks während meines ganzen Lebens.
Bei meiner Geburt war ich kaum lebensfähig; man hatte wenig Hoffnung, mich zu erhalten. Ich brachte den Keim eines Leidens mit auf die Welt, welches die Jahre entwickelt haben und das mir nicht nur hin und wieder eine kurze Ruhe gönnt, um sich mir dafür auf andere Weise um so grausamer fühlbar zu machen. Eine Schwester meines Vaters, ein liebenswürdiges und kluges Mädchen, pflegte mich mit so großer Sorgfalt, daß ihr meine Rettung gelang. In dem Augenblicke, da ich dieses schreibe, ist sie noch am Leben, im Alter von achtzig Jahren einen Mann pflegend, der jünger als sie, aber durch die Trunksucht heruntergekommen und geschwächt ist. Liebe Tante, ich verzeihe dir, mich am Leben erhalten zu haben, und bedaure, dir am Ende deiner Tage nicht die zärtliche Sorge vergelten zu können, die du am Beginn der meinigen an mich verschwendet hast. Auch meine Wärterin, Jacqueline, ist noch am Leben, gesund und kräftig. Die Hände, welche mir die Augen bei meiner Geburt öffneten, werden sie mir bei meinem Tode zudrücken können.
Ich fühlte, ehe ich dachte; das ist das gemeinsame Schicksal der Menschheit. Ich erfuhr es in einem höheren Grade als andere. Ich erinnere mich nicht, was ich bis zu einem Alter von fünf oder sechs Jahren that. Ich weiß nicht, wie ich lesen lernte; ich entsinne mich nur noch meiner ersten Lectüre und wie sie auf mich wirkte; von dieser Zeit an beginnt mein ununterbrochenes Selbstbewußtsein. Meine Mutter hatte Romane hinterlassen. Wir, mein Vater und ich, fingen an, sie nach dem Abendessen zu lesen. Zuerst handelte es sich nur darum, mich durch unterhaltende Bücher im Lesen zu üben; aber bald wurde das Interesse so lebhaft, daß wir abwechselnd unaufhörlich lasen und selbst die Nächte bei dieser Beschäftigung zubrachten. Wir konnten uns nicht überwinden, vor Beendigung eines Bandes aufzuhören. Mitunter sagte mein Vater, wenn er gegen Morgen die Schwalben schon zwitschern hörte, ganz beschämt: »Laß uns zu Bette gehen, ich bin noch mehr Kind als du.«
Auf diesem gefährlichen Wege eignete ich mir nicht allein in kurzer Zeit eine außerordentliche Gewandtheit im Lesen und Auffassen an, sondern auch ein für mein Alter ungewöhnliches Verständnis der Leidenschaften. Während es mir noch an jedem Begriffe von den wirklichen Verhältnissen fehlte, hatte ich bereits einen Einblick in die Welt der Gefühle gewonnen. Ich hatte nichts begriffen, aber alles gefühlt. Die unklaren Vorstellungen, die ich nach einander in mich aufnahm, konnten der Vernunft, die ich noch nicht hatte, zwar nicht schädlich sein, aber sie waren doch die Ursache, daß die meinige ganz eigenartig wurde, und brachten mir über das menschliche Leben höchst wunderliche und schwärmerische Begriffe bei, von denen mich Erfahrung und Nachdenken nie haben vollkommen heilen können.
1719 – 1723
Die Romane hatten wir bis zum Sommer 1719 ausgelesen. Der folgende Winter verschaffte uns Abwechselung. Da uns die Bibliothek meiner Mutter nicht mehr Neues bot, nahmen wir zu den Büchern unsere Zuflucht, die uns aus der Erbschaft ihres Vaters zugefallen waren. Glücklicherweise befanden sich darunter gute Bücher, und das ist leicht erklärlich, da sie zwar von einem Geistlichen, und noch dazu einem gelehrten, worauf man damals großes Gewicht legte, aber doch einem Manne von Geschmack und Geist angeschafft worden waren. Die Geschichte der Kirche und des deutschen Kaiserreichs von Le Sueur, Bossuets Vorlesungen über die allgemeine Weltgeschichte, Plutarchs Lebensbeschreibungen berühmter Männer, die Geschichte Venedigs von Nani, Ovids Verwandlungen, La Bruyère, die Himmelskörper von Fontenelle, seine Todtengespräche, sowie einige Bände von Molière wurden in das Arbeitszimmer meines Vaters hinübergebracht und täglich las ich ihm, während er sich seiner Beschäftigung hingab, daraus vor. Ich fand eine eigenthümliche und in diesem Alter vielleicht nie wieder vorkommende Freude daran. Besonders wurde Plutarch meine Lieblingslectüre. Der Genuß, mit dem ich ihn immer und immer wieder las, heilte mich ein wenig von den Romanen, und bald zog ich Agesilaos, Brutus und Aristides dem Orondates, Artamenes und Juba vor. Durch diese fesselnde Lectüre und die Gespräche, welche sie zwischen meinem Vater und mir hervorriefen, entwickelte sich in mir jener freie und republikanische Geist, jener unzähmbare und stolze Charakter, der, unfähig Unterjochung und Knechtschaft zu ertragen oder mit anzusehen, mich mein Lebenlang gefoltert hat, und noch dazu zumeist in Verhältnissen, die am wenigsten danach angethan waren, ihm Erfolg zu versprechen. Unaufhörlich mit Rom und Athen beschäftigt, gleichsam im steten Verkehre mit den großen Männern derselben lebend, selbst geborener Bürger einer Republik und Sohn eines Vaters, dessen stärkste Leidenschaft die Vaterlandsliebe war, entflammte mich sein Beispiel; ich hielt mich für einen Griechen oder Römer; ich versetzte mich in die Lage der Person, deren Lebensbeschreibung ich las; bei der Erzählung der Züge von Ausdauer und Unerschrockenheit, die mich ergriffen hatten, leuchteten meine Augen auf und wurde meine Stimme kräftiger. Als ich eines Tages die bekannte Geschichte von Scävola erzählte, erschraken alle Anwesende, als sie sahen, wie ich mit einem Male aufsprang und die Hand über ein Kohlenbecken hielt, um ihnen seine That zu veranschaulichen.
Ich hatte einen Bruder, der sieben Jahre älter war als ich. Er lernte das Geschäft meines Vaters. Bei der grenzenlosen Liebe, die man für mich hegte, wurde er ein wenig vernachlässigt, und ich kann das keineswegs billigen. In seiner Erziehung machten sich die Nachwehen dieser Vernachlässigung bemerkbar. Er zeigte vor der Zeit einen Hang zu einem ausschweifenden Leben. Man gab ihn bei einem andern Meister in die Lehre, bei dem er nicht weniger muthwillige Streiche verübte, als im väterlichen Hause. Ich sah ihn fast nie, ich kann kaum sagen, ihn gekannt zu haben, aber trotzdem liebte ich ihn zärtlich, und er erwiderte meine Liebe, so viel ein Gassenbube etwas lieben kann. Ich erinnere mich, daß ich mich einmal, als ihn mein Vater derb und im Zorne züchtigte, ungestüm zwischen beide warf und ihn fest in meine Arme schloß. Auf diese Weise schützte ich ihn mit meinem Leibe, indem ich die ihm zugedachten Schläge erhielt, und ich blieb so hartnäckig in dieser Stellung, daß mein Vater endlich Gnade vor Recht ergehen ließ, sei es nun durch mein Geschrei und meine Thränen entwaffnet, oder um mich nicht mehr zu mißhandeln als ihn. Endlich gerieth mein Bruder auf so traurige Abwege, daß er plötzlich davon lief und verschwand. Einige Zeit nachher erfuhr man, daß er sich in Deutschland befände. Er schrieb nicht ein einziges Mal. Seit jener Zeit hat man nichts von ihm gehört, und so bin ich der einzige Sohn geblieben.
Ließ bei diesem armen Knaben die Erziehung viel zu wünschen übrig, so war dies bei seinem Bruder nicht der Fall. Kindern von Königen hätte keine größere Sorgfalt bewiesen werden können, als ich mich deren in meinen ersten Jahren zu erfreuen hatte, – angebetet von meiner ganzen Umgebung, und was viel seltener ist, als ein geliebtes, aber nicht als ein verzogenes Kind behandelt. Auch nicht ein einziges Mal bis zu meinem Austritt aus dem väterlichen Hause hat man mich mit den andern Kindern allein auf der Straße umherlaufen lassen; niemals hatte man in mir einen jener launischen Einfälle zu unterdrücken oder zu befriedigen, welche man dem Charakter zuschreibt, während sie doch lediglich eine Folge der Erziehung sind. Ich hatte die Fehler meines Alters: ich plauderte gern, aß viel, log auch bisweilen. Ich wäre im Stande gewesen Obst, Bonbons, Eßwaaren zu stehlen; aber nie habe ich Freude daran gefunden, Jemandem ein Leid zuzufügen, Schaden anzurichten, andere zu beschuldigen oder arme Thiere zu quälen. Ich erinnere mich jedoch, einmal den Topf einer unserer Nachbarinnen, einer Frau Clot, während sie dem Gottesdienste beiwohnte, verunreinigt zu haben. Ich bekenne sogar, daß ich bei dieser Erinnerung noch immer lachen muß, weil Frau Clot, im Uebrigen eine ganz gute Frau, die brummigste Alte war, die ich in meinem ganzen Leben gekannt habe. Das ist die kurze und wahrhafte Geschichte aller meiner kindlichen Uebelthaten.
Wie hätte ich schlecht werden können, wenn ich nur Beispiele von Sanftmuth vor Augen und die besten Menschen von der Welt um mich hatte? Mein Vater, meine Tante, meine Wärterin, meine Verwandten, unsere Freunde, unsere Nachbarn, kurz meine ganze Umgebung, gehorchte mir zwar, liebte mich aber, und ich liebte sie wieder. Mir wurde so wenig Gelegenheit gegeben, auf meinem Willen zu bestehen, und ich fand so wenig Widerspruch, daß es mir gar nicht in den Sinn kommen konnte, Eigenwillen zu zeigen. Ich kann beschwören, daß ich, bis ich mich unter den Willen eines Meisters beugen mußte, nicht gewußt habe, was eigensinnige Launen sind. Außer der Zeit, die ich bei meinem Vater mit Lesen oder Schreiben zubrachte, und derjenigen, in welcher mich meine Wärterin spazieren führte, war ich beständig bei meiner Tante und saß oder stand neben ihr, um zuzusehen, wie sie stickte, oder ihrem Gesange zu lauschen, und das genügte mir bei meiner Anspruchslosigkeit. Ihr Frohsinn, ihre Sanftmuth, ihr anmuthiges Gesicht haben mir so lebhafte Eindrücke hinterlassen, daß ich noch immer ihre Mienen, ihren Blick, ihre Haltung vor mir sehe; ich entsinne mich ihrer Schmeichelworte, ich vermöchte noch ihre Kleidung und Frisur zu beschreiben, ohne die beiden Locken zu vergessen, welche ihr schwarzes Haar an den Schläfen bildete, wie es die damalige Mode verlangte.
Ich bin überzeugt, daß ich ihr den Geschmack oder vielmehr die Leidenschaft für die Musik verdanke, die sich erst viel später in mir entwickelt hat. Sie wußte eine erstaunliche Menge Melodien und Lieder, die sie mit schwacher, aber sehr wohlklingender Stimme sang. Die Seelenheiterkeit dieses vortrefflichen Mädchens ließ weder in ihr noch in meiner Umgebung je ein träumerisches Sinnen oder trübe Gedanken aufkommen. Der Reiz, der in dem Gesange meiner Tante für mich lag, war so gewaltig, daß mir nicht allein mehrere ihrer Lieder stets im Gedächtnis geblieben sind, sondern daß mir sogar jetzt, wo ich es fast ganz verloren habe, je älter ich werde, immer wieder andere, die ich seit meiner Kindheit völlig vergessen hatte, erinnerlich werden und einen unbeschreiblichen Zauber auf mich ausüben. Sollte man es glauben, daß ich alter Knabe, von Sorgen und Mühen aufgerieben, mich bisweilen dabei ertappe, wie mir, als ob ich ein Kind wäre, die Thränen in die Augen treten, wenn ich eines dieser Liedchen mit schwacher und zitternder Stimme vor mich hinsinge? Namentlich befindet sich eines darunter, dessen Melodie mir vollkommen wieder eingefallen ist; dagegen kann ich mich, so viel Mühe ich mir auch gegeben habe, auf die zweite Hälfte der Worte nicht mehr besinnen, obgleich ich mich der Endreime dunkel erinnere. Der Anfang und das Wenige, was ich noch behalten habe, lautet:
Tircis, je n'ose Ecouter ton chalumeau Sous l'ormeau; Car on en cause Déjà dans notre hameau. - - - - - - - - - - - - - un berger - - - - s'engager - - - - sans danger Et toujours l'épine est sous la rose.
Umsonst frage ich mich, worin eigentlich der rührende Reiz liegt, den mein Herz bei diesem Liede empfindet. Es ist eine Seltsamkeit, die ich mir nicht zu erklären vermag, allein es ist mir vollkommen unmöglich, es bis zu Ende zu singen, ohne von meinen Thränen unterbrochen zu werden. Hundertmal habe ich mir vorgenommen, nach Paris zu schreiben, um mich nach dem Reste der Worte erkundigen zu lassen, falls sie dort noch irgend jemand kennen sollte. Aber ich bin fast sicher, daß das Vergnügen, welches mir die Rückerinnerung an dieses Lied gewährt, zum Theil verschwinden würde, wenn ich den Beweis in Händen hätte, daß es auch andere als meine arme Tante Susanne gesungen haben.
So waren meine ersten Gefühle bei meinem Eintritt in das Leben; so begann sich in mir jenes so stolze und doch auch wieder so zärtliche Herz zu bilden oder zu zeigen, jener weichliche, aber doch unzähmbare Charakter, der, beständig zwischen Schwäche und Muth, Weichlichkeit und Kraft schwankend, mich bis zu diesem Augenblick in Widerspruch mit mir selbst gesetzt hat und die Ursache ist, daß ich mir Enthaltsamkeit und Genuß, Vergnügen und Mäßigung gleich wenig nachsagen kann.
Diese Erziehungsweise wurde durch ein Ereignis unterbrochen, dessen Folgen auf mein ganzes übriges Leben voll Einfluß waren. Mein Vater hatte mit einem Herrn Gautier, Hauptmann in französischen Diensten und fast mit dem ganzen Rathe verschwägert, eine Rauferei. Dieser Gautier, ein frecher und ehrloser Mensch, hatte aus ihr eine blutige Nase davon getragen, und um sich zu rächen, klagte er meinen Vater an, auf städtischem Gebiete den Degen gezogen zu haben. Mein Vater, den man gefänglich einziehen wollte, verlangte, daß man den Ankläger nach dem Gesetze eben so gut wie ihn in das Gefängnis führte. Da er dies nicht durchzusetzen vermochte, verließ er lieber Genf und wohnte während seiner übrigen Lebenszeit außerhalb seines Vaterlandes, als daß er in einem Punkte nachgab, bei dem ihm Ehre und Freiheit gefährdet schienen.
Ich blieb unter dem Schutze meines Onkels Bernhard, der damals bei den Festungsbauten von Genf Anstellung gefunden hatte, zurück. Seine älteste Tochter war todt, aber er hatte einen Sohn von meinem Alter. Wir wurden beide bei dem Pfarrer Lambercier in Vassey in Kost gegeben, um dort neben dem Latein all jenen nichtssagenden Kram zu lernen, ohne den man sich eine richtige Erziehung gar nicht denken zu können scheint.
Zwei auf dem Lande verlebte Jahre nahmen mir etwas von meiner römischen Schroffheit und verliehen mir wieder Kindlichkeit. In Genf, wo man mir nichts aufgab, arbeitete und las ich gern, und hatte daran fast meine einzige Freude; in Vassey flößten mir die vielen Arbeiten Lust zum Spielen ein, bei dem ich Erholung fand. Das Landleben war mir etwas so Neues, daß ich seiner Genüsse gar nicht müde werden konnte. Ich faßte für dasselbe eine so große Vorliebe, daß sie nie wieder völlig in mir erloschen ist. Die Erinnerung an jene glücklichen Tage, die ich auf dem Lande zubrachte, hat mich in jeder Lebenszeit bis zu der, welche mir die Rückkehr auf das Land wieder gestattete, mit Sehnsucht nach ihm und seinen Freuden erfüllt. Herr Lambercier war ein sehr vernünftiger Mann, der, ohne unsern Unterricht zu vernachlässigen, uns doch nicht mit Aufgaben überbürdete. Als Beweis für die Richtigkeit seiner Methode kann der Umstand dienen, daß ich trotz meiner Abneigung gegen allen Zwang doch nie mit Unlust meiner Unterrichtsstunden gedacht habe, und daß, wenn ich auch nicht gerade viel von ihm lernte, ich mir doch das Wenige ohne Mühe aneignete, und davon nichts vergessen habe.
Der Einfachheit dieses ländlichen Lebens verdanke ich ein unschätzbares Gut, indem es mir das Herz für die Freundschaft öffnete. Bis dahin hatte ich wohl edele, aber doch nur eingebildete Empfindungen gekannt. Die Gewohnheit, friedlich zusammen zu leben, verband mich innig mit meinem Vetter Bernhard. In kurzer Zeit hegte ich für ihn freundschaftlichere Gefühle, als einst für meinen Bruder, und nie sind diese erloschen. Er war ein hoch aufgeschossener, sehr schwächlicher und zarter Knabe, eben so sanft von Gemüth wie schwächlich von Körper, welcher die Vorliebe, die man für ihn als den Sohn meines Vormundes im Hause hatte, nicht allzu sehr mißbrauchte. Unsere Arbeiten, unsere Vergnügungen, unsere Neigungen waren die nämlichen. Wir waren allein, wir waren von demselben Alter, und jeder von uns bedurfte eines Genossen; durch unsere Trennung würde man uns gewissermaßen vernichtet haben. Obgleich uns wenig Gelegenheit gegeben war, unsere gegenseitige Anhänglichkeit an den Tag zu legen, so war sie doch außerordentlich innig, und wir konnten nicht allein keinen Augenblick von einander getrennt leben, sondern konnten uns auch nicht einmal die Möglichkeit einer dereinstigen Trennung vorstellen. Alle beide bei freundlichem Entgegenkommen leicht zu lenken und, sobald uns kein Zwang auferlegt wurde, willig und dienstfertig, befanden wir uns stets über alles im Einverständnis. Wenn ihm, so lange wir unter den Augen unserer Erzieher waren, von denselben ein gewisser Vorzug vor mir eingeräumt wurde, so hatte ich, wenn wir allein waren, wieder einen solchen vor ihm, was das Gleichgewicht herstellte. In unseren Lehrstunden sagte ich ihm vor, wenn er seine Aufgabe nicht weiter wußte; war meine Arbeit beendigt, so half ich ihm bei der seinigen, und bei unsern Spielen und Zerstreuungen war ich bei meinem lebhafteren Sinn immer der Tonangeber. Kurz, unsere beiden Charaktere vertrugen sich so gut, und die Freundschaft, welche uns vereinigte, war so aufrichtig, daß wir während unseres mehr als fünfjährigen Aufenthalts zu Vassey und Genf fast unzertrennlich waren. Wir schlugen uns zwar oft mit einander, aber nie brauchte man uns auseinander zu bringen, nie währte eine unserer Streitigkeiten länger als eine Viertelstunde, und auch nicht ein einziges Mal verklagten wir uns gegenseitig. Mögen diese Bemerkungen auch, wenn man will, kindisch erscheinen, so sind sie doch für ein in der Kinderwelt fast einzig dastehendes Beispiel bezeichnend.
Das Leben in Vassey gefiel mir so wohl, daß es bei längerer Dauer bestimmend auf meinen Charakter eingewirkt haben würde. Die zärtlichen, liebevollen, friedlichen Gefühle bildeten die Grundlage desselben. Ich bin überzeugt, daß nie ein Individuum unserer Gattung von Natur weniger Eitelkeit besaß als ich. In Augenblicken der Begeisterung wurde ich von erhabenen Gemüthsregungen ergriffen, aber ich sank sofort wieder in meine Schlaffheit zurück. Von allem, was mir nahte, geliebt zu werden, war mein sehnlichstes Verlangen. Ich war sanft, mein Vetter gleichfalls; auch die, welche uns erzogen, waren es. Zwei volle Jahre war ich weder Zeuge noch Opfer einer heftigen Empfindung. Alles nährte die natürlichen Anlagen meines Herzens. Ich kannte keine größere Wonne, als jedermann mit mir und allen Dingen zufrieden zu sehen. Stets werde ich dessen eingedenk bleiben, wie mich bei der Kinderlehre in der Kirche, wenn ich einmal beim Aufsagen des Katechismus stockte, nichts mehr in Verwirrung setzte, als die Zeichen von Unruhe und Aerger, welche auf Fräulein Lamberciers Gesichte deutlich hervortraten. Dies allein betrübte mich mehr als die Scham über meine öffentlich an den Tag gelegte Unwissenheit, wie sehr ich auch unter diesem Gedanken litt; denn so wenig ich auch für Lob empfänglich war, so war ich es doch um so mehr für Beschämung, und ich kann hier versichern, daß ich weniger durch die Erwartung der Vorwürfe des Fräulein Lambercier beunruhigt wurde, als durch die Furcht, sie zu betrüben.
Gleichwohl fehlte es ihr im Nothfalle eben so wenig wie ihrem Bruder an Strenge; aber da diese fast in jedem Falle gerechte Strenge nie das Maß überschritt, so schmerzte sie mich zwar, ließ aber keinen Gedanken an Widersetzlichkeit in mir aufkommen. Ich litt unter dem Gefühle zu mißfallen mehr als unter der Strafe, und das Zeichen der Unzufriedenheit bereitete mir größere Qualen als die körperliche Züchtigung. Es setzt mich in Verlegenheit, mich deutlicher darüber auszusprechen, allein ich halte es für nöthig. Eine wie ganz andere Strafweise würde man gegen die Jugend in Anwendung bringen, wenn man die Nachwirkungen der jetzt Üblichen, deren man sich immer unterschiedslos und oft unvorsichtig bedient, besser einsähe! Die große Lehre, welche man einem eben so allgemeinen als verderblichen Beispiele entnehmen kann, bestimmt mich, es anzuführen.
Da Fräulein Lambercier uns mit der Liebe einer Mutter zugethan war, nahm sie auch deren Gewalt über uns in Anspruch und trieb dieselbe mitunter so weit, daß sie uns auch, wenn wir es verdient hatten, wie eine Mutter ihr Kind, züchtigte. Ziemlich lange ließ sie es bei der Drohung bewenden, und diese Androhung einer mir ganz neuen Strafe versetzte mich in großen Schrecken; aber nach ihrer Erduldung fand ich sie weniger schrecklich, als ich sie mir in der Erwartung vorgestellt hatte, ja, was noch eigenthümlicher ist, diese Züchtigung flößte mir noch größere Zuneigung zu der ein, die sie mir ertheilt hatte. Es gehörte sogar die ganze Aufrichtigkeit dieser Zuneigung und meine natürliche Folgsamkeit dazu, um mich davon zurückzuhalten, absichtlich eine Unart zu begehen, die in gleicher Weise hätte geahndet werden müssen; denn der Schmerz und selbst die Scham war mit einem Gefühle von Sinnlichkeit verbunden gewesen, das in mir eher das Verlangen, es von derselben Hand von Neuem erregt zu sehen, als die Furcht davor zurückgelassen hatte. Da dies ohne Zweifel von einer vorzeitigen Regung des Geschlechtstriebes herrührte, würde ich allerdings in der nämlichen Züchtigung von der Hand ihres Bruders nichts Angenehmes gefunden haben. Allein bei seinem Charakter brauchte ich nicht leicht zu befürchten, daß er bei Ertheilung der Strafe seine Schwester vertreten würde, und wenn ich es trotzdem vermied, eine Züchtigung zu verdienen, so geschah es lediglich aus Besorgnis, Fräulein Lambercier zu erzürnen; denn so große Gewalt übt die Zuneigung, selbst wenn sie nur ein Ausfluß der Sinnlichkeit ist, auf mich aus, daß sie letztere stets in Schranken hält.
Die Wiederholung der körperlichen Strafe, der ich, ohne sie zu fürchten, aus dem Wege ging, geschah ohne mein Verschulden, das heißt ohne daß ich sie absichtlich veranlaßt hätte, und ich kann sagen, daß ich sie getrost und nicht ohne einen geheimen Reiz über mich ergehen ließ. Aber dieses zweite Mal war auch das letzte, denn Fräulein Lambercier, die ohne Zweifel an irgend einem Zeichen gemerkt hatte, daß diese Züchtigung ihren Zweck nicht erfüllte, erklärte, daß sie mit einer solchen Bestrafung nichts mehr zu thun haben wollte, da dieselbe sie zu sehr ermüdete. Bis dahin hatten wir in ihrem Zimmer geschlafen und im Winter sogar hin und wieder in ihrem Bette. Zwei Tage später erhielten wir ein besonderes Schlafzimmer, und ich genoß von nun an die Ehre, auf die ich gern verzichtet hätte, von ihr als erwachsener Knabe behandelt zu werden.
Wer sollte glauben, daß diese in einem Alter von acht Jahren von der Hand eines Mädchens von dreißig Jahren empfangene Züchtigung über meine Neigungen, meine Begierden, meine Leidenschaften, über mich selbst für meine ganze übrige Lebenszeit entschieden hat und noch dazu in einer Weise, daß gerade das Gegentheil der von ihr erwarteten Folgen hervorgerufen wurde? Von dem Augenblicke des Erwachens meiner Sinnlichkeit an verirrten sich meine Begierden dergestalt, daß sie, da sie sich auf das, was ich empfunden hatte, beschränkten, nie den Antrieb fühlten, etwas Anderes zu suchen. Trotz meines fast von meiner Geburt an sinnlich erhitzten Blutes hielt ich mich bis zu dem Alter, in dem sich auch der kältesten und am langsamsten heranreifenden Naturen entwickeln, von jeder Befleckung rein. Lange gepeinigt, ohne zu wissen wovon, verschlang ich mit brennenden Augen schöne Mädchenerscheinungen; unaufhörlich stellte meine Einbildungskraft mir ihr Bild wieder vor die Seele, einzig und allein um sie mir in der Ausübung des Strafakts zu zeigen, und eben so viele Fräulein Lambercier aus ihnen zu machen.
Selbst nach erreichter Mannbarkeit hat mir dieser eigenthümliche und verdorbene, ja an Verrücktheit streifende Geschmack, der sich nie verloren hat, die Sittenreinheit bewahrt, die er mir dem Anschein nach hätte rauben müssen. Wenn je eine Erziehung keusch und züchtig war, so war es sicherlich die, welche ich erhalten habe. Meine drei Tanten waren nicht allein von musterhafter Sittsamkeit, sondern auch von einer Zurückhaltung, welche die Frauen schon seit lange nicht mehr kennen. Mein Vater, der sehr lebenslustig war, aber bei seinen Galanterien noch der alten Mode huldigte, hat in Gegenwart der Frauen, die er am meisten liebte, nie ein Wort über die Lippen gebracht, welches dem jungfräulichsten Wesen hätte Schamröthe auf die Wangen treiben können, und wol nirgends hat man die Rücksicht, die man den Kindern schuldig ist, weiter getrieben als in meiner Familie und meiner Gegenwart. Bei Herrn Lambercier fand ich in dieser Hinsicht die gleiche Vorsicht, und hier wurde eine sonst sehr gute Magd um eines etwas schlüpfrigen Wortes willen, das ihr uns gegenüber entschlüpft war, entlassen. Nicht allein hatte ich bis zu meinem Jünglingsalter keine klare Vorstellung von der Vereinigung der Geschlechter, sondern die verworrene Vorstellung davon stellte sich mir auch nur unter einem ekelhaften und widrigen Bilde dar. Oeffentliche Dirnen flößten mir einen Abscheu ein, der mir bis zu dieser Stunde treu geblieben ist; einen Wüstling konnte ich nicht ohne Verachtung, ja nicht ohne Schrecken sehen. Bis zu diesem Grade hatte sich mein Widerwille gegen jede Ausschweifung gesteigert, seitdem ich einmal in Klein-Sacconex auf einem Gange durch einen Hohlweg auf beiden Seiten desselben Gruben gesehen, in denen, wie man mir sagte, derartige Leute ihre Orgien feierten. So oft ich daran dachte, fiel mir unwillkürlich das Gebahren der Hunde in der Brunstzeit ein, und schon bei der blosen Vorstellung davon empörte sich mein Herz.
Diese mir durch die Erziehung eingeimpfte Vorstellung, an sich schon geeignet, die ersten Ausbrüche eines leicht entzündlichen Temperamentes aufzuhalten, wurde, wie gesagt, durch die Wendung unterstützt, welche das erste Erwachen der Sinnlichkeit in mir nahm. Mit meinen Gedanken nur immer bei dem weilend, was ich empfunden hatte, wußte ich trotz der oft sehr lästigen Wallungen des Blutes meine Begierden nur auf die Art der Wollust zu lenken, die mir bekannt war, ohne mich je derjenigen zuzuwenden, die man mir verhaßt gemacht hatte, und die doch, ohne daß ich es im geringsten ahnte, mit der andern im engsten Zusammenhange stand. In meinen thörichten Einbildungen, in meinen erotischen Tollheiten, in den überspannten Handlungen, zu denen mich dieselben nicht selten trieben, mußte mir in der Einbildung das andere Geschlecht seine Hilfe leihen, ohne daß ich je auf den Gedanken gerieth, daß es zu einer anderen Dienstleistung geeignet sei, als zu der, zu welcher ich es heranzuziehen brannte.
Auf diese Weise habe ich nicht allein trotz eines sehr feurigen, sehr wollüstigen, sehr früh entwickelten Temperamentes dennoch das Alter der Mannbarkeit erreicht, ohne andere sinnliche Genüsse zu verlangen oder zu kennen, als die, von denen Fräulein Lambercier sehr unschuldiger Weise eine Vorstellung in mir erweckt hatte, sondern es mußte mir auch, als ich im Laufe der Jahre zum Manne herangereift war, das, was mich hätte verderben müssen, zu meinem Schutze dienen. Mein alter kindlicher Geschmack verlor sich nicht etwa, sondern verschmolz im Gegentheile dergestalt mit dem andern, daß ich ihn nie aus meinen sinnlichen Begierden entfernen konnte; und diese Narrheit hat mich in Verbindung mit meiner angeborenen Schüchternheit bei den Frauen stets sehr wenig unternehmend gemacht, weil ich weder alles zu sagen wagte, noch alles zu thun vermochte, indem die Art von Genuß, wovon der andere in meinen Augen nur als das letzte Ziel galt, von dem, welcher ihn ersehnte, nicht verlangt, noch von derjenigen, von der die Erfüllung abhing, errathen werden konnte. So habe ich mein Leben lang trotz aller Gelüste den Personen gegenüber, die ich am meisten liebte, geschwiegen. Unfähig, meinen Geschmack einzugestehen, befriedigte ich ihn durch den Umgang mit Persönlichkeiten, die ihn in mir wach erhielten. Vor einer herrischen Geliebten auf den Knien liegen, ihrem leisesten Winke nachkommen, sie um Verzeihung anflehen, das waren für mich selige Genüsse, und je mehr meine lebhafte Einbildungskraft mir das Blut erhitzte, desto mehr hatte ich das Aussehen eines blöden Liebhabers. Eine derartige Liebeswerbung erzielt begreiflicherweise keine schnellen Erfolge und ist der Tugend der Frauen, denen man seine Huldigungen darbringt, nicht sehr gefährlich. Ich habe deshalb wenig besessen, allein dessenungeachtet auf meine Weise, das heißt in der Einbildung viele Genüsse gehabt. So hat mir gerade meine Sinnlichkeit, die meinem schüchternen Wesen und meinem schwärmerischen Geiste entsprach, die Unschuld meiner Gefühle und die Reinheit meiner Sitten bewahrt, und gerade mit Hilfe desselben Geschmacks, der mich, wenn ich ein wenig frecher aufgetreten wäre, vielleicht in die gemeinsten Wollüste hineingezogen hätte.
Ich habe den ersten Schritt, der mir am schwersten geworden ist, in das düstre und schmutzige Labyrinth meiner Bekenntnisse gethan. Nicht das Geständnis dessen, was verbrecherisch ist, kostet am meisten Ueberwindung, sondern die offene Einräumung dessen, was lächerlich und beschämend ist. Von nun an bin ich meiner sicher; nachdem ich den Muth gehabt habe, so viel zu sagen, kann mich nichts mehr zurückhalten. Wie schwer mir solche Geständnisse angekommen sind, kann man daraus schließen, daß ich es nie in meinem Leben habe über mich gewinnen können, meine Tollheit denen zu bekennen, die ich doch mit einer so rasenden Leidenschaft liebte, daß ich nicht zu sehen und zu hören vermochte, daß ich völlig außer mir gerieth und mein ganzer Körper von einem krampfhaften Zittern befallen wurde. Auch in den Stunden der innigsten Vertraulichkeit hatte ich nicht das Herz, sie um Gewährung der einzigen Gunsterweisung zu bitten, die mir zu den übrigen noch fehlte. Diese ist mir nur einmal in meinen Kinderjahren von einem Mädchen meines Alters zu Theil geworden, und noch dazu ging von diesem der Vorschlag aus.
Indem ich so bis zu den ersten Eindrücken meines Gefühllebens zurückgehe, finde ich Elemente, die, so unvereinbar sie auch bisweilen erscheinen, doch gemeinschaftlich dazu beigetragen haben, eine gleichmäßige und einfache Wirkung in ausgeprägtesten Farben hervorzubringen. Wieder andere finde ich, die, dem Anschein nach die nämlichen, durch das Zusammentreffen gewisser Umstände so verschiedene Verflechtungen herbeigeführt haben, daß man nie auf die Vermuthung kommen könnte, daß diese Elemente in irgend einem Zusammenhange ständen. Wer sollte zum Beispiel glauben, daß auf dieselbe Quelle, aus der Wollust und Sinnlichkeit in mein Blut geströmt sind, eine der kräftigsten Triebfedern meiner Seele zurückzuführen ist? Indem ich bei dem Gegenstande, welchen ich so eben besprochen habe, noch einen Augenblick verweile, wird sich der Leser sogleich überzeugen, daß derselbe auch einen andern, gar sehr verschiedenen Eindruck ausgeübt hat.
Eines Tages lernte ich in dem an die Küche stoßenden Zimmer allein meine Aufgabe. Die Magd hatte die Kämme des Fräulein Lambercier auf die Kaminplatte zum Trocknen gelegt. Als sie zurückkam, um sie zu holen, zeigte es sich, daß an einem derselben die Zähne auf einer ganzen Seite ausgebrochen waren. Wer konnte der Thäter gewesen sein? Außer mir war kein anderer in das Zimmer getreten. Man verhört mich; ich läugne, die Kämme auch nur berührt zu haben. Herr und Fräulein Lambercier scheinen in ihrem Verdachte einig zu sein; beide ermahnen mich, dringen in mich, drohen mir; ich bleibe hartnäckig beim Läugnen; allein da alles zu sehr gegen mich sprach, kehrte man sich nicht an meine Betheuerungen, obgleich es das erste Mal war, daß sie mich über eine solche Keckheit im Lügen ertappt hatten. Die Sache wurde, wie sie es verdiente, ernst genommen. Die Büberei, die Lüge, die Halsstarrigkeit schienen gleicher Strafe werth! aber diesmal war es nicht Fräulein Lambercier, welche sie an mir vollzog. Man schrieb an meinen Oheim Bernard: er kam. Mein armer Vetter hatte sich ein anderes, nicht weniger schweres Verbrechen zu Schulden kommen lassen; eine und dieselbe Züchtigung wurde über uns verhängt. Sie war furchtbar. Hätte man das Heilmittel in dem zugefügten Leid selber gesucht und meine auf Abwege gerathene Sinnlichkeit für immer ertödten wollen, so hätte man es gar nicht besser anstellen können. Auch ließ mich letztere lange Zeit in Ruhe.
Trotzdem war man nicht im Stande mir das Geständnis, welches man verlangte, zu entreißen. Wiederholentlich vorgenommen und furchtbar mißhandelt, blieb ich unerschütterlich. Ich hätte den Tod erlitten und war dazu entschlossen. Selbst die Gewalt ermüdete, vor dem teuflischen Starrsinn eines Kindes, denn so nannte man meine Beharrlichkeit. Endlich ging ich aus dieser grausamen Prüfung zerfetzt, aber siegreich hervor.
Seit diesem Vorfalle sind jetzt fast fünfzig Jahre verstrichen, und ich brauche nicht zu fürchten, für dieselbe That von Neuem bestraft zu werden; nun wohl, im Angesichte des Himmels erkläre ich, daß ich unschuldig war, daß ich den Kamm weder zerbrochen noch auch nur berührt hatte, daß ich gar nicht in die Nähe der Kaminplatte gekommen war, und daß ich nicht einmal daran gedacht hatte. Man frage mich nicht, wie dieser Schaden geschehen ist, ich weiß es nicht und kann es nicht begreifen; nur so viel weiß ich mit größter Bestimmtheit, daß ich daran unschuldig war.
Man denke sich einen im gewöhnlichen Leben schüchternen und lenksamen, aber in der Leidenschaft feurigen, stolzen, unbeugsamen Charakter; ein stets von der Stimme der Vernunft geleitetes, stets mit Milde, Billigkeit, Freundlichkeit behandeltes Kind, welches nicht einmal einen Begriff von der Ungerechtigkeit hat und nun zum ersten Male eine so furchtbare gerade von Seite der Leute erleidet, die es liebt und am meisten achtet: welcher Umsturz der Begriffe, welche Verwirrung der Gefühle, welche Umwälzung in seinem Herzen, in seinem Kopfe, in seinem ganzen sich eben erst entwickelnden Geistes- und Seelenleben! Ich sage, man denke sich das alles, wenn man es im Stande ist; denn ich für meine Person fühle mich wenigstens unfähig, die geringste Spur von dem, was damals in mir vorging, aufzufinden und zu verfolgen.
Ich hatte noch nicht Vernunft genug, um einzusehen, wie sehr der Anschein mich verurtheilte, und um mich an die Stelle der anderen zu versetzen. Ich beharrte auf der meinigen, und alles, was ich fühlte, war die Härte einer furchtbaren Strafe für ein Vergehen, welches ich nicht begangen hatte. Der körperliche Schmerz war mir trotz seiner Heftigkeit wenig empfindlich; ich fühlte nur den Unwillen, die Wuth, die Verzweiflung. Mein Vetter, der in einem ziemlich ähnlichen Fall war, und den man für einen unabsichtlichen Fehler wie für eine vorsätzliche That bestraft hatte, versetzte sich nach meinem Beispiele in Wuth und quälte sich so zu sagen in dieselbe leidenschaftliche Aufwallung hinein wie ich. Das Bett mit einander theilend, umarmten wir uns beide unter krampfhaften Wuthausbrüchen; wir erstickten; und wenn unsere jungen Herzen, ein wenig erleichtert, ihrem Zorne Luft machen konnten, dann richteten wir uns im Bette auf und fingen beide an hundertmal mit aller Kraft zu schreien: carnifex, carnifex, carnifex!
Noch jetzt fühle ich, indem ich dies niederschreibe, meinen Puls stärker schlagen. Jene Augenblicke würden mir stets gegenwärtig sein, lebte ich auch hunderttausend Jahre. Dieses erste Gefühl von Gewalttätigkeit und Ungerechtigkeit ist mir so tief in der Seele eingeprägt geblieben, daß alle Vorstellungen, welche sich daran knüpfen, wieder die erste Aufregung in mir hervorrufen; und dieses Gefühl, das ursprünglich mich nur persönlich berührt, hat in sich selbst solche Kraft gewonnen und sich so vollkommen von jedem persönlichen Interesse losgelöst, daß mein Herz bei dem Anblicke oder der Erzählung, jeder ungerechten Handlung, an wem und wo sie auch immer verübt werde, auflodert, als ob ich selbst unter ihr zu leiden hätte. Wenn ich die Grausamkeiten eines schonungslosen Tyrannen, die schlau angelegten Schlechtigkeiten eines schurkischen Priesters lese, würde ich mich gern aufmachen, um diese Elenden zu erdolchen, sollte ich auch hundertmal dabei zu Grunde gehen. Ich habe mich oft in Schweiß gesetzt, um im Laufe oder mit Steinwürfen einen Hasen, eine Kuh, einen Hund, ein Thier zu verfolgen, welches ich ein anderes lediglich deshalb quälen sah, weil es sich stärker fühlte. Diese leichte Erregbarkeit kann mir angeboren sein, und ich glaube, es ist so; allein die unauslöschliche Erinnerung an die erste Ungerechtigkeit, die ich erduldet, war zu lange und zu tief damit verbunden, um nicht wesentlich zu ihrer Verstärkung beizutragen.
Damit hatte die Heiterkeit meiner Kindheit ihr Ende erreicht. Von diesem Augenblicke an hörte ich auf mich eines reinen Glückes zu erfreuen, selbst heute fühle ich noch, daß die Erinnerung an die Seligkeit meiner Kindheit hier vorüber ist. Wir waren dort, wie man uns den ersten Menschen darstellt, noch im irdischen Paradiese, aber ohne ferner Genuß davon zu haben. Es war scheinbar noch dieselbe Lage, und in Wirklichkeit doch ein ganz anderes Sein. Die Anhänglichkeit, die Achtung, die Herzlichkeit, das Vertrauen verband die Zöglinge nicht mehr mit ihren Erziehern; wir betrachteten sie nicht mehr wie Götter, die in unsern Herzen lasen; wir schämten uns weniger darüber, Böses zu begehen, und hatten größere Furcht, beschuldigt zu werden; wir begannen uns zu verbergen, uns aufzulehnen, zu lügen. Alle Laster unseres Alters vernichteten unsere Unschuld und gaben unsern Spielen einen häßlichen Anstrich. Selbst das Land verlor in unsern Augen den Reiz einer sanften Einfachheit, der zum Herzen geht; es schien uns öde und düster; es hatte sich wie mit einem Schleier bedeckt, der uns die Schönheiten desselben verhüllte. Wir hörten auf, unsere kleinen Gärten, unsere Pflanzen, unsere Blumen zu pflegen. Wir scharrten nicht mehr leicht die Erde auf und jauchzten vor Wonne, wenn wir den Keim des Samenkornes, das wir ausgestreut hatten, entdeckten. Wurden wir dieses Lebens überdrüssig, so wurde man auch unser überdrüssig; mein Onkel nahm uns weg, und wir schieden von Herrn und Fräulein Lambercier, unser gegenseitig satt und unsere Trennung wenig bedauernd.