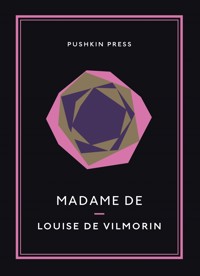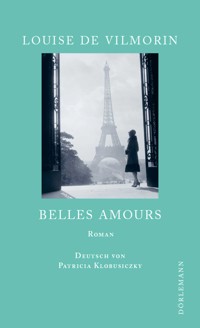
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wohlhabenden Duvilles führen in Valronce ein beschauliches Dasein auf dem Lande. Die größte Sorge, vor allem Madame Duvilles, ist es, ihren einzigen Sohn gut zu verheiraten. Umso glücklicher fügt es sich, als Louis sich Hals über Kopf in die Nichte eines Bekannten verliebt.Zur Hochzeit reist selbstverständlich auch der langjährige Freund der Familie an. M. Zaraguirre ist klug, elegant und verfügt über einen Charme, der sämtliche Frauenherzen höher schlagen lässt. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als er sich in die Braut verliebt.Louise de Vilmorin erzählt in rasantem Tempo eine tragikomische Dreiecksgeschichte um Liebe, Leidenschaft, Intrige, Rache und Verrat in der Neuübersetzung von Patricia Klobusiczky.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Louise de Vilmorin
Belles Amours
Roman
Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky
DÖRLEMANN
Die französische Originalausgabe »Les Belles Amours« erschien 1954 bei Gallimard, Paris.
Für Orson Welles
Neuübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © Éditions Gallimard, Paris, 1954 © 2022 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Umschlagfoto: Mary Evans/Classicstock/H. ARMSTRONG ROBERTS Porträt von Louise de Vilmorin auf Seite 5: © Éditions Gallimard (Jacques Sassier) Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-991-1www.doerlemann.com
Inhalt
Louise de Vilmorin
I
Sobald von Liebe die Rede war, sagte M. Zaraguirre, lieben sei im Grunde erfinden, und führte aus, dass die Liebe sich zunächst der Fantasie bemächtige, bevor sie vom Herzen Besitz ergreife. Er war ein mutiger, willensstarker Mann, weder eitel noch überheblich. In seiner Kindheit hatten ihn mehr Klagen als Lieder gewiegt, und sie war ihm als Insel der Traurigkeit in Erinnerung geblieben, von der er früh Reißaus nahm, um andere Welten zu erobern. Er war Abenteuer, Arbeit und Erfolg gewohnt. Die Beobachtungsgabe, die bei ihm noch lebhafter war als jede Herzensregung, hatte ihm Reichtum beschert und trug zu dessen Erhalt bei, auch wenn dieser Reichtum, den er selbst als Ergebnis gesunden Menschenverstands und leidenschaftlichen Einsatzes betrachtete, oft glücklichen Umständen zugeschrieben wurde, also den Unwägbarkeiten des menschlichen Geschicks.
M. Zaraguirre lebte in Südamerika. Dort hatte er große Unternehmen gegründet; er hatte eine Vorliebe für einfache Dinge und wollte keiner gesellschaftlichen Schicht angehören. Vom schwachen Feuer, das man hinter seiner kühlen Fassade schwelen spürte, stiegen gelegentlich Flammen auf, die den Anschein eines sinnenfrohen, flatterhaften Mannes erweckten, dabei glaubte er tatsächlich an die Liebe, an Hingabe und Glut, die mit reiner Lust nichts gemein hatten.
Sein Auftreten, sein Vermögen, seine sagenumwobene Intelligenz und die Aufmerksamkeit, die seine Persönlichkeit allerseits erregte, imponierten den Frauen. Wenn sie ihn sahen, suchten sie seinen Blick, und falls sie ihm gefielen, gewann er diese Frauen mit einem Lächeln. Er war ihnen durchaus zugetan. Weil es für einen Mann wie ihn, mit einer Fülle unterschiedlichster Neigungen, Ideen und Talenten, die ihn in Atem und Bewegung hielten, jedoch von Nachteil war, allzu sehr geliebt zu werden, blieb er auf der Hut, und auch wenn er nicht jeder Versuchung widerstand, auch wenn er sich so zärtlich wie geduldig erweisen konnte, entzog er sich möglichen Vorwürfen und verweigerte jeden Schwur. Die Frau, auf die seine Wahl fiel, geriet stets in einen Rausch aus Hoffnung und Hochmut und erlag sogleich Trugvorstellungen, die sich nach und nach in Tränen des Argwohns auflösten. Wer ihn liebte, musste ihm hinterherweinen, sein Kuss überwand keine Distanz, hinter seinem Werben war der Freiheitsdrang zu spüren und das Streben nach Unabhängigkeit schien durch seine Anhänglichkeit hindurch. Er weckte Erwartungen und enttäuschte sie, und da er nicht zu greifen war, träumten die Frauen davon, seiner habhaft zu werden. »Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen, nur keine Versprechen«, pflegte er zu sagen, und wenn sie, der Ungewissheit müde und auf einen Beweis ihrer Macht erpicht, schließlich nach Juwelen verlangten statt nach Küssen, bestärkte er sie darin und ließ ihnen als Belohnung für so viel Weisheit einen Diamantring zukommen. Diesen verschenkte er als Souvenir, begleitet von ein paar schlichten Worten: »Der Solitär ist mein Wahrzeichen, ein tristes Wahrzeichen, das Sie sich nicht zu eigen machen sollten. Nehmen Sie ihn, vergessen Sie ihn, er ist als Abschiedskuss gedacht.«
Während Männer diese lockere Art, Verbindungen einzugehen und wieder zu lösen, aller heimlichen Bewunderung zum Trotz aus Prinzip verurteilten, bewahrten sich die Frauen eine gewisse Sehnsucht nach ihrer Liebesseligkeit und beschrieben M. Zaraguirre lächelnd, mit guter Miene zum bösen Spiel, als uneinnehmbare Festung. Das sollte sich jedoch als Irrtum herausstellen. Kurz vor Vollendung seines fünfundfünfzigsten Lebensjahrs verliebte sich M. Zaraguirre rettungslos in die Braut von Louis Duville, zufällig der Sohn seiner besten Freunde. Es hätte nicht schlimmer kommen können.
Vater und Sohn Duville waren Samenhändler. Sie führten gemeinsam ein alteingesessenes Geschäft in der Provinz, mit großem Geschick und der heiteren Ernsthaftigkeit und sanften Autorität, die auch ihr Privatleben prägten. Darin ähnelten sich die beiden, die sonst sehr verschieden waren. Während der Vater durch Pflichterfüllung und Traditionsbewusstsein sein Glück gefunden hatte, schöpfte sein Sohn Vergnügen aus weniger strengen Quellen, und so verbrachte er seine Freizeit allwöchentlich in Paris, in Gesellschaft von hübschen Frauen und von Freunden, die genauso reich und verschwenderisch waren wie er. Louis Duville besaß eine Wohnung am linken Ufer der Seine. Er war kein Bohemien, doch er galt als Schürzenjäger und hatte zahlreiche Mätressen gehabt, die seinen besorgten Eltern alle gleich gefährlich schienen. Sie hatten Angst, dass er eine junge Frau zweifelhafter Herkunft heiraten oder dass eine verhängnisvolle Liebe zu einer verheirateten Dame ihn davon abhalten würde, selbst eine Familie zu gründen. Da sie ihren Sohn aber nicht ermahnten, ihrem Beispiel zu folgen, und ihm weder Ärger noch Enttäuschung zeigten, hatten sie sich sein Vertrauen bewahrt, und sie bildeten zu dritt eine glückliche Familie.
Valronce, ihr Landhaus, war zur Zeit des Napoleonischen Konsulats erbaut worden. Es lag unweit der Stadt, in der sie werktags ihr Geschäft betrieben, und der dazugehörige, für seine Sammlung seltener Pflanzen berühmte Park spendete ringsum reichlich Schatten und rückte das Haus in den Mittelpunkt einer exotischen Landschaft.
M. Duville und M. Zaraguirre waren alte Freunde. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander, unterstützten sich gegenseitig und amüsierten sich gemeinsam über obskure Scherze, in denen nur sie beide Ereignisse und Gefährten aus ihrer Jugend wiedererkannten. In Valronce entspannte sich M. Zaraguirre von der Rolle des Fremden, die ihm sonst überall zugewiesen wurde, er genoss die Wärme freundschaftlicher Zuneigung und lachte mit den schönen jungen Frauen, die Mme Duville immer wieder einlud, in der Hoffnung, ihr Sohn würde sich in eine von ihnen verlieben. Er hingegen schien nicht für die Ehe bestimmt zu sein und ließ sie, ungeachtet des erwartbaren Bedauerns seiner Mutter, der Reihe nach andere heiraten. Mme Duville war jedoch recht hartnäckig, sie ging zu jeder Hochzeit, nahm die Brautjungfern der Frischvermählten in Augenschein und lud die hübschesten nach Valronce ein, um die entstandene Lücke zu füllen. Diese jungen Frauen boten M. Zaraguirre das Schauspiel einer glücklichen Jugend, die ihm selbst nicht vergönnt gewesen war, und wiegten ihn außerdem in der Illusion, zugleich ihr Bruder, ihr Vater und ihr Großvater zu sein. Abends, wenn Mme Duville sich ans Klavier setzte, tanzte er mit ihnen; M. Duville und sein Sohn taten es ihm nach, und so wirbelten sie alle miteinander fröhlich im Garten oder im Haus umher. Im Oktober ging es in Valronce immer am heitersten zu. M. Zaraguirre fühlte sich unter diesem vertrauten Dach heimisch, er war dort glücklich, wusste aber, dass sein wahres Leben sich woanders abspielte, und nach zwei Wochen reiste er, wie aus Angst, zu weich zu werden, wieder in die Ferne, wo er sich treu blieb und dennoch den Zwängen einer Persona unterwarf, die den Duvilles fremd erschienen wäre.
Auch wenn Louis Duville schnelle Autos, durchgefeierte Nächte, flüchtige Affären und Pferderennen schätzte, hatten er und sein Vater die Liebe zur Natur und den Stolz auf ihr Unternehmen gemeinsam. Trotz der vielen Vergnügungen vernachlässigte er seine Arbeit keineswegs. Er war vom Erfolg verwöhnt, langweilte sich schnell und mit dreißig verlobte er sich schließlich doch.
Vom Taumel der Liebe ergriffen, entschloss er sich von jetzt auf gleich, ohne nachzudenken, denn er war von der Aufrichtigkeit seiner Gefühle felsenfest überzeugt. Tatsächlich ist die Liebe stärker als jede Geduld, aber es war wohl nicht sie allein, die ihn zur sofortigen Heirat drängte, sondern eine Vorahnung.
Gott zeigt sich in vielen geheimnisvollen Begebenheiten, die gerade durch ihre Zufälligkeit bestechen. Mme Duville war einem ihrer Cousins besonders zugetan; er war Oberst, und das erfüllte sie verständlicherweise mit Stolz. Als sie am 18. September 1925 zum Einkaufen in die Stadt fuhr, begegnete sie ihm mittags zufällig in der Konditorei. Er sei gerade pensioniert worden, teilte er ihr mit, das schmerzte ihn, und vielleicht aß er zum Trost einen Liebesbrunnen.
»Pensioniert! Endlich! So ein Glück!«, rief Mme Duville. »Dann werden wir dich häufiger sehen. Komm am Samstag doch zum Mittagessen nach Valronce. Dein Haus hast du hoffentlich wieder bezogen? Es wurde ja auch Zeit. Na, wie ist es mit Samstag?«
»Samstag, nein, da kann ich nicht, die Frau meines Neffen kommt mich besuchen …«
»Deines Neffen? Welches Neffen? Ist er nicht 1918 gestorben?«
»Noch hat der Heroismus nicht alle umgebracht«, antwortete der Oberst. »Mein Neffe ist tot, doch seine Frau lebt. Sie ist erst fünfundzwanzig, und ich versuche, sie auf andere Gedanken zu bringen. Mit dem Krieg ist es immer wieder die alte Geschichte: ohne Krieg ohnehin keine Geschichte, wo wären wir also ohne Krieg, und was wäre mit der Geschichte? Ach, wenn man nur auf mich hören würde …«
Mme Duville fiel ihm ins Wort: »Niemand hört auf irgendwen, ich hasse den Krieg, und hör du mit diesen Geschichten auf, ich ertrage sie nicht. Mach uns die Freude und bring deine Nichte zum Mittagessen mit. Louis wird nicht da sein. Er fährt samstags immer weg. Und wohin? Dreimal darfst du raten: nach Paris! In seinen Zwanzigern konnte ich das noch verstehen, aber jetzt ist er dreißig, was hofft er dort zu finden?«
Der Oberst räusperte sich und ging nicht weiter darauf ein.
Zurück in Valronce berichtete Mme Duville ihrem Mann, sie habe den Oberst getroffen und eingeladen, und er käme am übernächsten Tag gern mit seiner Nichte zum Mittagessen. »Er ist jetzt pensioniert, er hat Dentelle wieder bezogen. So gewinnen wir einen Nachbarn hinzu, ich freue mich darüber, du nicht?« M. Duville nickte. Oft sah er aus Wohlwollen von einer Antwort ab.
Zwei Tage später wollte Louis Duville gerade aufbrechen und ging die Außentreppe hinab, als unten ein Auto hinter seinem hielt. Der Oberst sprang heraus und reichte einer jungen Frau die Hand, die ebenso schnell ausstieg. Louis Duville begrüßte seinen Onkel, wurde der jungen Dame vorgestellt und geleitete beide in die Bibliothek. Sie waren zu früh, und da sich weder M. noch Mme Duville blicken ließen, gebot ihm die Höflichkeit, den Gästen Gesellschaft zu leisten. Die junge Frau bewunderte die Gemälde. »Ach!«, rief sie mehrmals, und so schlicht diese Reaktion war, weckte sie die Aufmerksamkeit Louis Duvilles. »Ach! Was für ein faszinierender Mann«, sagte sie vor einem der Porträts. »Was für ein Gesicht, und diese Stirn! Er ähnelt Ihnen ein wenig.« Er fragte sie, ob sie Ausländerin sei. »Ich klinge wie eine Spanierin, ich weiß.«
»Ausländerin«, ließ sich der Oberst vernehmen, »dieses Wort mag ich nicht. Sie ist keine Ausländerin, sondern in Spanien aufgewachsen, wo ihr Vater als Militärattaché tätig war.«
»Ja, fünf Jahre lang, während ich über zehn Jahre in meiner Klosterschule in Madrid geblieben bin. Ich bin nur in den Ferien nach Frankreich gefahren, und mit siebzehn habe ich dann urplötzlich geheiratet.«
»In Spanien?«, fragte Louis Duville.
»Nein, in Frankreich«, entgegnete der Oberst und lobte erst den Charakter, die Laufbahn und die Verdienste seines Neffen, bevor er die Heldentat schilderte, die ihm zum Verhängnis geworden war.
Seiner Nichte war das sichtlich unangenehm. Resigniert saß sie da, ein gezwungenes Lächeln auf den Lippen, und Louis Duville fiel auf, dass sie errötete. Sie sah ihn an, zuckte mit den Schultern, als wollte sie fragen: »Was tun?«, und bedachte ihn mit einem Blick, den er komplizenhaft erwiderte. Sie saßen an den entgegengesetzten Enden eines länglichen Sofas, und während der Oberst auf und ab ging und zwischendurch innehielt, um Luft zu holen oder seinen gedanklichen Faden wiederzufinden, tauschten sie hinter seinem Rücken spöttische Blicke und gelegentlich sogar ein Augenzwinkern. Diese Kommunikation währte nur kurz. Zunächst waren beide verblüfft, dann wurden sie ernst und verloren schließlich mehr und mehr die Bodenhaftung, von dieser angenehmen Verwirrung ergriffen, die stets auf gegenseitiger Anziehung beruht und zuweilen Liebe verheißt. Das hielt Louis Duville an Ort und Stelle fest. Er malte sich Dinge aus, die ihn aus der Fassung brachten, sein Herzschlag veränderte sich, er verspürte eine gewisse Trägheit und Schwere, eine Stille, und hatte keine Lust mehr wegzufahren.
»Mut ist eine gefährliche Waffe, die sich durchaus gegen uns kehren kann. Man sollte sie mit Bedacht einsetzen. Natürlich muss man sich mit Mut wappnen, aber man muss ihn auch rechtzeitig ablegen können. Davon hängt alles ab – ohne Mut kein Heer, doch zu viel Mut vernichtet das Heer. Was mich angeht …«, sagte der Oberst, als Mme Duville eintrat.
»Bravo!«, rief sie.
»Ich darf dir meine Grüße entbieten und zugleich meine Nichte vorstellen«, antwortete er. Darauf folgte ein Austausch von Liebenswürdigkeiten, bis Mme Duville ihren Sohn ansprach: »Wie, du bist noch da?«
»Ich habe auf dich gewartet«, sagte er, verabschiedete sich und ging.
In der Eingangshalle traf er seinen Vater, der ebenso erstaunt fragte: »Wolltest du nicht wegfahren?«
»Ich schwanke noch. Es ist schon spät, und ich fühle mich nicht so gut.«
»Dann solltest du die Landstraßen meiden. Du weißt ja, wie es im September ist. Lass für dich ein Gedeck auftragen und bleib einfach hier, das ist klüger.«
Und so betrat M. Duville die Bibliothek Arm in Arm mit seinem Sohn.
Als beim Mittagessen abermals von Heldentum die Rede war, gab M. Duville ein Zitat von M. Zarraguirre zum Besten: »Ob Kathedralen, Gedichte, Kunstwerke oder Helden – je großspuriger, desto langlebiger.«
Louis Duville beteiligte sich nicht am Gespräch. »Du hast sicher Halsschmerzen. Du wirst dich erkältet haben«, sagte seine Mutter.
»Kann schon sein«, antwortete er knapp. Er lauerte auf den Moment, da die junge Frau, die ihm gegenübersaß und ihre Augen auf den Tisch gerichtet hielt, ihn ansehen würde, ohne den Kopf zu heben, und dachte nur noch an diesen Blick, in dem so viel Präsenz, Sehnsucht und Verlorenheit enthalten war. Offenbar teilten sie einander auf diese Weise eine ganze Menge mit, denn kaum war das Essen vorbei, schlug er ihr vor, unter den breiten, schattenspendenden Kronen spazierenzugehen. Sie folgte ihm bereitwillig in den Garten, wo sie die späten Blüten und deren moderigen Duft würdigte.
»Ihretwegen bin ich geblieben«, sagte er.
»Meinetwegen?«
»Ja. Sie haben mich zum Bleiben bewegt, warum, werden Sie gleich erfahren.«
Am Morgen hatte es geregnet. Sie zeigte ihm die winzigen Löcher, die das Wasser im Sand am Wegesrand gegraben hatte, als es von den Strauchblättern geperlt war.
Ähnlichkeiten geben Rätsel auf. Sie sind zugleich Positiv und Negativ eines Bilds. Die junge Frau war weder blond noch brünett, Teint und Haarfarbe waren so unauffällig wie ihre Gesichtszüge, sie gehörte zu jenen, die an alle möglichen Schönheiten erinnern, ohne dahinter zurückzustehen, die den herrlichsten Gestalten verwandt sind und zu Recht Anklang finden. Um einen besseren Eindruck zu gewinnen, wäre Louis Duville ihr lieber gefolgt, als neben ihr einherzugehen. Ihr Gang war so ungezwungen und leicht, dass sie wie von der Herbstluft getragen schien, und ihrem ganzen Wesen haftete etwas Unschuldiges und Freies an, etwas sehr Einfaches und Eigenartiges, das zur Kühnheit herausforderte. Und sie lächelte. Ein Efeukranz schmückte ihren weißen Filzhut. »Die Blätter sind echt. Sie können sie ruhig anfassen.« Er strich mit einem Finger darüber; sie blieben kurz stehen und sie erklärte: »Das war meine Idee.«
»Waren Sie glücklich?«, fragte er.
»Aus dieser Frage spricht Eifersucht. Was soll ich Ihnen denn antworten? Langeweile ist eine mir sehr vertraute Art von Traurigkeit. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich lebe im Osten, bei meinen Eltern, zusammen mit meinem Bruder und seiner Frau, ich bin nicht unglücklich, außerdem habe ich meine Hunde.«
»Mehr nicht?«
»Ja und nein. Natürlich haben wir eine Menge Nachbarn, die sich gern vergnügen. Es gibt Picknicks, Jagdausflüge, kleine Bälle, und wenn nicht, spielen wir Karten. Mein Dasein ist typisch für Leute, die auf dem Land leben und sich um ihr Anwesen kümmern. Nur dass ich allein bin, da wird es eintönig. Sie haben wenigstens Ihre wichtigen Geschäfte und eine Großstadt in der Nähe. Und Sie haben Paris.«
»Das stimmt«, antwortete er. »Wobei es mir leichter fallen würde, künftig auf Paris zu verzichten als auf Ihren bezaubernden Akzent.«
Dieser Akzent war ein unendlich sanftes Gurren, ein leiser Trommelwirbel, der aus der Ferne kam, auf ihren Lippen erstarb und jedes ihrer Worte unterstrich; ein Überrest ihrer Kindheit, einer Kindheit in der Fremde, der in einem erfahrenen Mann wie ihm den Wunsch weckte, auf sie zuzugehen, sie näher kennenzulernen und in ein Leben jenseits aller Konventionen zu entführen.
»Ach, Paris«, sagte sie, »dort war ich noch nie.«
Als sie den Park hinter sich gelassen und eine Brache überquert hatten, wo nur Dornensträucher gediehen, tat sich vor ihnen eine gelblich schimmernde Ebene auf, in der ein paar Wolfsmilchgewächse im Wind bebten.
»Lassen Sie uns in den Park zurückkehren. Ach! Um nichts in der Welt würde ich diese Blumen pflücken wollen. Ich fürchte mich viel zu sehr davor, mich mit ihrem Trübsinn anzustecken. Hier würde mir sogar ein Hase Angst einjagen, ein Hase oder ein Vogel. Vor Vögeln kann man sich ja leicht erschrecken. Wie öde es hier ist! Wie trostlos!«
»Hier sind wir unter uns«, antwortete er.
Sie folgte ihm unwillig an den Rand einer Straße, die von ausladenden Steinhaufen gesäumt war.
»Kommen Sie, hier wird man uns für ein Königspaar halten, das unterwegs auf einem Behelfsthron rastet«, sagte er, und sie hatte noch gar nicht verstanden, was er meinte, als er sie hochhob und auf einen dieser Steinhaufen setzte, neben ihr Platz nahm, ihre Hände ergriff und sachte an seine Lippen führte. »Ich will mich nie mehr von Ihnen trennen, lassen Sie uns zusammenleben. Einverstanden?«
»Ich denke nicht daran.«
»Dann denken Sie eben doch daran. Oder nein, denken Sie nicht, träumen Sie lieber, ja, denn Träume sind schneller als Gedanken.«
»Ich werde heute Nacht träumen.«
»Nein, träumen Sie jetzt.«
»Ich träume«, sagte sie.
»Gut, schlafen Sie.«
»Es kommt mir so vor, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes gemacht.« Sie schloss die Augen und flüsterte: »Stimmt, Träume sind schneller. Ich treibe davon.«
»Aber nicht zu weit weg.«
»Ich reise Ihnen entgegen, und Sie sind noch in weiter Ferne.«
Er küsste sie, sie blickten sich an, und es war alles gesagt.
Am Beginn einer Liebe scheint die Ewigkeit auf. Beide fühlten, dass sie sich im Nu als Paar gefunden hatten und einander niemals gleichgültig werden konnten, sie empfanden ein schier unbegreifliches Glück und freuten sich über das, was ihnen widerfahren war. Er war ein schöner Mann, sie war voller Leidenschaft und Anmut, und wer weiß, wie viel Stolz in ihre Liebe hineinspielte und sie noch strahlender machte. Die trostlose Ebene kam ihnen vor wie verzaubert, sie verweilten dort und pflückten Wolfsmilch, die sie zum Emblem ihrer glorreichen Liebe bestimmten, und schon verknüpfte sich die Erinnerung an ihren ersten Eindruck mit ihrer jetzigen Wahrnehmung, stiftete eine tiefe Vertrautheit. Als sie nach Valronce zurückkehrten, war der Tee längst aufgetragen.
»Wir haben euch gerufen«, sagte Mme Duville, »aber ihr habt uns wohl nicht gehört.«
»Ich habe sogar ›Huhu!‹ gemacht«, warf der Oberst ein, »und das seit Jahrzehnten zum ersten Mal.« Er wandte sich an seine Nichte: »Weißt du eigentlich, wie spät es ist, meine Liebe?«
»Nein.«
»Das dachte ich mir. Zeit spielt aber durchaus eine Rolle, auch wenn du sie geringschätzt. Die Zeit entscheidet über Sieg oder Niederlage. Na los, es wird Abend, und ich fahre nicht gern bei Dunkelheit.«
»Wir haben uns einfach treiben lassen«, sagte Louis Duville.
»Das kann ich verstehen. Beim Spazieren lässt sich so vieles erkunden, und das Tempo ist so angenehm, dass man sich eben treiben lässt«, bemerkte M. Duville. »Am liebsten würde man herausfinden, welche Überraschungen der Horizont birgt: noch einen Baum, noch ein Farbenspiel, was bietet diese Hügelkuppe wohl für eine Aussicht? Die Zeit tritt in den Hintergrund. Es ist eine wahre Entschleunigung, außerdem braucht es keinen Abschied: Wer spaziert, geht ja nicht weg.«
»Das ändert nichts daran, dass es bald sechs ist. Marsch, marsch!«, befahl der Oberst und warf seiner Nichte einen recht strengen Blick zu.
Anstatt ihm zu gehorchen, seufzte sie und legte Louis Duville die Hand auf die Schulter. Auf diese kecke Geste folgte ein Moment stiller Fassungslosigkeit. Louis Duville lächelte. »Wir sind verlobt«, erklärte er.
Wie ein Riesenvogel, der sich auf seine Beute stürzt, warf sich Mme Duville in die Arme ihres Mannes und stammelte: »Hast du gehört? Verlobt! Verlobt wie wir.« Naivität rührt eher, als dass sie verführt, aber diese schlichten Worte verliehen ihr eine gewisse Schönheit.
Bei M. Duville paarten sich Geduld und Liebenswürdigkeit mit einem Hauch von Ironie und viel Resignation. Er wusste, dass Menschen umso verletzlicher sind, je mehr es ihnen an Intelligenz mangelt, und dass sie erlittenen Schmerz nicht aus eigener Kraft verwinden können. Er ärgerte sich oft über seine Frau, aber sie stimmte ihn immer wieder weich, weil sie auf geradezu erbarmenswerte Weise herzensgut war. Kein Wunder, dass sie ihren Mann liebte, auch wenn sie ihn nun genauso wenig zu ergründen vermochte wie am ersten Tag; dank ihm hatte sie sich ihre mädchenhaften Illusionen bewahrt und durfte ihn auch nach mehr als dreißig Jahren Ehe als ihren Bräutigam betrachten. Von ihrem Sohn und ihm abgesehen, hatte sie nur für M. Zaraguirre wirklich etwas übrig. »Verlobt, verlobt wie wir!«, wiederholte sie und umarmte ihren Mann anstelle ihres Sohns. Dem Oberst ging dieses bewegende Geschehen durchaus nah. Sein Erstaunen war nicht minder gewaltig als die Freude von M. und Mme Duville. Es wurde gejauchzt, geweint und geküsst, der Oberst sang ein Loblied auf die Familie seiner Nichte, woraufhin sich alle setzten und Pläne schmiedeten.
»Wir könnten gleich heiraten«, schlug Louis Duville vor.
»Lass uns doch wenigstens einmal Luft holen«, antwortete seine Mutter.
M. Duville neckte das Brautpaar: »Ah! Ihr wollt schon morgen heiraten, um möglichst bald unter euch zu sein. Das ist typisch für Verliebte: Sie wollen in erster Linie allein sein, was ihnen am Ende leider gelingt.« Die Pointe dieses recht traurigen Witzes entging Mme Duville. »Ihr lacht?«, fragte sie die jungen Leute. »Das ist jetzt gar nicht angebracht. Wollt ihr nun lachen oder wollt ihr heiraten?« An die Braut gewandt, fügte sie hinzu: »Ich bin gegen eine übereilte Hochzeit. Es sorgt nur für Gerede, es bringt nichts, und Ihre Eltern sind sicher meiner Meinung. Sie werden so viel zu erledigen haben! Wer seine Tochter verheiratet, hat alle Hände voll zu tun!«
Die Braut wurde unsicher; sie nahm ihren Onkel beiseite, redete leise auf ihn ein und bat ihn, ihr Unbehagen zu erläutern.
»Die Sache ist die«, hob der Oberst an. »Es ist mir sehr unangenehm, denn sobald es um Gefühle geht, wird es gleich so melodramatisch.«
»Gefühle haben eine eigentümliche Macht«, sagte M. Duville, »wie der Nebel: Man verliert sich darin, hört Stimmen, sucht vergeblich, obwohl doch alle da sind.«
»Tatsächlich würde meine Nichte lieber so manchem aus dem Weg gehen. Kinderei! Mimosenhaftigkeit! Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber sie möchte Ihren Sohn nicht in der Kirche heiraten, in der sie das erste Mal getraut wurde. Das ist sogar nachvollziehbar. Was meinen Sie?«