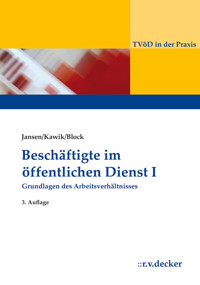Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Decker, R v
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: TVöD in der Praxis
- Sprache: Deutsch
Das Lehrbuch "Beschäftigte im öffentlichen Dienst II" erscheint in einer 4. völlig überarbeiteten Auflage. Die Autoren Frau Dr. Jansen, Herr Dr. Kawik und Herr Dr. Block, sind alle drei Dozenten an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Band II widmet sich den Schwerpunkten, Urlaub, Krankheit und Eingruppierung. Urlaubsumfang, Verfall und Abgeltung werden unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung strukturiert dargestellt, ebenso wie die praxisrelevanten Bereiche Arbeitsbefreiung, Sonderurlaub und Bildungsurlaub. Weiterhin wird das Entgeltfortzahlungsrecht nebst Krankengeldzuschuss, Krankengeld und die stufenweise Wiedereingliederung unter Einbeziehung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement behandelt. Den dritten großen Themenbereich stellt die klar gegliederte Aufbereitung des Eingruppierungsrechts dar. Alle Themenblöcke sind durch eine Vielzahl von Beispielsfällen, Prüfschemata und Checklisten gekennzeichnet und ergänzt durch wertvolle praktische Hinweise für den Arbeitsalltag. Auch in diesem Band schließt jedes Kapitel mit Kontrollfragen ab, so dass das (klausurrelevante) Wissen sofort überprüft werden kann. Sie finden ein Wissensquiz aus den Kontrollfragen zu Band I unter https://www.rehm-verlag.de/klausurenwissen. Melden Sie sich gleich an, dann werden Sie über alle neuen Fragen in dem Quiz informiert. Der Band I dieser Reihe beschäftigt sich mit den allgemeinen Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts. Darüber hinaus werden Arten, Aufbau und Struktur der Tarifverträge im öffentlichen Dienst einschließlich ihrer bindenden Wirkung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer behandelt. Außerdem werden die dem Arbeitsverhältnis wesenseigenen Pflichten, Arbeitszeit, Beschäftigungs-, Dienst- und Jubiläumszeit, Grundzüge des Rationalisierungsschutzes, die Ausschlussfristen, arbeitsrechtliche Maßnahmen bei ihrer Verletzung sowie die Beendigungstatbestände einschließlich des Rechts auf Zeugniserteilung behandelt. Die Reihe TVöD Praxisbuch ergänzt den großen TVöD/TV-L-Kommentar von Sponer/Steinherr, der im gleichen Verlag erscheint. Die Buchreihe greift einzelne Themen aus dem TVöD/TV-L auf und vertieft sie auf eine insbesondere für Anfänger gut verständliche Weise. Dennoch finden auch bereits erfahrene Praktiker wertvolle Hilfestellungen für ihren Arbeitsalltag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Anhang
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Autoren
Abkürzungsverzeichnis
Kapitel A Urlaub
I. Erholungsurlaub
1. Historische Entwicklung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs
2. Tarifliche Urlaubsansprüche
3. Entstehung des Urlaubsanspruchs
a) Wartezeit nach dem BUrlG
b) Teilurlaubsansprüche nach dem BUrlG
c) Teilurlaubsansprüche nach dem TVöD
d) Spannungsfeld zwischen Teilurlaubsansprüchen nach dem BUrlG und dem TVöD
4. Umfang des Erholungsurlaubsanspruchs
a) Regelfall
b) Abweichung
5. Unregelmäßige Arbeitszeit
6. Änderung der Anzahl der Wochenarbeitstage im laufenden Kalenderjahr
a) Entwicklung
b) Auswirkungen auf die Praxis
7. Erfüllung des Urlaubsanspruchs
8. Änderung der zeitlichen Festlegung des Erholungsurlaubs
9. Zusammenhängende Urlaubsgewährung
10. Mitbestimmung
11. Erkrankung während des Urlaubs
12. Urlaubszweckwidrige Erwerbstätigkeit während des Urlaubs
13. Ausschluss von Doppelansprüchen
14. Übertragung des Erholungsurlaubs
a) Regelfall
b) Übertragung des Erholungsurlaubs bei Mutterschutz und Elternzeit
15. Urlaubsentgelt
16. Urlaubsabgeltung
17. Ersatzurlaub
18. Kürzung des Erholungsurlaubs bei ruhendem Arbeitsverhältnis
a) Elternzeit
b) Wehrdienst
c) Rente auf Zeit
d) Sonderurlaub
e) Pflegezeit
19. Keine Ruhensfälle
a) Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
b) Mutterschutz
c) Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation
d) Freistellungsphase in der Altersteilzeit
e) Sabbatical
f) Langzeitkonten
II. Zusatzurlaub
1. Zusatzurlaub für Schichtarbeit
2. Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen
III. Sonderurlaub
IV. Bildungsurlaub
V. Arbeitsbefreiung
1. Vorbemerkung
2. Persönliche Anlässe nach § 29 Abs. 1 TVöD
3. Allgemeine staatsbürgerliche Pflichten nach § 29 Abs. 2 TVöD
4. Arbeitsbefreiung in sonstigen dringenden/begründeten Fällen nach § 29 Abs. 3 TVöD
5. Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche Zwecke gem. § 29 Abs. 4 TVöD
6. Arbeitsbefreiung für die Tätigkeit in Berufsbildungsausschüssen und in Organen von Sozialversicherungsträgern nach § 29 Abs. 5 TVöD
7. Arbeitsbefreiung in Anlehnung an besondere Tatbestände der SUrlV
a) Arbeitsbefreiung für Aus- und Fortbildung gem. § 9 SUrlV
b) Arbeitsbefreiung zur fremdsprachlichen Aus- und Fortbildung gem. § 10 SUrlV
c) Arbeitsbefreiung für Zwecke der militärischen und zivilen Verteidigung gem. § 11 SUrlV
d) Arbeitsbefreiung für vereinspolitische Zwecke gem. § 12 SUrlV
e) Arbeitsbefreiung für eine Ausbildung zur Schwesternhelferin oder zum Pflegediensthelfer gem. § 14 SUrlV
f) Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche Zwecke gem. § 15 SUrlV
g) Arbeitsbefreiung für kirchliche Zwecke gem. § 16 SUrlV
h) Arbeitsbefreiung für sportliche Zwecke gem. § 17 SUrlV
i) Arbeitsbefreiung für Familienheimfahrten gem. § 18 SUrlV
j) Arbeitsbefreiung aus dienstlichem Anlass eines Umzugs ins oder aus dem Ausland gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 SUrlV
Kontrollfragen
Kapitel B Eingruppierung und Stufenzuordnung
I. Eingruppierung TVöD (Bund)
1. Einführung
a) Bisheriges Eingruppierungsrecht
b) Neues Eingruppierungs- und Entgeltrecht
2. Grundlagen der Eingruppierung (§ 12 TVöD)
a) Allgemeines zur Eingruppierung
aa) Eingruppierungsanspruch
bb) Einstellung und Höhergruppierung von Arbeitnehmern
b) Grundsatz der Tarifautomatik
c) Bildung von Arbeitsvorgängen
d) Aufspaltungsverbot
e) Hälfte-Grundsatz
f) Auszuübende Tätigkeit
aa) Dauerhaft zugewiesene Tätigkeit
bb) Änderung der Arbeitsinhalte
g) Abschließende Gesamtbewertung
h) Persönliche Anforderungen
i) Unbeachtliche Kriterien für die Eingruppierung
j) Bewertungssystematik
k) Eingruppierungssystem im Überblick
3. Eingruppierung in besonderen Fällen (§ 13 TVöD)
a) Allgemeines
b) Voraussetzungen
4. Korrigierende Rückgruppierung
a) Allgemeines
b) Vertrauensschutz
c) Abgrenzung zur Herabgruppierung
5. Eingruppierungsfeststellungsklage im öffentlichen Dienst
6. Mitbestimmung
a) Eingruppierung
b) Höher- und Herabgruppierung
aa) Mitbestimmungspflichtige Höhergruppierung
bb) Mitbestimmungspflichtige Herabgruppierung
7. Zusammenfassung
II. Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund)
1. Einführung
2. Allgemeines
3. Geltungsbereich
4. Tätigkeitsmerkmale
5. Geltung der einzelnen Teile der Entgeltordnung
a) Allgemeines
b) Geltung der Teile III, IV, V und VI
c) Geltung der Teile I und II
d) Eingruppierung bei mehreren Arbeitsvorgängen
e) Tätigkeitsmerkmale mit Voraussetzungen in der Person in den Teilen III bis VI
6. Ständige Vertreterinnen und Vertreter
7. Unterstellungsverhältnisse
8. Abschnitt II Voraussetzungen in der Person
a) Voraussetzungen in der Person
b) Eingruppierung bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen in der Person
9. Abschnitt III Zulagen
a) Entgeltgruppenzulagen
b) Sonstige Zulagen
aa) Außertarifliche Zulage für Beschäftigte im Vorzimmerdienst
bb) Außertarifliche Zulage für Tarifbeschäftigte beim BAMF
cc) Übertarifliche IT-Fachkräftezulage
10. Abschnitt IV Inkrafttreten
III. Entgeltordnung (Anlage 1 zum TV EntgO Bund)
1. Allgemeines
a) Modernisierung der Tätigkeitsmerkmale
b) Integration Arbeiter-/Angestelltenmerkmale
2. Höhere Eingruppierungen – Berücksichtigung früherer BAT-Aufstiege
3. Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst
a) Aufbau der Eingruppierungsmerkmale des Teils I
b) Baukastenprinzip und Heraushebungsmerkmale
c) Tätigkeitsmerkmale für Verwaltungsangestellte mit Beispielen
aa) „einfachste Tätigkeiten“ (Entgeltgruppe 1)
bb) „einfache Tätigkeiten“ (Entgeltgruppe 2)
cc) „Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist“ (Entgeltgruppe 3)
dd) „schwierige Tätigkeiten“ (Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1)
ee) „gründliche Fachkenntnisse“ (Entgeltgruppen 4 und 5 Fallgruppe 2)
ff) „abgeschlossene Berufsausbildung und entsprechende Tätigkeit“ (Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1)
aaa) „abgeschlossene Berufsausbildung“ (§ 11 TV EntgO Bund)
bbb) „entsprechende Tätigkeit“
gg) „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse“ (Entgeltgruppe 6)
hh) „selbstständige Leistung (Entgeltgruppen 7, 8, 9a, 9b Fallgruppe 2)
ii) „gründliche, umfassende Fachkenntnisse (Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2)
jj) „abgeschlossene Hochschulbildung und entsprechende Tätigkeit“ (Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1)
aaa) „abgeschlossene Hochschulbildung“ (§ 8 TV EntgO Bund)
bbb) „entsprechende Tätigkeiten“
kk) „besonders verantwortungsvolle Tätigkeit“ (Entgeltgruppe 9c)
ll) „besondere Schwierigkeit und Bedeutung“ (Entgeltgruppe 10 und 11)
mm) „Maß der Verantwortung“ (Entgeltgruppe 12)
nn) „abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung und entsprechende Tätigkeiten“ (Entgeltgruppe 13)
aaa) „abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung“ (§ 7 TV EntgO Bund)
bbb) „entsprechende Tätigkeit“
oo) „besondere Schwierigkeit und Bedeutung der Tätigkeit“ (Entgeltgruppe 14)
pp) „Maß der Verantwortung“ (Entgeltgruppe 15)
4. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten
5. Teil III Tätigkeitsmerkmale für besondere Berufsgruppen
6. Teile IV bis VI Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Verwaltungszweige
IV. Überleitung vorhandener Beschäftigter
1. Überleitungsgrundsatz
2. Verbleib in der bisherigen Entgeltgruppe
3. Höhergruppierung auf Antrag
a) Einführung der neuen Entgeltordnung
b) Einführung der neuen Entgeltgruppe 9c
4. Stufenzuordnung bei antragsmäßiger Höhergruppierung
a) Überleitung in die EntgO
b) Einführung der Entgeltgruppe 9c
V. Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit (§ 14 TVöD)
1. Allgemeines
a) Zweck der Tarifnorm
b) Verhältnis zum Grundsatz der Tarifautomatik
2. Interessenlage der Beteiligten und Rechtsprechungsentwicklung
3. Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
a) Tarifliche Wertigkeit
b) Übertragung im Wege der Direktionsrechtsausübung
4. Vorübergehende Übertragung
a) Allgemeines
b) Übertragungsvorgang
c) Vorübergehender Bedarf
aa) Allgemeines
bb) Abgrenzung
5. Einzelfälle
a) Erprobung
b) Übertragung von Führungspositionen auf Probe oder Zeit
c) Überbrückung
d) Vertretungsfälle
6. Erforderliche Ausübungsdauer der höherwertigen Tätigkeit
a) Tatsächliches Ausüben der höherwertigen Tätigkeit
b) Grundsatz: Monatsfrist
aa) Fristbeginn: § 187 Abs. 2 BGB
bb) Dauer: 30 Tage
cc) Fristende: § 188 Abs. 1 BGB
c) Öffnungsklausel für landesbezirkliche Tarifverträge (§ 14 Abs. 2 TVöD)
7. Rechtsfolge: persönliche Zulage nach § 14 Abs. 3 TVöD
a) Rückwirkende Zahlung der Zulage
b) Höhe der Zulage
aa) Neuregelung der Bemessungsvorschrift
bb) Bemessungsgrundlage
c) Fälligkeit der Zulage
8. Beendigung der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
9. Beteiligung der Mitarbeitervertretungen
a) Mitbestimmung von Personal- oder Betriebsrat
b) Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten
10. Zusammenfassung
VI. Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle
1. Tabellenentgelt (§ 15 TVöD)
a) Allgemeines
b) Höhe des Tabellenentgelts
c) Neuregelung der Entgelte durch Tarifeinigung 2018 und 2020
2. Stufenzuordnung (§ 16 TVöD)
a) Neuregelung des Einstufungsrechts
aa) Strukturelle Änderungen des Einstufungsrechts
bb) Stufenprüfung und -zuordnung bei Neueinstellungen
b) Anzahl der Stufen in den Entgeltgruppen
aa) Stufenanzahl
bb) Besondere Überleitungsregeln für die EG 9a–15
aaa) Überleitung aus der Stufe 5 zum Stichtag
bbb) Überleitung aus einer individuellen Endstufe
ccc) Tarifbeschäftigte in der Entgeltgruppe 9a oder Entgeltgruppe 9b
cc) Stufenzuordnung in die Stufe 6 ab dem 1. März 2016
c) Stufenzuordnung bei Einstellungen
aa) Grundlagen des Stufenrechts
aaa) Berufserfahrung
bbb) Beschäftigungszeit
bb) Stufenzuordnung bei Einstellung in die EG 2–15
aaa) Einstellung
bbb) Zuordnung zur Stufe 1
ccc) Zuordnung zur Stufe 2 und Stufe 3
(1) Anspruchsvoraussetzung – Einschlägige Berufserfahrung
(a) Gleichartigkeit der beiden Tätigkeiten
(b) Eingruppierungsrechtliche Gleichwertigkeit der vorherigen Tätigkeit
(c) Vorhergehende berufliche Tätigkeit
(d) Vollzeit/Teilzeit, mehrere berufliche Tätigkeiten
(e) Zusammenfassung einschlägige Berufserfahrung
(2) Keine schädliche Unterbrechung
(3) Rechtsfolge
ddd) Stufenzuordnung bei Anerkennung förderlicher Zeiten
(1) Voraussetzungen
(a) Förderliche Zeiten
(b) Deckung des Personalbedarfs
(2) Rechtsfolge
(3) Zusammenfassung „Anrechnung förderlicher Zeiten“
d) Stufenzuordnung bei horizontaler und vertikaler Wiedereinstellung
aa) Anspruchsvoraussetzungen
aaa) Unmittelbarer Anschluss
bbb) Arbeitsverhältnis zum Bund
ccc) Einschlägige Berufserfahrung (Gleichwertigkeit)
bb) Rechtsfolge
cc) Stufenzuordnung bei vertikaler Wiedereinstellung
e) Anrechnung von Stufenlaufzeiten bei einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes
aa) Anspruchsvoraussetzungen
aaa) Unmittelbarer Anschluss
bbb) Vorheriger Arbeitgeber
ccc) Gleichwertigkeit
bb) Rechtsfolge
cc) Wechsel innerhalb des Bundes
f) Stufenlaufzeiten
aa) Allgemeines
aaa) Ununterbrochene Beschäftigung
bbb) Derselbe Arbeitgeber
ccc) Dieselbe Entgeltgruppe
bb) Stufenlaufzeiten im Einzelnen
g) Besonderheit der Stufenzuordnung in der Entgeltgruppe 1
h) Zulage zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften zur Deckung des Personalbedarfs
aa) Tarifliche Maßnahmen
bb) Übertarifliche Maßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften auf dem Gebiet der Informationstechnik
aaa) Übertarifliche IT-Fachkräftezulage
bbb) Übertarifliche Vorweggewährung von Stufen
ccc) Weitere Maßnahmen
i) Inkrafttreten und Stufenzuordnung
j) Zusammenfassung Stufenzuordnung
k) Checkliste Stufenzuordnung
l) Beteiligung der Betriebs- und Personalräte
3. Stufenaufstieg (§ 17 TVöD)
a) Allgemeines
b) Änderung der Stufen
c) Verkürzung oder Verlängerung der Stufenlaufzeiten unter Leistungsaspekten
d) Berücksichtigung von Zeiten bei der Berechnung der Stufenlaufzeit
aa) Unschädliche Unterbrechungen
bb) Schädliche Unterbrechungen
e) Höhergruppierung, dauerhafte
aa) Allgemeines
bb) Stufenzuordnung bei Höhergruppierungen
f) Herabgruppierung
aa) Allgemeines
bb) Stufenzuordnung bei Herabgruppierungen
Kontrollfragen
Kapitel C Entgelt und sonstige Leistungen
I. Leistungsbezogenes Entgelt
1. Allgemeines
2. Leistungsentgelt im TVöD (Bund)
a) Geltungsbereich
b) Tarifvertragliches Leistungsentgelt als Option
c) Verpflichtung zur Ausgestaltung nach dem LeistungsTV-Bund
d) Umsetzung LOB nach LeistungsTV-Bund und Dienstvereinbarungen
e) Instrumente der Leistungsfeststellung
aa) Zielvereinbarung
bb) Systematische Leistungsbewertung
cc) Kombination
dd) Dokumentation
f) Konfliktregelung und paritätische Kommission
3. Form des Leistungsentgelts: Leistungszulagen und Leistungsprämien
II. Übertarifliche Einführung eines Leistungsprämien- und Leistungszulagensystems
1. Leistungsprämien- und Leistungszulagensystem als Option
2. Anwendungsbereich
3. Vergabe der Leistungsprämien und Leistungszulagen
III. Jahressonderzahlung
1. Allgemeines
2. Anspruchsvoraussetzungen
a) Allgemeines
b) Stichtag 1. Dezember
c) Besonderheiten
aa) Unterbrochene Arbeitsverhältnisse beim selben Arbeitgeber
bb) Wechsel des Arbeitgebers
d) Vorangegangenes Ausbildungsverhältnis
3. Höhe und Auszahlung der Jahressonderzahlung
a) Prozentsätze
b) Bemessungsgrundlage
c) Verminderung der Jahressonderzahlung
aa) Die Zwölftelungsregelung
bb) Ausnahmen von der Zwölftelungsregelung
IV. Überblick über Zuschläge für Sonderformen der Arbeit
1. Allgemeines
2. Zulagen
V. Entgeltfortzahlung
1. Allgemeines
2. Bemessungsgrundlage der Entgeltfortzahlung
a) Lohnausfallprinzip
aa) Tabellenentgelt
bb) Sonstige in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile
cc) Weiterzahlung
b) Referenzprinzip
aa) Nichtständige Entgeltbestandteile
bb) Besonderheiten
cc) Nicht berücksichtigungsfähige Umstände
3. Berechnung der Entgeltfortzahlung nach dem Referenzprinzip
a) Allgemeines
b) Berechnungszeitraum im Grundfall
c) Berechnungszeitraum bei besonderen Konstellationen
d) Ermittlung der Summe aller im Berechnungszeitraum berücksichtigungsfähigen (sogenannten) unständigen Entgeltbestandteile
e) Berechnung eines Tagesdurchschnitts – Regelfall
f) Berechnung des Tagesdurchschnitts bei verkürztem Berechnungszeitraum – Ausnahmefall
g) Berechnung des Tagesdurchschnitts bei verkürztem Berechnungszeitraum
h) Berechnung des Stundendurchschnitts
i) Allgemeine Entgeltanpassungen
VI. Besondere tarifliche Zahlungen: vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumsgeld, Sterbegeld
1. Allgemeines
2. Vermögenswirksame Leistungen
3. Jubiläumsgeld
4. Sterbegeld
a) Allgemeines
b) Anspruchsvoraussetzung: Tod des Beschäftigten
c) Berechtigte
d) Höhe
e) Entstehung und Fälligkeit
VII. Berechnung und Auszahlung des Entgelts
1. Bemessungszeitraum
2. Auszahlung bei Teilzeitbeschäftigten
a) Auszahlung im Grundfall
b) Auszahlung bei geleisteter Mehrarbeit
c) Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile Teilzeitbeschäftigter
d) Höhe von Schichtzulagen bei Teilzeitarbeit
3. Berechnung von anteiligem Monatsentgelt
4. Teil-Entgelt nach Absatz 5
5. Pauschalierung von Zuschlägen durch einzelvertragliche Vereinbarung
VIII. Betriebliche Altersversorgung
1. Allgemeines
2. Anspruch auf Zusatzversicherung
3. Betriebsrente als Zusatzversorgung zur gesetzlichen Rentenversicherung als Grundversorgung
4. Höhe der Betriebsrente
5. Vorzeitig beendetes Arbeitsverhältnis
6. Betriebsrente für Hinterbliebene
Kontrollfragen
Kapitel D Krankheit der Beschäftigten
I. Einführung
II. Historische Entwicklung
III. Verhältnis tarifrechtlicher und gesetzlicher Vorschriften der Entgeltfortzahlung
IV. Anspruchsvoraussetzungen des Entgeltfortzahlungsanspruchs im Krankheitsfall
1. Allgemeines
2. Anspruchsvoraussetzungen des Entgeltfortzahlungsanspruches
a) Persönlicher Anwendungsbereich nach dem EFZG
b) Persönlicher Anwendungsbereich und der TVöD
c) Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
aa) Krankheit
bb) Arbeitsunfähigkeit infolge der Krankheit
cc) Arbeitsunfähigkeit: Einzelfälle
(1) Übertragbare bzw. ansteckende Krankheiten
(2) Stationäre Behandlungen
(3) Arztbesuche in der Arbeitszeit
(4) Wegerisiko bei Erkrankungen, die nicht zu Arbeitsunfähigkeit führen
d) Kausalität/Ursächlichkeit der Krankheit, problematische Einzelfälle
aa) Allgemeines
bb) Besondere Fälle: Streik
cc) Besondere Fälle: Erkrankung während des Urlaubs
dd) Sonderurlaub
ee) Arbeitszeitausgleich
ff) Altersteilzeit
gg) Elternzeit
hh) Erkrankung an einem Feiertag
ii) Kündigung
jj) Beschäftigungsverbot und Krankheit in der Schwangerschaft
e) Kein Verschulden des Beschäftigten
aa) Zur Definition des Verschuldens
bb) Einzelfälle
(1) Arbeitsunfälle
(2) Alkohol
(3) Weitere Suchterkrankungen
(4) Weiteres gesundheitsschädigendes Verhalten
(5) Verkehrsunfälle
(6) Sportunfälle
f) Unverschuldete Arbeitsunfähigkeit bei Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation
g) Wartezeit
3. Anzeige- und Nachweispflichten
a) Allgemeines
b) Anzeigepflicht
c) Besonderheiten der Anzeigepflicht im Ausland
d) Nachweispflicht
e) Verkürzung des Vorlagezeitraums: Vorlage einer AU-Bescheinigung am ersten Krankheitstag
f) Fortdauernde Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
4. Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers
a) Verletzung der Nachweispflicht
b) Forderungsübergang bei Dritthaftung
V. Bezug, Höhe und Dauer der Entgeltfortzahlung
1. Allgemeines
2. Höhe
3. Dauer der Entgeltfortzahlung
a) Grundsatz
aa) Erkrankung nach Arbeitsschluss
bb) Erkrankung vor Arbeitsbeginn
cc) Erkrankung an einem arbeitsfreien Tag
dd) Erkrankung während der Arbeit
ee) Ruhendes Arbeitsverhältnis
b) Ende der Entgeltfortzahlung
c) Weitere bzw. Wiederholungserkrankungen
aa) Dauer der Entgeltfortzahlung bei Eintritt einer weiteren Erkrankung
bb) Neue Erkrankung während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit/Grundsatz der Einheit des Versicherungsfalles
cc) Wiederholungserkrankung: Erhalt des Anspruchs nach § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 EFZG
(1) Zum Begriff der Wiederholungserkrankung
(2) Erhalt des Anspruchs nach § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EFZG (Sechs-Monats-Zeitraum)
(3) Erhalt des Anspruchs nach § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 EFZG (Zwölf-Monats-Zeitraum)
(4) Verhältnis zwischen § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 EFZG
(5) Wechsel des Arbeitsplatzes
4. Darlegungs- und Beweislast
VI. Bezug, Höhe und Dauer des Krankengeldzuschusses
1. Allgemeines
2. Anspruch auf Krankengeld
3. Anspruch auf Krankengeld bei Erkrankung des Kindes
4. Krankengeldzuschuss
a) Höhe des Krankengeldzuschusses
b) Dauer des Krankengeldzuschusses
c) Krankengeldzuschuss bei Wiederholungserkrankungen
d) Höchstgrenzen des Krankengeldzuschusses im Kalenderjahr
5. Rückforderung überzahlter Krankengeldzuschüsse
VII. Stufenweise Wiedereingliederung bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit
VIII. Betriebliches Eingliederungsmanagement
IX. Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge von Krankheit
Kontrollfragen
Kapitel E Kontrollfragen und Antworten
Kapitel A
Kapitel B Teil 1
Kapitel B Teil 2
Kapitel C
Kapitel D
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Fußnoten
Vorwort
Nach der erfolgreichen Neuauflage des beliebten Standardwerkes Beschäftigte im öffentlichen Dienst I, das die Grundlagen des Arbeitsverhältnisses vermittelt, vervollständigt Band II dieses um die Themen Urlaub, Krankheit und Eingruppierung.
Insbesondere die anspruchsvolle Materie des Urlaubsrechts hat Dank des bedeutenden Einflusses der europarechtlichen Vorgaben und der vielfältigen und zugleich wechselhaften Rechtsprechung im letzten Jahrzehnt zu großer Verunsicherung in der Praxis geführt. Um diesen gordischen Knoten zu lösen, bietet das Werk eine systematisch klare Heranführung zu den zentralen Fragestellungen. Die Struktur urlaubsrechtlicher Grundsätze wird pointiert wiedergegeben, ergänzt um zahlreiche Beispielsfälle aus und für die Praxis, wie etwa zum Wechsel von Vollzeit zur Teilzeit, dem Verfall von Urlaubsansprüchen und Fragen der Urlaubsabgeltung.
Der Themenblock der Krankheit bildet den weiteren praxisrelevanten Akzent. Fragen zu Voraussetzung und Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall werden dargestellt ohne die sozialversicherungsrechtlichen Aspekte außen vor zu lassen. Zur Vervollständigung wird auf die praxisnahen Fälle der stufenweisen Wiedereingliederung und des betrieblichen Eingliederungsmanagements näher eingegangen.
Schließlich kommt der Bereich der Eingruppierung im öffentlichen Dienst nicht zu kurz. Gerade für Einsteiger in die Materie bietet der zweite Band einen Handlungsleitfaden, wie eine rechtliche einwandfreie Entlohnung beim Arbeitgeber Bund gelingen mag. Auch in dieser Materie zeichnet sich das Werk durch zahlreiche Prüfschemata, Checklisten und wertvolle Praxishinweise aus.
Anknüpfungspunkt bildet, wie auch im ersten Band, die Vorauflage des geschätzten, sich nunmehr im Ruhestand befindenden, Kollegen Herrn Peter Linde, Dozent an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung – Fachbereich Bundeswehrverwaltung. Ihm gebührt großer Respekt und der Dank der Autoren.
Wir wünschen den Nutzern für die alltägliche Arbeit, dass dieses Buch zu einer praxisorientierten Unterstützung werden möge.
Brühl/Mannheim, im Januar 2021
Dr. Beatrix Jansen
Dr. Michael Kawik
Dr. Alexander Block
Autoren
Dr. Beatrix Jansen lehrt und forscht seit 2006 an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung am Fachbereich Bundeswehrverwaltung. Ihre Lehrtätigkeit umfasst das öffentliche Dienstrecht.
Bereits 1994 nahm Frau Dr. Jansen beratende Funktionen bei der Deutschen Postgewerkschaft wahr, gefolgt von Lehrtätigkeiten für den Deutschen Gewerkschaftsbund sowie die Handwerkskammer Trier. Für die AOK, Direktion Rheinland-Pfalz, war sie Verhandlungsführerin im Referat Krankenhäuser/Stationäre Pflege, von wo aus sie in das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung wechselte. Neben Stationen im Beschaffungsbereich und Vergaberechtsgrundsatz war sie zuletzt im Leitungsstab tätig. Neben zahlreichen Veröffentlichungen ist sie als ständige Ansprechpartnerin zu Fragen des öffentlichen Dienstrechts in den verschiedenen Ressorts der Bundesverwaltung gefragt.
Prof. Dr. Michael Kawik war viele Jahre als Jurist in der Bundesverwaltung in den unterschiedlichsten Bereichen tätig. Dabei hat er insbesondere praktische Erfahrungen im Bereich des Personalrechts gesammelt, welche auch seine Tätigkeit an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung prägen. Seit 2014 lehrt und forscht er nunmehr an der Hochschule des und beschäftigt sich dabei im Schwerpunkt mit Fragen des Rechts des öffentlichen Dienstes (Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht und Soldatenrecht). Dabei legt er ein besonderes Augenmerk auf die Verbindung zur Praxis. Aus diesem Grund ist er auch stark in der Fortbildung von Mitarbeitern der unterschiedlichen Behörden engagiert, führt Fortbildungsveranstaltungen für Rechtanwälte durch und bekommt einen weiteren Blick auf die Praxis über seine Kooperation mit einer Rechtsanwaltskanzlei.
Regierungsdirektor Dr. Alexander Block, LL.M ist seit 2011 Hochschullehrer für Bürgerliches Recht und Recht des öffentlichen Dienstes (Arbeits- und Tarifrecht) an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung am Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung in Brühl. Vor dieser Beschäftigung war er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Peter Winkler von Mohrenfels an der Universität Rostock und anschließend am Lehrstuhl von Prof. Dr. Ralph Weber an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald tätig. In dieser Zeit fertigte er seine Dissertation zum Internationalen Arbeitsrecht an und leitete Kolloquien und Vorlesungen zum Bürgerlichen Recht und zum Arbeitsrecht. Neben Veröffentlichungen vor allem im Bereich des Arbeitsrechts führt er personalrechtliche Seminare zum Tarif- und Arbeitsrecht für die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung durch. Seit Februar 2020 ist er stellvertretender Leiter des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltung an der Hochschule des Bundes.
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.
am angegebenen Ort
AbgG
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages
Abs.
Absatz
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ArbPlSchG
Arbeitsplatzschutzgesetz
Art.
Artikel
ASiG
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
AV
Arbeitsverhältnis/Arbeitsvorgang
AZG
Arbeitszeitgesetz
BAG
Bundesarbeitsgericht
BAT
Bundes-Angestelltentarifvertrag
BBG
Bundesbeamtengesetz
BBhV
Bundesbeihilfeverordnung
BBiG
Berufsbildungsgesetz
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BEEG
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BEM
Betriebliches Eingliederungsmanagement
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BFDG
Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGleiG
Bundesgleichstellungsgesetz
BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement
BHO
Bundeshaushaltsordnung
BImAG
Gesetz über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz
BMAS
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMEL
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMI
Bundesministerium des Innern
BMVg
Bundesministerium der Verteidigung
BPersVG
Bundespersonalvertretungsgesetz
BRRG
Beamtenrechtsrahmengesetz
bspw.
beispielsweise
BT-Drucks.
Bundestags-Drucksache
Buchst.
Buchstabe
BUKG
Bundesumzugskostengesetz
BUrlG
Bundesurlaubsgesetz
BZ
Beschäftigungszeit
bzw.
beziehungsweise
d.h.
das heißt
EG
Entgeltgruppe
EFZG
Entgeltfortzahlungsgesetz
EignÜbG
Eignungsübungsgesetz
Electronic Mail
EU
Europäische Union
EuAbgG
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
EÜGV
Verordnung zum Eignungsübungsgesetz
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FallGr.
Fallgruppe
ff.
fortfolgende
FPflZG
Familienpflegezeitgesetz
gem.
gemäß
GewO
Gewerbeordnung
GG
Grundgesetz
ggf.
gegebenenfalls
GÖD
Gewerkschaft öffentlicher Dienst
GRCh
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
grds.
grundsätzlich
i.d.R.
in der Regel
IfSG
Infektionsschutzgesetz
insb.
insbesondere
i.S.d.
im Sinne des
i.S.v.
im Sinne von
i.V.m.
in Verbindung mit
JArbSchG
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend
JFDG
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
KatSchErwG
Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes
KatSchG
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
Kfz
Kraftfahrzeug
KrWG
Kreislaufwirtschaftsgesetz
KSchG
Kündigungsschutzgesetz
KfW
Kreditanstalt für Wiederaufbau
lfd.
laufenden
Lj.
Lebensjahr
MiLoG
Mindestlohngesetz
MuSchG
Mutterschutzgesetz
NachwG
Nachweisgesetz
Nr.
Nummer
PC
Personal Computer
PflegeZG
Pflegezeitgesetz
Rn.
Randnummer
Rz
Randzeichen
RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz
Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung
S.
Satz
s.
siehe
SaZ
Soldat auf Zeit
SGB III
Sozialgesetzbuch Drittes Buch – Arbeitsförderung
SGB IV
Sozialgesetzbuch Viertes Buch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
SGB VI
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch – Gesetzliche Rentenversicherung
SGB IX
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
SMS
Short Message Service
sog.
sogenannte/r
SVG
Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihrer Hinterbliebenen
TdL
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
THW-HelfRG
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Helfer der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
TV ATZ
Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit
TV EntgO Bund
Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes
TVG
Tarifvertragsgesetz
TV-L
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TVöD
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVÜ-Bund
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
TVÜ-Land
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts
TVÜ-VKA
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD
TVUmBw
Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr
TzBfG
Teilzeit- und Befristungsgesetz
u.a.
unter anderem
UBWV
Unterrichtsblätter für die Bundeswehrverwaltung
UN
United Nations
u.U.
unter Umständen
VV-BHO
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung
WÜ
Wehrübung
z.B.
zum Beispiel
ZDG
Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer
ZPO
Zivilprozessordnung
ZSKG
Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes
Kapitel AUrlaub
I.Erholungsurlaub
1.Historische Entwicklung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs
1
Wenngleich der Erholungsurlaub von den Beschäftigten heutzutage als Selbstverständlichkeit zum Zwecke der Erholung und des Genusses von Freizeit wahrgenommen wird, hat sich ein Anspruch erst mühsam entwickeln müssen. Denn zunächst handelte es sich um ein wenigen Privilegierten zukommendes Luxusgut – der Statusgruppe der Beamten, die im Reichsbeamtengesetz von 1873 gestaffelt nach dem jeweiligen Status Urlaub erhielten: Schreiber und Adjutanten wurden eine Woche vom Dienst befreit, hohe Beamte erhielten bereits bis zu sechs Wochen Urlaub.
Sukzessive folgten Urlaubsansprüche für leitende Angestellte bei Banken und im Handel. „Einfachen“ Arbeitern blieb ein solcher Anspruch jedoch verwehrt bis zur Einführung des BUrlG von 1963, das ausgehend von einer Sechs-Tage-Woche 15 Tage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr und nach Vollendung des 35. Lebensjahres 18 Tage und damit drei Wochen Urlaub zusprach.
1994 wurde der Anspruch schließlich in § 3 BUrlG auf 24 Tage Mindesturlaub – folglich vier Wochen in einer Sechs-Tage-Woche – erhöht. Hiermit wurde den europäischen Vorgaben der Richtlinie des Rates vom 23.11.1993 entsprochen, überarbeitet durch die RL 2003/88/EG vom 4.11.2003, dessen Art. 7 wie folgt lautet:
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit jeder Arbeitnehmer einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen nach Maßgabe der Bedingungen für die Inanspruchnahme und die Gewährung erhält, die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder nach den einzelstaatlichen Gepflogenheiten vorgesehen sind.
(2) Der bezahlte Mindestjahresurlaub darf außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden.
Damit wurde der europäische Mindeststandard bis heute festgeschrieben, der in keinem Mitgliedsland der Europäischen Union unterschritten werden darf.
2.Tarifliche Urlaubsansprüche
2
Mit der letzten großen Tarifreform im öffentlichen Dienst vom 9.2.2005 haben die Tarifvertragsparteien die Urlaubsansprüche in § 26 TVöD neu gestaltet und in weiten Teilen auf das BUrlG Bezug genommen. Während es zunächst eine Staffelung der Urlaubshöhe nach dem Alter der Beschäftigten gab, wurde seitens der höchstrichterlichen Rechtsprechung diese aufgrund Altersdiskriminierung für rechtswidrig und damit unwirksam erklärt, weshalb sich die Tarifvertragsparteien zu Änderungen gezwungen sahen.
Dies hatte zur Folge, dass der Urlaubsanspruch für die Arbeitnehmer schließlich einheitlich geregelt wurde und ausgehend von der Fünf-Tage-Woche 30 Arbeitstage pro Kalenderjahr umfasst. Dabei setzt sich der tarifliche Anspruch aus 20 Tagen gesetzlichem Mindesturlaub und 10 weiteren Tagen – dem sog. Mehrurlaub – zusammen.
3
Dieselbe Anzahl von 30 Urlaubstagen steht nunmehr auch den Auszubildenden, normiert in § 9 TVAöD-BT-BBiG, zu, worauf § 9 TVAöD-AT verweist.
4
Praktikanten können nach § 10 TVPöD ebenfalls einen 30-tägigen Urlaubsanspruch geltend machen.
3.Entstehung des Urlaubsanspruchs
5
Jeder Arbeitnehmer i.S.d. § 2 BUrlG hat nach § 1 BUrlG, gleichgültig, ob voll- oder teilzeitbeschäftigt, ob befristet oder unbefristet, einen jährlichen Anspruch auf Erholungsurlaub.
Auch einem Arbeitnehmer in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis i.S.v. § 8 SGB IV, umgangssprachlich als Minijobber bezeichnet, steht ein solcher zu.
Maßgeblich zur Berechnung ist insoweit das Kalenderjahr wie gleichfalls § 1 BUrlG zu entnehmen ist.
Steht der Arbeitnehmer in zwei Arbeitsverhältnissen mit verschiedenen Arbeitgebern, sog. Doppelarbeitsverhältnissen, hat der Arbeitnehmer jeweils einen eigenständigen Urlaubsanspruch aus jedem einzelnen Arbeitsvertrag.
6
Wie § 13 Abs. 1 BUrlG zu entnehmen ist, kann von dem in § 3 BUrlG garantierten Mindesturlaubsanspruch i.H.v. vier Wochen nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden, sog. Unabdingbarkeitsgrundsatz.
7
Es handelt sich um einen höchstpersönlichen Anspruch, der weder verpfändet, gepfändet noch abgetreten werden kann, ebensowenig ist eine Aufrechnung mit bzw. gegen den Urlaubsanspruch möglich.
Demzufolge wurde seitens der Rechtsprechung auch jahrzehntelang die Vererbbarkeit von Urlaubsansprüchen abgelehnt. Da nur der Arbeitnehmer selbst den Urlaub in Anspruch nehmen kann, könne dieser einmal entstandene Anspruch im Todesfall auch nicht an die Hinterbliebenen vererbt werden. Nachdem das LAG Hamm den Fall der Alleinerbin Bollacke dem EuGH vorlegt hat, deren Ehemann während des bestehenden Arbeitsverhältnisses mit 140,5 offenen Urlaubstagen verstorben war, hat dieser entschieden, dass ein Abgeltungsanspruch im Hinblick auf den gesetzlichen Mindesturlaub aufgrund Art. 7 der RL 2003/88/EG besteht.[1] Der Urlaubsanspruch umfasse auch dessen Bezahlung; ein finanzieller Ausgleich sei bei dem Tod des Beschäftigten unerlässlich, da es sonst zu einem rückwirkenden Verlust des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub kommen könne.
Während der EuGH nur hinsichtlich des europarechtlich garantierten Mindesturlaubs einen Abgeltungsanspruch zusprechen konnte, hat das BAG diesen darüber hinaus auf Mindesturlaub, Mehrurlaub sowie Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen erweitert.
Abgegolten werden:[2]
Mindesturlaub i.H.v. 20 Tagen
Mehrurlaub i.H.v. 10 Tagen
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen, § 208 SGB IX
Gleiches müsste auch gelten für:
Zusatzurlaub für Schichtarbeit, § 27 TVöD, mangels anderweitiger tarifvertraglicher Regelung.
a)Wartezeit nach dem BUrlG
8
Die Tarifvertragsparteien haben keine Regelung dahin gehend getroffen, ab wann der Arbeitnehmer Erholungsurlaub geltend machen kann.
Demzufolge ist § 4 BUrlG heranzuziehen, mit der Folge, dass der volle Urlaubsanspruch erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben wird.
Die Beziehung der Vertragsparteien soll sich zunächst verfestigt und insbesondere die Probezeit als solche auch genutzt werden, bevor Urlaub gewährt wird.
Ist die Wartezeit nach sechs Monaten abgelaufen, entsteht bereits der volle gesetzliche Mindestjahresurlaub.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer wird zum 1.10.2021 eingestellt und scheidet zum 31.12.2021 wieder aus dem Arbeitsverhältnis aus. Bis zum 31.12.2021 kann er im laufenden Kalenderjahr die Wartezeit nicht erfüllen.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer wird zum 1.2.2021 eingestellt. Die Wartezeit beginnt nach § 187 Abs. 2 S. 1 BGB zum 1.2. zu laufen, sie endet nach § 188 Abs. 2 S. 2 BGB am 31.7. Ab dem 1.8. ist die Wartezeit überschritten und es besteht ein Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen.
b)Teilurlaubsansprüche nach dem BUrlG
9
Wird die sechsmonatige Wartezeit nicht überschritten, steht dem Arbeitnehmer lediglich ein Teilurlaubsanspruch zu. § 5 BUrlG lässt dabei für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs entstehen. Pro Monat wird folglich 1/12 von 20 Tagen gewährt, was 1,66 Tagen entspricht.
§ 5 BUrlG differenziert dabei zwischen drei Varianten:
Absatz 1 a Nichterfüllung der Wartezeit im Kalenderjahr
Erfasst werden Fälle, in denen der Arbeitnehmer die Wartezeit aufgrund des Beginns des Arbeitsverhältnisses nicht mehr überschreiten kann.
Dies ist bei jeder Einstellung ab dem 1. Juli der Fall.
Beispiele
Ein Arbeitnehmer wird zum 1.7.2021 eingestellt. Seine Wartezeit endet zum 31.12.2021. Der Arbeitnehmer überschreitet diese erst am 1.1.2022. Daher entsteht ein Anspruch von 6/12 von 20 Tagen, folglich 10 Tage.
Ein Arbeitnehmer wird zum 1.12.2021 eingestellt. Es entsteht mit Ablauf des 31.12.2021 ein Anspruch auf 1/12 von 20 Tagen, folglich 1,66 Tage.
Nach § 5 Abs. 2 BUrlG wird dieser, da mindestens einen halben Tag ergebend, aufgerundet auf 2 Tage.
Absatz 1 b Ausscheiden vor erfüllter Wartezeit
Diese Ausnahmeregelung vom vollen Urlaubsanspruch berücksichtigt Fallkonstellationen, bei denen der Arbeitnehmer in der ersten Kalenderjahreshälfte eingestellt wurde, jedoch vor Überschreiten der Wartezeit wieder ausscheidet.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer beginnt sein Arbeitsverhältnis zum 1.4.2021 und scheidet mit Ablauf des 31.5.2021 aus diesem aus. Es entsteht ein Anspruch von 2/12 von 20 Tagen, folglich 3,33 Tage.
Dieser Anspruch ist genau in diesem Umfang zu gewähren. Zwar enthält § 5 BUrlG eine Regelung zur Aufrundung, soweit ein Anspruch von mindestens 0,5 Tagen besteht. Es fehlt indessen bei unterhälftigen Ansprüchen bis 0,49 eine Regelung, die die Abrundung erlaubt. Fehlt eine solche, darf der entstandene gesetzliche Mindesturlaubsanspruch auch nicht abgerundet werden.
Absatz 1 c Ausscheiden in der ersten Kalenderjahreshälfte nach erfüllter Wartezeit
Hat der Arbeitnehmer die Wartezeit bereits überschritten und scheidet sodann aus dem Arbeitsverhältnis aus, entsteht ein Teilurlaubsanspruch, wenn das Arbeitsverhältnis in der ersten Kalenderjahreshälfte, also bis zum 30.6. endet.
Beispiele
Ein seit 2015 beschäftigter Arbeitnehmer kündigt sein Arbeitsverhältnis zum 30.6.2021. Da er aufgrund der langjährigen Beschäftigungszeit die Wartezeit schon lange überschritten hat, ist § 5 Abs. 1 c BUrlG einschlägig, mit der Folge, dass ihm ein Teilurlaubsanspruch zusteht. Dieser berechnet sich wie folgt: 6/12 von 20 Tagen, folglich 10 Tage.
Ein seit 2015 beschäftigter Arbeitnehmer scheidet zum 30.9.2021 aus dem Arbeitsverhältnis aus. Er hat die Wartezeit überschritten, so dass § 5 Abs. 1 a und b BUrlG nicht in Betracht kommen. Auch § 5 Abs. 1 c BUrlG greift nicht, da der Arbeitnehmer in der zweiten Kalenderjahreshälfte ausscheidet.
Daher steht ihm nicht nur ein Teilurlaubsanspruch zu, sondern mangels weiterer Ausnahmeregelung der volle gesetzliche Mindesturlaub von 20 Tagen.
10
Ist dem Arbeitnehmer bereits der volle Jahresurlaubsanspruch gewährt worden und scheidet er gleichwohl in der ersten Jahreshälfte aus, stellt § 5 Abs. 3 BUrlG ein Rückforderungsverbot auf.
Weder kann der Arbeitnehmer, der zu viel Urlaub erhalten hat, diesen zurückgeben noch kann das dem Arbeitnehmer gezahlte Urlaubsentgelt von diesem zurückgefordert werden. Die zu viel gewonnene Freizeit kann nicht mehr rückgängig gemacht werden und das Geld verbleibt beim Arbeitnehmer.[3] Nur im Falle eines nachweisbar treuwidrigen oder sittenwidrigen Handelns des Arbeitnehmers kann sich ein Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers im Umfang des zu viel gezahlten Urlaubsentgelts ergeben, mit der Folge, dass dieses zurückgefordert oder mit ausstehenden Lohnansprüchen grds. verrechnet werden kann.[4]
11
Scheinbar nicht deutlich formuliert ist in § 5 BUrlG, ob die Regelung bei dem verwendeten Begriff „Monat“ von einem Beschäftigungsmonat oder einem Kalendermonat ausgeht. Um Arbeitnehmer nicht zu benachteiligen, die im laufenden Kalendermonat ein Arbeitsverhältnis eingehen, erfasst die Regelung Beschäftigungsmonate.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer wird zum 15.1.2021 eingestellt und scheidet zum 14.2.2021 aus diesem wieder aus. Da es bei der Berechnung von Teilurlaubsansprüchen nicht auf Kalendermonate, sondern Beschäftigungsmonate ankommt, erwirbt der Arbeitnehmer einen Anspruch von 1/12 von 20 Tagen, folglich 1,66 Tage. Auch hier erfolgt eine Rundung aufgrund § 5 Abs. 2 BUrlG auf 2 Tage.
Hat der Arbeitnehmer hingegen nur Teile eines Monats in einem Beschäftigungsverhältnis erbracht, erwirbt er insoweit keinen Urlaubsanspruch.
Beispiel
Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1.3.2021 und endet mit Ablauf des 29.4.2021. Hier besteht lediglich ein voller Beschäftigungsmonat vom 1.3. bis 31.3.2021, so dass auch nur ein anteiliger Urlaubsanspruch von 1/12 von 20 Tagen, folglich 1,66 Tage, gerundet 2 Tage entsteht.
12
Unerheblich für die Ermittlung des Urlaubsanspruchs ist es, ob an dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses eine Arbeitspflicht besteht oder nicht. Auch ohne Arbeitsleistung entsteht ein Anspruch auf Erholungsurlaub.
Beispiel
Ein Arbeitsvertrag wird mit Beginn zum 1.1.2021 geschlossen. Dass der erste Arbeitstag auf einen gesetzlichen Feiertag – Neujahr – fällt, steht dem Anspruch nicht entgegen.
Unerheblich ist es ebenfalls für die Entstehung des Urlaubsanspruchs, wenn der Arbeitnehmer gleich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses nicht arbeiten kann, weil er arbeitsunfähig erkrankt ist.
Gleiches gilt für eine Arbeitnehmerin, für die nach dem MuSchG ein Beschäftigungsverbot besteht oder für einen nach dem IfSG unter Quarantäne stehenden Beschäftigten, wie z.B. eines an COVID-19 erkrankten Arbeitnehmers oder eines insoweit krankheitsverdächtigen Arbeitnehmers. Zum Erwerb von Urlaubsansprüchen ist in diesen Beispielsfällen keinerlei tatsächliche Arbeitsleistung erforderlich.
c)Teilurlaubsansprüche nach dem TVöD
13
Auch der Tarifvertrag sieht einen anteiligen Urlaubsanspruch vor, soweit ein Arbeitnehmer nicht das gesamte Kalenderjahr in einem Arbeitsverhältnis steht.
Nach § 26 Abs. 2 b TVöD erhält der Beschäftigte für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Jahresurlaubsanspruchs von 30 Tagen.
Im Gegensatz zu der gesetzlichen Regelung im BUrlG sieht die Tarifnorm in Absatz 1 Satz 4 TVöD eine Rundungsregelung nach oben und unten vor.
Beispiel
Der Arbeitnehmer tritt am 1.3.2021 in das Arbeitsverhältnis ein, welches am 31.7.2021 endet. Es entsteht ein anteiliger Urlaubsanspruch von 5/12 von 30 Tagen, folglich 12,5 Tage, die auf 13 Tage aufgerundet werden.
Besteht das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate, so bleibt es – im Gegensatz zu der gesetzlichen Regelung nach § 4 BUrlG – bei einer anteiligen Urlaubsberechnung.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer tritt am 1.4.2021 in das Arbeitsverhältnis ein und scheidet am 31.12.2021 aus diesem aus. Es entsteht ein anteiliger Anspruch von 9/12 von 30 Tagen, folglich 22,5 Tage, gerundet 23 Tage.
Auch bei dem tariflichen Urlaubsanspruch ist es unerheblich, ob der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zu Beginn oder im Laufe eines Kalendermonats beginnt, da wie bei der gesetzlichen Regelung der Begriff „Monat“ als Beschäftigungsmonat zu verstehen ist. Dies lässt sich in § 26 TVöD bereits aus dem Umkehrschluss des Absatz 2 c ableiten, der stattdessen von Kalendermonat spricht. Da ein Unterschied zwischen „Monat“ und „Kalendermonat“ bestehen muss, kann sich hinter „Monat“ nur der Beschäftigungsmonat verbergen.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer tritt zum 17.2.2021 in das Arbeitsverhältnis ein und scheidet zum 16.4.2021 wieder aus. Der Arbeitnehmer hat zwei volle Beschäftigungsmonate gearbeitet, so dass sich ein Anspruch auf 2/12 von 30 Tagen, folglich 5 Tage ergibt.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer tritt zum 17.2.2021 in das Arbeitsverhältnis ein und scheidet zum 16.4.2021 wieder aus. Der Arbeitnehmer hat zwei volle Beschäftigungsmonate gearbeitet, so dass sich ein Anspruch auf 2/12 von 30 Tagen, folglich 5 Tage ergibt.
Unerheblich ist es für den Arbeitnehmer, wenn er zum Ende des Kalenderjahres mit dem Arbeitsverhältnis beginnt. Auch bei Überschreiten des Kalenderjahres erfolgt die Urlaubsberechnung nach Beschäftigungsmonaten.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer beginnt zum 6.12.2021 sein Arbeitsverhältnis und scheidet zum 5.1.2022 aus diesem wieder aus. Hier erwirbt der Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch von 1/12 von 30 Tagen, folglich 2,5 Tage, gerundet 3 Tage.
Allerdings werden auch beim tarifierten Anspruch lediglich volle Monate erfasst.
Beispiel
Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1.5.2021 und endet zum 28.6.2021. Hier entsteht für den Beschäftigungsmonat vom 1.5.2021 bis zum 31.5.2021 ein anteiliger Urlaubsanspruch von 1/12 von 30 Tagen, folglich 2,5 Tage, gerundet 3 Tage.
Der darauffolgende Zeitraum ab dem 1.6.2021 bleibt in Bezug auf einen Urlaubsanspruch unberücksichtigt.
d)Spannungsfeld zwischen Teilurlaubsansprüchen nach dem BUrlG und dem TVöD
14
Der gesetzliche Urlaubsanspruch darf wegen des Unabdingbarkeitsgrundsatzes des § 13 BUrlG nicht unterschritten werden. Demgegenüber lässt es das Günstigkeitsprinzip stets zu, dass der Anspruch des Arbeitnehmers überschritten werden darf.
Beispiel
Das am 1.5.2021 beginnende Arbeitsverhältnis wird zum 31.10.2021 beendet.
Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 6/12 von 20 Tagen, folglich 10 Tage.
Der tarifliche Anspruch beläuft sich auf 6/12 von 30 Tagen, folglich 15 Tage.
Aufgrund des Günstigkeitsprinzips erwirbt der Arbeitnehmer den höheren Urlaubsanspruch von 15 Tagen.
Beispiel
Das Arbeitsverhältnis beginnt zum 1.1.2021 und endet mit Ablauf des 1.7.2021. Da die Wartezeit mit Ablauf des 31.6.2021 überschritten worden ist und erst mit Ablauf des 1.7.2021 endet, entsteht der volle gesetzliche Mindestjahresurlaubsanspruch von 20 Tagen. Der tarifliche Urlaubsanspruch besteht hingegen nur i.H.v. 6/12 von 30 Tagen, folglich 15 Tage. Weil aufgrund des Unabdingbarkeitsgrundsatzes nach § 13 BUrlG der gesetzliche Mindestjahresanspruch nicht unterschritten werden darf, erhält der Arbeitnehmer 20 Tage Erholungsurlaub.
Beispiel
Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1.3.2021 und endet mit Ablauf des 30.9.2021. Es entsteht der volle gesetzliche Mindestjahresurlaubsanspruch von 20 Tagen. Der tarifliche Urlaubsanspruch besteht hingegen nur i.H.v. 7/12 von 30 Tagen, folglich 17,5 Tage, gerundet 18 Tage.
Die beiden letztgenannten Beispiele zeigen deutlich eine Schwäche der gesetzlichen Regelung auf, indem ein Arbeitnehmer, der kaum mehr als sechs Monate bzw. sieben gearbeitet hat, genauso gestellt wird wie ein Arbeitnehmer, der acht Monate seine Arbeit erbracht hat und nach dem Tarifvertrag ebenfalls 20 Tage Erholungsurlaub erhält (8/12 von 30 Tagen, folglich 20 Tage). Solange der Gesetzgeber insofern keinen Regelungsbedarf sieht, ist diese Unbilligkeit jedoch schlichtweg hinzunehmen.
4.Umfang des Erholungsurlaubsanspruchs
a)Regelfall
15
Der Mindesturlaub nach dem BUrlG beträgt, wie bereits erwähnt, nach § 3 Abs. 1 jährlich mindestens 24 Werktage. Da nach Absatz 2 als Werktage alle Kalendertage gelten, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind, ging das BUrlG bei seinem Inkrafttreten noch vom Regelfall einer Sechs-Tage-Woche aus.
In der heutzutage üblichen Fünf-Tage-Woche entspricht dies einem Urlaubsanspruch von 5/6 von 24 Tagen, folglich 20 Urlaubstagen.
Auch dem TVöD liegt grds. eine Fünf-Tage-Woche zugrunde, wie sich aus § 6 Abs. 1 S. 3 und § 26 Abs. 1 S. 3 TVöD ergibt, wonach die regelmäßige Arbeitszeit auf fünf Tage verteilt wird, so dass sich bei 30 Urlaubstagen jährlich ein sechswöchiger Urlaubsanspruch ergibt, folglich ein Mehrurlaub von 10 Tagen gegenüber § 3 BUrlG.
b)Abweichung
16
Wählt der Arbeitnehmer ein von der Fünf-Tage-Woche abweichendes Arbeitszeitmodell oder wird dies von ihm abverlangt, hat dies auch Auswirkungen auf die Anzahl der Urlaubstage, wie dem Wortlaut des § 3 BUrlG zu entnehmen ist. Auch die Tarifnorm lässt eine anderweitige Verteilung der Arbeitszeit nicht unberücksichtigt. So legt § 26 Abs. 1 S. 3 TVöD fest, dass bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche sich der Urlaubsanspruch entsprechend erhöht oder vermindert.
Unerheblich ist hingegen für die Berechnung der Urlaubstage, wie lange der Arbeitnehmer an den einzelnen Tagen arbeiten muss. Ob Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit spielt insoweit also keine Rolle und hat lediglich Auswirkungen auf das Entgelt. Denn dafür umfasst die freizustellende Zeit pro Arbeitstag bei einer Teilzeitkraft auch entsprechend weniger Arbeitsstunden als die einer Vollzeitkraft. Eine Ungleichbehandlung eines in Vollzeit tätigen Arbeitnehmers erfolgt somit nicht.
Anhand folgender Formel wird der Erholungsurlaubsanspruch berechnet:
Anzahl der Urlaubstage nach § 26 Abs. 1 S. 2 TVöD × Anzahl der individuellen Arbeitstage pro Woche: 5 Arbeitstage.
Hieraus ergeben sich folgende Urlaubsansprüche:
Urlaubsanspruch im Kalenderjahr in Tagen
1-Tag-Woche
6
2-Tage-Woche
12
3-Tage-Woche
18
4-Tage-Woche
24
5-Tage-Woche
30
6-Tage-Woche
36
6.Änderung der Anzahl der Wochenarbeitstage im laufenden Kalenderjahr
18
Die neue „Arbeitswelt 4.0“ hat bereits in den vergangenen Jahren deutliche Spuren hinterlassen, die sich auch zwingend auf die Urlaubsansprüche der Beschäftigten auswirken. Anpassungsfähige, wechselnde Arbeitszeiten und Arbeitsorte sind unter den Arbeitnehmern begehrt und die Gewährung flexibler Arbeitszeitmodelle zeichnen einen modernen Arbeitgeber aus, der mittels „atmender Systeme“ den Wünschen seiner Beschäftigten entgegenkommt, um insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherzustellen.
Dies hat allerdings den Preis, dass bei einem unterjährigen mehrfachen Wechsel der Arbeitszeiten nicht unerhebliche Probleme bei der Berechnung von Urlaubsansprüchen auftreten können, wie im Folgenden dargestellt werden wird.
a)Entwicklung
19
Bis zum Kalenderjahr 2010 wurden Urlaubsansprüche stets danach ermittelt, zu welchen aktuellen Bedingungen der Arbeitnehmer seine Arbeit erbrachte. Wurde er in Vollzeit tätig und nahm Urlaub, so wurde bei der Berechnung stets eine Vollzeittätigkeit zugrunde gelegt, selbst wenn der Arbeitnehmer „Resturlaub“ aus einem anderen Teilzeitarbeitszeitmodell in Anspruch nahm.
Dies führte insbesondere dann zu nicht unerheblichem Unmut unter den besonders betroffenen weiblichen Beschäftigten, wenn im umgekehrten Fall diese Beschäftigten zunächst in Vollzeit gearbeitet hatten, schwanger wurden und nach der Elternzeit in Teilzeit ihre Arbeit wieder aufnahmen. Auch hier wurden ganz selbstverständlich alle „Resturlaubsansprüche“ aus der vorherigen Vollzeit an die neue, geringere Arbeitszeit angepasst und damit die Urlaubstage regelmäßig gekürzt.
20
Einer Arbeitnehmerin aus Tirol/Österreich erging es ebenso. Sie war zunächst in Vollzeit beschäftigt, wurde schwanger und durfte aufgrund eines Beschäftigungsverbots nicht mehr arbeiten. Nach Rückkehr aus der Elternzeit arbeitete sie an einer reduzierten Anzahl von Tagen in Teilzeit. Ihre Urlaubsansprüche aus der Vollzeittätigkeit wurden ihr sodann an das neue Arbeitszeitmodell angepasst und reduziert. Dies wollte die Arbeitnehmerin nicht hinnehmen und klagte. Das zuständige Gericht legte den Fall sodann dem EuGH vor, der zu diesem Themenkomplex die aufsehenerregende Entscheidung mit der Bezeichnung Tirol traf.[6]
So hat dieser festgestellt, dass ein Verstoß gegen § 4 der am 6.6.1997 geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15.12.1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit in der durch die Richtlinie 98/23/EG des Rates vom 7.4.1998 geänderten Fassung vorliegt, soweit bei einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes eines Arbeitnehmers das Ausmaß des noch nicht verbrauchten Erholungsurlaubs in der Weise angepasst wird, dass der von einem Arbeitnehmer, der von einer Vollzeit- zu einer Teilzeitbeschäftigung übergeht, in der Zeit der Vollzeitbeschäftigung erworbene Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, dessen Ausübung dem Arbeitnehmer während dieser Zeit nicht möglich war, reduziert wird oder der Arbeitnehmer diesen Urlaub nur mehr mit einem geringeren Urlaubsentgelt verbrauchen kann.
Der der Entscheidung zugrunde liegende § 4 Nr. 1 und 2 der o.g. Rahmenvereinbarung lautet wie folgt:
„1. Teilzeitbeschäftigte dürfen in ihren Beschäftigungsbedingungen nur deswegen, weil sie teilzeitbeschäftigt sind, gegenüber vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden, es sei denn, die unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen Gründen gerechtfertigt.
2. Es gilt, wo dies angemessen ist, der Pro-rata-temporis-Grundsatz.“
Der EuGH sieht denn auch in der Anpassung der Resturlaubsansprüche auf die Zeit der Teilzeitbeschäftigung eine Schlechterstellung von Teilzeitbeschäftigten.
Die Inanspruchnahme des Jahresurlaubs zu einer späteren Zeit als dem Bezugszeitraum soll in keiner Beziehung zu der in der späteren Zeit vom Arbeitnehmer erbrachten Arbeitszeit stehen. Aufgrund des Pro-rata-temporis-Grundsatzes soll der Urlaubsanspruch pro Zeiteinheit der jeweiligen Beschäftigung berechnet und gewährt werden.
Unzulässig ist demgegenüber eine nachträgliche Anwendung des Pro-rata-temporis-Grundsatzes bei Berechnung des Urlaubsanspruchs. Damit darf auch keine nachträgliche Minderung des Resturlaubsanspruchs erfolgen, der durch die Umstellung auf Teilzeitbeschäftigung zuvor generell erfolgte.
Zwar darf für neu zu erwerbende Urlaubsansprüche während der Teilzeit eine anteilige Berechnung des Urlaubs erfolgen, nicht jedoch für davor liegende Zeiträume der Vollzeitbeschäftigung.
Eine Einschränkung erfuhr die Entscheidung des EuGH jedoch zunächst unter Berufung auf die vorherige Rechtsprechung[7] dadurch, dass dieser Grundsatz nur gelten sollte, wenn der Arbeitnehmer nicht zuvor tatsächlich die Möglichkeit hatte, den Resturlaubsanspruch in Anspruch zu nehmen. War der Arbeitnehmer tatsächlich gehindert – so etwa bei aus betrieblichen Gründen verweigertem Urlaub oder bei Vorliegen eines Beschäftigungsverbots wie auch bei Krankheit oder einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme – so verbot sich eine Anpassung der Resturlaubsansprüche und damit ggf. deren Reduzierung.
21
Die Ausführungen des EuGH hielten die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik jedoch zunächst nicht davon ab, die in Vollzeit erworbenen Urlaubsansprüche runterzurechnen und Eins-zu-eins anzuerkennen, weshalb der EuGH erneut in der Sache Brandes um eine Entscheidung bemüht werden musste.[8] Die im Geltungsbereich des TV-L beschäftigte Frau Brandes arbeitete ebenfalls in Vollzeit, wurde schwanger, erhielt ein Beschäftigungsverbot und kehrte ebenfalls in Teilzeit aus der Elternzeit zurück. Nachdem auch ihr der verbliebene Urlaub aus der Vollzeit angepasst an die Teilzeit gekürzt worden war, zog Frau Brandes vor das Arbeitsgericht. Auch sie erhielt Rückendeckung seitens des EuGH, der bestätigte, dass auch für die Bundesrepublik die europäischen Mindeststandards Anwendung finden und eine Kürzung der Urlaubsansprüche eine Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter darstellt.
22
In einer weiteren Entscheidung ist das BAG dieser Ansicht gefolgt und hat das Diskriminierungsverbot direkt aus § 4 Abs. 1 TzBfG abgeleitet und nicht von weiteren Bedingungen abhängig gemacht.[9]
So spielt es gerade keine Rolle, ob der Arbeitnehmer vor dem Wechsel des Arbeitszeitmodells seinen Erholungsurlaub hat nehmen können. Krankheit oder Beschäftigungsverbot sind keine Bedingung für den Erhalt der einmal erworbenen Urlaubsansprüche. Auch der Grund des Wechsels von Vollzeit zu Teilzeit ist unerheblich.
23
Abgerundet wurde der Entscheidungsreigen durch die Sache Greenfield.[10] Eine britische Arbeitnehmerin wechselte von Teilzeit zu Vollzeit. Ihr wurde der in der Vollzeit erworbene höhere Urlaubsanspruch wie auch das höhere Urlaubsentgelt jedoch zu Unrecht verwehrt. Auch ihr musste sodann der Erholungsurlaub entsprechend der jeweiligen Zeitabschnitte konkret gewährt und entlohnt werden.
b)Auswirkungen auf die Praxis
24
Mit der nunmehr gefestigten Rechtsprechung hat sich gezeigt, dass Urlaubsansprüche bei einem Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit wie auch Teilzeit zu Vollzeit stets abschnittsbezogen zu berechnen sind. Jeder Zeitabschnitt muss getrennt betrachtet und geprüft werden. Hieran hat sich auch das zu zahlende Urlaubsentgelt zu orientieren. Je nach Zeitabschnitt ist auch dieser Betrag gesondert festzulegen. Das kann zur Folge haben, dass bei der Inanspruchnahme von Urlaub aus einem vorhergehenden Arbeitszeitmodell das Entgelt im laufenden Monat unterschiedlich hoch sein kann.
Beispiel
Eine Arbeitnehmerin wechselt nach der Rückkehr aus der Elternzeit ab dem 1.1.2021 in eine 3-Tage-Woche. Sie hat aus dem vorhergehenden Arbeitszeitmodell noch fünf Tage Resturlaub. Wenn sie im Jahr 2021 diesen Resturlaub in Anspruch nimmt, muss sie fünf Arbeitstage von der Arbeitspflicht befreit werden. Folglich hat sie eine Woche und in der darauffolgenden Woche noch zwei weitere Tage einen Urlaubsanspruch.
Beispiel
Eine Arbeitnehmerin arbeitet vom 1.1.2021 bis zum 28.2.2021 in einer 5-Tage-Woche. Ab dem 1.3.2021 wechselt sie in eine 4-Tage-Woche. Aus der Zeit der Vollzeitbeschäftigung hat sie 2/12 von 30 Tagen, folglich 5 Tage Urlaub erworben. Ab dem 1.3. steht ihr ein Anspruch von 10/12 von 24 Tagen, folglich 20 Tage zu. Nimmt sie den Jahresurlaub erst zum Sommer, so muss sie in ihrer 4-Tage-Woche, wenn sie den Urlaub aus Januar und Februar abbaut, für eine Woche und einen weiteren Tag von der Arbeit befreit werden.
Beispiel
Eine Arbeitnehmerin arbeitet vom 1.1.2021 bis 30.4.2021 in der 3-Tage-Woche und ab dem 1.5.2021 in der 4-Tage-Woche. Für den ersten Zeitabschnitt erwirbt sie 4/12 von 18 Tagen, folglich 6 Tage. In dem darauffolgenden Zeitabschnitt erwirbt sie einen Anspruch auf 8/12 von 24 Tagen, folglich 16 Tage.
Ergibt sich für einen Bezugszeitraum im Kalenderjahr ein Bruchteil, so erfolgt für diesen Zeitraum eine Rundung, wie aus § 26 Abs. 1 S. 4 TVöD abgeleitet werden kann.
Beispiel
Eine Arbeitnehmerin arbeitet vom 1.1.2021 bis 31.3.2021 in einer 5-Tage-Woche. Zum 1.4.2021 wechselt sie in eine 4-Tage-Woche. Für den ersten Zeitabschnitt steht ihr ein Anspruch von 3/12 von 30 Tagen, folglich 7,5 Tagen zu, die auf 8 Tage gerundet werden. Im zweiten Zeitabschnitt stehen ihr 9/12 von 24 Tagen, folglich 18 Tage zu.
Sofern ein Arbeitnehmer mehrfach im Kalenderjahr das Arbeitszeitmodell wechselt, müsste, um eine zutreffende Urlaubsermittlung sicherzustellen und weder eine Benachteiligung noch Bevorzugung auszuschließen, der Urlaubsanspruch wie bei flexiblen Arbeitszeitmodellen üblich, nicht monatsbezogen, sondern jahresbezogen unter Zugrundelegung von 260 Arbeitstagen ermittelt werden.
Erfolgt der Wechsel nicht zum Beginn eines Monats, sondern im laufenden Monat wird der höhere Ansatz nach BMI unter entsprechender Anwendung des § 5 Abs. 4 S. 3 EUrlV herangezogen.[11]
Beispiel
Eine Arbeitnehmerin wechselt zum 2.2.2021 von einer 5-Tage-Woche in eine 2-Tage-Woche. Für die Monate Januar und Februar wird daher von einer 5-Tage-Woche und erst ab März hinsichtlich der Berechnung von einer 2-Tage-Woche ausgegangen: 2/12 von 30 Tagen, folglich 5 Tage sowie 10/12 von 12 Tagen, folglich 10 Tage, so dass sich ein Gesamtanspruch von 15 Tagen ergibt.
7.Erfüllung des Urlaubsanspruchs
25
§ 26 TVöD trifft keine Festlegung, wann der Erholungsurlaub konkret im laufenden Urlaubsjahr zu nehmen ist. Lediglich in Absatz 1 Satz 6 findet sich der Hinweis, dass der Erholungsurlaub im laufenden Kalenderjahr zu gewähren ist und auch in Teilen genommen werden kann.
Ergänzt wird die tarifvertragliche Regelung durch die dazugehörige Protokollerklärung, nach der der Urlaub grds. zusammenhängend gewährt werden soll; insoweit soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.
Im Übrigen wird sodann einleitend im Absatz 2 des § 26 TVöD auf das BUrlG verwiesen. Dort findet sich denn auch in § 7 eine Regelung zur Festlegung des Urlaubs, wonach bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs, die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt. Zudem ist der Urlaub zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitgebers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubsteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen.
26
Vorausgesetzt wird daher zunächst einmal, dass der Beschäftigte sein Urlaubsbegehren gegenüber dem Arbeitgeber beantragt.
Die Antragstellung als solche führt jedoch nicht bereits dazu, dass der Beschäftigte den Urlaub anzutreten berechtigt ist. Der Beschäftigte hat selbst dann kein Selbstbeurlaubungsrecht, wenn der Arbeitgeber auf den vorgetragenen Urlaubswunsch hin überhaupt nicht reagiert.
Beurlaubt sich der Beschäftigte selbst, verstößt er gegen seine arbeitsvertragliche Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung. Folge dessen ist zumindest, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, den Beschäftigten abzumahnen, ggfs. kann auch im Einzelfall eine verhaltensbedingte Kündigung – zumindest im Wiederholungsfall – angemessen sein. Daneben kann sich der Beschäftigte nach § 280 Abs. 1 BGB schadensersatzpflichtig machen, wenn dem Arbeitgeber aufgrund des Ausfalls ein Schaden entsteht oder er eine zusätzliche Kraft einstellen muss. In jedem Fall kann er die Zahlung des Lohns verweigern.
Will der Beschäftigte seinen Urlaubswunsch kurzfristig trotz fehlender oder ablehnender Reaktion des Arbeitgebers durchsetzen, muss er dies im Wege des einstweiligen Rechtschutzes mittels einer einstweiligen Verfügung vor dem Arbeitsgericht ersuchen.
Der Arbeitgeber ist allerdings auch nicht frei, nach Gutdünken über den Urlaubsantrag zu entscheiden. Vielmehr hat er dem Begehren zu entsprechen, soweit keine dringenden betrieblichen Interessen entgegenstehen. Dazu zählen etwa ein außergewöhnlich hoher Krankenstand, ein unvorhergesehener Auftrag oder besonders arbeitsintensive, branchenübliche Zeiten. Nicht dazu rechnen regelmäßig wiederkehrende Organisationsstörungen, die auf eine mangelnde Planung zurückzuführen sind. Solche Phasen sind vielmehr durch entsprechenden Vorhalt an Personal aufzufangen oder aber vom Arbeitgeber hinzunehmen.
Stehen die Urlaubswünsche anderer Beschäftigter entgegen, so sind der Entscheidung des Arbeitgebers, wem er den Urlaub bewilligt, soziale Gesichtspunkte zugrunde zu legen. In Betracht kommen z.B. Urlaubsmöglichkeiten des Partners oder von schulpflichtigen Kindern, das Alter oder die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Auch die Tatsache, ob es sich um den ersten Erholungsurlaub oder einen weiteren im Kalenderjahr handelt, ist ebenso zu berücksichtigen wie auch der Grad der Erholungsbedürftigkeit. Auch jahreszeitliche Aspekte verdienen Beachtung: Leidet der Beschäftigte oder Partner/Kinder etwa an Heuschnupfen, kann etwa ein Urlaubswunsch im Frühjahr besonders angezeigt sein, um an der Nordsee der Pollenbelastung auszuweichen.
Ausschlaggebend kann es schließlich auch sein, wie der Urlaub in den Vorjahren verteilt wurde, so dass in rotierenden Systemen alle Beschäftigten mit Familie und ggfs. auch kinderlose Beschäftigte einmal in den Sommer- oder insbesondere während der Weihnachtsferien in Urlaub fahren können.
27
Zur Vereinfachung werden bisweilen schließlich auch Urlaubslisten und Urlaubspläne erstellt.
Werden die Urlaubswünsche der einzelnen Beschäftigten abgefragt, handelt es sich zunächst einmal um eine unverbindliche Urlaubsliste.
Zu einem verbindlichen Urlaubsplan und damit einer Art Richtlinie für die Gewährung des Urlaubs kann die Liste jedoch erstarken, wenn aufgrund betrieblicher Übung der Beschäftigte davon ausgehen darf, dass der Urlaub als genehmigt gilt, wenn sich der Arbeitgeber nicht ablehnend äußert. Weicht der Arbeitgeber später hiervon ab, kann er sich schadensersatzpflichtig machen; der Beschäftigte kann dann die Kosten ersetzt verlangen, die ihm entstanden sind, weil er darauf vertrauen durfte, dass seinem Eintrag im Plan nicht widersprochen worden ist, so etwa hinsichtlich angefallener Buchungs- oder Stornierungskosten.
Die Rechtsprechung hat insoweit entschieden, dass von einem Arbeitgeber verlangt werden kann, auf die Einträge im Urlaubsplan in angemessener Zeit zu reagieren. Erfolgt kein Widerspruch, darf der Arbeitnehmer davon ausgehen, dass sein Urlaub entsprechend dem Urlaubswunsch als gewährt gilt. Als angemessene Zeitspanne ist in der Regel ein Zeitraum von einem Monat nach Vorlage des Urlaubswunsches oder Erstellung des Urlaubsplans anzusehen.[12]
Hat der Arbeitgeber dem Urlaubswunsch des Beschäftigten nicht entsprochen und stattdessen einen anderen Zeitraum bestimmt, so ist erneut auf die persönlichen Belange des Urlaubsberechtigten Rücksicht zu nehmen und ein neuer Termin für den Urlaubsantritt zu finden.
28
Der Arbeitgeber kann sich hingegen nicht einem Urlaubswunsch versperren, soweit dieser die Zeit im Anschluss an eine Kur oder Rehamaßnahme betrifft. Hier sieht das Gesetz ausdrücklich eine Pflicht des Arbeitgebers zur Urlaubsgewährung vor. Dem kann der Arbeitgeber weder Wünsche anderer Beschäftigter noch betriebliche Gründe, selbst keine bereits angeordneten Betriebsferien entgegenhalten. Denn der Erholungsbedürftigkeit des (zuvor) gesundheitlich beeinträchtigt Beschäftigten wird oberste Priorität eingeräumt.
29
Macht der Arbeitnehmer keinen Urlaub geltend, so kann der Arbeitgeber eine Freistellungserklärung vornehmen und dem Arbeitnehmer gleichwohl Urlaub erteilen. Dass der Arbeitnehmer keinen Urlaub beantragt hat, steht dem nicht entgegen.[13] Aus Fürsorgegesichtspunkten trifft den Arbeitgeber hierzu eine Pflicht. Auch das Fehlen eines Urlaubsantrags steht dem nicht entgegen.
Legt der Arbeitgeber einen Zeitraum fest, innerhalb dessen der Arbeitnehmer Urlaub zu nehmen hat, ist diese Erklärung bindend und wirksam. Allenfalls soweit der Arbeitnehmer auf die Freistellungserklärung des Arbeitgebers hin einen anderweitigen zeitlichen Urlaubswunsch äußert, ist diese Erklärung nicht bindend.[14] Der Arbeitnehmer kann sich folglich nur auf sein Leistungsverweigerungsrecht berufen, wenn er persönliche Gründe – wie eine andere Urlaubsplanung – vorbringen kann. Eine pauschale und generelle Weigerung, Urlaub in Anspruch zu nehmen, genügt hierzu nicht. Damit würde dann auch dem Sinn und Zweck des Urlaubs, der Regeneration von Körper und Geist, widersprochen werden.
8.Änderung der zeitlichen Festlegung des Erholungsurlaubs
30
Die Festlegung, wann der Erholungsurlaub genommen werden soll, entfaltet für Arbeitgeber wie auch Beschäftigte Bindungswirkung. Weder die eine noch die andere Seite kann sich von der Festlegung einfach lossagen. Der Arbeitgeber erteilt insoweit im Voraus eine unwiderrufliche Freistellungserklärung zu Erholungszwecken.
Dabei ist es unerheblich, dass die Freistellungserklärung nicht erkennen lässt, an welchen Tagen der Arbeitgeber dem Beschäftigten zum Zwecke der Gewährung von Erholungsurlaub und an welchen Tagen er zu anderen Zwecken freistellt. Denn einer nicht näher bestimmten Urlaubsfestlegung soll der Beschäftigte regelmäßig entnehmen, dass der Arbeitgeber es ihm überlässt, die zeitliche Lage seines Urlaubs innerhalb des Freistellungszeitraums festzulegen – so bei einem aus dem Betrieb ausscheidenden, freigestellten Beschäftigten.
31
Sind sich beide Vertragsparteien jedoch einig, den Urlaub auf einen anderen Zeitraum festlegen zu wollen, so ist eine solche einvernehmliche Verlegung freilich jederzeit möglich.
32
Will der Arbeitgeber den festgelegten Urlaub abändern, kann er den Urlaub weder einseitig widerrufen noch den Beschäftigten aus dem Urlaub zurückrufen. Weder das BUrlG noch der TVöD geben dem Arbeitgeber ein entsprechendes Recht; dieser muss sich vor der Genehmigung des Urlaubs vielmehr gründlich Gedanken machen, ob er den Urlaub zu dem gewünschten Zeitpunkt gewähren kann oder nicht.
Hat der Arbeitgeber unter Vorbehalt den Urlaub bewilligt, um den Beschäftigten gleichwohl aus dem Urlaub zurückrufen zu können, fehlt es an einer uneingeschränkten und damit wirksamen Urlaubsgewährung.
Eine solche Erklärung verstößt hinsichtlich des Mindesturlaubsanspruchs gegen § 13 Abs. 1 BUrlG und ist mithin rechtsunwirksam.
Was den über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehenden tariflichen Urlaubsanspruch betrifft, so ist auch diese „Vereinbarung“ unwirksam. Denn nach § 4 Abs. 4 S. 1 TVG ist ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte nur in einem von den Tarifvertragsparteien gebilligten Vergleich zulässig.
Da es bislang an einer vorherigen Zustimmung der Tarifvertragsparteien fehlt, hat der Arbeitgeber keine Möglichkeit, sich von dem einmal dem Beschäftigten gegenüber erteilten Urlaub zu lösen.
Auch der Beschäftigte kann sich nicht von dem zuvor festgelegten Urlaub wieder lossagen. Eine einseitige Änderung des Beschäftigten ist gleichfalls unwirksam.
Im Rahmen der Corona-Epidemie kommt diesem Grundsatz besondere Bedeutung zu. Nicht wenige Arbeitnehmer haben – in Anbetracht dessen, dass die Beschäftigungsstellen ohnehin (teilweise) geschlossen oder begrenzt besetzt wurden oder der Urlaub aufgrund von Reisebeschränkungen nicht angetreten werden konnte – sich darum bemüht, ihren Urlaub zu stornieren. Im Einverständnis mit dem Arbeitgeber ist dies möglich. Allerdings haben Arbeitgeber zunehmend die Rücknahme des Urlaubs aus Sorge darum verweigert, dass sich die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubs auf das Jahresende verlagert und insoweit Personalengpässe entstehen können. Zudem geht die Sorge um, dass es zu einem Konflikt mit den Verfallsfristen des Urlaubs kommen könne.
9.Zusammenhängende Urlaubsgewährung
33
Die gesundheitspolitische Zielsetzung des BUrlG und diesem folgend der TVöD sehen eine zusammenhängende Inanspruchnahme des Urlaubs vor, damit sich ein nachweisbarer Erholungseffekt für den Beschäftigten einstellen kann.
Daher ist auch eine beliebig zergliederte Aufsplittung des Urlaubs nicht möglich. Dieser ist vielmehr zusammenhängend zu gewähren und zu nehmen. Damit die Regeneration von Körper und Geist tatsächlich eintritt, haben arbeitsmedizinische Untersuchungen ergeben, dass eine Urlaubsdauer von zumindest zwei, besser drei Wochen von Nöten ist. Dem kommt daher die Protokollerklärung zu § 26 Abs. 1 S. 6 TVöD nach, die zwar auch die grds. Teilungsmöglichkeit des Gesamturlaubsanspruchs vorsieht, aber zugleich anstrebt, dass ein Urlaubsteil von zwei Wochen gewährt werden soll.
Eine Gewährung von halben Tagen oder gar Stundenanteilen sieht das Urlaubsrecht demzufolge nicht vor.
Beispiel
Abzulehnen ist der Wunsch eines sog. Wochenendpendlers alle Urlaubstage einzeln zur Verlängerung der Wochenenden zu nehmen. Dies würde de facto auf eine 4-Tage-Woche hinauslaufen, die der Zielsetzung vom BUrlG und TVöD zuwiderlaufen würde.
10.Mitbestimmung
34
§ 75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG sieht vor, dass dem Personalrat durch Abschluss von Dienstvereinbarungen ein Mitbestimmungsrecht bei der Aufstellung des Urlaubsplanes sowie bei der Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte eröffnet wird, wenn zwischen Arbeitgeber und Beschäftigtem kein Einverständnis erzielt wird.
Demgegenüber ergibt sich für den Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG hinsichtlich der Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie der Festlegung der zeitlichen Lage des Urlaubs einzelner Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird.