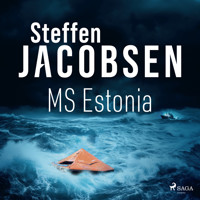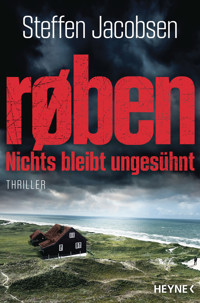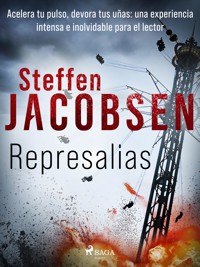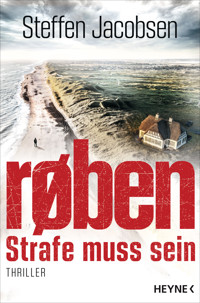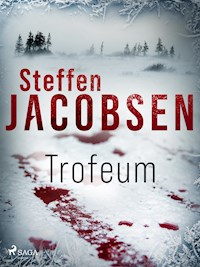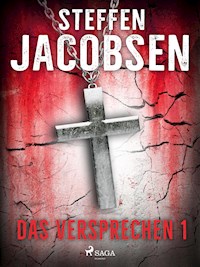9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Lene Jensen und Michael Sander
- Sprache: Deutsch
Dänemark verliert seine Unschuld, als ein Selbstmordattentäter im Tivoli, dem beliebtesten Vergnügungspark des Landes, eine Bombe zündet. Mehr als Tausend Menschen finden den Tod. Doch niemand bekennt sich zu dem Anschlag, und die Ermittlungen laufen ins Leere. Bis Kommissarin Lene Jensen eine Verbindung zu einem vermeintlichen Selbstmord im U-Bahnhof Nørreport herstellt. Gemeinsam mit Privatdetektiv Michael Sander geht sie der Sache auf den Grund. Sie finden Schreckliches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
Ein Attentat erschüttert Dänemark. Mitten im Tivoli geht eine Bombe hoch und kostet unzähligen Menschen das Leben. Ein Jahr später erhält Kommissarin Lene Jensen einen mysteriösen Anruf. Eine junge Frau, die Jensen im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Arbeit für die Telefonseelsorge kennengelernt hat, ist in panischer Angst. Die Kommissarin muss mit anhören, wie die junge Frau stirbt. Angeblich ist sie vor eine einfahrende U-Bahn gesprungen. Lene Jensen glaubt nicht an Selbstmord. Zu offensichtlich sind die Hinweise, dass ein Zusammenhang zu dem Anschlag im Tivoli besteht. Doch ihre Ermittlungen werden von höchster Stelle massiv behindert. Ein Grund mehr für Lene Jensen, gemeinsam mit Privatdetektiv Michael Sander, der Sache auf den Grund zu gehen.
Zum Autor
Steffen Jacobsen, 1956 geboren, ist Chirurg und Autor. Seine Bücher sind unter anderem in den USA, England und Italien erschienen. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und lebt in Kopenhagen.
STEFFEN JACOBSEN
Bestrafung
THRILLER
Aus dem Dänischen von Maike Dörries
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe Gengældelsen erschien 2014
bei People’s Press, Kopenhagen
Vollständige deutsche Erstausgabe 01/2016
Copyright © 2014 Steffen Jacobsen
Copyright © 2015 by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Nike Müller
Umschlagfoto: Johannes Wiebel unter Verwendung
eines Motivs von designritter/photocase.de
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-16526-0
www.heyne.de
Der Körper des zerbombten Märtyrers duftet nach Moschus.
HAMAS-KOMMANDANT, GAZA
17. SEPTEMBERIM MAKKAH-JAHR 1434
Nabil hatte seine Mutter so deutlich gesehen, als säße sie zusammen mit ihnen im Wohnzimmer der Fremden. Er hatte sie um Vergebung gebeten für das, was er zu tun gezwungen war, aber sie hatte gerufen, er solle an die Barmherzigkeit der Menschen denken und sich nicht in das Haus des Krieges begeben. Es waren schon zu viele umgekommen.
Seine Entschlossenheit geriet unter der Suade seiner Mutter ins Schwanken, bis Fadr ihn wachrüttelte.
»Mit wem redest du da?«, fragte er.
Der Freund hatte sich einen Oberlippenbart stehen lassen, um die Hasenscharte zu verbergen, die nie ordentlich verheilt war.
»Mit niemandem«, antwortete Nabil.
Seine Mutter war Einbildung. Er hatte in den letzten Wochen nur wenig gegessen, da waren Halluzinationen normal, hatten sie gesagt.
Nach einem Artillerieangriff, der die halbe Straße seiner Kindheit in Damaskus verwüstete, hatte er mit bloßen Händen die Leichen seiner Eltern und seiner Schwestern Basimah und Farhah unter den Mauerbrocken im Hofgarten der Familie ausgegraben. Gemeinsam mit dem Imam Sufyan hatte er sie gewaschen und angekleidet und das Salat al-Dschanaza, das Totengebet, für sie gesprochen.
Seitdem war Nabil bei den Milizen gewesen. Während Zehntausende seiner Landsleute ermordet und Millionen obdachlos wurden, hielten sich EU, NATO und die USA hinter der roten Linie, vom Veto des UN-Sicherheitsrates überstimmt. Erdöl, Erdgas, Sportschuhe und Putins Ego waren wichtiger als syrisches Leben, und Nabil hasste sie alle.
Samir war mit seinen vierundzwanzig Jahren der älteste von den dreien in der Wohnung in Nørrebro. Er verließ seinen Beobachtungsposten am Fenster, kniete sich im Halbdunkel zwischen Nabil und Fadr auf den Boden und drehte die Handflächen himmelwärts.
»Nabil, reinige deine Seele von unreinen Gedanken. Verabschiede dich von dem, was wir die Welt und dieses Leben nennen, die Zeit zwischen dir und deiner Hochzeit im Himmel ist nun sehr kurz«, sagte er.
»Subhan’Allah, herrlich ist Gott«, murmelten Nabil und Fadr einstimmig.
Fadr legte es in seine Hände, und Nabil faltete das schwarze Tuch mit den goldenen Schriftzeichen auf. Schweiß tropfte aus seinen kurz geschorenen Haaren und bildete kleine dunkle Flecken auf dem Stoff.
»Al-Uqab, der Adler«, sagte Fadr feierlich. »Saladins Wappen. Muhammad al-Amir Atta hat es mit in die Türme nach New York genommen.«
»Ich werde es mit Ehrfurcht tragen, Inschallah, so Gott will.«
Nabil faltete das Tuch zusammen.
»Ich muss mich waschen«, sagte er.
Das Badezimmer duftete nach Frau. Aus Respekt vor dem Heim und der Gastfreundschaft der Unbekannten hatten sie keinen Schrank und keine Schublade in der Wohnung geöffnet. Das Wohnzimmer war nüchtern eingerichtet, es gab einen Weltatlas und ein Poster mit einer schwarzen Katze, die Absinth aus einem Stielglas trank. Den einzigen Hinweis, dass die Bewohnerin zum Netzwerk gehörte, lieferte der Koran auf dem Nachtschrank, mit rotem Ledereinband, der durch den häufigen Gebrauch weich wie Handschuhleder geworden war.
Der Kühlschrank war bei ihrer Ankunft gefüllt gewesen, und Fadr hatte als Einziger die Wohnung verlassen, um in dem Kiosk auf der anderen Straßenseite Zigaretten zu kaufen.
Nabil wusch sich das Gesicht und trocknete sich mit einem Handtuch ab, das ebenfalls nach der Bewohnerin duftete. Er löschte das Licht, öffnete das Fenster zum Hinterhof und richtete sich gen Osten zum Himmel über dem gegenüberliegenden Dach.
»Aldebaran, Elnath, Alhena«, murmelte er.
An Deck des polnischen Küstenschiffes, das sie über den Sund in dieses kleine Land gebracht hatte, hatte er dieselben Sterne gesehen. Als der Coaster vor Anker ging, hatte Samir den Kapitän mit einem dicken Bündel Euroscheine ausgezahlt. Sie waren über die Reling in ein dunkelgraues Gummiboot geklettert, das auf dem schwarzen, ruhigen Wasser für sie bereitlag. Samir und Fadr waren ans Ufer gepaddelt, eine blinkende Taschenlampe hatte ihnen den Weg gezeigt, während Nabil mit dem Koffer mit Sprengstoff und Sprengzündern zwischen den Knien auf der hinteren Bank gesessen hatte. Sie hatten sich von den Wellen auf den Strand tragen lassen und das Boot zurück aufs Wasser geschoben, ehe sie mit ihrem Gepäck durch den nassen Sand gelaufen und von einer Gestalt in Empfang genommen worden waren, die zwischen den Stämmen der Bäume hervortrat.
Samir hatte ein paar Worte mit dem Fremden gewechselt, und sie hatten sich kurz umarmt, ehe sie im Gänsemarsch die steile Böschung hochmarschiert waren. Die Gestalt ging federnd und sicher, und Nabil dachte, dass es eine Frau war. Sie führte sie zu einem weißen Lieferwagen auf einem einsamen Parkplatz. Samir hatte vorne Platz genommen, die beiden anderen hatten sich mit ihren Koffern und Rucksäcken im Laderaum auf den Boden gesetzt.
Im Wohnzimmer klingelte ein Handy. Fadr und Samir sahen ihn ernst an, als er aus dem Bad kam. Fadr schob das Handy in die Tasche, und Nabils Beine gaben unter ihm nach.
»Sei stark, Shaheed«, sagte Samir, als spürte er, was Nabil fühlte. »Wer in Allahs Namen stirbt, ist nicht tot. Er lebt als Schatten unter uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können.«
Das Handy in Fadrs Hosentasche vibrierte. Er öffnete die SMS.
»Der Wagen wartet unten«, sagte er.
Es war kühl. Die drei Männer saßen dicht nebeneinander im Laderaum des Lieferwagens und wurden in jeder Kurve hin und her geschaukelt.
Samir entdeckte eine Thermoskanne, schraubte den Verschluss auf und schnupperte am Inhalt, ehe er sie weiterreichte.
»Tee?«
Nabil schüttelte den Kopf. Er betrachtete die weiße, sternförmige Narbe an Samirs Schläfe, halb verdeckt von den langen schwarzen Haaren des Freundes. Er hatte nie erzählt, woher sie stammte. Ein Wunder, sagte er nur. Sie erinnerte an eine Schusswunde, aber wer überlebte schon einen Schuss in die Schläfe?
Die jungen Männer hatten sich vor drei Monaten in einem Trainingslager im Iran kennengelernt. Fadr und Samir waren wie Brüder für ihn geworden. Es war üblich, dass einer, der gläubig war, den Weg des Märtyrers ging, as-Shaheed, per Video einen Abschiedsgruß sprach oder eine Erklärung verlas, damit die Familienangehörigen den Beitrag später Freunden und Nachbarn zeigen und ins Internet stellen konnten. Sie wollten dieses kleine blasphemische Land im Kriegszustand an einer sehr empfindlichen Stelle treffen. Aber Nabil war sicher, dass seine Familie in diesem Moment bei ihm war, darum hatte er keiner Kamera etwas zu sagen.
Es hatte ihn nicht gewundert, dass er der Auserwählte für diese Mission war. Seit seiner Kindheit war die Hinwendung zu Gott für ihn ganz natürlich und existenziell gewesen. Sufyan, der Imam, hatte ihn nach dem Bürgerkrieg bei sich aufgenommen, ihn dem Mufti Ebrahim Safar Khan und dem Netzwerk vorgestellt und sich für seine Frömmigkeit und Tauglichkeit verbürgt.
Endlich hielt der Lieferwagen, die Handbremse wurde angezogen, und der Motor verstummte. Die Fahrertür wurde aufgestoßen und mit einem Knall zugeschlagen. Sie hörten Schritte, die sich entfernten, dann war alles still.
Die kommenden Stunden dösten sie vor sich hin, während es draußen langsam heller wurde. Sie hörten Stimmen in allen möglichen Sprachen, eilige Schritte, Kinder, Fahrräder, Autos und Busse, aufheulende Motoren und quietschende Reifen.
Der Tee konnte die Trockenheit aus Nabils Kehle nicht vertreiben. Er fror, dann wurde ihm fieberheiß. Versteinert folgte sein Blick dem Sekundenzeiger der Armbanduhr an Fadrs sonnenbraunem Handgelenk, der allzu schnell um die Uhrscheibe lief.
Um Punkt halb elf setzten die beiden anderen sich auf, und Nabil vergrub das Gesicht in den Händen. So saß er ein paar Sekunden da, den Blick auf den Boden geheftet, ehe er in die Hocke ging und die Arme ausstreckte.
Die Selbstmordweste war schwer wie die Sünde der Menschheit. Lange, rechteckige Semtex-Sprengstoffblöcke waren in vier Reihen vor Brust und Rücken in Canvastaschen eingenäht. Die flachen, mit Stahlkugeln gefüllten Plastikbeutel waren an die Blöcke geklebt und am schwersten von allem. Zehntausende Stahlkugeln würden Nabils Körper in einer todbringenden Haufenwolke verlassen, wenn er die Weste sprengte. In seiner Schultertasche befand sich zusätzlicher Sprengstoff.
Samir band die Weste mit schweren Gurten, Drahtseilen und Vorhängeschlössern um Nabils Taille, damit kein misstrauischer, heroischer Kontrolleur oder Polizist die Sprengladung entfernen konnte, ohne sie auszulösen. Unterdessen überprüfte Fadr die Sprengzündungen, Batterien und Kabel auf seinem Rücken.
Schließlich half Samir ihm in eine große, helle Windjacke und zog den Reißverschluss bis zum Kinn hoch. Nabil setzte sich mit zitternden Händen eine blaue Baseballkappe auf. Er hatte raspelkurze Haare und keinen Bart, trug ein Paar orangefarbene Nike-Sneakers und verwaschene Levi’s. Er sah aus wie Tausende andere junge Männer in Kopenhagen.
Sie umarmten sich.
»As-salamu’ alaikum«, sagten Samir und Fadr wie aus einem Mund.
»Wa ’alaikum as-salam«, erwiderte Nabil den jahrhundertealten Gruß.
»Ich bin stolz, und ich beneide dich«, sagte Samir. »Beim nächsten Mal, so Gott will, werden ich oder Fadr einem der Kreuzfahrerländer das Schwert in den Bauch rammen, das unser Volk und unsere Brüder tötet.«
»Inschallah«, murmelte Nabil.
»Hast du den Übersichtsplan vom Park?«, fragte Fadr.
Nabil nickte und klopfte auf die Innentasche der Windjacke. Er würde keine Karte brauchen, weil das Ziel von überallher auszumachen war, wenn man nur den Kopf ein wenig in den Nacken legte.
Nabil stieg aus und drehte sich zu seinen beiden Freunden um.
»Und die Frau lässt mich rein?«, fragte er.
Samir nickte.
»Ma’as-salam, fi aman Allah, geh mit Gott«, murmelte er. »Die Frau wird dort sein. Und wir sind bei dir. Du bist nicht allein.«
Nabil nahm Haltung an und ging zügig los, den Blick auf die Gehwegplatten gerichtet. Es war plötzlich ganz leicht. Das Ende war nah, und er sah sich selbst aus der Vogelperspektive eine breite, belebte Straße überqueren und zum östlichen Ende des Tivoligeländes gehen.
Er wischte sich mit dem Jackenärmel über die Stirn und drückte den Mützenschirm tiefer ins Gesicht, als er sich der schmalen Gittertür näherte. Die Sonne stand hoch am Himmel, es war sehr warm und hell, nur die Schatten der Bäume spendeten dunkle Kühle. Nabil sah die Silhouette der Frau hinter dem Zaun und hörte das Schnalzen des Schlosses. Er schlüpfte durch den Spalt in einen engen Durchgang zwischen einem Restaurant und einer Spielhalle, nicht sichtbar für die Überwachungskameras im Außenbereich. Ihm wurde flau von den Essensgerüchen aus dem Restaurant. Über den Müllcontainern surrten Fliegen. Aber die Frau duftete frisch. Er schätzte sie auf sein Alter. Sie trug ein kurzärmeliges weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und hatte eine lange weiße Schürze um die schlanke Taille gebunden. Über ihrer linken Brust war der Name des Restaurants mit grünem Garn auf das Shirt gestickt. Sie trug keinen Schmuck und hatte das Haar nicht bedeckt. Sie hatte es mit zwei überkreuzten gelben Bleistiften zu einem Knoten im Nacken zusammengesteckt. Nabil schämte sich für sie, verstand aber, dass das vermutlich Teil der Tarnung war, wenn sie zum Netzwerk gehörte. Aber wenigstens hielt sie sich an das, was ihr aufgetragen worden war: ihm die Tür zum Paradies zu öffnen.
Er überlegte, ob sie auch diejenige gewesen war, die sie an der Küste aufgesammelt hatte, ob es ihre Wohnung war, in der sie die letzten Tage verbracht hatten, ob sie sie hierher gefahren hatte. Kannte sie Samir? Er spürte einen kleinen Stich der Eifersucht, unterdrückte das Gefühl aber sofort. Eifersucht war von dieser Welt.
»Ich heiße Ain«, sagte sie auf Arabisch.
Nabil nickte, ohne zu antworten, worauf sie wortlos sein Handgelenk nahm und ihm einen Papierstreifen darumklebte. Er war völlig überrumpelt von ihren kühlen Fingern. Er konnte sich nicht erinnern, wann ihn zuletz eine Frau berührt hatte.
»Das ist dein Eintrittsband«, sagte sie. »Damit kannst du alle Fahrgeschäfte ausprobieren, ohne zu zahlen. Du musst einfach nur das Band vorzeigen.«
»Fahrgeschäfte?«
Sie lächelte.
»Ja, das ist ein toller Park.«
»Du bleibst im Restaurant?«, fragte er ernst. »Hier? Arbeitest du?«
»Ja.«
»Bleib im Restaurant, okay? Geh nirgendwo hin.«
»Klar, wo sollte ich auch hingehen?«, sagte sie und suchte seinen Blick im Schatten der Cap. »Warum?«
»Es ist wichtig, seine Arbeit gut zu machen«, sagte er, als wäre er viel älter und weiser als sie.
Sie strich sich eine Strähne hinters Ohr und richtete den Knoten im Nacken. Das T-Shirt spannte über ihren Brüsten. Er schaute zu Boden.
»Na gut, sehr wichtig also, aber jetzt muss ich zurück«, sagte sie lächelnd. »Sag mal, frierst du?«
»Was?«
»Willst du deine Jacke nicht ausziehen?«
»Ich komme aus einer Wüste und finde es sehr kalt hier in deinem Land.«
Er schüttelte sich, als ob er wirklich fröre.
»Welche Wüste?«
»Irgendeine Wüste. Sand, Schlangen und Sonne.«
»Okay. Wenn du Hunger hast, komm einfach her und klopf an die Tür da drüben, dann geb ich dir was. Du musst nicht bezahlen.«
Er schaute an ihr vorbei.
»Das werde ich tun, Schwester. Wa’alaikum as-salam, Ain«, sagte er. Der Unterton in seiner Stimme und seine Körperhaltung ließen ihr Lächeln erstarren. Sie drehte sich um und verschwand im Restaurant.
Nabil seufzte. Seine Nasenflügel weiteten sich. Dieser Duft. Flüchtig und vage, aber er war sicher, dass es der Duft aus der Wohnung war. Er ging zur Tür und öffnete sie. Weiß gekleidete Köche liefen eilig zwischen Stahltischen mit dampfenden Töpfen und Schüsseln voller Fleisch, Obst und Brot hin und her. Niemand schien Notiz von ihm zu nehmen.
Ain stellte Gläser auf ein Tablett. Sie drehte sich um, als er ihren Namen rief. Ihre Hand schob erneut die verirrte Strähne hinters Ohr, als sie mit geschmeidigen Bewegungen zwischen den Tischen auf ihn zusteuerte.
Nabil schob eine Hand in die schwere Schultertasche und fand den Schal mit den Heiligen Schriftzeichen. Er bewegte sich rückwärts zurück in den Gang, während sie ihm die Tür aufhielt.
»Ain …«
»Ja? Wie heißt du eigentlich? Hast du keinen Namen?«
»Nein, ich habe keinen Namen. Nabil, wenn du willst.«
Er drückte ihr das zusammengefaltete Tuch in die Hand.
»Danke«, sagte er.
»Wofür?«
Er zeigte auf das Band um sein Handgelenk.
»Die Fahrgeschäfte.«
Sie wollte den Stoff auffalten, aber er hielt ihre kühlen Hände fest.
»Warte«, sagte er. »Und bleib hier im Restaurant, okay?«
»Wo soll ich sonst hin, aber …«
»Lebwohl.«
Nabil ließ sich mit dem langsamen Menschenstrom treiben. Wer im Sommer Kopenhagen besuchte, kam auch hier in diesen Park, hatten sie ihm erzählt.
Er ging in nordöstlicher Richtung. Schau ihnen nicht in die Augen oder ins Gesicht, hatten sie gesagt. Sie sind nichts wert. Sie sind Schatten, die im Tal der Toten wandern, aber das wissen sie nicht. Sie sind Kafir, Ungläubige, keine Menschen, Nabil.
Die Luft war klebrig vom penetranten Duft der Süßigkeitenbuden, Zuckerwattestände und Eiswagen. Er spürte förmlich den Zucker zwischen den Zähnen knirschen und musterte verächtlich die verwöhnten, übergewichtigen Menschen um sich herum.
Er hielt sich am Rand des Gedränges, wissend, dass er nach dreihundert Schritten unmittelbar unter seinem Ziel stehen würde: der achtzig Meter hohen Stahlkonstruktion von Nordeuropas höchstem Kettenkarussell, das passenderweise den Namen Himmelsschiff trug.
Das Karussell hatte Platz für 24 Fahrgäste, die mithilfe kräftiger Luftdruckpumpen gen Himmel transportiert und ein paar Minuten mit bis zu siebzig Stundenkilometern in ihren an langen Ketten befestigten Sitzen waagerecht im Kreis herumgeschleudert wurden.
Nabil überlegte, ob der eine oder andere Körper wohl auf den Straßen außerhalb des Vergnügungsparks landen würde. Der pakistanische Ingenieur, der ihnen die Konstruktionspläne, technische Fotos und ein Modell des Himmelsschiffes gezeigt hatte, hatte den nördlichen tragenden Sockel als Ziel bestimmt. Wenn der Karussellturm in diese Richtung kippte, lagen der Konzertsaal, mehrere Restaurants und Spielhallen in seiner Falllinie.
Er wartete vor der Einfriedung, bis die Fahrgäste der letzten Runde die Treppe am Fuß des Turmes verlassen und die nächsten Gäste ihre Plätze eingenommen hatten. Die Pumpen zischten, die große Plattform begann sich zu heben. Nabil warf einen Blick zu der jungen blonden Frau in dem Glaskasten, die die Pumpen bediente. Ihr Blick war auf die Plattform gerichtet, während ihre Hände die Hebel und Knöpfe betätigten. Er stieg über eine niedrige Absperrung, schubste ein paar Kinder beiseite und sprang über die nächste Absperrung.
Jemand versuchte, ihn aufzuhalten, aber er befreite sich und lief unter die Konstruktion. Er legte die Wange an das kalte Metall des Stahlträgers, legte die Arme darum und lauschte den begeisterten Schreien hoch oben, weit über sich, als das Himmelsschiff am Höhepunkt seiner Fahrt die Fahrgäste durch den blauen Himmel über Kopenhagen schleuderte. Der Stahl vibrierte an seiner Schläfe.
Er sah den zwei Kontrolleuren entgegen, die auf ihn zugelaufen kamen, sah sie erschrocken zurückweichen, als er den Reißverschluss der Windjacke aufzog und die Weste mit den gelben Kabeln und den Sprengstoffblöcken sichtbar wurde.
Er lächelte die blonde Frau in dem Glaskasten an. Sie hatte ein Funkgerät ans Ohr gepresst. Er dachte an seine Mutter, an seine Schwestern – und an Ain. Hoffentlich blieb sie im Restaurant.
Nabil griff nach dem Zünder in der Jackentasche und schloss die Augen vor den Gesichtern der Menschen und die Ohren vor ihren Schreien.
»Allahu’Akbar, Gott ist groß«, sagte er leise und drückte den Knopf bis zum Anschlag durch.
I
Das Auditorium im Polizeipräsidium war brechend voll. Die Leute saßen an den Wänden entlang auf dem Boden und um das Podest des Technikers mit seinen Projektoren und Computern herum.
Das war einer der Vorteile, Kommissarin zu sein, dachte Lene Jensen, die in der Mitte einer Stuhlreihe saß. Sie konnte zumindest immer sicher sein, einen Platz zu bekommen, auch wenn sie in letzter Zeit senkrecht durch die Hierarchie nach unten gefallen war.
Sie saß zwischen anderen Angestellten der Staatspolizei, der Einsatzleitung der Polizei, der Ministerien und des polizeilichen Nachrichtendienstes PET sowie des militärischen Geheimdienstes FE. Die Lohn- und Gewichtsklassen von Belang saßen in der ersten Reihe.
Der Amerikaner auf dem Podium war der bis auf Weiteres letzte Terrorexperte, der nach Kopenhagen eingeladen worden war, um den diversen Dienststellen zu erklären, was an jenem Septembertag vorigen Jahres im Tivoli passiert war – aus historischer und sachkundiger Perspektive.
Er war sonngebräunt, groß und athletisch und hatte Schultern wie ein Offizier. Er trug einen eleganten, marineblauen Anzug mit exakten Bügelfalten, glänzend polierte schwarze Schuhe, ein weißes Hemd mit einer dezent grau gestreiften Krawatte, sah aber aus, als würde er sich in einer ausgeblichenen, leger sitzenden Wüstenuniform viel wohlerfühlen.
Das Mikrofon übersteuerte, worauf der Amerikaner es vom Mund wegführte.
»Wir müssen begreifen, dass im Mittleren Osten niemand den Teufelskreis durchbrechen will oder kann. Gewalt wird unumgänglich mit neuer Gewalt vergolten, was immer mehr Waisen zur Folge hat, die einen tiefen Hass gegen den Westen und Israel hegen. Nehmen Sie das Beispiel der Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Schatila in Beirut 1982. In der Nacht zum 16. September stürmten christlich falangistische Milizen und Soldaten des libanesischen Heeres die Lager und ermordeten Frauen, Kinder und Alte. Zwei Tage lang trieben sie ungestört ihr Unwesen.«
Hinter ihm wechselten alte Presseaufnahmen zwischen Bunkern mit aufeinandergestapelten Kinderleichen, blutverschmierten, zerschossenen Mauern, brennenden Zelten und Wellblechschuppen. Die Erde zwischen den Schuppen war rot, ebenso die Regenpfützen in den Reifenspuren.
»Nach der Invasion des Libanon oblag dem israelischen Militär die formell militärische und international rechtliche Verantwortung für die Sicherheit der Lager, aber sie haben nichts zum Schutz der Flüchtlinge unternommen. Im Gegenteil, sie feuerten Leuchtraketen über den Lagern ab, sodass die Angreifer auch nachts arbeiten konnten und keiner – kein Einziger – entkam.«
Das Gesicht des Amerikaners war ausdruckslos. Er trank einen Schluck Wasser, ehe er fortfuhr.
»Alle wussten, dass Yassir Arafat mit seinen jungen PLO-Kämpfern und einem Teil der Kinder einen Monat zuvor nach Tunesien evakuiert worden war und dass sich in Sabra und Schatila keine bewaffneten ›Terroristen‹ mehr aufhielten. Es gab keine zornigen jungen, mit Kalaschnikows bewaffneten Männer in den Lagern, aber das war bedeutungslos: Die Massaker waren eine unmissverständliche Mitteilung von Elie Hobeika, dem Befehlshaber des libanesischen Geheimdienstes, und von Ariel Scharon, dem israelischen Verteidigungsminister, an Yassir Arafat.«
Der Amerikaner ließ den Blick über die ersten Reihen schweifen, während auf der Leinwand Porträts von Scharon und Hobeika gezeigt wurden.
»Die Falangisten haben zwischen dem 16. und 18. September etwa 3500 Menschen getötet. Das sind ungefähr so viele Tote wie bei den Angriffen auf das World Trade Center und das Pentagon 2001. Ihnen ist natürlich die Überschneidung der Daten der Tivoli-Bombe im letzten Jahr und den Massakern in den Flüchtlingslagern aufgefallen …«
Natürlich, dachte Lene. Die Frage war nur, ob das von Bedeutung oder Zufall war. Bisher hatte sich keine Gruppierung zum Tivoli-Attentat bekannt, was ungewöhnlich war. Alle hatten damit gerechnet, dass irgendeine Organisation von Al-Qaida bis Ansar al-Islam diesen Erfolg für sich verbuchen würde, aber weder war ein Bekennerschreiben oder -video in irgendeinem internationalen Pressebüro eingegangen, noch war auf YouTube ein Film von Pakistans nordwestlichen Stammesterritorien oder aus dem Jemen eingestellt worden.
Die Leinwand wurde grau und leer.
»Nach Sabra und Schatila gab es einen Angriff auf die amerikanische Botschaft in Beirut, bei dem 63 junge Menschen ums Leben kamen. Danach wurden die Kasernen der US Marines bombardiert, weitere 241 Amerikaner wurden getötet. Der Mittlere Osten ist ein chronisches, politisches Epizentrum. Ein Tier, das die Kinder anderer verschlingt und seine eigenen dazu. Jemand muss diesen Teufelskreis durchbrechen, meine Damen und Herren, sonst wird die Geschichte ein sehr hartes Urteil über uns alle fällen. Fragen?«
Ein muskulöser Mann am äußeren Ende von Lenes Reihe erhob sich, reckte eine Hand in die Luft und bekam ein Mikrofon gereicht. Lene kannte ihn nicht, aber er war ein typischer Vertreter vom PET: Anfang vierzig, durchtrainiert, Jeans und schwarzes T-Shirt, dessen Ärmel über einem imposanten Bizeps spannten. Aber er wirkte erschöpft, das Gesicht schmal, mit tief in ihren Höhlen liegenden Augen, schonungslosem Blick und kurzem vorzeitig ergrauten Haar. An seinem Hals pochte eine Ader.
»Vizepolizeidirektor Kim Thomsen, PET«, stellte er sich vor. »Wenn wir oder andere den Teufelskreis durchbrechen sollen, muss man den Anschlag zuerst in einen relevanten Zusammenhang stellen, egal, wie weit hergeholt er sein mag. Was allerdings schwierig ist, weil sich keine Gruppierung zu diesem Anschlag bekennt.«
Die Körpersprache des Fragenden war beherrscht, aber eine gewisse Gepresstheit in seiner Stimme verriet persönliche Betroffenheit.
Wie fast jeder Bewohner ihres kleinen Landes, dachte Lene. Alle kannten jemanden oder hatten selbst Verwandte verloren, die am 17. September im Tivoli gewesen waren. Die Bombe war ein nahezu tödlicher Schlag für das Land gewesen, das davon abgesehen von der Geschichte so glimpflich behandelt worden war. Auf so etwas waren sie nicht vorbereitet gewesen, hatten noch nie etwas Vergleichbares erlebt, und hatten keinen Schimmer, wie sie damit umgehen sollten.
Das Handy vibrierte an ihrem Oberschenkel. Sie wechselte die Sitzhaltung und ignorierte es. Ihre Augenlider waren bleischwer. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal ohne Schlaftabletten, Rotwein oder Wodka eingeschlafen war – oft war es eine Kombination aus allen dreien.
Der Amerikaner nickte.
»Ich glaube nicht, dass auch nur ein Kenner der mittelöstlichen Szene die Verantwortung für den Tivoli-Anschlag nicht mit einer dschihadistischen Terrorzelle in Verbindung bringt. Dass keiner sich zu dem Anschlag bekennt, ist auch eine Form von Signatur. Al-Saleem aus Teheran und Scheich Ebrahim Safar Khan aus … Gott weiß woher … vermutlich Amman, haben es zu einer Art Markenzeichen gemacht, nicht offiziell die Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Sie verfügen beide über kleine, aber gut organisierte Einheiten ausgewählter junger Männer und Frauen.«
Der PET-Agent mit dem Mikrofon hatte offensichtlich keine weiteren Fragen oder Kommentare.
»Sie sind hervorragend ausgebildet und vor allen Dingen geduldig. Sie kämpfen für ein weltumspannendes Kalifat und betrachten dafür die Ausrottung oder Konvertierung aller Ungläubigen als Grundvoraussetzung. Aber diese Männer und besonders Frauen leben in gewisser Weise im Mittelalter, während wir, die westlichen Geheimdienste und Polizeikräfte mit unseren Satelliten, Drohnen, Abhörstationen und Computern aus der Zukunft stammen.«
Er machte eine ausholende Geste.
»Für die seid ihr allesamt Science-Fiction-Gestalten. Wir leben in zwei parallelen, aber getrennten, unterschiedlichen Zeitordnungen, und es ist verdammt schwer, diese Kluft zu überbrücken, sie zu finden … und zu liquidieren. Wir im Westen sind so verletzlich, weil kein Mensch sich vor einem entschlossenen Mann oder einer entschlossenen Frau schützen kann, denen es nichts ausmacht, zu sterben. Das schließt unser gesamtes Gedankengebäude kurz, in dem wir niemals sterben wollen, und schon gar nicht für eine ›Sache‹.«
Der Mann, der sich als Kim Thomsen vorgestellt hatte, sah verwirrt aus, aber der Amerikaner lächelte ihn aufmunternd an.
»Normalerweise benutzen sie keine Mobiltelefone, aber wenn doch, dann verwenden sie Prepaidkarten, sagen ein paar Worte oder schicken eine SMS und zerstören das Gerät. Sie wissen, wie sie aussehen, kennen ihre Klans und Familien, die Dialekte und Akzente, und sie haben bewiesen, dass sie für den Auftrag taugen. Jeder von ihnen hat entweder eine Busladung Schiiten auf dem Weg zu einem Markt hingerichtet, eine Mädchenschule in die Luft gesprengt, eine Frau geblendet, die behauptet, sie wäre vergewaltigt worden, oder einen Homosexuellen geköpft. Jemanden bei ihnen einzuschleusen ist unmöglich, weil wir von unseren Agenten nicht verlangen können, als Beweis ihrer Tauglichkeit kleine Mädchen zu verstümmeln oder umzubringen. Sie übernehmen keine Verantwortung für ihre Aufträge und treten nicht länger wie Rockstars auf wie Ilich Ramirez Sanchez, besser bekannt als der Schakal.«
Der Amerikaner starrte vor sich hin.
»Möglicherweise setzt sich der ideologisch harte Kern heutzutage aus jüngeren, gut ausgebildeten Frauen zusammen, was die Bedrohung um einiges komplizierter macht. Sie brauchen kein spezielles Training, weil sie Frauen sind. Sie sind diskret, gute Lügner und generell besser geeignet, Geheimnisse zu bewahren, als Männer.«
Unter den Frauen im Saal wurde vorhersehbares Gemurmel laut. Der Amerikaner wartete geduldig, bis es verebbt war.
»Es sind meist die Männer, die vergessen, sich bei Facebook auszuloggen, oder den String-Tanga noch in der Jackentasche haben, den Lippenstift auf dem Hemdkragen nicht wegwischen, das verräterische lange Haar auf der Jacke nicht bemerken oder die schmachtende SMS auf dem Handy nicht löschen, nachdem sie mit ihrer Geliebten zusammen waren. Der Antrieb für die Frauen ist ihre persönliche Tragödie. Sie haben Ehemänner, Brüder, Schwestern, Kinder oder Eltern verloren oder ihr Land und Erbe, und sie machen den Westen und Israel verantwortlich für diesen Verlust. Sie tragen weder Burka noch Niqab und gehen nicht zwölf Schritte hinter ihrem Mann. Sie rauchen, fahren Auto, trinken Mojitos, haben vorehelichen Sex und hören Rihanna. Das alles dürfen sie, weil sie einem höheren Ziel dienen: der Destabilisierung des Westens.«
Da sagt der Mann was Wahres, dachte Lene.
»Aber wieso gerade jetzt? Und wieso ausgerechnet in Dänemark?«, fragte der PET-Agent.
Der Amerikaner zuckte mit den Schultern und legte Daumen und Zeigefinger an die Nasenwurzel.
»Well … Es ist kein Geheimnis, dass wir, eure Alliierten, uns über die Leichtsinnigkeit gewundert haben, mit der Dänemark in den Siebzigern und Achtzigern politisches Asyl und permanente Aufenthaltsgenehmigungen an Gott und die Welt vergeben hat, unter anderem an aktive islamische Fundamentalisten und Demagogen. Sie wurden willkommen geheißen, weil ihr geglaubt habt, dass sie von der Diktatur in Ägypten verfolgt wurden, auch wenn das natürlich das Risiko ist, wenn man plant, das Oberhaupt eines Staates zu töten. Sie haben euch leidgetan. Dann war da die Sache mit den Mohammed-Karikaturen, die nicht recht in Vergessenheit geraten will und immer wiederbelebt wird, wenn die Mullahs die Menschen auf die Straße treiben wollen. Und man darf nicht vergessen, ihr ward Teil der Koalitionstruppen in Afghanistan und im Irak, die christlichen Kreuzfahrer unserer Zeit. Darüber hinaus kann es natürlich auch noch andere Ursachen geben, von denen wir nichts wissen. Zum Beispiel, dass sich in diesem Land eine islamische Zelle gebildet hat, die getestet werden soll.«
»Wollen Sie damit sagen, dass wir selber schuld sind?«, fragte der PET-Agent erbost.
Der Amerikaner sah ihn mit leerem Blick an.
»Natürlich nicht, und mir liegen keine soliden Fakten vor, auf deren Basis ich eine befriedigende Antwort geben könnte«, antwortete er nach einer kurzen Pause. »Vielleicht war Dänemark einfach an der Reihe, oder es war das leichteste Opfer. Wir müssen bedauerlicherweise einfach feststellen, dass der Anschlag auf das Tivoli besonders erfolgreich war. Dänemark wurde gezwungen, umzudenken und anders zu handeln, wenn eine Wiederholung vermieden werden soll. Nach dem Anschlag auf das Tivoli ist Dänemark in einer neuen Wirklichkeit angekommen. Die Frage ist, ob das Land bereit ist, die Überwachung von Zivilisten zu intensivieren, Abhöraktionen, Festnahmen ohne Anklage, physischen Druck bei Verhören, Wahrheitsserum, Lügendetektoren, Ausweisung ohne Gerichtsurteil zuzulassen. Kann Dänemark damit leben, ein Polizeistaat zu werden, um zu verhindern, dass sich das Tivoli-Attentat wiederholt?«
Die Zuhörer begannen nervös auf ihren Stühlen hin und her zu rutschen. Wiederholung?! Ein unerträglicher Gedanke.
Lene sah, wie ihre Chefin, Polizeidirektorin Charlotte Falster, sich erhob. Die schlanke Frau mit dem tadellosen, grauen Pagenkopf drehte sich um und starrte den PET-Agenten nieder, bis er sich setzte. Dann erklomm sie das Podium und bedankte sich bei dem Amerikaner. Beide standen frontal zum Publikum, und es wurden Fotos von ihrem Händedruck gemacht. Charlotte Falster war eine Meisterin solcher Details.
Lenes Augenlider begannen sich unaufhaltsam zu schließen, aber als ihre Vorgesetzte die nächste Referentin vorstellte, schlug Lene alarmiert die Augen wieder auf.
Dr. med., internationale arabische Studien, Lehrbücher, Harvard und Oxford, Sonderbeauftragte für den dänischen Nachrichtendienst. Chefärztin der Psychiatrie.
Irene Adler.
Die Köpfe im Saal drehten sich wie von einer Schnur gezogen nach vorn.
Irene Adler hatte Ausstrahlung, dachte Lene. Wenn jemand wissen wollte, was natürliches Charisma war, musste er nur sie ansehen. Ihr langes, goldblondes Haar war zu einem Zopf geflochten, dick wie das Handgelenk eines Mannes, und reichte bis zum Nietengürtel ihrer schwarzen, hautengen Jeans. Der Zopf wischte mit jedem Schritt rhythmisch über ihre schmales Becken. Sie sah aus wie ein Modell auf dem Catwalk.
Der Einzige, der der Psychiaterin keine Aufmerksamkeit schenkte, war der PET-Agent am Ende der Stuhlreihe. Er starrte zu Boden, die Ellenbogen auf die Knie gestützt.
Charlotte Falster sagte etwas zur Rekrutierung von Terroristen, die Aufarbeitung ihrer Psyche und den sozialen Hintergrund von Selbstmordattentätern, aber Lene hörte nicht zu. Die Übelkeit beim Anblick von Irene Adler zwang sie auf die Beine. Sie drängte sich Entschuldigungen murmelnd durch die Stuhlreihe und eilte durch den Mittelgang.
Und die ganze Zeit spürte sie den Blick der Psychiaterin im Nacken.
*
Lene ging langsam über die Steinplatten des berühmten runden Innenhofes vom Polizeipräsidium, die Hände in den Taschen der Lederjacke begraben und froh, an der frischen Luft zu sein. Es war zu früh. Sie ertrug die Nähe von Menschen einfach nicht. Die anderen lösten ihre Grenzen auf, flossen in sie hinein. Als sie rasche Schritte hinter sich hörte, drehte sie sich um und erblickte den finster dreinschauenden PET-Agenten. Kim … Thomsen? Er schien sie nicht zu bemerken, lief mit ausladenden Schritten über den Vorplatz und glitt auf den Fahrersitz eines dunkelblauen Ford Mondeo. Er fuhr mit quietschenden Reifen vom Bürgersteig, und das blaue Einsatzlicht fing noch vor der nächsten Straßenecke an zu blinken.
Lene bog um die Ecke des Gebäudekomplexes in die Otto Mønsteds Gade und zog kurz in Erwägung, einen Kaffee in der Konditorei der Glyptothek zu trinken, wo es um diese Zeit sicher schön ruhig war.
Gelbe Baukräne schnitten den Himmel über dem Tivoli in breite Scheiben. Die Aufräumarbeiten waren noch immer nicht abgeschlossen.
Ihr Handy vibrierte wieder. Sie fischte es aus der Tasche und schaute auf das Display.
»Fuuuck …«, murmelte sie.
Ain?
Lene blinzelte. Sie hatte als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Lebenslinie, einem anonymen Sorgentelefon für Selbstmordgefährdete, mit der jungen arabischen Frau gesprochen, aber das lag inzwischen mehrere Monate zurück. Sie war sich nicht einmal sicher, ob Ain der richtige Name der Frau war, und hatte keine Ahnung, wie sie an ihre Privatnummer gekommen war. Jedenfalls waren vier SMS und zwei Anrufe eingegangen, letzterer flehender und unzusammenhängender als der erste. Sie drückte die Rückruftaste.
Die junge Frau klang kurzatmig, ihre Stimme ertrank im Hintergrundlärm.
»Ain?«
»Lene? Lene … danke! Sie müssen mir helfen. Entschuldigung.«
Der Unterton in Ains Stimme veranlasste Lene instinktiv, das Tempo zu beschleunigen. Sie lief zu ihrem Auto, das vor der Glyptothek parkte.
»Woher haben Sie meine Nummer? Egal … Ich kann Sie kaum verstehen, Ain. Wo sind Sie? Können Sie sich einen ruhigeren Platz suchen … Was ist los?«
»Ich glaube, ich werde verfolgt. Nein, ich weiß es … Warten Sie …«
»Wo sind Sie?«
»U-Bahn-Station Nørreport.«
Die Verbindung wurde unterbrochen. Lene trat frustriert mit einem Fuß gegen die Bordsteinkante. Sie riss die Fahrertür auf, das Handy rutschte unter die Pedale. Sie suchte mit zittrigen Händen danach. Sie wollte gerade die Rückruftaste drücken, als das Display aufleuchtete.
Ain schluchzte.
»Sie sind hinter mir her, Lene!«
Lene atmete tief ein und versuchte, ihre Stimme ruhig klingen zu lassen. Sorgentelefon-ruhig.
»Es ist niemand hinter Ihnen her, Ain. Niemand verfolgt Sie! Bleiben Sie ganz ruhig … Sie sind pa…«
Um ein Haar hätte sie »paranoid« gesagt, konnte das Wort aber gerade noch rechtzeitig hinunterschlucken. Im Hintergrund waren metallische Lautsprecherstimmen zu hören, das Geräusch von dichtem Menschengewimmel, ein Auf- und Abschwellen von Stimmen.
»Ich bin nicht paranoid, Lene. Das bin ich nicht. Ich bin nicht krank!«
»Natürlich nicht, Ain. Sie sind nicht krank. Aber wer sind die?«
Die junge Frau klang plötzlich ganz ruhig, was nicht weniger beunruhigend war. Es gab eine unerklärliche Stagnation des infernalischen Kraches um sie herum, und die dünnen Härchen auf Lenes Unterarmen stellten sich auf, als sie das kindliche Schluchzen am anderen Ende der Verbindung hörte.
»Ich bin selber schuld, Lene. Ich verdiene es nicht anders. Ich habe etwas Grauenvolles getan, etwas ganz, ganz Schreckliches. Ich war diejenige … Und jetzt habe ich Sie da auch noch mit reingezogen …«
»Was wollen Sie damit sagen? Was haben Sie verdient? Hören Sie, ich komme zu Ihnen, und dann suchen wir uns einen Ort, an dem wir reden können, okay? Okay, Ain?«
Lene startete ihren alten Citroën und trat das Gas bis zum Anschlag durch. Ein Mann, der seinen Hund ausführte, rannte um sein Leben, als sie auf dem H. C. Andersens Boulevard eine rote Ampel überfuhr. Ein Fahrradkurier schlug klatschend mit der flachen Hand auf ihr Autodach, als sie ihn an die Bordsteinkante drängte.
»Sagen Sie was, Ain!«
Lene hörte Ains schnelle, hohe Absätze auf dem harten Bodenbelag des Bahnsteiges, als hielte sie das Handy am gestreckten Arm neben dem Körper.
»Ja, Lene … Wollen Sie wirklich kommen? Ich kann ihn sehen. Er ist hier unten.«
»Ich bin in zwei Minuten da.«
»Danke …«
Jetzt sah Lene den U-Bahn-Aufgang Nørreport vor sich, blockiert durch zähfließenden Verkehr. Sie presste das Telefon ans Ohr und lenkte ihr Auto mit einer Hand. Die scheppernde Lautsprecherstimme machte wieder eine Ansage, und eine Bahn fuhr ein. Ain sagte nichts mehr, Lene hörte nur ihren schnellen Atem.
»Es nützt alles nichts, Lene. Ich …«
Lene hörte ein lautes Schnappen nach Luft, eine Sekunde später Schreie, laute, hysterische Frauenstimmen.
»Ain!«
Es folgte ein Knall, der Lene fast das Trommelfell zerriss, vermutlich schlug das Mobiltelefon auf dem Bahnsteig auf. Dem Krach folgte das Geräusch schneller Schritte. Die Bremsen des Zuges kreischten ohrenbetäubend laut und erschreckend nah. Lene wurde schwarz vor Augen.
Sie blieb an einem Fußgängerüberweg stehen und sah, wie die Straße sich mit Menschen füllte, die aus der U-Bahn heraufströmten.
Die Lautsprecher verkündeten lakonisch einen Personenschaden.
Lene hörte Schritte näher kommen. Das Mobiltelefon wurde aufgehoben, ein Mann sagte ein paar Mal beherrscht »Hallo«, ehe die Verbindung unterbrochen wurde.
*
Der Zugführer lehnte an einer kalten Wand, während ein paar Kollegen ihn zu beruhigen versuchten. Er hatte die Ellenbogen auf die Oberschenkel gestützt, sein Kopf war vornübergebeugt, er fuhr sich mechanisch mit den Händen über das bleiche Gesicht. Wie paralysiert starrte er auf die Pfütze Erbrochenes zwischen seinen Füßen.
Vorruhestand, dachte Lene automatisch, als sie an dem Mann mittleren Alters vorbeiging. Endstation Nørreport.
Der leere Zug stand still, alle Türen waren geöffnet, die Wagen erleuchtet, merkwürdig verlassen. Er wartete an dem langen, gähnend leeren Bahnsteig, als wäre die gesamte Menschheit von diesem Planeten evakuiert worden. Das einzige Geräusch war das rastlose Zischen der Druckluftbremsen.
Lene ging zu ein paar Polizisten und Sanitätern, die neben einer abgedeckten Trage standen. Als sie näher kam, hörte sie Gelächter aus einem Radio. Zwei Sanitäter gingen mit gelben Plastiksäcken das Gleisbett ab. Der eine bückte sich, sammelte etwas auf und ließ es in den Sack fallen. Es schien schwer zu sein.
Unter der weißen Decke von der Ambulanz zeichneten sich die kaum erkennbaren Umrisse eines Menschen ab. Dort, wo eigentlich der Kopf hätte sein sollen, hatte sich die Decke mit Blut vollgesogen. Der Körper war unnatürlich kurz, und es dauerte einen Augenblick, bis Lene begriff, dass die Beine unterhalb der Knie abgetrennt waren.
Lene zeigte dem Beamten neben ihr ihren Dienstausweis.
»Ich glaube, ich kenne die Tote«, sagte sie zu einer extrem jungen, dunkelhaarigen Frau mit Pferdeschwanz, die aussah, als wäre sie am liebsten ganz woanders.
»Wir haben einen Namen«, sagte sie und zeigte Lene eine Brieftasche. »Und wir haben das hier gefunden.«
Sie hielt eine unförmige Schultertasche hoch. Das Leder war zerfetzt, und die Ränder waren mit Blut vollgesogen.
»Ain?«, fragte Lene. »Heißt sie Ain?«
Ihr Blick wanderte zu den weißen Überwachungskameras an der Decke.
Die junge Kommissarin nickte. »Ain Ghazzawi Rasmussen. Es gibt einen Führerschein.«
»Gibt es einen Brief?«
»Einen Brief?«
»Ja, einen Abschiedsbrief oder Ähnliches. Eine Erklärung?«
»Nein.«
Die junge Kommissarin schaute zu der Trage.
»Es lässt sich allerdings nur schwer sagen, ob das tatsächlich sie ist. Sie ist extrem verstümmelt.«
Lene sah sich den Führerschein an. Eine zurückhaltend lächelnde, dunkelhaarige junge Frau. Ain Ghazzawi Rasmussen war dreiundzwanzig Jahre alt geworden. Sie trug ein Halstuch, hatte einen hübschen Mund, hohe Wangenknochen, dunkle, leicht schräg stehende Augen und sah eindeutig mittelöstlich aus. Der Führerschein war vor vier Jahren von der Polizei Kopenhagen ausgestellt worden.
Die beiden Sanitäter kletterten auf den Bahnsteig und schüttelten den Kopf, als der Einsatzleiter sie fragend ansah.
»Mehr ist da nicht«, sagte der eine.
Lene hob den Blick, als Sirenen ertönten. Das blaue Blinken reflektierte an den Wänden des Treppenaufganges.
Sie gab den Führerschein zurück.
»Kannten Sie sie?«, fragte die Kommissarin.
»Nicht wirklich«, sagte Lene. »Nein.«
Sie öffnete die Brieftasche der Toten. Versicherungskarte, ein paar Geldscheine, Kreditkarte. Keine Fotos. Hinter der Krankenversicherungskarte steckte die Visitenkarte eines Restaurants in Østerbro: Le Crocodile Vert.
Lene gab die Brieftasche und die Schultertasche zurück.
»Das hier haben wir auf dem Bahnsteig gefunden«, sagte die junge Beamtin und zeigte Lene ein weißes Smartphone.
»Haben Sie es schon untersucht?«
»Noch nicht.«
Lene nahm das Handy und drehte es hin und her. Auf den ersten Blick schien es intakt, aber die Tastensperre war eingeschaltet.
Die Sanitäter schoben die Trage Richtung Treppe. Eine Kollegin der jungen Kommissarin legte ihr eine Hand auf die Schulter und sagte etwas zu ihr.
»Wir fahren mit ihr«, sagte sie zu Lene. »Ich weiß ja nicht, ob Sie …«
Sie sah Lene flehend an. Wahrscheinlich wäre sie überglücklich über das Angebot Lenes gewesen, mit in die Rechtsmedizin zu fahren und am besten auch gleich die Angehörigen der Toten zu verständigen, weil die Kriminalkommissarin sicher viel mehr Erfahrung mit solchen Dingen hatte als sie.
Lene zögerte, konnte sich aber nicht dazu durchringen. Sie hatte keinen Platz für noch mehr Tote.
»Sie werden das schon schaffen«, sagte sie. »Man gewöhnt sich daran.«
»Ist das so?«
»Nein.«
*
Als Lene im Hausflur nach dem Schlüssel für den Briefkasten suchte, stellte sie fest, dass Ains Mobiltelefon noch in ihrer Jackentasche lag. Sie fluchte leise vor sich hin auf dem Weg in die vierte Etage. Seit der Trennung von Josefines Vater lebte sie in dieser friedlichen Straße in Frederiksberg. Zu dem Zeitpunkt war sie neununddreißig und Josefine siebzehn gewesen. Jetzt war sie fast fünfundvierzig und der Meinung, dass der Mensch viel zu lange lebte.
Sie legte die Morgenzeitung auf den Küchentisch und machte ihre gewohnte Runde zu den Fenstern im Wohnzimmer, um die Gardinen aufzuziehen. Sie öffnete dem klarblauen Nachmittagshimmel die Fenster, hängte die Decke über das Balkongeländer, betrachtete lange den Wäschekorb im Badezimmer, konnte sich aber nicht aufraffen, eine Maschine anzustellen. Dann warf sie einen Blick in Josefines altes Zimmer, das leer stand, seit ihre Tochter mit einer Freundin von der Physiotherapeutenschule zusammengezogen war. Trotzdem musste Lene dort jeden Tag nach dem Rechten sehen.
Sie goss sich einen Becher Nescafé auf und setzte sich mit der Tageszeitung aufs Sofa, die seit der Katastrophe im Tivoli mit einem schwarzen Rand auf der Titelseite gedruckt wurde, der die Zeitung 1241 Tage zieren würde: für jedes Opfer ein Tag.
Eine frostige Besonnenheit machte sich seit der Katastrophe in den dänischen Medien breit. Verschwunden waren die ewigen Kochsendungen, und keiner vermisste sie. Die Gesichter der Moderatoren waren ernst und sachlich, die Stimmen gedämpft. Die Meteorologen verkündeten mit gequältem Schuldbewusstsein Tage mit klarem, wolkenfreiem Himmel, und selbst die kommerziellen Fernsehkanäle hatten viele ihrer hirnlosen Reality-Shows ausrangiert und zeigten stattdessen seriöse historische Sendungen und Filme aus den glorreichen Zeiten Dänemarks. Die eine Hälfte des politisch korrekten linken Flügels war in der Konfrontation mit der Wirklichkeit verstummt, von der sie wohl schon gehört, an die sie aber nicht so recht geglaubt hatte, während die andere Hälfte in verzerrter Schadenfreude meinte, das Land sei selber schuld, und man müsse das Ganze auch mal aus der Perspektive der Terroristen betrachten. Dänemark hatte bekommen, was es verdiente nach der neoimperialistischen Außenpolitik, vor allen Dingen der bürgerlichen Regierung. Man hätte sich damit begnügen sollen, Forstwirte und Verkehrspolizisten in den Kosovo und Irak zu schicken, um Fahrradwege in Afghanistan anzulegen, worin Dänemark stolzer Weltmeister war.
Die Dänen hatten sich nach innen und oben gewandt. Die dänische Volkskirche vermeldete erstmals steigende Zahlen ihrer Gemeindemitglieder, und jeder Mensch, der jemals ein Wochenendseminar in Gestalttherapie oder Mindfullness besucht hatte und eine Homepage einrichten konnte, erlebte goldene Zeiten, indem er anbot, die Traumata und Sorgen anderer Menschen zu bearbeiten. Die Ministerpräsidentin stellte einen begabten Redenschreiber ein und feuerte ihre alten politischen Berater. Nach dem Anschlag hatte sie eine allseits gelobte Rede gehalten, die in voller Länge auf CNN ausgestrahlt worden war. Sie hatte die Stimme eine halbe Oktave gesenkt und erstmals den Eindruck vermittelt, die Wirklichkeit ihrer Landsleute zu teilen. Die Prognosen sagten ihre Wiederwahl voraus.
Aber selbstverständlich hatte die Terroraktion Neonazis, antiislamische und rassistische Gruppierungen auf den Plan gerufen, in der Regel angeführt von größenwahnsinnigen alten Männern. Etlichen türkischen und libanesischen Gemüsehändlern und Gastwirten waren die Scheiben ihrer Läden eingeworfen oder die Lieferwagen mit rassistischen Parolen vollgeschmiert worden. In einem Viertel in Vestegnen war ein vierzehnjähriges jordanisches Mädchen in einem Fußgängertunnel überfallen und vergewaltigt worden – vermutlich von Neonazis.
Das war zu erwarten gewesen, und trotzdem mahnten alle – von Einwanderer- bis zu Mietervereinen – zur Besonnenheit. Inzwischen patrouillierten Freiwillige rund um die Uhr in den Vierteln.
Lene blätterte die Zeitung durch, ohne sich auf einen Artikel konzentrieren zu können. Sie schielte zu dem weißen Smartphone auf dem Sofatisch, rührte es aber nicht an.
Wie oft hatte sie mit Ain gesprochen? Fünfmal? Achtmal? Die ersten Gespräche waren ein vorsichtiges Herantasten gewesen, wie das häufig der Fall war, wenn sich jemand überwand, die Lebenslinie anzurufen. Die junge Frau hatte einigermaßen klar auf sie gewirkt, die Gespräche hatten selten länger als eine Viertelstunde gedauert und in der Regel in einem konstruktiven, optimistischen Ton geendet.
Ain hatte kaum persönliche Details von sich preisgegeben, sich ihren Problemen in einer Art Krebsgang genähert, was völlig normal war. Sie hatte eine chaotische Kindheit als palästinensische Waise in einem Flüchtlingslager in Tunesien hinter sich, war schließlich aber von einem dänischen Ärzteehepaar adoptiert worden, die für Ärzte ohne Grenzen arbeiteten, und war mit acht Jahren nach Dänemark gekommen. Sie sprach akzentfrei, lebte offensichtlich wie die meisten dänischen Frauen ihres Alters und erwähnte nie Probleme wie Mobbing, Ausgrenzung oder Diskriminierung. Ain hatte von Ängsten und Einsamkeit gesprochen, und Lene hatte ihr vorgeschlagen, sich mit einem Psychiater oder Psychologen in Verbindung zu setzen. In der Lebenslinie gab es eine Liste mit Psychiatern und Psychologen, die kurzfristig Patienten annehmen konnten, wenn die Gefahr eines Selbstmordes als wahrscheinlich erachtet wurde, aber sie hatte keine Ahnung, ob Ain ihren Rat befolgt hatte.
Nachdem Ain fünf, sechs Wochen nichts von sich hatte hören lassen, hatte Lene schon gehofft, dass sie sich in Behandlung begeben oder von allein stabilisiert hatte. Vielleicht war sie verliebt, befördert worden oder emigriert. Oder hatte sie dem Mädchen am Ende gar helfen können?
Ihre Hoffnungen zerplatzten an dem Abend, als ein anderer Ehrenamtlicher der Lebenslinie signalisierte, dass Ain in der Leitung war.
Sie hatte kurzatmig und ängstlich geklungen und lange Pausen gemacht, in denen nur das Rauschen der Leitung zu hören war, ehe sie unvermittelt ein oder zwei Sätze abgefeuert hatte. Die Worte waren größtenteils unverständlich, und Lene hatte hochkonzentriert mit geneigtem Kopf die Kopfhörermuscheln fester auf die Ohren gedrückt, um keine Silbe zu verpassen. Ain sagte, sie habe herausgefunden, dass sie etwas Grauenvolles getan hätte. Etwas Unverzeihliches, das niemals, niemals wiedergutgemacht werden könne. Sie weinte leise, schniefend, halb erstickt. Sie hatte angefangen, nachts draußen herumzulaufen, hielt es weder zu Hause noch an anderen ihr bekannten Orten aus. Sie lief im Wald umher oder an den Stränden nördlich von Kopenhagen.
Lene hatte in die Dunkelheit hinter den Bürofenstern geschaut und sich die junge Frau vorgestellt, wie sie durch dunkle Parks und Wälder oder an einem einsamen Strand herumirrte, und ihr Magen hatte sich zusammengezogen. Genau dieses Gefühl hatte sie gehabt, wenn Josefine nachts unterwegs gewesen war und Lene nicht genau wusste, wo, und das verfluchte Gör nicht ans Handy gegangen war.
In der folgenden Stunde hatte Lene versucht, irgendeinen konkreten Anhaltspunkt in dem Gespräch zu finden, etwas Handfestes und Alltägliches. War sie in Behandlung, bezahlte sie ihre Rechnungen, aß sie regelmäßig? Ging sie einer Arbeit nach? Kontakt zu ihrer Familie? Sie versuchte, die junge Frau auf eine kleine Insel einer gemeinsamen Wirklichkeit zu ziehen.
Aber es perlte alles an ihr ab. Ain hatte schreckliche Angst vor etwas, das weder Namen noch Gestalt hatte oder greifbar war: eine dämonische und übermächtige Kraft. Jemand manipuliere sie, sagte sie. Sie meinte, jemand wäre in ihrer Wohnung gewesen, während sie bei der Arbeit war oder ihre einsamen Ausflüge unternahm. Sie hörten alles, was sie sagte, und sahen alles, was sie tat.
»Ja, aber wer tut das, verdammt noch mal, Ain?«, hatte Lene irgendwann gerufen, worauf die Köpfe der anderen Freiwilligen wie Korken hinter ihren Tischen hochgeploppt waren. Sie dämpfte ihre Stimme und wusste, dass sie vor ihrer nächsten Schicht zu einer freundlichen Supervision zitiert werden würde, um ihr die internen Regeln nahezulegen. Die Berater der Lebenslinie sollten empathisch sein und ein offenes Ohr haben. Es war nicht Sinn der Sache, den Selbstmordkandidaten den Kopf zurechtzustutzen.
ENDE DER LESEPROBE