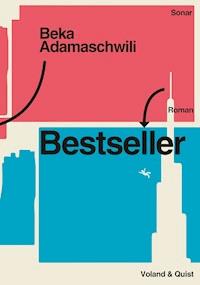
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pierre Sonnage, ein erfolgloser Schriftsteller, sieht seine einzige Chance auf Ruhm im Selbstmord und springt kurzerhand von einem Wolkenkratzer. Doch statt im Bestsellerhimmel landet er in der Literatenhölle. Hier trifft er nicht nur auf Dante, Kafka, Hemingway und all die anderen VIPs, sondern muss sich Rätseln stellen, so überfrachtet und verschlüsselt, wie er sie nur aus seinen eigenen Romanen kennt. Eine irrwitzige Reise beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
The book is published with the support of the Georgian National Book Center and The Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia.
Die vorliegende Übersetzung wurde durch ein Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e.V. gefördert.
Originaltitel: , erschienen bei Sulakauri Publishing, Tiflis 2014
© Beka Adamaschwili, 2014
DEUTSCHE ERSTAUSGABE
1. Auflage 2017
Verlag Voland & Quist, Dresden und Leipzig, 2017
© der deutschen Ausgabe by Verlag Voland & Quist GmbH
Korrektorat: Annegret Schenkel
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Satz: Fred Uhde
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
E-Book: zweiband.media, Berlin
ISBN: 978-3-86391-190-4
www.voland-quist.de
Beka Adamaschwili, geboren 1990 in Tiflis, Georgien, studierte Journalismus und Sozialwissenschaften an der Caucasus University in Tiflis. Für seine Kurzgeschichten, die bereits in frühen Jahren in Magazinen und Zeitungen publiziert wurden, erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Als Blogger macht er mit satirisch-humoristischen Postings auf sich aufmerksam. Heute arbeitet Adamaschwili für eine große georgische Werbeagentur. Mit »Bestseller« veröffentlichte er 2014 seinen Debütroman, der in Georgien schnell zum echten Bestseller avancierte und auf der Shortlist für den besten Roman beim SABA- und Tsinandali-Preis stand.
Sybilla Heinze, geboren 1976 in Pößneck, studierte Kaukasiologie, Ostslawistik und Südosteuropastudien an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach ersten Übersetzungen von Gedichten nahm sie regelmäßig an Weiterbildungsseminaren des DÜF (Hieronymus-Programm, ViceVersa-Übersetzerwerkstätten) teil. Es folgten Übersetzungen von Kurzgeschichten und Romanen, u. a. von Ana Kordsaia-Samadaschwili, Rusudan Ruchadse und Anina Tepnadse.
Beka Adamaschwili
Bestseller
Gewidmet allen Bäumen, um den Schaden ein wenig zu kompensieren, der durch die Notwendigkeit einer Seite mit Widmung entstanden ist.
Anstelle des »Anstelle eines Vorworts«
Ich kenne wenige Leute, die gern Vorworte lesen. Und noch viel weniger, die gern welche schreiben. Wahrscheinlich deshalb, weil sie so sinnlos lang sind wie die Nacht des einundzwanzigsten Dezember, so obligatorisch wie gegenseitige Komplimente bei Banketten und so langweilig wie das mitternächtliche Fernsehprogramm.
Im Unterschied zum Obengenannten wird dieses Vorwort jedoch kurz ausfallen und zum Glück keinen Platz bieten für langatmige Vorwortfloskeln wie diese: »Der Stil des Autors zeichnet sich durch äußerste Raffinesse und Leichtigkeit aus«, »Erwähnt werden sollte die meisterhaft verwobene Symbolik, in welcher …«, »Im eklektischen Charakter der Hauptfigur lassen sich erste Spuren der Melancholie erahnen« und dergleichen mehr. Nur so viel sei gesagt: Erstens beinhaltet dieses Buch keinerlei tiefgründige und allumfassende Gedanken, und zweitens soll es nicht mit Symbolik überladen sein, deren Erhabenheit sowieso fast kein Mensch begreift. In vielen Fällen noch nicht einmal der Autor selbst.
Seid euch gleich im Klaren darüber, dass ihr in diesem Buch weder Kraftausdrücke, pornografische Szenen noch irgendwelche Skandale antreffen werdet, die dem Autor später fünfzehn Minuten gesellschaftlichen Ruhm bringen könnten. Stattdessen findet man Bilder und Dialoge, die das schmerzhafte Defizit der vorgenannten Dinge, wenn schon nicht vollständig, so doch zumindest bis zu einem gewissen Grade aufwiegen. Alles in allem ist das Buch leicht, unterhaltsam und – nach grober Schätzung des Autors – mühelos in sechstausenddreihundertfünfundzwanzig Atemzügen durchzulesen.
Noch ein paar Worte zu den Lokalitäten: Ein Teil der Handlung von »Bestseller«1 spielt in Frankreich. Das Land wurde in diesem Fall eher zufällig gewählt und ist dem Klang des Namens der Hauptfigur – Pierre Sonnage – geschuldet. Der zweite Teil der Geschichte spielt in der Literatenhölle, und weil »ein Teufel leichter zu malen ist als ein Hahn, denn einen Hahn hat schließlich schon jeder mal gesehen, einen Teufel jedoch nicht«, fiel dem Autor die Beschreibung desselben wesentlich leichter.2
Was gibt es noch zu sagen? Willkommen in der Literatenhölle!
»Mahalaleel war fünfundsechzig Jahre und zeugte Jared und lebte darnach achthundertunddreißig Jahre und zeugte Söhne und Töchter.«
(1. Mose 5, 15-16)
»Und sie aßen alle und wurden satt.«
(Markus 6, 42)
».«
(James Joyce, »Ulysses«, nach jedem Satz)3
I.
Der PR-Schritt oder Hoppla in die Hölle
Pierre Sonnage war fest entschlossen, an seinem dreiunddreißigsten Geburtstag Suizid zu begehen. Der Grund dafür war alles andere als banal – weder hatte er seine Braut mit dem Trauzeugen in flagranti erwischt noch im Casino erst den Kopf, dann die Hoffnung und zuletzt sein ganzes Hab und Gut verloren; auch vergrub er sich nicht in existenziellen Fragen, die ihn im Sumpf der Vergeblichkeit hätten versinken lassen; und was die Hauptsache ist: Er hatte bei niemandem riesige Schulden – wenn man von der Sache mit Haus, Baum und Sohn absieht, natürlich. Tatsächlich war er während der Planung seines Suizids viel idealistischer gewesen, als die bloße Aussicht auf die Lösung des Dilemmas der Unsterblichkeit der Seele versprochen hätte.
Jedenfalls war Pierre Schriftsteller. Unbekannt zwar und nicht unbedingt einer, den man eine »Person des öffentlichen Lebens« nennen konnte, aber dennoch ein Schriftsteller. Er gehörte zu jener Kategorie Menschen, die lieber Bücher schreiben als lesen, und so hatte er neben zahlreichen Erzählungen in Zeitschriften schon vier Bücher herausgebracht. Er war quasi der Rubens unter den Schriftstellern – er schuf gern »dicke Werke«. Und ungeachtet der Dicke seiner Bücher waren die Gourmets unter den Lesern durchaus der Meinung, seine Bücher seien »geschmackvoll zu lesen«. So gut diese Einschätzung war, so gering war die Wertschätzung, weshalb es Pierre schwerlich gelang, sich mit Beigbeder, Le Clézio und Houellebecq auf eine Plattform zu stellen. Zur Vorstellung seines letzten Buches waren alles in allem nur zwölf Zuhörer gekommen. Klar, die Vorstellung war nicht gerade pompös gewesen und hatte abseits der breiten Öffentlichkeit stattgefunden, es waren nur Weingläschen und Baguettehäppchen gereicht worden, aber man muss zugeben, zwölf Zuhörer sind für ein Alter von dreiunddreißig Jahren trotzdem ziemlich wenig.
Natürlich hatte er auch dafür eine Erklärung parat. Pierre glaubte aus tiefstem Herzen daran, dass »die Gesellschaft bloß nicht reif für seine genialen Ideen« sei und sie deshalb für die »Bekehrung zur Wahrhaftigkeit« wirksamen Maßnahmen unterzogen werden müsse. Genau zu jener Zeit reifte im Kopf des Schriftstellers der Plan, mit dem diese ganze komplizierte Geschichte ihren Anfang nahm …
[In Anbetracht der Tatsache, dass Pierre Sonnage am Ende dieses Kapitels sowieso Selbstmord begehen wird, sieht der Autor vorerst davon ab, dessen Aussehen und Charaktereigenschaften zu beschreiben.]
Jawohl, Pierre entschied sich, zugunsten seiner eigenen Weiterentwicklung aus dem Leben zu scheiden, denn er wusste, dass der Tod eine unsterbliche Fähigkeit besitzt – er lässt den Respekt gegenüber den Menschen wachsen.4
Selbstmord schien ihm die einzige Chance auf ewigen Ruhm zu sein, daher hatte Pierre noch eine bewährte Maxime 5, nämlich: »Allererste Voraussetzung für die Unsterblichkeit ist das Sterben.«
Nun, da der Mensch aber mehr oder weniger nur einmal im Leben Selbstmord begeht, sollte dieses Ereignis für Pierre aufsehenerregend und pompös vonstattengehen. Dementsprechend begann er weit im Voraus mit der Planung. Für den Selbstmord schloss er die Benutzung eines Seiles von vornherein aus, da das Seil, welches Pierre in seinem Schrank fand, genauso abgenutzt war wie die Seilmethode selbst. Aus dem selben Grund schied auch die Pistole aus. Erstens würde er schon, bevor er den Abzug gedrückt hatte, tausend Tode sterben. Zweitens war er fest davon überzeugt, dass sein Gehirn nach dem Tod Besseres verdiene, als an einer gewöhnlichen Wand eines gewöhnlichen Zimmers verteilt zu sein. Zum Beispiel, stolz in einem durchsichtigen Glas mit Speziallösung in einer Museumsvitrine ausgestellt zu werden. Er zog noch in Erwägung, dreiunddreißig Schlaftabletten zu schlucken, aber dann wurde ihm klar, dass ja nach seiner Obduktion sowieso niemand die Anzahl der Tabletten nachzählen würde und diese Symbolik der Literaturgeschichte für immer verborgen bliebe. Freilich hätte er in einem Abschiedsbrief auf diesen Zusammenhang hinweisen können, aber, nun ja, wie sollte sich das lesen: »Nun, ich werde jetzt dreiunddreißig Jahre alt, und deshalb habe ich mich entschlossen, dreiunddreißig Schlaftabletten zu schlucken.« ›Nee, nee‹, dachte Pierre, ›das ist so primitiv, da würde ich mich eher umbringen, als das zu machen.‹
Es gab noch viele weitere Selbstmordmethoden: sich auf dem Hauptplatz von Rouen demonstrativ selbst verbrennen, aus seinem Fluss des Lebens in den Fluss Seine überwechseln, rohen Fugu verkosten, bei der Bank einen Kredit aufnehmen oder sich gar mit den eigenen Büchern in der Hand unter einen Zug werfen und mit aggressivem Marketing oder – vielmehr noch – mit schrillem Gekreische die Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich ziehen.
Und weil Pierre sowieso der Meinung war, man müsse der Zukunft von Newtons Schultern aus entgegensehen 6, entschloss er sich, dem Tod aus maximaler Höhe in die Augen zu blicken. Mond und Mount Everest schieden natürlich von vornherein aus. Der Mond deshalb, weil er zu weit weg ist, und der Mount Everest – nicht weniger. Zumal es zweifelhaft ist, ob jemand irgendeinen im Orbit schwebenden oder im Schnee vereisten französischen Schriftsteller als Selbstmörder erkennen würde. Vorausgesetzt, man fände ihn überhaupt. Deshalb wählte Pierre mit glühendem Herzen und kühlem Kopf die Höhe aus, die zu erklimmen nicht allzu sehr anstrengte.
So landete er an seinem Geburtstag in Dubai. In einer nahezu aus dem Nichts erschaffenen Stadt, die nun Pierres Zukunft nahezu aus dem Nichts neu erschaffen sollte …
[In Anbetracht dessen, dass der Autor Landschaftsbeschreibungen jeglicher Art verabscheut und das Gedächtnis sich ohnehin gegen verschnörkelt formulierte architektonische bzw. räumliche Details wehrt, wird hier bewusst auf die Beschreibung der Sehenswürdigkeiten von Dubai verzichtet. Ein Bild vom Burj Khalifa im Internet zu googeln geht sowieso allemal schneller als eine drei Seiten lange Beschreibung zu lesen.]
Nun, Pierre sah den Burj Khalifa mit eigenen Augen, betrat auf eigenen Füßen den Lift, drückte mit eigener Hand den Knopf für die Etagenauswahl und bekam in den eigenen Ohren dieses Druckgefühl, welches (zumindest ihn) die Höhenveränderung spüren ließ. »Jeder hat sein eigenes Golgatha«, sagte Pierre zu einer etwa zweiundzwanzigjährigen, gerade zugestiegenen Frau, die dann in der achtundzwanzigsten Etage verwirrt ausstieg und wahrscheinlich noch einige Minuten lang über diesen Spruch nachdachte. Im Lift passierte dann nichts mehr, was Pierres Leben hätte ändern können. Weder stieg eine sexy Frau ein noch fiel der Strom aus, welches Pierre als göttliches Zeichen hätte deuten können. Im Gegenteil – die Kabine fuhr so langsam nach oben, dass Pierre Sonnage dreimal gähnen, vier Selfies machen, mehrmals seine Lieblingsmelodie summen, ein Romansujet erfinden und sich innerlich jenen sentimentalen Text zurechtlegen konnte, den er über die herzlose Welt während des freien Falls denken wollte. Er beruhigte sich jedoch damit, dass »der Weg nach unten wesentlich schneller vonstattenginge«.
Psychologen sind der Meinung (oder vielmehr: irgendwelche Leute sind der Meinung, dass Psychologen der Meinung sind), dass im Menschen beim Herabschauen aus großer Höhe in der Regel das Verlangen nach dem Hinunterspringen aufkommt. Im Falle von Pierre war das nicht so. Vielmehr hätte er es sich noch einmal anders überlegt, wäre dieser »Salto mortale« nicht für die PR notwendig gewesen. Als er sich jedoch auf dem Gipfel der Architektur den Gipfel seines eigenen Ruhmes vorstellte, winkte er ab und tat ohne großes Federlesen den PR-Schritt ins Leere …
… Pierre fiel dermaßen lange, dass er auf dem Weg erst an Galileis Fallgesetze glaubte, dann an Gott und am Ende – als er sich mit ausgebreiteten Armen der Straßenkreuzung näherte – von Newtons Gravitationsgesetz gründlich überzeugt war …
II.
Höllische Popularität
Veraltete idiomatische und oftmals auch idiotische Vergleiche waren Pierre schon immer gegen den Strich gegangen. Oft entschied er sich, lieber »ihre Stimme war süß wie der November« zu schreiben, statt sich über die Einzigartigkeit der Stimmbänder der Sirenen auszulassen. Zur Beschreibung von Schönheit benutzte er statt »Engel« lieber »schön wie das eigene Spiegelbild«. Zumal niemand je den Gesang von Sirenen gehört, geschweige denn Engel gesehen hatte.
Jedenfalls spürte Pierre, als er die Augen öffnete, gleich eine höllische Hitze. Aus irgendeinem Grunde hatte er angenommen, er würde – der Klassiker – die flackernde Einheitsbeleuchtung an einer Krankenzimmerdecke sehen, aber Fehlanzeige. Zum einen lag er für einen Sturz aus dem hundertachtundvierzigsten Stock erstaunlich unversehrt auf der Erde, zum anderen sah das Tor vor ihm nicht unbedingt aus wie das einer Notaufnahme.
Pierre stand auf. Das Tor war groß, eingelassen in einen Arc de Triomphe, an den ein riesiger Zaun aus schwarzen Obelisken anschloss. Ringsum war Stille, am Tor jedoch stand ein Mann mittleren Alters, lächelnd und in eine fast vergessene mittelalterliche Tracht gekleidet. An seiner Seite befand sich ein Hund an einer gesprenkelten Leine, der ab und zu Feuer spie und wenn er sich bewegte, scharlachrote Spuren in der Luft hinterließ.
Schon von Weitem redete ihm der Mann mit italienischem Akzent gut zu:
»Habt keine Angst! Eigentlich ist der Hund friedlich gesinnt,
er kann nichts dafür, dass ihn so schuf Herr Conan Doyle,
er ist ein Praktikant – während im Urlaub weilt der Zerberus …«
… Ab dem folgenden Satz bemühte er sich aber um eine etwas zeitgemäßere Sprache, damit seine Art zu reden einem Schriftsteller des einundzwanzigsten Jahrhunderts nicht ein wenig spanisch vorkam.
Pierre kratzte sich am Hinterkopf. Das tat er meistens dann, wenn er verwirrt war. Jetzt war er wirklich genauso verwirrt wie James Cook, als dieser begriff, dass die hawaiianischen Eingeborenen nicht MIT, sondern AUS ihm einen Imbiss machen wollten. ›Normalerweise würde ich jetzt aufwachen und alles würde ein banales Ende nehmen‹, dachte Pierre und steuerte, weil jeder im Traum zweimal mutiger ist als in Wirklichkeit, geradewegs auf den italienischen Mann zu.
Außer dem Mann und dem Hund stand bei dem Tor ein flaches weißes Gerät der Marke Mac.Phisto, auf dem das Logo eines beidseitig angebissenen, von einer Schlange umwundenen Apfels prangte.
[Leider glaubt der Autor hier eine auffällige Anspielung entdeckt zu haben.]
»Das ist ein Hoffnungsdetektor. Wir versuchen, in Sachen moderne Technologien Fuß zu fassen. Oder, genauer gesagt, Hand.« Der Italiener strich mit dem Finger über den Bildschirm des Geräts, um es zu entsperren. »Vivere est militare …7 Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!«
»Das heißt?« Pierre begriff, dass er schon nichts mehr begriff.
»Das heißt, ich habe die große Hoffnung, dass Euch keinerlei Hoffnung geblieben ist.«
»Ich für meinen Teil habe keine, und meine Leser erst recht nicht.« Pierre musste ob dieser Selbsterkenntnis schmunzeln und beschloss, in dem Traum mitzuspielen. »Alles was ich hatte, habe ich dort zurückgelassen. Hmm, im vorherigen Leben, Signor …«
»Alighieri, Dante Alighieri«, ergänzte der Mann und gab auf einer elektronischen Tafel »1984« ein, um das Tor zu öffnen. »Na dann, seid herzlich willkommen … in der Literatenhölle.«
* * *
»Die dort zurückgelassene Hoffnung« wurde also Wirklichkeit.
Banal ausgedrückt: Solch große Beliebtheit hätte Pierre sich nie im Leben träumen lassen.
Für diese Popularität schienen ein paar sentimentale Schlagzeilen völlig auszureichen – »Ein aussichtsloser Schritt eines aussichtsreichen Schriftstellers«, gespielte Verwunderung auf dem Gesicht des Türnachbarn und dessen vorsichtige Skepsis – »Also, in letzter Zeit kam er mir recht fröhlich vor«, die vom Blatt abgelesene Rede des Präsidenten über »die unermessliche Trauer über einen unermesslichen Verlust«, dann zehnfach die Version der Klatschpresse, er sei »in Wahrheit ermordet« worden, sei »einfach unglücklich ausgerutscht«, habe »in der Liebe kein Glück gefunden« (und die Journalisten trieben tatsächlich irgendeine Charlize auf, die »Pierre vor sieben Jahren im Abstand von drei Sekunden zweimal auf den rechten Winkel der Oberlippe geküsst hatte«), er sei »gay« gewesen (und Charlize heiße »in Wirklichkeit nicht Charlize, sondern Charlie«), er habe »einige Staatsgeheimnisse gewusst«. Und er habe »dies getan«. Und sei »jenes gewesen«. Und so weiter und so weiter.
Auf die Meldungen im Fernsehen folgten die Zeitungsmeldungen. »Prosaiker, der poetisch starb«, schrieb eine (was daran poetisch sein soll, aus riesiger Höhe mit der Schläfe auf den Asphalt zu knallen, kann sich wahrscheinlich nur ein Journalist vorstellen). »Seine Bücher sind wie prasselnder Regen, der unser vom Alltag verwittertes Bewusstsein nährt«, schrieb eine zweite, eine ältliche Kulturkolumnistin. »Pierre litt an Altophobie 8, sonst hätte er auf jeden Fall den Gipfel seines kreativen Schaffens erklommen«, schrieb der dritte, ein selbstverliebter Autor. »Hätte er nur ein paar Jahrhunderte eher gelebt, hätte Napoleon vor seinem Tod auf jeden Fall gesagt: ›Frankreich, die Armee, Josephina, Pierre …‹«, schrieb der vierte, ein bekannter Literaturkritiker, wobei er dachte, hätte er nur eins von Pierres Büchern gelesen, könne er kompetentere Urteile abgeben.
Auch die Leser waren von so grenzenlosem Enthusiasmus erfüllt, dass Pierres Bücher innerhalb weniger Tage vergriffen waren. In sozialen Netzwerken tauchten unzählige Kommentare auf, in denen Pierre, mit tausenderlei Emojis verziert, als »der Proust/Sartre/Flaubert/Mérimée/etc. unserer Zeit«, »eine Karyatide 9, auf die sich die französische Literatur stützte«, »ein literarischer Jongleur, der mit Worten spielte«, »ein Genie, dessen Bücher nie ein Lesezeichen brauchten« und vieles mehr bezeichnet wurde. Das verbale Bedauern wurde mit derart vielen Herz- und Kusssymbolen illustriert, dass einen zeitweise der Gedanke an Massennekrophilie befallen konnte. Die Menschen litten, die Menschen weinten, die Menschen ersetzten ihr Profilbild durch Bilder von Pierre, und Pierres Image wandelte sich immer mehr zum Positiven.
Wie dem auch sei, mit einem Schritt nach vorn hatte Pierre das erreicht, wonach er all die dreiunddreißig Jahre vergeblich gestrebt hatte – er wurde vergöttert.
III.
Lucy usw.
»Wie schon gesagt, das ist die Literatenhölle«, Dante hob in einem Ton an, in dem öffentliche Redner sprechen, wenn sie mit einem Filzstift irgendwas an die Tafel malen und sich für klüger halten als alle Zuhörer. »Es hat sich herausgestellt, dass es überhaupt keine Höllenkreise gibt und die Hölle weitaus weniger beängstigend ist, als ich gedacht hatte. Wie heißt es so schön: ›Geh in den Himmel wegen des Klimas, zur Hölle wegen der Gesellschaft.‹ 10 Die einzige Unannehmlichkeit bei uns ist, dass in der Hölle jeder Schriftsteller gemäß seiner literarischen Sünden bestraft wird, das heißt, so wie er einst seine Leser gequält hat, so wird auch er selbst gequält werden …«
›Oh …‹, war Pierres einziger Gedanke, denn aufgrund des hohen Sprechtempos Dantes konnte er gar keinen längeren Gedanken fassen.





























