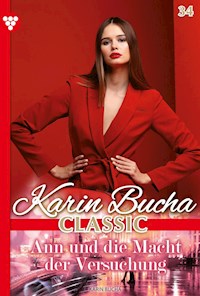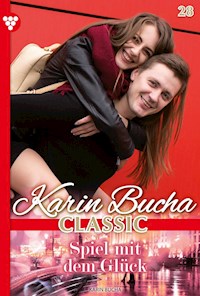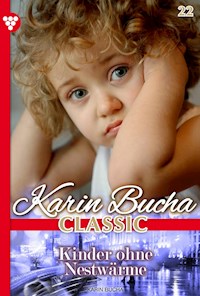Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Mit einem Ruck reißt Henriette Goedecke das Fenster auf und starrt in den Himmel. Dunkelgraue Wolkenfetzen jagen dahin. Wind erhebt sich und rauscht in den Bäumen, fegt über die Hunderte von Rosenstöcken hinweg, die dem Landsitz der Goedeckes den Namen gegeben haben: Rosenhall. Es ist unerträglich schwül. Schon fallen die ersten Tropfen. Bald wird sich ein Gewitter entladen. Henriette ängstigt sich nicht. Sie lächelt voll Bitterkeit vor sich hin. Wie in der Natur Sonne, Sturm und Regen, so folgen auch im Leben in wechselvollem Spiel Liebe, Glück und Leid. Wie ein Sturmwind ist das Leid über ihr junges Herz dahingebraust. Sie beugt den Oberkörper etwas zurück. Berte, die liebe, gute Berte, richtet jetzt in der Küche das Abendessen her. Bald wird sie auch bei ihr mit dem Tablett erscheinen. Unwillkürlich faßt sich Henriette an den Hals. Nein! Nicht einen Bissen wird sie hinunterbringen. Keiner ahnt, wie ihr zumute ist. Vielleicht Berte, deren Liebling sie von jeher war. Sie stützt beide Hände auf die Fensterbank. Noch klingt ihr das Gespräch mit Mama und Kathrin in den Ohren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 27 –Bezaubernde Herniette
Karin Bucha
Mit einem Ruck reißt Henriette Goedecke das Fenster auf und starrt in den Himmel. Dunkelgraue Wolkenfetzen jagen dahin. Wind erhebt sich und rauscht in den Bäumen, fegt über die Hunderte von Rosenstöcken hinweg, die dem Landsitz der Goedeckes den Namen gegeben haben: Rosenhall.
Es ist unerträglich schwül. Schon fallen die ersten Tropfen. Bald wird sich ein Gewitter entladen. Henriette ängstigt sich nicht. Sie lächelt voll Bitterkeit vor sich hin. Wie in der Natur Sonne, Sturm und Regen, so folgen auch im Leben in wechselvollem Spiel Liebe, Glück und Leid.
Wie ein Sturmwind ist das Leid über ihr junges Herz dahingebraust.
Sie beugt den Oberkörper etwas zurück. Berte, die liebe, gute Berte, richtet jetzt in der Küche das Abendessen her. Bald wird sie auch bei ihr mit dem Tablett erscheinen. Unwillkürlich faßt sich Henriette an den Hals. Nein! Nicht einen Bissen wird sie hinunterbringen.
Keiner ahnt, wie ihr zumute ist. Vielleicht Berte, deren Liebling sie von jeher war.
Sie stützt beide Hände auf die Fensterbank. Noch klingt ihr das Gespräch mit Mama und Kathrin in den Ohren.
»Was trägst du denn für einen komischen Ring am Finger? Ist das ein billiges Ding.«
Sie hat nicht gewußt, wie es in ihren großen haselnußbraunen Augen aufblitzte, und wie angriffslustig ihr Ton war.
»Billig? Du hast einen Vogel, Kathrin.« Liebevoll hat sie über den Ring mit dem roten Stein gestrichen. »Für mich ist er wertvoll, sehr wertvoll.«
Aber sie hat doch die Hand unter dem Tisch versteckt und sich gewundert, daß sie äußerlich so ruhig geblieben ist. Sie wäre der Schwester am liebsten an die Kehle gesprungen. Doch dann wurde sie aus ihrer Versunkenheit emporgerissen. Sie hörte Mama sagen:
»Dieser Rainer Kauffmann ist doch ein richtiger Luftikus. Man sieht ihn täglich in den Katerstuben. Ja, er hat sich sogar mit einer der Bardamen verlobt –«
»Richtig öffentlich verlobt?« hat Kathrin entsetzt eingeworfen, und Henriette hat gemeint, ihr müßte vor Schreck das Herz aussetzen. Ihre Augen wanderten hilfesuchend und tieferschrocken von Mama zu der Schwester. Doch keine nahm Notiz von ihr. Und das war gut so. Henriette ist noch kindhaft jung und hat gerade ihren ersten Hausball hinter sich, so daß man sie in keiner Weise mit Dr. Rainer Kauffmann in Verbindung bringt.
Henriette preßt die Hände im Schoß zusammen und lauscht der weiteren Unterhaltung.
»Jawohl, Kind«, hört sie die Mama empört sagen. »Mit Karten und allem, was dazugehört. Heute abend soll die Verlobungsfeier steigen.« Hier hat sich Mamas Mund verächtlich verzogen. »In den Katerstuben natürlich. Professor Kauffmann wird nicht sehr erbaut von seiner Schwiegertochter sein.«
Aber ich bin doch seine Braut, hetzen die Gedanken hinter Henriettes Stirn, mir hat er den Ring, den Kathrin als billig bezeichnete, beim Ball in Rosenhall an den Finger gesteckt. Sie stöhnt so tief auf, daß Magda Goedecke sich ihrer Jüngsten zudreht.
»Wie siehst du denn aus, Kind? Ist dir nicht wohl?« erkundigt sie sich besorgt.
»In der Tat, Mama – mir ist ganz übel. Darf ich mich zurückziehen?«
»Ja, Kind, leg dich sofort hin. Berte soll dir Tee aufbrühen. Kathrin und ich müssen jetzt fort. Beim Heimkommen schau ich noch bei dir herein!«
Wie gehetzt hat sie ihr Zimmer aufgesucht und sich weinend auf ihr Bett geworfen.
Rainer! So schlecht kann doch ein Mensch nicht sein. Er hat sich verlobt? Und ihr hat er den Ring angesteckt, damals zu dem Fest in Rosenhall, hat sie geküßt und seine »kleine bezaubernde Braut« genannt.
Henriette preßt beide Hände gegen den Mund. Nein! Nein! Das ist alles nicht wahr. Es kann nicht wahr sein. Er liebt sie, wie sie ihn.
An allen Gliedern wie zerschlagen, hat sie sich erhoben und das Fenster aufgerissen. Mama und Kathrin sind seit einer Stunde fort, um an einem Fest bei Larsens teilzunehmen.
Nun steht sie am Fenster und zerbricht sich den Kopf über das Gehörte.
Rainer, dem ihr Herz gehört, sieht sie vor sich, den Nachbarssohn, den Gefährten ihrer Kindheit, mit dem sie Hühnernester ausgenommen hat, wofür sie von Berte Vorwürfe bekam.
Rainer, der ihr zärtliche Liebesworte ins Ohr geflüstert hat auf dem ersten Ball, den man alljährlich in Rosenhall zur Rosenblüte zu veranstalten pflegt.
Und seine Küsse? Die Scham erstickt sie fast. Ein Glück, daß keiner weiß, was sie mit Rainer verbindet.
Aber wie bekommt sie Gewißheit? Heute ist Verlobungsfeier? Wenn sie nur wüßte, wo die Katerstuben sind!
Der Sturm fegt ins Zimmer und mit ihm der Regen. Sie spürt nicht die Nässe, die ihr dichtes kastanienbraunes Haar und ihre Wangen benetzt. Sie spürt nur den Sturm in ihrem Herzen, und der ist stärker als der in der Na-
tur.
Wie eines der schlanken Rosenbäumchen kommt sie sich vor. Hin und her gebeutelt. Und sie kann sich ebensowenig gegen diesen Ansprall von Gefühlen wehren, wie die zarten Rosensträucher, die der Wind nach allen Seiten beugt.
So versunken in ihrem Schmerz ist sie, daß sie Bertes Eintritt überhört. Erst deren Ausruf läßt sie herumfah-
ren.
»Schließ doch das Fenster, Heny! Es gibt ein schweres Gewitter.«
Sie ist ein kräftiger Mensch, aber sie hat ein Kindergemüt und ist die Treue in Person. Und sie liebt Henriette wie eine Mutter.
Wie angewurzelt steht Henriette am Fenster.
»Nun mach schon, Heny«, ermahnt Berte sie, und als diese sich nicht rührt, stapft sie durch das Zimmer. Kopfschüttelnd schließt sie es und blickt besorgt in Henriettes farbloses Gesicht.
»Was hast du, Heny? Du siehst zum Erbarmen aus. Tut dir was weh?«
Wortlos geht Henriette an den Tisch, wo Berte das Tablett abgestellt hat. Aus Augen, in denen die Tränen schwimmen, sieht sie auf die zierlich angerichteten Speisen hinab.
Fast lautlos gleitet Berte herbei und legt den Arm um die schmalen Schultern Henriettes. »So rede doch ein Wort, Kind. Du ängstigst mich. Hat dir jemand etwas zuleide getan? Sprich doch endlich.«
Henriette dreht sich zu Berte um. Ihr Gesicht ist jetzt nicht nur vom Regen naß, sondern auch von Tränen, die unter den dichten, dunkelglänzenden Wimpern hervorquellen.
Unheimlich ruhig fragt sie, während lautlos die Tränen laufen:
»Weißt du, wo die Katerstuben sind, Berte?«
Berte setzt sich vor Schreck nieder. Die Augen fallen ihr bald aus dem Kopf. »Die Katerstuben?« wiederholt sie, als habe sie sich verhört. »Sagtest du Katerstuben? Was hast du denn mit dieser Bar zu tun?«
»Weißt du, wo sie sind?« drängt Henriette ungeduldig.
»Die Katerstuben? Wart mal.« Sie überlegt und runzelt dabei die Stirn. »Ich glaube, am Wilhelmsplatz.« Sie blinzelt zu Henriette empor, die sich mit dem Handrücken die Tränen hinwegfegt. »Willst du in die Stadt? Etwa jetzt bei diesem Wetter?«
»Genau das, Berte«, erwidert Henriette in einem Ton, der keine Widerrede duldet. »Ich fahre in die Katerstuben. Besorge mir ein Taxi.«
Empört erhebt Berte sich. Mit der Hand fuchtelt sie vor Henriettes Gesicht herum. »Das kommt überhaupt nicht in Frage, mein Kind. Erstens hast du in den Katerstuben nichts zu suchen, du Küken, und zweitens habe ich auf dich aufzupassen, wenn deine Mutter nicht da ist. Also schlage dir diese Albernheiten aus dem Kopf.«
»Berte!« Leidenschaftlich, ungestüm, daß Berte fast aus dem Gleichgewicht gekommen wäre, wirft Henriette sich an deren Brust. »Du mußt mich gehen lassen, Berte, hörst du? Mein Leben hängt davon ab. Ich muß hin, jetzt, sofort! Wenn du mich daran hinderst, werde ich etwas ganz Schreckliches tun, etwas, was du dein Leben lang nicht vergißt.«
Berte hält den schmalen, bebenden Mädchenkörper fest umfangen.
»Ach, du liebe Güte«, jammert sie, ganz aus der Fassung gebracht durch diesen Schmerzensausbruch. Sie spürt aber auch Henriettes Entschlossenheit. Sie kennt deren wildes Temperament und fürchtet tatsächlich das Schlimmste.
»Warum willst du denn in die Stadt, Kind?« Sie nimmt das verweinte Gesichtchen mit den vor Schmerz verdunkelten Augen in ihre Hände. »Wenn du schon gehen mußt, dann gehe ich mit.«
»Nein!« Energisch löst Henriette sich aus Bertes Armen. »Diesen Weg muß ich allein gehen, Berte, das mußt du verstehen. Bitte, ruf ein Taxi herbei. Inzwischen zieh ich mich um.«
Sie verhält an der Tür zum Badezimmer den Schritt und fragt über ihre Schulter hinweg: »Was zieht man denn an, wenn man ein solches Lokal aufsucht?«
Ächzend erhebt Berte sich und wackelt hinüber zu dem breiten Schrank. Sie wühlt zwischen den Kleidern und brummelt dabei vor sich hin: »So ein Wahnsinn. Die gnädige Frau wird mir den Kopf abreißen, wenn ich das Kind weglasse. Was soll ich tun? Henriette hat ihren Dickkopf aufgesetzt, dagegen kommt keiner an.«
Ihre Hände zittern, als sie ein grünes Kleid auf den Sessel legt. Sie hört nebenan Wasser rauschen und wartet, bis Henriette wieder erscheint.
»Heny, bitte«, versucht sie noch einmal, das junge Mädchen umzustimmen. »Bleibe da – oder laß mich mitfahren. Ich bleibe im Wagen sitzen.«
Henriette hat die Tränenspuren beseitigt. Nur erschreckend blaß ist sie. Liebevoll streichelt sie über Bertes Wange. »Sei lieb, Berte. Ich kann dich bei dieser Fahrt wirklich nicht brauchen. Wenn es dich beruhigt, ich will mir nur eine Gewißheit holen, dann kehre ich sofort zurück.«
»Wirklich?« Berte umschlingt Henriette und drückt ihr einen Kuß auf die Stirn. »Ich warte bis zu deiner Rückkehr, Heny. Und keiner wird ein Sterbenswörtchen aus mir herausholen können.«
»Berte!« Im Überschwang und voll Dankbarkeit umarmt Henriette ihre Kinderfrau. In ihrer Stimme klingt verhaltener Jubel. »Ich wußte ja, daß ich mich auf dich verlassen kann.«
»Wenn ich bloß eine Ahnung hätte«, murmelte Berte, aber Henriette zieht sich bereits das Kleid, das sie besonders gut kleidet, über den Kopf.
Ihr ist erbärmlich zumute, als sie die einzige Taxe, die es im Ort gibt, anruft.
Sie geleitet Henriette, die sie noch in ein Regencape gehüllt hat, mit dem Schirm bis zum Wagen. »Das wird eine teure Fahrt bis in die Stadt, Heny. Hast du genügend Geld bei dir?«
»Ja! Ich hoffe, es reicht«, erwidert Henriette und steigt ein. Sie kennt den Mann, der das Taxiunternehmen besitzt.
»Zu den Katerstuben«, befiehlt sie und lehnt sich im Sitz zurück. Durch das seitliche Fenster sieht sie Berte mit traurigem Gesichtsausdruck zwischen Regen und Blitzen stehen.
Gewißheit! Gewißheit! Nichts anderes denkt sie, als der Wagen in diesem Gewitterregen der Stadt zurollt.
Nachdem sie den Fahrer entlohnt hat, hat Henriette aller Mut verlassen.
Das Gewitter ist vorbeigezogen. Aber immer noch regnet es in Strömen. Sie lehnt neben dem Eingang zur Bar an der Mauer. Der Eingang ist hell erleuchtet. Unter dem schützenden Dach steht der livrierte Portier, ein Kleiderschrank von einem Mann, vor dem Henriette Furcht empfindet. Immer, wenn ein Wagen vorfährt, geleitet er die Gäste mit seinem Schirm in die Bar.
Bisher sind nur Paare angefahren gekommen. Das läßt Henriette immer mutloser werden. Wie kann sie bloß an diesem Kleiderschrank vorbei und in das Haus gelangen?
Tausend Lichter spiegeln sich auf dem regennassen Asphalt. Musikfetzen dringen aus der Bar an ihr Ohr, sobald die Tür sich öffnet.
Henriette ist verzweifelt. Der Regen tropft an ihr herunter. Sie beginnt zu frösteln. Aber das kommt wohl mehr aus dem Herzen, weil alles öd und leer in ihr ist.
Wieder fährt ein Wagen vor. Er blitzt vor Chrom, und ihm entsteigt ein Mann. Henriette betrachtet ihn aus übergroßen Augen. Er trägt keine Kopfbedeckung. Sie sieht dunkles, schlicht zurückgekämmtes Haar, eine kluge Stirn und eine hohe Gestalt, gegen die sie sich wie ein Zwerg vorkommt.
Was sie veranlaßt, an ihn heranzutreten, weiß sie selbst nicht. Sie hört sich mit einer ihr fremden Stimme sagen:
»Bitte, würden Sie mich mit in die Bar nehmen?«
Er stockt und winkt dem Portier ab, der mit seinem Schirm neben ihm auftaucht. Neugierig betrachtet er Henriette.
»Sie wollen in die Bar?« fragt er. Seine Stimme gefällt ihr. Sie erinnert sie etwas an die Stimme ihres Vaters, was ihr sofort Vertrauen einflößt. »Sie gehören ins Bett, kleines Mädchen.« Das klingt verweisend und belustigt zugleich.
Henriette umklammert verzweifelt seinen Arm.
»Bitte, nehmen Sie mich mit«, fleht sie, und jetzt rollen ihr die Tränen wieder über die Wangen. »Ich muß hinein. Bitte, fragen Sie nicht, aber nehmen Sie mich mit.« Und kleinlaut setzt sie hinzu: »Allein wage ich es nicht.«
»Kommen Sie«, sagt er nach ganz kurzem Zögern, und sie weiß nicht, ob er ihr böse ist und sie für aufdringlich hält.
»Ich werde Ihnen keine Ungelegenheiten bereiten«, flüstert sie, während er sie vor sich her durch die Drehtür schiebt. Er antwortet nicht. Im Vorraum an der Garderobe zieht er seinen leichten Mantel aus und wendet sich zu ihr um.
»Mit diesem nassen Überzeug können Sie nicht in die Bar«, sagt er schroff, und ohne zu fragen, schält er sie aus der unkleidsamen Hülle. Das braune Haar, wirr und lockig in die Stirn fallend, trägt rote Tupfen, hervorgezaubert durch die Wandbeleuchtung. Ein schmales, süßes Kindergesicht mit übergroßen braunen Augen sieht verstört zu ihm auf.
»Kommen Sie«, sagt er abermals und nimmt ihren Arm. So betritt sie die Bar, in der Rainer seine Verlobung feiern soll.
Ihre Augen wandern umher. Musik, gedämpft und einschmeichelnd, dringt auf sie ein. Stimmengewirr, perlendes Frauenlachen. Auf der Tanzfläche drehen sich einige Paare. Die Damen im Abendkleid, die Herren im Frack.
Henriettes Fuß stockt. Da sitzt Rainer, an einem Tisch an der Tanzfläche, inmitten einer kleinen Gesellschaft, und neben ihm eine schöne blondhaarige Frau, um deren Schultern er besitzergreifend den Arm gelegt hat.
Sie taumelt und wäre gefallen, wenn nicht eine kraftvolle Hand sie festgehalten hätte.
»Verzeihen Sie«, stammelt sie zu dem Fremden auf. »Mir – mir war plötzlich so schwindlig.«
Mißtrauisch blickt er sie an, bemerkt ihre schneeige Blässe und führt sie zu einem freien Tisch, unweit der lustigen Gesellschaft, die scheinbar Rainer Kauffmanns Gast ist.
»Was wollen Sie trinken?« erkundigt er sich, und abermals läuft ein abtastender Blick über sie dahin. Er weiß wirklich nicht, was er von dem seltsamen jungen Mädchen halten soll. Jung ist sie. Das hat er auf den ersten Blick festgestellt. Ihr Kleid ist äußerst geschmackvoll und das Material kostbar.
Was hat dieses Kind hier zu suchen? Hier verkehrt die Creme der Gesellschaft. Töchter und Söhne reicher Eltern, die sich gern einmal die Nase begießen und sich im Tanz austoben.
Da sie keinen Wunsch äußert, sondern immer nur starr in eine Richtung blickt, bestellt er, was ihm für sie gut dünkt, und folgt dann ihren Blicken. Er sieht einen großen Tisch mit einer ausgelassenen Gesellschaft. Ein junger blonder Mann führt das Wort, und die anderen trinken ihm und seiner Begleiterin fröhlich zu.
»Wollen Sie nicht trinken?« ermahnt er Henriette.
Sie schrickt zusammen. Also ist doch alles wahr. Rainer hat sie vergessen! Drüben sitzt er mit einer schönen Frau, hält sie zärtlich an sich gepreßt, wie einstmals sie. Ekel steigt in ihr auf. Nur jetzt nicht mehr weinen! Sie beißt die Zähne zusammen und sieht verstört auf ihren Begleiter. Unter dichten Brauen sehen sie ein Paar helle Augen durchdringend an. Kühle, prüfende Augen, vor denen sie sich auf keinen Fall eine Blöße geben möchte.
»Ja, natürlich«, stottert sie, hebt das Glas und läßt es im nächsten Augenblick auf den Tisch fallen. Sein Inhalt ergießt sich auf das blütenweiße Tuch, der Rest fließt auf ihr Kleid, und das Glas ist zerbrochen.
In tödlicher Verlegenheit springt sie auf. Jetzt kann sie die Tränen, die ihr schon locker im Halse saßen, nicht länger zurückhalten. »Verzeihen Sie vielmals«, schluchzt sie. »Nun bereite ich Ihnen wirklich Unannehmlichkeiten. Ich komme selbstverständlich für den Schaden auf.«
An Dr. Rainer Kauffmanns Tisch ist man aufmerksam geworden. Er blickt herüber, erkennt Henriette und erblaßt. Ehe ihn die blonde Frau zurückhalten kann, ist er an Henriettes Tisch gelaufen, den der Ober bereits wieder in Ordnung bringt.
»Henriette – du?« stößt er entsetzt hervor. »Was hast du hier zu suchen?«
Sie sieht ihn an. Wie durch einen Nebelschleier erkennt sie das sonst so übermütig lachende Gesicht, das jetzt böse und sehr fremd aussieht.
»Was ich hier suche?« Sie streckt die schmale Gestalt. Sie wächst in diesem Augenblick, da es ihr das Herz vor Schmerz zusammenpreßt, über sich hinaus. Aus großen Augen, an deren Wimpern noch die Tränen glitzern, sieht sie ihn verächtlich an. »Ich wollte mir nur einmal deine Braut ansehen. Gratuliere, Rainer, wirklich, so guten Geschmack hätte ich dir nicht zugetraut.« Sie zieht und zerrt an ihrem Finger, daß es schmerzt. Sie wirft ihm den Ring vor die Füße. »Da hast du ihn zurück. Deine Braut wird allerdings mit solchem Tand nicht zufrieden sein.«
Sie rafft ihre kleine Tasche vorn Tisch und läuft über den breiten Gang zum Ausgang. Der Fremde blickt amüsiert in das blasse, zuckende Gesicht des jungen Mannes. Als ein Mann mit Erfahrung hat er sofort erkannt, was sich vor seinen Augen abspielte.
Er wirft einen Geldschein auf den Tisch und eilt hinter der fliehenden Mädchengestalt her.
*
Henriette zieht ihr Regencape fester um sich. Wind peitscht ihr den Regen ins Gesicht. Sie spürt es kaum. Sie läuft und läuft ohne Ziel. Wie auf der Flucht vor sich selbst stürzt sie vorwärts.
Und dann schält sich aus dem wilden Durcheinander doch ein einziger Gedanke klar heraus. Alles Lüge! Alles Betrug! Und diesen Mann, den Mama einen Luftikus genannt hat, liebte und verehrte sie wie einen Halbgott. Sie hat ihn in ihrer Phantasie auf einen Thron erhoben, und nun ist er herabgestürzt, und nichts als Scherben sind ihr geblieben.
»Hallo! Hallo!«
Schreckhaft fährt sie zusammen. Neben ihr gleitet langsam ein chromblitzender Wagen. Ein ernstes Männergesicht erkennt sie und ein Paar helle Augen.
Vor diesen Augen läuft sie davon. Sie schämt sich unsagbar. Sie möchte am liebsten sterben.
Der Fremde bringt den Wagen zum Stehen. Schwingt sich stürmisch aus dem Innern und rennt dann hinter Henriette her.
»So warten Sie doch.« Keuchend erreicht er sie und packt sie am Arm. »Wohin wollen Sie in dem Regen laufen? Haben Sie mir die Szene in den Katerstuben zugemutet, müssen Sie jetzt auch mit mir fahren.«
Ihre Augen weiten sich vor Angst und Schrecken. »Nein! Nein!«
»Ich will Sie ja nur sicher heimbringen, kleines Mädchen. Nachts durch die Straßen zu laufen, ist nicht ungefährlich. Ich bin kein Räuber. Also, kommen Sie. Wir werden beide naß bis auf die Haut, das heißt, ich komme mir schon wie eine gebadete Maus vor.«
Henriettes Glieder versagen ihr den Dienst. »Verzeihung«, murmelt sie und läßt sich beinahe zum Wagen tragen. Sie spürt, wie es ihr warm aus dem Innern entgegenschlägt, spürt das weiche Polster und legt den Kopf zurück. Langsam rollt der Wagen an. Der Mann lenkt ihn durch die Innenstadt. Er fragt nicht, wohin, und sie sagt kein Wort. Sie ist wie ausgepumpt. Sie möchte weinen, weinen!
»Kleines Mädchen«, sagt er nach einer ganzen Weile mit sehr viel Wärme in der Stimme, »Sie haben sich tapfer gehalten.«
Ihr Kopf ruckt herum. »Bitte sprechen Sie nicht davon, bitte!«
»Das liegt auch nicht in meiner Absicht«, fährt er gelassen fort. »Aber ich darf Ihnen doch sagen, daß Sie mir imponiert haben. Schade, die wertlosesten Männer werden von den besten Frauen geliebt.«
»Nun sprechen Sie doch darüber.« Jetzt funkelt sie ihn an. Er lacht leise, unterdrückt auf.
»Ich habe nur laut gedacht. Verzeihen Sie.«
Weiter geht die Fahrt durch Wind und Regen. Schweigen herrscht zwischen den beiden Menschen. Allmählich gewinnt Henriette ihr Gleichgewicht zurück, wenngleich der Schmerz wie ein Krampf in der Brust sitzt.
»Hören Sie mal, kleines Mädchen«, läßt er sich endlich erneut vernehmen. »Wollen wir die ganze Nacht durch die Stadt kreuzen? Vielleicht nennen Sie mir Ihre Wohnung, und ich setze Sie dort ab?«
»Das geht nicht«, erwidert sie leise, stockend. »Ich wohne eine Stunde Wagenfahrt von hier entfernt. Das kann ich Ihnen auf keinen Fall zumuten. Ich nehme mir ein Taxi.«
»Das haben Sie schon gefunden.« Seine Stimme ist beherrscht und duldet keinen Widerspruch. »Ich werde Sie fahren. Also, kleines Mädchen, wohin soll ich Sie bringen?«
Seufzend nennt Henriette ihren augenblicklichen Wohnort. »Ich sehe schon, Sie lassen sich nicht abschütteln«, sprudelt sie widerwillig hervor. »Sie dürfen mich aber nicht vor dem Haus absetzen. Ich bin nämlich –«
»– durchgebrannt!« vollendet er ruhig.
»So ähnlich«, gibt sie leise zu und preßt die Lippen zusammen. Lichtreklamen tauchen das Innere des Wagens in sekundenlanges Zwielicht. Sie sieht von der Seite her ein scharfgeschnittenes Profil. Merkwürdig! Vor diesem Mann empfindet sie keine Furcht, nur Scham, daß er sie in so großer Fassungslosigkeit gesehen hat.
Sie ist müde. Aber die Ereignisse reißen sie immer wieder aus einem Halbschlaf. Sie hört Rainers betörende Stimme:
»Nun bist du meine kleine bezaubernde Henriette!«
Sie sieht sich in ihrem ersten Ballkleid aus weißem Organza mit den perlenbestickten Trägern in seinem Arm über die Tanzfläche gleiten. Vorbei! Alles vorbei! Eine andere liegt jetzt in seinen Armen. Sie küßt er, und Henriette, die an ihn glaubte, hat er vergessen.
Unaufhörlich rinnen die Tränen über ihre Wangen. Ihr Kopf gleitet zur Seite. Sie weint ihren ganzen Schmerz in den Mantel des fremden Mannes, der sich ihrer hilfreich angenommen hat.
Sie weint und weint, weint sich bald die Seele aus dem Leibe, bis die sonore Stimme neben ihr sagt:
»Jetzt haben Sie mir den ganzen Mantel vollgeweint, kleines Mädchen. Gibt es überhaupt einen so großen Schmerz? Und ist er diese bitteren Tränen wert?«
Sie rückt zurück auf ihren Platz und wischt sich mit dem Handrücken über Augen und Wangen. Ohne den Blick von der Fahrbahn zu wenden, greift er in seine Rocktasche und reicht ihr sein Taschentuch.
»Da«, sagt er nur.
Widerstrebend nimmt sie es. »Sie halten mich sicherlich für eine Heulsuse.« Seitwärts sieht sie, wie sich das Lächeln um seinen ausdrucksvollen Mund vertieft. Irgendwie macht es sie wütend. »Ich weine für gewöhnlich nicht so leicht«, setzt sie erklärend hinzu.
»Für gewöhnlich, sagten Sie? Heute scheint mir kein gewöhnlicher Tag in Ihrem Leben.«
Sie zerrt an seinem Taschentuch und zerknüllt es dann zu einem Ball. Nach einem kurzen Seitenblick bemerkt er:
»Das arme Taschentuch.«
»Ich werde es waschen und bügeln«, trotzt sie, und er erwidert darauf gönnerhaft, was ihr das Blut in die Wangen treibt:
»Ich schenke es Ihnen. Da Sie nicht wissen wollen, wer ich bin und Sie mir Ihren Namen nicht genannt haben, würden Sie es mir schwerlich zukommen lassen können. Doch – das stimmt nicht ganz. Sie heißen Henriette.«
»Ein schrecklicher Name«, stößt sie ehrlich aufgebracht hervor. »Nur weil einmal eine Urahne von mir so geheißen hat, muß ich ihn mein Leben lang tragen.«
Er atmet im stillen auf. Hat er sie doch durch das kleine Wortgeplänkel von ihrem Schmerz abzulenken verstanden.
»Ich finde ihn schön«, meint er belustigt. »Außerdem paßt er irgendwie zu Ihnen.«
»Sie – Sie haben mich doch noch nicht einmal richtig angesehen«, platzt sie voreilig heraus.
»Denken Sie! Schade, daß ich kein Maler bin, ich würde Ihnen ein Bild von Ihnen hinlegen – wirklich, sehr schade.«
Beleidigt zieht Henriette sich in den äußersten Winkel ihres Platzes zurück. »Sie machen sich lustig über mich.«
»Durchaus nicht, kleines Mädchen.« Jetzt ist sein Ton ernst und überzeugend. »Eine Frau wie Sie ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Sie sind eine merkwürdige Mischung zwischen Kind und Frau, äußerst temperamentvoll und sehr stolz. Genau eine solche Frau habe ich mir immer gewünscht.«
»Fehlt nur noch, daß Sie mir einen Heiratsantrag machen.«
»Nein, durchaus nicht. Ich möchte mir nicht den letzten Rest Ihrer Sympathie verscherzen. Sie sind mir doch böse, daß ich so einfach über Sie bestimme, ja?«
»Ich bin Ihnen nicht böse«, gibt sie leise zurück und bearbeitet wieder sein Taschentuch, bis es ihr bewußt wird und sie es rasch in ihre Tasche steckt.
»Danke, das freut mich. Und wo soll ich Sie absetzen?«
Henriette blickt aufmerksam durch das Seitenfenster. So schnell ist ihr die Fahrt vergangen in Gesellschaft des interessanten Mannes. »Biegen Sie rechts ein und halten Sie an der nächsten Ecke, dann finde ich schnell nach Hause.«
»Wie Sie wünschen«, das klingt wieder völlig unbeteiligt, und sie wird nicht recht klug aus ihm. Einmal ist seine Stimme voll Wärme, dann wieder kühl und herrisch.
Er läßt den Wagen an der Ecke ausrollen, faßt über sie hinweg und öffnet die Tür.
»Bitte, kleines Mädchen«, sagt er und macht eine freundliche Geste. »Wir sind am Ziel. Ich hätte Sie gern wiedergesehen.« Er seufzt. »Ich fürchte, daß Sie nach dem Erlebnis dieses Abends kein Verlangen danach haben. Hoffentlich behalten Sie mich dennoch in angenehmer Erinnerung.«
Henriette steigt aus. Zaghaft reicht sie ihm die Hand.
»Ich danke Ihnen.« Ihre Augen gleiten noch einmal prüfend über ihn dahin. »Sie haben recht. Der Gedanke an Sie wird immer mit unangenehmen Erinnerungen für mich verbunden sein. Gute Nacht!«
Er lauscht lange auf die sich eilends entfernenden Schritte. Er sieht die schmale dunkle Silhouette verschwinden. Dann ist nur noch Nacht um ihn und der gleichmäßig auf das Dach des Wagens trommelnde Regen.
»Gott sei Dank!« Berte schnellt aus dem Sessel, in dem sie auf Henriette gewartet hat. »Wie habe ich mich um dich gesorgt.« Sie schießt auf Henriette zu. »Deine Mutter und Kathrin sind noch nicht zurück. Meine Güte, Heny, wie siehst du aus? Warum hast du dein Cape nicht übergezogen?«
Achtlos läßt Henriette das Cape zur Erde fallen und wirft sich in Bertes geöffnete Arme. Henriette ist dem Umfallen nahe, und kurz entschlossen nimmt Berte das mit den Zähnen klappernde, bebende Nervenbündel auf ihre starken Arme und trägt Henriette dann in ihr Zimmer. Dort zieht sie sie aus und hüllt sie in das lange Nachtgewand.
Ehe Henriette es sich versieht, liegt sie in ihrem Bett, und Berte schlurft hinaus, um wenig später mit Wärmeflaschen und einer Tasse dampfendem Tee zurückzukehren.
»Wirst du auch nichts Mama verraten?« läßt Henriette sich in einer Atempause vernehmen, da Berte ihr den Tee förmlich eintrichtert. »Bitte, schwöre es.«