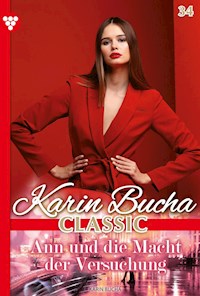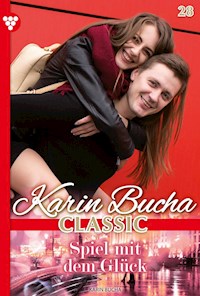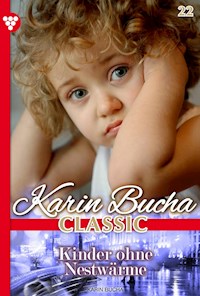Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Buntfarbige Fahnen und Wimpel wehen lustig im Winde. An eigens für das Betriebsfest errichteten Masten winden sich Girlanden hinauf und verleihen dem weiten Fabrikhof ein buntes, fröhliches Aussehen. Alle, die zur Gefolgschaft der Imhoff-Weberei gehören, sind auf den Beinen, denn heute gilt es, die stattlichen Bauten einzuweihen, die sich nach einem verheerenden Brand an Stelle der Trümmer stolz erheben. Meister Henschel, ein graubärtiger, rüstiger Fünfziger, führt seine kleine Schar vor die Freitreppe, die zu dem Verwaltungsgebäude emporführt. Sie nehmen Aufstellung zum Empfang des Fabrikherrn. Dann läuft alles programmgemäß ab. Bernds Wagen fährt vor. An seiner Seite sitzen Bob Rodisch und dessen Vater Christoph, seine beiden ungleichen Freunde, die sich in der letzten schweren Zeit so treu bewährt haben. Das Gesicht des Fabrikherrn Bernd Imhoff wirkt wie eine Maske. Seine Augen, düster und traurig, schweifen über das prächtige, farbenfreudige Bild. Er sieht frohe, erwartungsvolle Gesichter. Ein erhebendes Gefühl schwellt seine Brust. Wie sie ihn freut, die Anhänglichkeit seiner Mitarbeiter! Die hohe Gestalt gestrafft, steigt er die Stufen hinan. Aus den Reihen der kaufmännischen und technischen Angestellten löst sich eine Gestalt, blaß das Gesicht, etwas vornübergeneigt, in den Augen jedoch strahlende Lebensfreude – der alte Prokurist Lehrmann. Er hält eine feierliche Ansprache. Bernds Augen glänzen feucht. Er hat immer noch die Hand Lehrmanns in der seinen und merkt es nicht einmal. Kummer und Sorgen um ein gemeinsames Ziel haben die beiden Männer eng miteinander verbunden. Zum Abschluß der offiziellen Feier spricht Bernd zu seinen Arbeitern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 35 –Ein Frauenschicksal erfüllt sich
Karin Bucha
Buntfarbige Fahnen und Wimpel wehen lustig im Winde. An eigens für das Betriebsfest errichteten Masten winden sich Girlanden hinauf und verleihen dem weiten Fabrikhof ein buntes, fröhliches Aussehen.
Alle, die zur Gefolgschaft der Imhoff-Weberei gehören, sind auf den Beinen, denn heute gilt es, die stattlichen Bauten einzuweihen, die sich nach einem verheerenden Brand an Stelle der Trümmer stolz erheben.
Meister Henschel, ein graubärtiger, rüstiger Fünfziger, führt seine kleine Schar vor die Freitreppe, die zu dem Verwaltungsgebäude emporführt. Sie nehmen Aufstellung zum Empfang des Fabrikherrn.
Dann läuft alles programmgemäß ab. Bernds Wagen fährt vor. An seiner Seite sitzen Bob Rodisch und dessen Vater Christoph, seine beiden ungleichen Freunde, die sich in der letzten schweren Zeit so treu bewährt haben.
Das Gesicht des Fabrikherrn Bernd Imhoff wirkt wie eine Maske. Seine Augen, düster und traurig, schweifen über das prächtige, farbenfreudige Bild. Er sieht frohe, erwartungsvolle Gesichter. Ein erhebendes Gefühl schwellt seine Brust. Wie sie ihn freut, die Anhänglichkeit seiner Mitarbeiter! Die hohe Gestalt gestrafft, steigt er die Stufen hinan.
Aus den Reihen der kaufmännischen und technischen Angestellten löst sich eine Gestalt, blaß das Gesicht, etwas vornübergeneigt, in den Augen jedoch strahlende Lebensfreude – der alte Prokurist Lehrmann. Er hält eine feierliche Ansprache.
Bernds Augen glänzen feucht. Er hat immer noch die Hand Lehrmanns in der seinen und merkt es nicht einmal. Kummer und Sorgen um ein gemeinsames Ziel haben die beiden Männer eng miteinander verbunden.
Zum Abschluß der offiziellen Feier spricht Bernd zu seinen Arbeitern. Er schließt tiefbewegt seine Rede, die nachhaltig wirkt: »… Euer Vertrauen gab mir den Mut, das Werk nach dem Brande wieder aufzurichten, das wir hier, schöner als wir es uns träumen ließen, vollendet vor uns sehen. Für einen einzelnen wäre es unmöglich gewesen. Doch mit dem Bewußtsein, treue, arbeitswillige Mitarbeiter hinter mir zu haben, wurde es mir leicht gemacht. Und dann möchte ich meine Freunde nicht vergessen, die mir wertvolle, tatkräftige Hilfe geleistet haben.«
Er läßt eine kurze Pause eintreten.
Langanhaltendes Händeklatschen und begeisterte Hochrufe erfüllen minutenlang die Luft.
Hochaufgerichtet steht Bernd auf der Freitreppe. Seine letzten Worte klingen in ihm nach: »Seid fröhlich mit den Fröhlichen.«
Ach, wenn er es doch auch sein könnte. Wie Hohn kommt ihm der Ansporn für die anderen für sich selbst vor.
Da legt sich ihm eine Hand auf die Schulter, und Bobs Stimme spricht warm und eindringlich: »Sei auch du einmal fröhlich, Bernd. Vergiß wenigstens für einige Stunden das Leid um deine kranke Frau.«
»Ich will es versuchen«, kommt es leise über seine Lippen.
Als er seine Leute in ungehemmter Lebenslust beim Tanz gut aufgehoben weiß, verläßt er den Saal. Bob begleitet ihn. Sie fahren in Bernds Wohnung, wo seine Mutter in nimmermüde Liebe und Geduld wirkt. Bei einem Glase Wein sitzen sie sich gegenüber. Auch seine Mutter hat sich zu ihnen gesellt. Der Kinder wegen ist sie dem heutigen Festtrubel ferngeblieben.
»Ich erlebe im Geiste alles mit«, hat sie Bernd zum Abschied erwidert, als er nochmals in sie drang, ihn zu begleiten. Vermessen wäre es ihr vorgekommen, Marias Platz einzunehmen, den sie doch nie ganz ausfüllen kann.
Jetzt darf Bernd die Maske fallen lassen, braucht keinem mehr eine Fröhlichkeit vorzutäuschen, von der sein Herz nichts weiß.
Bobs Blicke folgen denen des Freundes. Diese gleiten suchend umher, bleiben an den durch die Erinnerung geheiligten Gegenständen haften, die Maria einst in ihren Händen gehalten hatte.
Bob gibt sich einen Ruck. Einmal muß es gesagt werden, jetzt hält er den Zeitpunkt für gekommen. »Bernd, du richtest dich zugrunde, wenn du dich derartig von der Vergangenheit beherrschen läßt«, beginnt er vorsichtig.
»Habe ich euch Grund zur Unzufriedenheit gegeben? Belästige ich euch etwa mit dem, was mich beschäftigt?« fragt Bernd beinahe gereizt. »Wenn ich die Erinnerung an Maria hege und pflege, dann falle ich damit doch niemandem zur Last.«
»Aber du leidest schwer darunter. Was bist du heute gegen früher? Ein Schatten!« Ein teilnehmender Blick streift sein Antlitz. »Von mir, deinem Freunde, darfst du dir das schon sagen lassen.«
»Ist das etwa ein Wunder?« fragt Bernd gequält.
»Nein, ich verstehe dich«, erwidert Bob warm. »Deshalb möchte ich dir einen Vorschlag machen. Du wirst vielleicht sehr erstaunt sein; wenn du dich jetzt erst mit dem Gedanken vertraut gemacht hast, wirst du einsehen, daß er gut ist für dich, für deine Mutter und auch für deine Kinder.«
»Da bin ich wirklich neugierig.« Bernd lächelte nachsichtig.
Bob lehnt sich zurück und macht mit der Hand einen Kreis in die Luft. »Du mußt aus der Wohnung hier heraus, wo dich jeder Gegenstand an Maria erinnert.«
Wie Bob vorausgesehen hat, fährt Bernd sogleich auf. »Ich soll die Wohnung aufgeben? Das einzige, was mich noch mit Maria verbindet? Von hier, wo ich glaube, ihre zarte Gestalt umhergehen, ihre feinen Hände walten zu sehen, von hier soll ich fort «
»Ja!«
»Ausgeschlossen!« Als wollte Bernd vor diesem Gedanken fliehen, steht er auf und beginnt eine ruhelose Wanderung durch die Zimmer.
Frau Hanna sinnt mit großen Augen vor sich hin. Bob bestürmt weder Mutter noch Sohn; aber ein wissendes, überlegenes Lächeln steht um seinen Mund. Was sich jetzt noch in Bernd gegen seinen Vorschlag wie gegen das Ungeheuerliche aufbäumt, wird bei ruhiger Überlegung verebben.
»Ich habe da draußen im Grünen ein nickt allzu großes, aber reizendes Landhaus entdeckt. Die Besitzerin lebt in der Schweiz. Sie will das Anwesen verkaufen. Ein Garten, wie ein kleines Paradies anzuschauen, gehört dazu.«
Bernd drängt das harte Wort der Ablehnung, das ihm auf die Lippen kommen will, zurück. Und er wird sich plötzlich bewußt, daß er an die Kinder noch gar nicht gedacht hat, sondern nur an sich selbst.
Bittend hebt Frau Hanna den Blick zu ihrem Sohne auf, der nun nähertritt.
Da steht Bernd auch schon neben ihr und nimmt ihre Hand. »Vermißt du deine Berge, Mutter? War ich zu egoistisch, als ich dich bat, zu mir zu kommen?«
Heftig abwehrend schüttelt sie den Kopf. »So war es nicht gemeint, mein Junge. Muß ich dir erst beteuern, wie gern ich deinem Rufe gefolgt bin?« Sie lächelt fein. »Ich sehe nur nicht ein, warum man nicht auch hier der Natur nahe sein kann. Daß ich mich etwas beengt fühle, ist schon richtig. Und wie würden die Kinder aufblühen in freierer Umgebung. Nicht wahr, Bernd, du wirst nicht unter allen Umständen ablehnen, sondern in Ruhe alles überdenken?«
Bernd preßt die Lippen zusammen. Keiner denkt an sich, alle nur immer an ihn! Nun gleitet sein Blick umher, über jeden Gegenstand. Ein kurzer, harter Kampf, dann wendet er sich an den still beobachtenden Bob: »Ihr habt mich überrumpelt.«
*
An einem der nächsten Tage schließt Bernd den Vertrag mit dem Bevollmächtigten der Besitzerin des wirklich schön gelegenen Landhauses ab.
Einige Stunden später, als er den unterschriebenen Vertrag in der Tasche hat, sitzt Bernd in seinem Wagen und fährt einem anderen schönen Fleckchen Erde zu – Dörflingen.
Stunde um Stunde sitzt er am Steuer, ohne müde zu werden. Nur eine kurze Rast legt er ein, um eine Stärkung zu sich zu nehmen. Am Spätnachmittag hält er vor einer hohen, weinumrankten Mauer, hinter der er seine Maria weiß.
Unverzüglich wird er zu Professor Holzer geführt.
Die beiden Männer schütteln sich die Hände wie alte Bekannte, mehr noch, wie Kameraden, denn sie haben beide gemeinsam nächtelang um ein Leben gebangt.
»Wie geht es meiner Frau? Kann ich sie sehen?« fragt Bernd, kaum mehr imstande, seine Ungeduld zu zügeln. »Ist ihr Zustand immer noch der gleiche?«
»Unverändert«, erwidert Professor Holzer und betrachtet dabei aufmerksam das schmale Männergesicht, das jetzt zwar vor Erregung fieberhaft gerötet ist, dem aber die einstige Straffheit fehlt. Armer Kerl! geht es ihm durch den Sinn. Er hat sich in seiner langjährigen Praxis, die ihn viel Elend, Tränen und Verzweiflung sehen ließ, ein mitfühlendes Herz bewahrt.
»Unverändert«, wiederholt er nochmals und setzt dem erklärend hinzu: »Wir haben selten eine Kranke von solcher Fügsamkeit im Hause gehabt wie sie. Schwester Johanna, die sie täglich betreut, hat sie sehr lieb gewonnen. Sie geht mit einem, man könnte sagen, Kinderlächeln umher. Glauben Sie mir eines, Ihre Frau ist glücklicher als Sie.«
Bernd preßt die Hände an die Schläfe. Das ist wirklich das einzige Gute bei all seinem Herzeleid. »Bitte führen Sie mich zu meiner Frau«, drängt er und erhebt sich.
Bernds Fuß stockt, als der Professor eine der weißen Türen weit vor ihm öffnet. Zitternde Erregung hat sich seiner bemächtigt. Er hat das Gefühl, als wollten die Glieder ihm den Dienst versagen.
Lautlos zieht der Professor die Tür hinter Bernd ins Schloß, nachdem er Schwester Johanna einen Wink gegeben hat, ihm zu folgen.
Bernd ist mit Maria allein. Er befindet sich in einem lustigen, von der Sommersonne erhellten Raum. In einem Blumenerker steht eine schmale Gestalt, den dunklen Kopf über blühende Topfgewächse geneigt. In den schmalen Händen hält sie eine Blumenspritze.
Bernd vermag kaum zu atmen. Unsagbar lieblich ist ihr Anblick. Er spürt sein Herz bis zum Halse klopfen. »Maria!« ruft er.
Der dunkle Kopf wendet sich gehorsam. Die großen schönen Augen blicken ihn verständnislos an. Sie lächelt und winkt ihn vertraulich zu sich. Ihre Stimme klingt zart und hell. »Willst du meine Blumen sehen?« fragt sie im Ton eines Kindes.
Bernd schießt es heiß in die Augen. Sie hat ihn nicht erkannt! Und doch ist er beglückt, denn sie spricht mit ihm. Zaghaft nähert er sich ihr, steht neben ihr und wagt es nicht, den Arm um sie zu legen.
»Siehst du hier die schöne rote Blume?« plaudert sie weiter. »Schwester Johanna hat sie mir geschenkt. Ich muß sie täglich begießen, meinte sie, damit sie mir nicht eingeht. Nun freue ich mich, daß sie so schön gewachsen ist.«
Bernd bringt kein Wort über die Lippen. Ihm ist, als halte eine eiserne Faust seine Kehle umspannt.
»Weißt du, wenn ich ihr genug Wasser gegeben habe und sie noch etwas größer geworden ist, darf ich sie Monika schenken. Kennst du Monika, meine kleine süße Monika?« fragte sie sprunghaft und richtet fragend den Blick auf ihn. Bernd schüttelt den Kopf, ohne sich bewußt zu werden, was er tut. Er lauscht dieser zärtlichen Stimme, die unsagbar an sein Herz rührt.
»Du kennst sie nicht?« fragt Maria erstaunt. Plötzlich legt sie die Blumenspritze aus der Hand und preßt ihre Hand auf seinen Arm. »Komm mit«, flüstert sie.
Sie führt ihn in die Ecke. Wie im Traum folgt Bernd ihr, alles kommt ihm so unwahrscheinlich, so ganz der Wirklichkeit entrückt vor.
Ein Kinderbett, nein, ein Puppenbett ist es, das sie Bernd zeigt. Marias schönes schmales Gesicht ist von rosiger Glut überhaucht, als sie sich niederbeugt und mit aller Zartheit eine Puppe aus den Kissen hebt. »Meine Monika!« sagt sie zärtlich und stolz zugleich.
Bernd hat kaum noch die Kraft, sich auf den Füßen zu halten. Er sinkt auf einen Stuhl und verbirgt den Kopf in den Händen. Er spürt nicht, wie es heiß über seine Wangen rinnt. Er weint!
Unbekümmert um die Gegenwart Bernds liebkost Maria das Puppenkind. Ja, sie hat die Anwesenheit des Mannes vergessen, der ihr ein Fremder ist. Sie führt Selbstgespräche mit ihrem eingebildeten Kinde – Bernd sitzt dabei. Jedes Wort trinkt er in sich hinein, und das Herz wird ihm schwerer und schwerer, jede Minute zur Qual.
Die Zeit schreitet voran. Bernd fährt auf, als die Schwester auftaucht.
»Herr Professor wartet draußen«, sagt sie leise zu ihm.
Bernd sieht mit einem verstörten Blick zu ihr auf, ist aufgewühlt bis ins Innerste seiner Seele. Er nickt, erhebt sich und tritt zu der schlanken Frauengestalt. »Maria, ich muß gehen.« Er zieht sie sanft von dem Bettchen fort in seine Arme.
»Kommst du wieder?« fragt sie, anscheinend mit wachsendem Interesse an seiner Person.
»Ja, ich komme wieder, Maria, bald komme ich wieder! Und –«
Mit innerem Widerstreben setzt er hinzu: »Ich bringe deiner Monika eine schöne rote Blume mit, darf ich das?«
Ihre Augen glänzen. Dann legt sie ihr Gesicht schmeichelnd in seine Hand. »Du bist gut – Schwester Johanna auch.«
»Auf Wiedersehen, Maria!« Er küßt sie auf Mund und Augen und reißt sich los.
Draußen lehnt er sich sekundenlang an die Tür, tief und gepreßt atmend. Viele solcher Besuche darf er sich nicht erlauben, sie zehren seine Kräfte auf.
Während er durch die Nacht fährt, ruft er sich Wort für Wort der Unterhaltung mit dem Professor ins Gedächtnis zurück. Wie mit Flammenschrift steht über der ganzen Unterhaltung das eine Wort: Unheilbar!
*
Mit tiefer Sorge bemerkt Frau Hanna den inneren Verfall ihres Sohnes. Seine Haltung ist nicht mehr so straff wie einst; er beginnt, sich in seiner Kleidung zu vernachlässigen; und wenn Frau Hanna nicht wäre, stünde es noch weit schlimmer um ihn.
In ihrer Ratlosigkeit setzt Frau Hanna sich mit Christoph Rodisch in Verbindung. Der alte Herr und Bob wären freilich auch ohne ihre Aufforderung gekommen, denn mit Schrecken haben sie die Veränderung in Bernds Wesen wahrgenommen. Sie warten tatsächlich nur auf den Augenblick, der ihnen als günstig erscheint, um ihn wachzurütteln.
Vater und Sohn betreten Bernds Büro, als dieser gerade im Begriff ist, das Werk zu verlassen.
»Na, da sind wir ja gerade zur rechten Zeit gekommen«, beginnt der alte Rodisch. »Wir fuhren zufällig vorbei, Bernd, und wollten Ihnen nur mal die Hand drücken.«
»Machst dich recht selten bei uns, alter Junge«, schließt sich Bob den Worten seines Vaters an und langt in die von Bernd gereichte Zigarrenkiste.
»Keine Zeit«, sagt Bernd kurz und abwehrend.
»Das hört sich gut an«, lacht Rodisch, »Zeit ist Geld, also müssen Sie gutes Geld verdienen.«
»Danke, bin zufrieden«, erwidert Bernd und schweigt.
Auch darüber wundern sich die beiden Besucher sehr, Bernd, der ihnen gegenüber allzeit aufgeschlossene Bernd, hat sich in das Gegenteil verwandelt, ist in ihrer Gegenwart wortkarg und zurückhaltend geworden. Wo ist der liebenswürdige Plauderer von einst geblieben?
Christoph Rodisch läßt seine klugen Augen forschend auf dem leidgezeichneten Männergesicht ruhen. »Sie gefallen mir nicht, Bernd«, bemerkte er teilnehmend.
»Ich gefalle mir selbst schon lange nicht mehr.« Der gequälte Zug um den schmalen Mund tritt stärker hervor. Aber da kommt ihm ein Gedanke, der ihn selbst überrascht. »Trägt Ihr Besuch geschäftlichen Charakter?« fragt er mit einer gewissen Spannung.
»Wie man’s nimmt«, erwidert Rodisch vorsichtig. Er hat die Führung des Gesprächs übernommen, Bob beschränkt sich vorläufig aufs Zuhören. Er empfindet tiefes Mitleid mit dem Freunde.
»Also doch geschäftlich«, versetzt Bernd.
Rodisch beugt sich vor. »Sie sind in Verhandlungen mit der Westram AG getreten. Wollen Sie den Auftrag annehmen?«
Erstaunt sieht Bernd hoch. »Woher wissen Sie das?«
»Ich weiß noch mehr«, lächelt Rodisch geheimnisvoll. »Ich weiß zum Beispiel auch, daß Sie so, wie es um Ihre Finanzen bestellt ist, den Auftrag kaum durchführen können.«
»Wir sind gut beschäftigt.«
»Wollen Sie damit behaupten, daß Sie gut auf diesen Auftrag verzichten können?«
»Ja.«
Rodisch fährt sich mit einer verzweifelten Gebärde durch das dichte Haar. »Da haben wir’s! Dacht’ ich mir’s doch!« Erblickt den Fabrikanten vorwurfsvoll an. »Ist das Ihr Vertrauen, dessen Sie mich seinerzeit versicherten?«
»Es hat doch alles keinen Zweck«, meint Bernd.
»Sie denken zuviel an Ihre unglückliche Frau, der Sie mit dieser Gleichgültigkeit ganz gewiß nicht helfen können! Denken Sie an die Menschen, die vertrauensvoll zu Ihnen aufschauen! Denken Sie an Ihre Kinder!«
Rodisch hat sich vorgenommen, ganz hart zu Bernd zu sein. Er ist der Ansicht, daß nur rücksichtslose Offenheit hier zum Ziele führen kann.
»Wie würde ich schuften, wenn ich wüßte, daß ich dadurch meinen Kindern die Mutter zurückgeben könnte!«
Nach dieser Äußerung, die der Ausdruck tiefster innerer Not ist, bleibt es eine Weile still zwischen den drei Männern.
Rodischs Worte haben dennoch Widerhall in Bernds Herzen gefunden. Kann er sich deren Wahrheit verschließen? Nein! Er hat eine Verantwortung übernommen, warum ist er sich dessen nicht mehr bewußt?
»Vermeiden Sie für eine gewisse Zeit das Wiedersehen mit Maria. Werden Sie erst einmal gesund, Bernd. Sie sind krank an Leib und Seele. Ein kranker Mensch ist nur ein halber Mensch, von dem man niemals gute Leistungen erwarten kann«, nimmt Rodisch abermals das Wort.
Bernds Augen starren ins Leere. »Ja, Sie haben recht, ich bin krank«, wiederholt er leise.
Rodischs Stimme wird um einen Ton wärmer. »Nehmen Sie an, Bernd, ich sei Arzt und verschriebe Ihnen eine wirksame Arznei. Vor allem, reißen Sie sich von der Vergangenheit los. Denken Sie an Ihre Frau wie an einen Menschen, der sich in seinem Zustand, obwohl er an sich überaus traurig ist, dennoch in gewissem Sinne glücklich fühlt. Nehmen Sie Zuflucht zu Ihrer Arbeit. Schaffen Sie aber nicht ohne innere Hingabe, denken Sie an Ihre Arbeiter, an Ihre Kinder, an Ihre Mutter. Wir sind doch Ihre Freunde, muß ich Ihnen das noch besonders ins Gedächtnis zurückrufen?«
Bernds Stimme verdüstert sich, und langsam kommt seine Frage: »Sie sorgen sich um das Kapital, das Sie mir geliehen haben?«
Der Alte lacht unbekümmert auf. »Unsinn!« Dann wird er sofort wieder ernst. »Wenn ich sie hätte, würde ich Ihnen die gleiche Summe noch einmal auf den Tisch legen. Aber soviel habe ich leider nicht mehr. Doch Sie brauchen Geld, Bernd! Eine offene Frage: Wieviel benötigen Sie?«
Mit einem energischen Ruck wendet Bernd sich ihm zu, seine Augen flammen jetzt von eiserner Entschlossenheit. »Nichts brauche ich!« sagt er fest und faßt nach Rodischs Hand. »Schon einmal habe ich ein Versprechen Ihnen gegenüber schlecht gehalten. Aber ich danke Ihnen, daß Sie mir die Augen geöffnet haben. Schlimm genug, daß ich es so weit kommen ließ!«
»Sie werden schon wieder alles in Ordnung bringen.« Rodisch drückt die ihm dargebotene Hand, seine hellen Augen blitzen unter den buschigen Brauen.
»Können wir wissen, ob wir immer das Rechte tun?«
»Das ist ein Wort!« fällt Bob ein, und er weiß, diesmal ist es Bernd bitter ernst.
»Es ist kein falscher Stolz, der mich Ihr Anerbieten ausschlagen läßt«, spricht Bernd weiter. »Ich will einfach den Beweis erbringen, daß man mir nicht umsonst vertraut hat. Verstehen Sie mich?«
Rodisch nickt, aber ganz einverstanden ist er nicht. Ganz richtig vermutet er, daß Bernd vielleicht vorzeitig erlahmen könnte, wenn er sieht, daß er nicht so kann, wie er will.
»Gut«, sagt er dennoch, »versuchen Sie es, Bernd! Wenn Sie es schaffen, dann haben Sie bewiesen, daß Sie ein ganzer Kerl sind!«
Der Herbst ist gekommen, und mit ihm hat sich manches geändert.
In den Imhoff-Werken herrscht wieder straffe Zucht und Ordnung wie früher, seit der Fabrikherr die Zügel fest in die Hand genommen hat. Neue Aufträge fließen dem Werk zu.
Aber nicht alles geht gut aus. Er hat schwer zu kämpfen, und manchmal kommt ihm der Gedanke, daß er es leichter haben könnte, wenn er Christoph Rodischs Angebot angenommen hätte.
Dann regt sich jedoch wieder der alte Stolz in ihm. Nein! Nur durch Kampf gelangt man zum Ziel! Warum soll er es sich so leicht machen? Und mit gesteigerter Willenskraft stürzt er sich in die Arbeit.
Draußen im Garten des Landhauses hat man längst das Obst von den Bäumen geholt. Die Blätter sinken müde zur Erde, und die letzten warmen Sonnenstrahlen zaubern ein buntes Farbenspiel hervor.
Die Kinder jubeln durch Garten und Haus und jauchzen auf, wenn das Laub unter ihren Füßen geheimnisvoll raschelt.
Frau Hanna ist der gute Geist, der um die Kinder wie um Bernd gleichermaßen fürsorglich bemüht bleibt.
Bernd ist von neuem aufgelebt, wenngleich die Sehnsucht nach Maria unvermindert stark in ihm wühlt.
Rodisch hat niemals wieder von Geld gesprochen. Wenn es nötig wird, wird der Dickkopf schon kommen, denkt er. Und dafür ist Bernd ihm von Herzen dankbar. Man vertraut seiner Kraft, und das hebt sein Selbstbewußtsein.
*
Frau von Delians Eitelkeit feiert Triumphe.
Die schöne blonde Charlotte Doehner, mit der sie in den sonnigen Süden gereist ist, ist dauernd von einer Schar von Verehrern umgeben. Ihre herbe, nordische Schönheit reizt immer wieder zu Annäherungen. Schon mancher hat sich die Finger verbrannt und ist Hals über Kopf abgereist. Lachend verteilt sie weiterhin Körbe. Sie freut sich auf jeden neuen Tag, der ihr die Schönheiten dieser Welt offenbart. Sie verweilen auch nicht lange an einem Ort. Jedesmal pflegt Charlotte bald wieder die Koffer zu packen.
Sie sind in Neapel angekommen und wohnen in einem der vornehmsten Hotels. Wie ein Kätzchen rekelt und dehnt Charlotte sich unter einem bunten Sonnenschirm auf der Terrasse. Ihre Haut hat ein sattes Braun angenommen, ihre Augen leuchten in einem tiefen Blau und stechen reizvoll von dem hellen Blond ihres duftigen Haares ab.
Frau von Delian wirft einen bewundernden Blick auf die geschmeidige Gestalt ihres Lieblings.
»Delian, ich glaube, ich habe Heimweh«, sagt Charlotte plötzlich und blinzelt unter halbgeschlossenen Lidern zu ihrer Beschützerin hinüber.
»Heimweh?« wiederholt die gute Delian und macht kugelrunde Augen. »Das soll doch nicht etwa heißen, daß wir abreisen?«
»Ich habe es satt, Delian, mir andauernd den Hof machen zu lassen! Wie viele habe ich nun schon abgewiesen!«
Plötzlich legt sie die Arme auf den Tisch und beginnt zu schluchzen. »Ist es nicht bitter? Den, den man liebt, den kann man nicht einmal mit all seinem Gelde bekommen, und die man nicht haben will, die quälen einen!«
»Aber Charlotte!« Voller Bestürzung fährt Frau von Delian über das lockere Blondhaar des jungen Mädchens. – »Das ist nun einmal der Lauf der Welt. Es gibt eben nichts, was vollkommen ist, daran können wir armseligen Menschenkinder nichts ändern.«
Charlotte legt trostsuchend den Kopf an die Brust der mütterlichen Freundin. »Ich möchte arbeiten, richtig arbeiten, damit ich mich abends müde nach einem Bett sehnen kann. Ist das Leben etwa schön, das ich führe?«
Frau von Delian fällt von einer Aufregung in die andere. »Was ist denn das nun wieder, Charlotte?«
»Reden Sie nicht, Delian! Ich bin ein unnützes Geschöpf, das dem lieben Gott den Tag wegstiehlt! Höchstens, daß ich mit viel Talent meines Vaters sauer verdientes Geld unter die Leute bringen kann!«
»Geld richtig auszugeben, will auch gelernt sein«, wirft Frau von Delian ein.