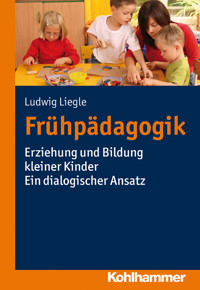Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
The concept of relationship education opens up an unexpected view of familiar phenomena. This includes the fundamental importance of the parent-child relationship for growing up and for the careers of the younger generation, as well as the fundamental importance of teacher-student relationships for the educational and school careers of children and young adults. This relationship-educational view observes and explores families and school classes as educational and learning communities that are intertwined with their environment through specific social expectations and systems of regulation, as well as specific cultural traditions and symbolic systems. The way in which their members communicate interactively in their roles and interact in teaching and learning processes becomes recognizable. This relationship-educational view regards all of the individuals involved as agents who are able to learn from all the other agents. This opens up common/shared experiential spaces with social practices in which the scope of action of everyone involved is held in motion. The new view of familiar phenomena obtained in this way opens up wide horizons for educational thought and action.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Liegle
Beziehungspädagogik
Erziehung, Lehren und Lernen als Beziehungspraxis
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Für Linde
1. Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-029382-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-029383-0
epub: ISBN 978-3-17-029384-7
mobi: ISBN 978-3-17-029385-4
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Teil I: Generationenbeziehungen im Kontext des Verwandtschaftssystems als Erfahrungsraum für Erziehungs- und Lernprozesse
1 Familiale Generationenbeziehungen – biologische und kulturelle Grundlagen und Aufgaben
2 Die Frage nach dem sozialen Wandel von familialen Generationenbeziehungen
3 Eltern-Kind-Beziehungen
3.1 »Bindung«: Elementare Formen der Liebe. Sorge (care) als elementare Form von »Erziehung«
3.2 »Deprivation«: Aufwachsen ohne befriedigende Bindungserfahrung als schwerwiegendes Überlebens- und Entwicklungsrisiko
3.3 Zwischenresümee
3.4 »Qualität«: Was macht »gute« Eltern-Kind-Beziehungen und eine »gute« Familienerziehung aus?
3.5 Familienerziehung in Aktion: Aufführungen (
performances
) der Akteure in Szenen, Situationen und Ritualen
4 Mehrgenerationenbeziehungen
5 Geschwisterbeziehungen und Geschwistererziehung
Zwischenresümee
6 Verbindungs- und Konfliktlinien zwischen Eltern-Kind-Beziehungen und Geschwisterbeziehungen
Teil II: Relationalität und Intersubjektivismus: Theoretische Ansätze zur Begründung der Beziehungspädagogik
1 Erste Annäherung: Von Hegel zu Tomasello
2 Herman Nohl (1879–1960) und seine Konzepte »Der pädagogische Bezug« und »Bildungsgemeinschaft«
3 Martin Buber (1978–1965) und sein »Dialogisches Prinzip«
4 Georg Simmel (1858–1918): Wechselwirkungen, Vergesellschaftung, individuelles Gesetz
5 George Herbert Mead (1863–1931): Bedeutungen schaffen – Symbolische Interaktion – Intersubjektivität, Rollenübernahme und Identität
6 John Dewey (1859–1952): Intersubjektive Erfahrung – Erziehung als Instrument fortschreitender Erfahrung
7 Karl Mannheim (1893–1947): Konjunktives und kommunikatives Denken – Perspektivik – Relationale Wissenssoziologie – Erziehungssoziologie
8 Lev Vygotsky (1896–1934): Kulturgeschichtliche und dialogische Voraussetzungen des Denkens – Situiertes Lernen
9 Pierre Bourdieu (1930–2002): Relationen – »kulturelles Kapital« – »Habitus«
10 Michael Tomasello: Koevolution von Biologie und Kultur – Denken und Lernen als kooperatives Geschehen – »Instructional encounter«
11 Wolf Singer: Biologische und kulturelle Evolution – Soziogenese und kulturelle Prägung des (Selbst-) Bewusstseins
12 Von interpersonalen zu interprozessualen Beziehungen: »Lehren und Lernen«
13 Zwischenresümee: Auf dem Weg zu einem Konzept der Beziehungspädagogik
Teil III: Generationenbeziehungen im Kontext des Schulsystems als sozialer Erfahrungsraum für Erziehungs- und Lernprozesse
1 Kann auch das Schulsystem beziehungspädagogisch interpretiert werden? Kurzresümee der relevanten schulpädagogischen Forschung
Zwischenresümee
2 Die Lehrer/in-Schüler/in-Beziehung als Erziehungs- und Lernfeld – Lehren und Lernen in Aktion
3 Die Schüler/in-Schüler/in-Beziehung als Erziehungs- und Lernfeld
Statt eines Zwischenresümees: Vision einer relationalen Schulpädagogik
Teil IV: Kinder unter sich: Spielgruppen, Freundschaften und »Kinderrepubliken« als beispielhafte Erziehungs- und Lernfelder
1 Spielgruppen und Betreuung in Kindergruppen
2 Freundschaften und Netzwerke Gleichaltriger
3 Kinderrepubliken
3.1 Strukturmerkmale der pädagogischen Beziehungspraxis in Kinderrepubliken
3.2 Die übergreifende normative Orientierung der beziehungspädagogischen Praxis in Kinderrepubliken: Entwicklung als Ziel der Erziehung
3.3 Die pädagogische Perspektive: Entwicklung einer kooperativen Moral
3.4 Anregungspotentiale der pädagogischen Beziehungspraxis in Kinderrepubliken für das allgemeine Schulsystem in Gegenwart und Zukunft
3.5 Zum Schluss: Kinderrepubliken als vorbildliches Beispiel einer beziehungspädagogischen Praxis
4 Mediatisierte Welten als soziale Erfahrungsräume
Teil V: Weitere Beziehungskonstellationen als Erfahrungsräume für Erziehungs- und Lernprozesse
1 Erfahrungen mit und Beziehungen zu Naturphänomenen
2 Mensch und Tier
3 Erfahrungen mit und Beziehungen zu Dingen, »Objektbeziehungen«
4 Erfahrungen mit und Beziehungen zu kulturellen Artefakten. Beziehungen als Thema von kulturellen Artefakten
4.1 Beziehungen zur Kunst und Beziehungsbilder in der Kunst
4.2 Beziehungen zur Literatur und Beziehungsgeschichten in der Literatur
4.3 Beziehungen zu Musik und Beziehungsklänge in der Musik
5 Person und Transzendenz
6 Beziehungen zur Lebenswelt des Alltags im privaten und im öffentlichen Raum
7 Zwischenresümee: Konfigurationen von Beziehungskonstellationen
Teil VI: Die Beziehung des Menschen zu sich selber
1 Vorreflexives Selbstempfinden in den Anfängen des Lebenslaufs
2 »Identität« als Prozess des Selbst- und Anderswerdens
3 Zur Ontogenese bzw. Soziogenese des (Selbst-) Bewusstseins und der Moralität
Teil VII: Umrisse einer beziehungspädagogischen Ethik für Theorie, Forschung und Praxis – am Beispiel der Beziehung zum Fremden
1 Der/das Fremde und der/das Andere sind Kategorien der Beziehungspädagogik
1.1 Anregung und Aneignung eines »Sinnes für das Fremde« – Aufgaben der Erziehung, der Bildung und des Lernens
1.2 Das Verstehen des Fremden als grundlegender Lern- und Bildungsprozess
1.3 Achtung des Fremden als zentrales Erziehungs- und Unterrichtsziel
1.4 Interkulturelle Erziehung und interkulturelles Lernen
1.5 Das Kind als Fremder – die im engeren Sinne beziehungspädagogische Perspektive
2 Beziehungspädagogische Theorie
2.1 Elemente einer (sozialen) Logik der pädagogischen Beziehungspraxis
2.2 Eine soziale Theorie der Erziehung/des Lehrens, des Lernens und des Wechselwirkungszusammenhangs zwischen Lehren und Lernen
2.3 Die Konstruktion des Kindes als Ko-Subjekt in der pädagogischen Beziehungspraxis
3 Beziehungspädagogische Forschung
3.1 Interesse am Sozialen und an sozialer Wechselwirkung
3.2 Interesse am Performativen
3.3 Die Beziehungen der Forscher/Innen zu Kindern und anderen Akteuren im pädagogischen Feld als Kontext der Datengewinnung
4 Beziehungspädagogische Praxis (1): Das Erbe der Schwarzen Pädagogik: Verletzende Beziehungen und gewaltförmige Erziehung.
5 Beziehungspädagogische Praxis (2): Ansatzpunkte einer »Fröhlichen Pädagogik«: Normative Kriterien für die Aufgaben der Gestaltung der beziehungspädagogischen Praxis: Von A (Achtung) bis Z (Zwischen)
Teil VIII: Ein riskanter Rück- und Ausblick zwischen Spekulation und Evidenz: Beziehungspädagogik und Evolutionsforschung
1 Evolutionsforschung und Pädagogik – Vorbemerkung
2 Spekulative Anfänge des Evolutionsdenkens: Georg Simmel, G. H. Mead und John Dewey
3 Die Hypothese vom »sozialen Gehirn«. Das Gehirn als »Beziehungsorgan«.
4 Kulturelles Lernen und Erlernen von Kultur: Implizite und explizite Lernprozesse und Erziehung als Antriebskräfte der kulturellen Evolution
5 Homines rationales et relationales: Der Beitrag der Evolutionsforschung zur Historischen und Pädagogischen Anthropologie
Literatur
Gesamtliteraturverzeichnis
»Wenn jemand der Vernunft des anderen etwas abfragen will, so kann es nicht anders als dialogisch, d.i. dadurch geschehen: dass Lehrer und Schüler einander wechselseitig fragen und antworten …, dass der Lehrer nach dem docendo discimus selbst lernt, wie er gut fragen müsse.«
(Kant, Metaphysik der Sitten, 1797, § 50)
»Es ist ein Gemeinplatz, dass ein waches und ausgreifendes geistiges Leben auf der Ausweitung der Berührungen mit der körperlichen Umwelt beruht. Das Entsprechende gilt noch bestimmter für das Gebiet, wo wir geneigt sind, es zu übersehen: für das Gebiet der sozialen Beziehungen.«
(Dewey, Demokratie und Erziehung, 1930, S. 137)
Einleitung
Von »Beziehungspädagogik« zu hören oder zu lesen, könnte die Frage provozieren, warum dann nicht gleich von Allerweltspädagogik die Rede ist; oder die ähnliche Frage, die ein griechischer Kollege an seine ebenfalls sehr weit gefasste Auffassung von Erziehung selbstkritisch gestellt hat: ob das nicht ein »Panpädagogismus« sei. Denn was eigentlich ist nicht in der einen oder andern Weise irgendeiner Art von Beziehung zuzurechnen? Zum Beispiel: Das Leben des Menschen und der weiteren Primaten geht aus einer Beziehung, nämlich der Beziehung zwischen Frau und Mann, genauer: aus der Vereinigung von Eizelle und Samenzellen hervor. Oder: Das Überleben und eine »normale« Entwicklung des Menschen und der weiteren Primaten wäre nicht möglich, träte das neu geborene Lebewesen nicht in die Erfahrung einer sehr engen, gleichsam symbiotischen Beziehung zu seiner Mutter und weiteren Bezugslebewesen, das heißt also in die Erfahrung von »Bindung« ein. Oder: Wenn ein(e) Lehrer(in) eine (n) Schüler(in) unterrichtet, so hat dies gleichermaßen zur Voraussetzung und zur Folge, dass zwischen Lehrer(in) und Schüler(in) irgendeine Art von Beziehung zustande kommt, zum Beispiel im Medium der sprachlichen Kommunikation (Frage, Lob und Tadel, Ermahnung und Ermunterung etc.). Beispiele in großer Zahl könnten hinzugefügt werden – und sie alle würden doch vielleicht das Echo auslösen, dass mit dem Unterfangen, an solchen und weiteren Beispielen einen Zusammenhang zwischen Erziehung und Beziehung aufzeigen zu wollen, nicht viel mehr als eine Selbstverständlichkeit oder sogar eine Banalität ausgesprochen würde.
Wenn dann darüber hinaus der Gliederung zu entnehmen ist, dass nicht nur von Eizellen und Samenzellen, nicht nur von Eltern und Kindern und nicht nur von Lehrern und Schülern, sondern außerdem von »Beziehungsbildern«, von »Beziehungsgeschichten« und von »Beziehungsklängen« die Rede sein soll, und zwar wiederum so, dass diese offenbar als Quelle von Erziehungs- und Lernerfahrungen vorgeführt werden sollen, so könnte einerseits der schon angesprochene Eindruck eines Panpädagogismus verstärkt werden. Andererseits könnte der Eindruck erweckt werden, dass mit solch ausschweifenden Ausflügen dem, was wir gemeinhin unter »Erziehung« zu verstehen pflegen, der Boden und jedes Profil entzogen werden.
Auch wenn ich an dieser Stelle nicht zu einer Verteidigungsrede ansetzen, sondern die Einschätzung dieses Versuchs meiner »Beziehungspädagogik« den Eindrücken und Urteilen der geneigten Leserschaft nach Abschluss der Lektüre meiner Überlegungen anheimstellen will, haben mich doch während der ganzen Arbeit die Empfindungen eines Wagnisses und eines Risikos sowie die Sorge um die Unabschließbarkeit dieses ausufernden Unterfangens kaum je verlassen. Hinzu kommt, dass die immer wieder durchscheinende Tendenz, das behauptete Beziehungs-, Erziehungs- und Lerngeschehen an eigenen Erfahrungen des Selbstseins und Selbstwerdens festzumachen, leicht autobiographische Züge annimmt. Ja, es ist so: Ich bin überzeugt, dass mein Selbstwerden und Selbstsein eine andere Gestalt gewonnen hätte ohne die Begegnungen mit Meisterwerken der Musik, der Kunst und der Literatur; eine derartige persönliche Färbung wissenschaftlicher Produktion mag zwar einem gealterten Autor nachgesehen werden, dennoch bleibt sie problematisch.
Mein Entwurf einer Beziehungspädagogik basiert auf einer Reihe von mehr oder weniger akzeptierten Aussagen. Deren Überprüfung anhand von Daten, Erklärungsansätzen, Argumenten und Beispielen ist ein zentrales Anliegen dieses Buches.
• Die erste Aussage lautet: Die phylogenetische Ausstattung, die Erbanlagen der Vorfahren und individuelle Erfahrungen bestimmen die menschliche Persönlichkeit und ihre über den gesamten Lebenslauf stattfindende Entwicklung.
• Die zweite Aussage besagt: Erfahrungen werden gemacht in Beziehungen mit Menschen, Natur und Kultur.
• Die dritte Aussage lautet: Erfahrungen machen und diesen subjektiv Bedeutung und Sinn zu verleihen heißt Lernen.
• Die vierte Aussage besagt: Erfahrungen zu ermöglichen und Erfahrungsräume zu schaffen und zu gestalten sind die zentralen Aufgaben von Erziehung.
• Die fünfte Aussage lautet: Je früher und je dauerhafter eine Erfahrung im Lebenslauf angesiedelt ist, desto größer ist ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung.
• Die sechste Aussage besagt: Die Qualität der Beziehung hat starke Auswirkungen, deshalb ist eine Ethik des Erziehens notwendig.
• Die siebente Aussage lautet: Neben den intersubjektiven Beziehungen muss die wichtige Rolle von historisch-gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten beachtet werden.
• Die achte Aussage besagt: Erziehung muss lernmotivierende und gesellschaftsrelevante Erfahrungsräume schaffen.
• Die neunte und letzte Aussage lautet: Beim Aufstellen pädagogischer Standards muss berücksichtigt werden, dass Erziehen und Lernen Beziehungsgeschehen sind.
Dass Kinder mit einem elementaren Bedürfnis nach verlässlichen Beziehungen, nach Zuwendung und Zugehörigkeit ins Leben treten, ist seit langem bekannt. Insbesondere die Bindungsforschung und die vorausgegangene Deprivations- und Hospitalismusforschung sowie Berichte über »wilde« oder so genannte »Wolfskinder« haben dafür zahlreiche Belege gesammelt und mitgeteilt. Relativ jungen Datums sind demgegenüber Belege dafür, dass Kinder bereits in ihrer vorsprachlichen Entwicklungsphase über ausgeprägte Fähigkeiten zur Wahrnehmung und Gestaltung von Beziehungen verfügen; diese kommen beispielsweise in Formen der Zusammenarbeit, des Helfens und Teilens sowie in Formen des Mitgefühls und der Fairness zum Ausdruck.
Die erwähnten Forschungsbefunde können als wissenschaftliche Bestätigung für eine Überzeugung gelesen werden, welche die Pädagogik seit ihrer Entstehung im Zeitalter der Aufklärung bis in die Gegenwart begleitet hat: die Überzeugung, dass Erziehungs- und Lernprozesse untrennbar verbunden sind mit der Erfahrung und Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen.
Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen »Beziehung« und »Erziehung« (und »Lernen«) kann man argumentieren: Historisch wie systematisch, begrifflich wie logisch gehen »Beziehungen« der »Erziehung« und dem »Lernen« voraus. Dafür sprechen die folgenden Überlegungen: Schon immer haben Menschen die Erfahrung gemacht und gewusst, dass sie, wie Aristoteles gesagt hat, »soziale Wesen« sind, und das heißt, dass sie aufeinander angewiesen sind, dass sie im Medium von Beziehungen aufeinander einwirken und dass sie sich verständigen und zusammenarbeiten müssen, um überleben und ein »gutes« Leben führen zu können. Die Prozesse, die im Medium von Beziehungen von den Beteiligten gemeinsam hervorgebracht werden, wurden erst dann mit spezifischen Begriffen belegt und als soziale Praxis sorgfältig institutionalisiert, als die kulturelle Evolution zur Entstehung und Institutionalisierung eines funktional ausdifferenzierten sozialen Systems der Erziehung und des Lernens in Gestalt der öffentlichen bzw. staatlichen Schule geführt hatte.
Im Hinblick auf Begriffe muss ich begründen, warum ein Schlüsselbegriff der deutschsprachigen Pädagogik – »Bildung« – bei mir nur ausnahmsweise vorkommt, und ich mich im Allgemeinen auf die Begriffe »Erziehung« bzw. »Erziehen« und »Lernen« beschränke. Eine erste Begründung lautet: Bei der Suche nach Begriffspaaren, die geeignet sind, Beziehungen zwischen der Tätigkeit des Vermittelns und der Tätigkeit des Aneignens sowie zwischen den Personen, welche diese Tätigkeiten ausüben, zu umschreiben, bin ich beim Bildungsbegriff auf Schwierigkeiten gestoßen, insbesondere dann, wenn ich die genannten Tätigkeiten auch sprachlich in der Tätigkeitsform ausdrücken wollte. Die Tätigkeiten des Vermittelns und der Aneignung können entweder zwei und mehr Personen betreffen oder in ein und derselben Person zusammentreffen. Für den letzteren Fall ist die aus der römischen Antike überlieferte Sentenz »docendo discimus« typisch. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass durch die Vermittlungstätigkeit einer Person zugleich deren Aneignungstätigkeit gefördert wird. Die wörtliche Übersetzung lautet »Durch Lehren lernen wir«. Wenn zur Übersetzung dieser Sentenz der Bildungsbegriff herangezogen werden soll, muss zunächst geklärt werden, ob der Begriff transitiv (jemanden bilden) oder intransitiv (sich bilden) verwendet wird. Nur im letzteren Fall ergäbe sich eine sinnvolle Umschreibung der Beziehung zwischen Vermittlungs- und Aneignungstätigkeit, nämlich: Erziehen und Sich-Bilden. Noch umständlicher wird es, wenn versucht werden soll, das »Lernen des Lernens« oder das »Lehren des Lernens« in Begriffen der Bildung zu fassen. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, Formen der Aneignungstätigkeit (z. B. Nachahmung, Üben) mit dem Lernbegriff und Formen der Vermittlungstätigkeit (z. B. Unterrichten, Zeigen, Ermutigen etc.) mit dem Erziehungsbegriff zu umschreiben.
Eine zweite Begründung für die Entscheidung, den Bildungsbegriff weitestgehend durch den Lernbegriff zu ersetzen, besagt: Diejenigen Theorieansätze, die zur Begründung einer »Beziehungspädagogik« für mich die größte Bedeutung erlangt haben, stammen – abgesehen von Herman Nohls Konzepten des »pädagogischen Bezugs« sowie der »Bildungsgemeinschaft« (Nohl 1935) und Martin Bubers »Dialogisches Prinzip« – aus Sprachräumen und Wissenschaftsdisziplinen, in welchen der Bildungsbegriff nicht beheimatet ist: aus dem anglo-amerikanischen (John Dewey, George Herbert Mead, Jerome Bruner und Michael Tomasello), dem französischen (Jean Piaget und Pierre Bourdieu) und dem russischen Sprachraum (Lev Vygotsky), aus der Soziologie (Georg Simmel, Karl Mannheim, George Herbert Mead und Pierre Bourdieu), aus der Psychologie (Jean Piaget, Lev Vygotsky, George Herbert Mead, Jerome Bruner und Michael Tomasello) und aus der Hirnforschung (Wolf Singer). Demgegenüber ist der Lernbegriff in den genannten verschiedenen Sprachräumen und Wissenschaftsdiziplinen allgegenwärtig.
Die zentrale Hypothese der Beziehungspädagogik, wonach Erziehen und Lernen im Medium zwischenmenschlicher und anderweitiger Beziehungen stattfinden und auf solche Beziehungen angewiesen sind, könnte den Eindruck erwecken, damit werde Beziehungen grundsätzlich eine positive Bedeutung für die Prozesse des Erziehens und des Lernens zugeschrieben. Demgegenüber gehe ich davon aus, dass Beziehungen, zumal zwischenmenschliche Beziehungen, vielfältige und immer auch widersprüchliche Potentiale aufweisen; sie können auf gegenseitiger Achtung und Anerkennung, auf Wohlwollen und Zusammenarbeit aufbauen, sie können aber auch auf einseitige, auf die Kinder und Jugendlichen gerichtete Beherrschung und Manipulation, Beschämung und Demütigung sowie auf körperliche und seelische Gewalttätigkeit und, wie gerade in den letzten Jahren zahlreiche Fälle in vielen Erziehungsinstitutionen gezeigt haben, auf Formen einer besitzergreifenden Liebe und des sexuellen Missbrauchs hinauslaufen.
Die Formen und die Qualität der Beziehungen in den sozialen Kontexten des Erziehens und des Lernens (gemeint sind insbesondere Familien und Schulen) werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst. An erster Stelle sind hier die beteiligten Personen, deren Überzeugungen und deren Verhalten zu nennen. Darüber hinaus stellen auch die Organisationsformen der Erziehung einen wichtigen Einflussfaktor dar; als extreme Beispiele dafür verweise ich auf die nach Geschlechtszugehörigkeit, nach Religionszugehörigkeit, nach Schicht- bzw. Klassenzugehörigkeit oder nach ethnischer bzw. Rassenzugehörigkeit getrennte Beschulung von Kindern und Jugendlichen, die es im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben hat und durch welche das Spektrum der möglichen Beziehungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen systematisch gesteuert bzw., in den genannten Fällen, systematisch eingeschränkt worden ist. Die erwähnten Beispiele für den Einfluss von Organisationsformen der Erziehung verweisen auf einen weiteren, übergreifenden Einflussfaktor: die Verfasstheit des politischen Systems, innerhalb dessen Erziehung stattfindet, zumal die Verfasstheit der weithin vom jeweiligen Staat getragenen Schulen. Um noch einmal ein extremes Beispiel zu wählen: Wenn ein diktatorischer oder totalitärer Staat den Versuch unternimmt, das Schulsystem für seine politisch-ideologischen Zwecke zu instrumentalisieren und die Lehrerschaft wie die Schülerschaft dementsprechend zu indoktrinieren und zu kontrollieren, so wird ein solcher Versuch selbst dann, wenn er in seiner Realisierung begrenzt bleibt, dem pädagogischen Beziehungsgeschehen in Schulen seinen Stempel aufdrücken.
Wenn man die konstitutiven Merkmale des übergreifenden Kontextes von Staat und Gesellschaft als wichtige Einflussfaktoren auf die Qualität des Beziehungsgeschehens in Einrichtungen des Erziehens und Lernens betrachtet und einschätzt, wie ich es gerade vorgeführt habe, stellt sich die Frage, in welcher Weise und mit welchem Ergebnis der für unsere eigene Gesellschaft geltende Typus der modernen kapitalistischen Gesellschaft als konstitutive Rahmenbedingung Einfluss auf die Verbreitung und Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen und zumal auf die Qualität des pädagogischen Beziehungsgeschehens nimmt, so kann man in diesem Zusammenhang auf die kritischen Gesellschaftsanalysen zwischen Karl Marx und Richard Sennett verweisen. Vereinfachend könnte man auf diesem Hintergrund einerseits argumentieren, dass die Implikationen einer Beziehungspädagogik darauf hinauslaufen, dass in unseren Erziehungs- und Lernumwelten Formen der Assoziation verbreitet und wünschenswert sind; andererseits müsste man diagnostizieren, dass in unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft Formen der Dissoziation viel weiter und stärker als Formen der Assoziation verbreitet sind, sodass anscheinend ein Widerspruch zwischen dem Sozialcharakter der Gesellschaft und dem Sozialcharakter der institutionalisierten Erziehungs- und Lernumwelten in unserer Gesellschaft entstanden ist. Der dissoziative Charakter der kapitalistischen Gesellschaft ist in vielerlei Begriffen und Bildern beschrieben worden. Ich nenne über Marx und Sennett hinaus einige Beispiele in historischer Reihung: Buber spricht von einer »strukturarmen« Gesellschaft sowie von Prozessen der »Individualisierung« und »Atomisierung«; Jürgen Habermas hat das Phänomen der »Entkopplung von Lebenswelt und System« und der diese begleitenden Tendenz zur »Kolonialisierung« der Lebenswelt analysiert (Habermas 1981, Band 2, S. 171 ff.); Lasch (1979) spricht von einer »culture of narcissism« bzw., in der deutschsprachigen Ausgabe (Lasch 1995), vom »Zeitalter des Narzissmus«; der Tübinger Kinder- und Jugendpsychiater Reinhard Lempp spricht von der »autistischen Gesellschaft« (Lempp 1996). Thiersch/Böhnisch (2014) greifen den Begriff der »Kommodifizierung« auf.
Wenn man die genannten Kennzeichnungen der kapitalistischen Gesellschaft für zutreffend hält und wenn man außerdem die schon zu Beginn erwähnte Auffassung des Großteils der Humanwissenschaften und ihrer Fachvertreter/Innen teilt, wonach Kinder nur im Medium verlässlicher zwischenmenschlicher Beziehungen gut aufwachsen und sich zu handlungsfähigen Erben und Fortsetzern bzw. Erneuerern der jeweiligen Kultur und Gesellschaft entwickeln können, dann erhalten Umwelten der Erziehung und des Lernens – gleichgültig, ob es sich dabei um verwandtschaftliche soziale Netzwerke oder um gesellschaftlich organisierte Institutionen handelt – den Charakter von Nischen, von eigens eingerichteten pädagogischen Provinzen, welche funktional auf die Tatsache reagieren, dass Kinder im Hinblick auf den skizzierten Typus der modernen kapitalistischen Gesellschaft zu »Außenseitern der Gesellschaft« geworden sind (Kaufmann 1980) und zwar insofern, als sie »strukturell von allen entscheidenden Lebensbereichen der Moderne ausgeschlossen (sind), mit Ausnahme derjenigen Einrichtungen, die speziell für sie geschaffen werden« (ebd., S. 767).
Wenn eine Gesellschaft nicht bzw. nicht mehr dazu angetan ist, das Handlungsvermögen (agency) ihrer Kinder im Rahmen der vorhandenen Handlungsräume herauszufordern, muss sie eigens für Kinder soziale Kontexte, »soziale Orte«, »soziale Felder« bzw. »Räume« oder Arenen einrichten, die geeignet sind, das Handlungsvermögen der Kinder zu unterstützen und anzuregen. Unbeschadet der Tatsache, dass die menschheitsgeschichtlichen Anfänge der Erziehung, wie schon der französische Soziologe Emil Durkheim aufgezeigt hat, in den Initiationsriten in traditionalen Kulturen und Gesellschaften zu finden sind, spricht alles dafür, dass die Geburtsstunde der Pädagogik, wie wir sie heute kennen – der Pädagogik als Instanz der Beobachtung und Reflexion der sozialen Praxis von Erziehung und Lernen – zeitlich zusammenfällt mit den Anfängen der Prozesse der »Modernisierung« und der kapitalistischen Organisation der Arbeitswelt und des Marktes. Es sind diese Umwälzungsprozesse der einsetzenden »Moderne«, die zur »Erfindung« der Kindheit und zur Evolution – oder auch Revolution – der Erziehung, insbesondere in Gestalt der Einführung der (Pflicht-)Schule geführt haben (vgl. Snyders 1971; Kessel/Siegel 1983).
Die damit einsetzende Pädagogisierung der Kindheit hat zweifellos die Position der Kinder als Außenseiter der Gesellschaft wenn nicht überhaupt in Gang gesetzt, so jedenfalls verfestigt. Außerdem aber bietet die Form der Pädagogisierung der Kindheit ein anschauliches Beispiel für die inneren Widersprüchlichkeiten des zivilisatorischen Fortschritts (vgl. Edelstein 1983); denn die Schule als neu, eigens für Kinder geschaffene Welt des Kindes ist von Haus aus zunächst einmal durch die gleichen Merkmale zweckrationaler und bürokratischer Organisation gekennzeichnet, die Max Weber als konstitutive Merkmale der kapitalistischen Gesellschaft beschrieben hat. Die angedeuteten inneren Widersprüchlichkeiten des Fortschritts sind bis heute virulent und wirksam und provozieren die Frage, ob und wie im Rahmen der organisierten Erziehung ein Beziehungsgeschehen gestaltet werden kann, welches geeignet sein könnte, eine intrinsische Lernmotivation der Kinder zu ermöglichen und ihr Handlungsvermögen zu unterstützen und herauszuzfordern (vgl. Edelstein 1983 und 2014). Es wäre denkbar, dass eine solche Möglichkeit nur unter der Bedingung Wirklichkeit werden kann, dass die Institutionen der organisierten Erziehung lebensweltliche Elemente – und von diesen sind die zwischenmenschlichen Beziehungen vermutlich das wichtigste und wirksamste Element – in sich aufnehmen und den Kindern präsentieren.
Eine Pädagogik, welche – im Sinne der bisherigen Ausführungen – in ihrer Theoriebildung und Forschung sowie in ihrer Reflexion und Gestaltung der Praxis Phänomene und das Problem von Beziehungen ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rückt, nenne ich »Beziehungspädagogik«.
Der Begriff »Beziehungspädagogik« wird meines Wissens in keinem erziehungswissenschaftlichen Handbuch oder Lexikon erläutert. Das könnte dafür sprechen, dass mit diesem Begriff etwas Neues, zumindest etwas bislang Vernachlässigtes beschrieben wird. Das ist jedoch nicht der Fall, im Gegenteil: Das mit dem Begriff »Beziehungspädagogik« Gemeinte – die Überzeugung von der grundlegenden Bedeutung von Beziehungen in der Theorie und Praxis der Erziehung – bildet einen Kernbestand der Pädagogik seit deren Entstehung im Zeitalter der Aufklärung bis in die Gegenwart (Giesecke 1997). Die Anfänge der Erziehungstheorie bei Schleiermacher werden von der Frage bestimmt: »Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?«, und diese Frage bezieht sich auf die Formen institutionalisierter Erziehung und damit – im Unterschied zum Konzept des »pädagogischen Bezugs« – auf das Verhältnis zwischen »kollektiven« Gesellschaftsgenerationen.
In einem enzyklopädischen Grundkurs der Erziehungswissenschaft (Lenzen 1994) heißt es: »Es nimmt daher nicht wunder, dass die Frage nach der pädagogisch richtigen Beziehung eine Zentralfrage der Erziehertheorie ist« (Rittelmeyer 1994, S. 220). Anke König (2010) hat »Interaktion«, verstanden als eine Grundkategorie der Didaktik, als professionelle Beziehungsgestaltung in Tageseinrichtungen für Kinder untersucht (König 2009) und als »didaktisches Prinzip« erörtert (König 2010). Entsprechend hat für den Schulbereich Miller (2009) eine »Beziehungsdidaktik« vorgelegt. Formeln wie »Erziehung ist Beziehung« oder »Erziehungsarbeit ist Beziehungsarbeit« gehören zu den zentralen Überzeugungen in (sozial)pädagogischen Professionen (z. B. Dollase 2007, Künkler 2011, Müller 2006, Wirth 2012).
Hätte ich für den Titel dieses Buches nicht den an die genannten Traditionen erinnernden Begriff der »Beziehungspädagogik« gewählt, sondern neuhochdeutsch von »relationaler Pädagogik« gesprochen, so wäre dies in der Fachöffentlichkeit sogleich verstanden worden als der Vorschlag eines neuen Paradigmas für die pädagogische Theorie, Forschung und Praxis. Tatsächlich ist in vielen humanwissenschaftlichen Diziplinen einschließlich der Pädagogik sowohl im deutschen als auch im anglo-amerikanischen Sprachraum in den letzten zehn bis zwanzig Jahren »Relationalität« als neue und fruchtbare Perspektive für Erkenntnisgewinnung, Theoriebildung, Forschung und professionelles Handeln beschrieben worden (z. B. Donati 2011, De Haan/Stewart 2008, Gergen 2009, Herzog 2001, Köngeter 2009, Reuter 2012, Schaller 2012, Spretnak 2011 und Thayer-Bacon 2003). Der in Cambridge lehrende Zoologe Robert Hinde hat eine Reihe von Beiträgen zu einer disziplinübergreifenden »sience of relationships« vorgelegt (z. B. Hinde 1993 und 1997).
Wie für viele Paradigmata, die mit einem Neuigkeitsanspruch auftreten, gilt auch für den »Relationismus«, dass er nicht wirklich neu ist; vielmehr schließt er an den symbolischen Interaktionismus eines G.H. Mead (Mead 1934/1968), an kommunikationstheoretische Ansätze (z. B. Watzlawick 1976) und verschiedene Ausprägungen des sozialen Konstruktivismus (z. B. Berger/Luckmann 1966) an.
Am Gegenpol zum Neuigkeitsanspruch könnte man die Auffassung ansiedeln, dass eine Beziehungspädagogik allzu viel Vertrautes wiederhole. Tatsächlich bekam ich, wenn ich Bekannten und Freunden – zumal solchen, die mit Pädagogik beruflich nichts zu tun haben – von meinem Vorhaben einer Beziehungspädagogik erzählte, verwunderte Reaktionen: Ist die Bedeutung von Beziehungen für Erziehungs- und Lernprozesse nicht so bekannt, so offensichtlich, dass eine Veröffentlichung zu diesem Thema kaum Neues bringen kann?
Nach diesen Vorbemerkungen bleibt zu fragen, was »trotz allem« dafür spricht, eine »Beziehungspädagogik« vorzulegen.
Da die Behauptung und Begründung eines neuen Paradigmas, wie gesagt, nicht beabsichtigt ist, sollen zwei Aufgaben im Zentrum stehen: Zum einen will ich die in der Pädagogik tradierten Beziehungskonzepte historisch und systematisch verorten und prüfen, ob und inwieweit sie gegenwärtig in einem neuen Sinne relevant sein können. Dazu – z. B. zum Nohlschen Konzept des »pädagogischen Bezugs« – liegen bereits anregende Studien vor (Müller 2002, Niemeyer 2011).
Zum anderen will ich die überlieferten pädagogischen Beziehungskonzepte systematisch erweitern. Partiell kann ich dabei an Studien anknüpfen, die sich als differenzierte Beiträge zur Begründung oder auch empirischen Überprüfung des Konzepts der »Relationalität« verstanden haben.
Die erste Erweiterung betrifft die Konstellationen von Personen, die beziehungspädagogische Ansätze in den Blick nehmen. Schon im Begriff »Pädagogik« kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass Erziehung die Führung und Anleitung von Kindern, d. h. von noch nicht erwachsenen Personen beinhaltet. Dem entsprechend sind in der Pädagogik ganz überwiegend diejenigen Beziehungen als relevant für die Prozesse der Erziehung betrachtet worden, die sich zwischen erwachsenen und noch nicht erwachsenen Personen oder, mit anderen Worten, zwischen Mitgliedern der älteren und Mitgliedern der jüngeren Generation entwickeln. Dies gilt seit den Anfängen der Pädagogik – zunächst in der jüdischen und griechischen Antike (z. B. Plato und Sokrates, vgl. Nelson1931/2002) – und dann im Zeitalter der Aufklärung in Europa (vgl. Giesecke 1997), bis hinein ins 20. Jahrhundert. Erst mit den Untersuchungen des Psychologen und Pädagogen Jean Piaget über die Entwicklung der Regelpraxis und des Regelbewusstseins von Vorschul- und Schulkindern in ausgewählten Spielgruppen von Großstadtkindern in der Schweiz (Piaget 1932/1973) sind in der Pädagogik neben den intergenerationalen auch die intragenerationalen Beziehungen als soziale Orte der (wechselseitigen) Erziehung und (ko-konstruktiven) Bildung anerkannt worden. Seitdem haben sie in der Forschung viel Aufmerksamkeit gefunden (z. B. Krappmann 1991, Youniss 1994, Krappmann/Ostwald 1994, Corsaro 1997, Honig/Joos/Schreiber 2004).
Die skizzierten Entwicklungen greife ich in der Weise auf, dass ich die Beziehungspädagogik in zwei Perspektiven erläutere: Die erste behandelt die intergenerationalen, die zweite die intragenerationalen Beziehungen, und zwar jeweils mit Blick auf deren Bedeutung für die den Lebenslauf von Individuen begleitenden Prozesse der Erziehung und des Lernens.
Die zweite Erweiterung der tradierten Beziehungsansätze betrifft die Typen von interpersonellen Beziehungen, die als soziale Kontexte der (lebenslangen) Erziehungs- und Bildungsprozesse identifiziert und erforscht werden. In der Tradition von Schleiermacher (1826/2000) und Nohl (Nohl 1918 und 1933) werden beziehungstheoretische Ansätze ganz überwiegend auf die professionelle Tätigkeit von Fachkräften in öffentlichen Einrichtungen der Erziehung und Bildung bezogen (beispielsweise hat Schleiermacher sogar die Hauslehrertätigkeit für nicht theoriefähig gehalten); das gilt auch für viele deutsch- und englischsprachige Beiträge zu einer »relationalen Pädagogik« (z. B. Köngeter 2009, Bingham/Sidorkin 2010) wie auch für das wunderbare Buch von Annedore Prengel (2013). Daneben hat sich ein eigener Strang erziehungs- und verhaltenswissenschaftlicher Studien über die Beziehungsdynamik und Erziehungsprozesse in Familien entwickelt (z. B. Kreppner/Lerner 1989, Mollenhauer/Brumlik/Wudtke 1975, Schneewind 2005), die ihrerseits ganz überwiegend interaktionistischen Ansätzen verpflichtet sind. Die damit angezeigte Trennung zwischen öffentlicher und privater, professioneller und von Laien wahrgenommener Erziehung als Themen der Forschung ist mittlerweile aus guten Gründen weitgehend überwunden worden. Denn die heutigen Kinder und Jugendlichen verbringen ihren Alltag in einer ständigen, wenn auch sich verändernden Verbindung von privater und öffentlicher Erziehung – und diese beiden Welten der Erziehung und des Lernens beeinflussen sich wechselseitig. In dieser Perspektive behandelt die vorgelegte »Beziehungspädagogik« sowohl die öffentliche/berufliche Erziehung als auch die Familienerziehung. Die Unterscheidung zwischen zwei Perspektiven – intergenerationale und intragenerationale Beziehungen – wird daher ergänzt durch die differenzierte Erörterung von privater (familialen) und öffentlicher (institutioneller) Erziehung. Konkret: Einerseits werden unter dem Dach der intergenerationalen Beziehungen sowohl die Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern bzw. Großeltern als auch die Beziehungen zwischen Erzieherinnen/Erziehern und Kindern bzw. Lehrerinnen/Lehrern und Schülerinnen/Schüler analysiert. Andererseits werden unter dem Dach der intragenerationalen Beziehungen neben den Beziehungen zwischen Geschwistern auch die Beziehungen zwischen etwa gleichaltrigen Kindern im Rahmen informeller Gruppen sowie in Schulen erörtert.
Mit der dritten Erweiterung der in der Pädagogik tradierten Beziehungskonzepte will ich der Tatsache Rechnung tragen, dass Menschen Beziehungen eingehen nicht nur mit ihren Mitmenschen (»interpersonelle Beziehungen«), sondern auch mit Tieren (insbesondere mit Pferden und Hunden als den traditionsreichsten Haustieren), mit Phänomenen der Natur (z. B. Elemente, Gestirne, Gezeiten etc.) sowie mit Artefakten der Kultur (z. B. Musik, Kunst, Literatur etc.). Auf diese Tatsache hat am eindringlichsten Martin Buber hingewiesen, indem er in seinem »Dialogischen Prinzip« die »Grundworte« ICH – DU und ICH – ES unterschieden hat, sodann auch die Vertreter einer »phänomenologischen« Pädagogik (z. B. Lippitz/Meyer-Drawe 1984). Die Überzeugung, dass als Faktoren der Erziehung nicht nur Menschen, sondern die »Natur« und die »Dinge« wirksam seien, geht auf Rousseau zurück: in seinem Erziehungsroman »Emile« benennt er die Mitmenschen erst als dritten Erziehungsfaktor nach der Natur und den Dingen. Die phänomenologische Pädagogik hat seit Martinus Langeveld vom »Aufforderungscharakter der Dinge« gesprochen (Langeveld 1964). Maria Montessori hat diese Vorstellung mit ihrem Konzept der (durch Lernmaterialien) »vorbereiteten Umgebung« zum Angelpunkt ihrer Kinderhauspädagogik gemacht.
In der vierten Erweiterung der tradierten Beziehungskonzepte gerät die Beziehung des Menschen zu sich selber in den Blick (z. B. Herzog 2001). Die zentrale Bedeutung der Selbstbezüglichkeit der Person des erziehenden Erwachsenen hat Siegfried Bernfeld mit dem Satz umschrieben: »So steht der Erzieher vor zwei Kindern: dem zu erziehenden vor ihm und dem verdrängten in ihm« (Bernfeld 1925, S.147). In diesem Satz kommt die in der Freudschen Psychoanalyse entwickelte Überzeugung zum Ausdruck, dass es der ausdrücklichen Reflexion der am eigenen Leib erfahrenen Erziehung bedarf, um den erziehenden Erwachsenen davor zu bewahren, blindlings dem Wiederholungszwang der erfahrenen Beziehungs- und Erziehungsmuster zu unterliegen (vgl. z. B. Martin/Olsen 1996).
Die fünfte Erweiterung des tradierten Beziehungsdenkens begründet den Anspruch, mit dem vorgestellten beziehungspädagogischen Rahmenkonzept einen konstruktiven Beitrag zur systematischen Pädagogik leisten zu wollen und zu können. Es ist fruchtbar – so lautet der Anspruch –, die Grundbegriffe der Pädagogik beziehungstheoretisch zu fassen, sie also in der Perspektive eines facettenreichen, im Kontext kulturspezifischer Verhältnisse verlaufenden Beziehungsgeschehens zu bestimmen, welches den gesamten Lebenslauf des Individuums begleitet. Einen ersten Versuch dieser Art habe ich in meiner »Frühpädagogik« vorgelegt (Liegle 2013).
Durch eine sechste Erweiterung des tradierten Beziehungsdenkens kann der Anspruch, einen konstruktiven Beitrag zur systematischen Pädagogik zu leisten, in Richtung auf eine beziehungstheoretisch begründete Erkenntnistheorie ergänzt werden. Bereits Wilhelm von Humboldt hat in seinen dialogisch orientierten bildungstheoretischen Schriften argumentiert, man könne Wahrheit als einen Prozess begreifen, der sich zwischen menschlichen Subjekten ereignet (Burkhardt 1987). Auf der Grundlage seiner Kommunikationstheorie geht Watzlawick der These nach, »dass die sogenannte Wirklichkeit das Ergebnis von Kommunikation« sei (Watzlawick 1976, S. 7). Das Konzept der »Relationalität« (s. oben) ist schon mehrfach zum Ausgangspunkt einer »neuen« erkenntnistheoretischen Position gewählt worden (z. B. Thayer-Bacon 2003): Mit Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung im Lebenslauf und Gesetzmäßigkeiten des lebenslangen Lernens ergibt sich aus relationalen Positionen der Erkenntnistheorie die Einsicht, dass der Erwerb bzw. die Aneignung von Erkenntnis als ein kooperatives Geschehen (collaborative process) verstanden werden kann (vgl. Rogoff 1998).
Die genannten Aspekte einer Beziehungspädagogik halte ich insbesondere deshalb für fruchtbar, weil sie dazu beitragen können, die Grundzüge einer Logik und einer Ethik des Erziehens – in allen seinen Gestalten zwischen systematischem Unterricht und Formen der indirekten »Aufforderung zur Bildung« (Liegle 2013) – zu bestimmen. Dabei meint »Logik« die Gesetzmäßigkeiten in jenem Beziehungsgeschehen, welches mit dem Begriff der »Erziehung« beschrieben wird. Unter »Ethik« verstehe ich diejenigen Regeln, die mit Blick auf die Achtung der Persönlichkeitsrechte der Erzogenen und die Anerkennung ihrer Person im Erziehungsalltag eingehalten werden sollten.
Dieses Buch hat nur auf der sicheren Basis der andauernden Unterstützung, anteilnehmenden Begleitung und Ermutigung zustande kommen können, die mir meine Frau, Linde Liegle, geschenkt hat. Ihr danke ich an erster Stelle und widme ihr dieses Buch. Für klärende Gespräche und hilfreiche Anregungen danke ich außerdem Renate und Hans Thiersch, Hans-Ulrich Schnitzler und Richard Michaelis, Kurt Lüscher und Lothar Krappmann, Anton Stingl jun. und Benedikt Brändle, Sibylle Höger-Schmid und Ulrich Herrmann.
Teil I: Generationenbeziehungen im Kontext des Verwandtschaftssystems als Erfahrungsraum für Erziehungs- und Lernprozesse
Wie in der Einleitung angekündigt, spreche ich über Beziehungen zwischen Generationen in zwei Perspektiven: Zum einen geht es um die Beziehungen zwischen Familienmitgliedern; Beziehungen dieser Art – »familiale Generationenbeziehungen« – hat jede(r) von uns erlebt, zumindest in der Rolle des Kindes von Eltern, häufig auch in der Rolle eines Geschwisters oder auch in der Rolle eines Enkelkindes, im weiteren Lebenslauf auch in der Rolle von Eltern und Großeltern. Zum anderen geht es um die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden in den gesellschaftlich organisierten Bildungsinstitutionen (von Tageseinrichtungen für Kinder über Schulen bis hin zu Hochschulen); auch dieser Typus von Beziehungen – man könnte von »gesellschaftlichen Generationenbeziehungen« sprechen – hat, jedenfalls in unserem Kulturraum, jede(r) erlebt, zumindest als Schüler(in) im Rahmen der Pflichtschule. Für beide Typen von Generationenbeziehungen ist es kennzeichnend, dass sie für das Verhältnis zwischen Alt und Jung stehen. Dies gilt zwar nicht ausschließlich; denn die Generationenbeziehungen sowohl in Familien als auch in gesellschaftlichen Bildungsinstitutionen erstrecken sich nicht allein auf die Beziehungen zwischen Alt und Jung, sie betreffen auch die (intragenerationalen) Beziehungen zwischen Jung und Jung (Geschwister, Mitschüler/Innen, Mitstudierende). Dennoch liegen in der prinzipiellen Unterscheidung zwischen Alt und Jung sowie in der Ko-Existenz von Alt und Jung in den Kontexten sowohl der Familie als auch der gesellschaftlichen Bildungsinstitutionen die wichtigsten Begründungen dafür, Generationenbeziehungen als Ausgangspunkt und Schwerpunkt für die Erziehungstheorie im Allgemeinen sowie für meinen Entwurf einer Beziehungspädagogik im Besonderen zu wählen.
Die Aufforderung, die Goethe dem Faust in seinem gleichnamigen Schauspiel in den Mund legt: »Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen«, formuliert in aller Kürze und Prägnanz, worum es in der Pädagogik geht und warum Pädagogik, verstanden als (Reflexion der) soziale(n) und kulturelle(n) Praxis des Erziehens und Lernens, ein grundlegendes Element der menschlichen Gesamtpraxis bildet: Die Jahrtausende lange Kulturentwicklung, auf die wir Menschen zurückblicken können, ist nur dadurch möglich gewesen, dass in der Generationenfolge nicht nur die physischen, »natürlichen« Überlebens- und Lebensfähigkeiten vererbt worden sind; auch die Kulturfähigkeit und die in Jahrtausenden angesammelten Hervorbringungen und Gehalte der Kultur sind von Generation zu Generation »vererbt« worden. In Fausts Aufforderung ist allerdings nicht vom » Vererben« die Rede, sondern vom » Ererben«, und zwar deshalb, weil sich Fausts Aufforderung nicht an die ältere Generation richtet, die manches zu vererben hat, sondern an die junge Generation, die manches zu (er)erben hat; Fausts Aufforderung an die junge Generation beinhaltet, sich das Ererbte zu eigen zu machen, und zwar dadurch, dass sie das Ererbte nicht einfach passiv übernimmt, sondern dadurch, dass sie sich das Ererbte »erwirbt«; was hier mit »Erwerben« gemeint ist, können wir getrost mit »Aneignung« übersetzen und als »Lernen« verstehen. »Ererbt« wird – um nochmals Faust heranzuziehen – »von den Vätern«, ein Plural, der wohl auf die lange Generationenkette gemünzt ist, aus welcher die Mitglieder der jungen Generation hervorgegangen sind und an welche sie anschließen. Dieser Anschluss, durch welchen die Kulturentwicklung fortgesetzt und außerdem einem Wandel zugeführt werden kann, ist indes nicht gleichsam als ein »Selbstläufer« zu verstehen; vielmehr bedarf dieser Anschluss der Eigeninitiative und der Selbsttätigkeit der jeweils jungen Generation in Gestalt ihrer aktiven, konstruktiven Lernprozesse. Erst diese Lernprozesse setzen die junge Generation instand, das, was sie von ihren Vätern ererbt haben, zu »besitzen«, fortzusetzen und zu erneuern. Diese Lernprozesse, die ich früher, zusammen mit Kurt Lüscher, in der Perspektive des Modells des »generativen Lernens« analysiert habe (Liegle/Lüscher 2004), sind in zwei sozialen Kontexten situiert, von welchen im Sinne der Unterscheidung von familialen und Gesellschaftsgenerationen bereits die Rede gewesen ist: im Familien- bzw. Verwandtschatssystem und im öffentlichen Bildungs- bzw. Schulsystem. Wenn Faust (im obigen Zitat) von »Vätern« spricht, richtet sich das Augenmerk in erster Linie auf den sozialen Kontext Familie. Man könnte allerdings auch argumentieren, dass die ursprünglich ausschließlich im Familien- und Verwandtschaftssystem situierten Erziehungs- und Lernprozesse im Laufe der kulturellen Evolution immer mehr ergänzt und partiell auch ersetzt worden sind durch die Inthronisation »funktionaler Väter« in Gestalt von professionellen Erzieher/Innen und Lehrer/Innen, welche den Jungen als Vertreter/Innen der älteren (Gesellschafts-)Generation entgegentreten.
Wenn also gelten soll, dass der Anfangs- und Schwerpunkt der sozialen und kulturellen Praxis des Erziehens und Lernens in den Kontexten von familialen und Gesellschaftsgenerationen zu verorten ist, bleibt zu entscheiden, mit welchem Typus von Generationenbeziehungen die Analyse einsetzen soll. Ich habe mich für den Einstieg mit den familialen Generationenbeziehungen entschieden, und zwar insbesondere aus zwei Gründen:
Erstens prägen familiale Generationenbeziehungen nicht nur die Anfänge, sondern zudem so gut wie die gesamte Dauer des Lebenslaufs aller Individuen in (soweit wir wissen) allen Geschichtsepochen und in allen Kulturen, während die im öffentlichen Bildungssystem repräsentierten Beziehungen zwischen Gesellschaftsgenerationen nur einen bestimmten Ausschnitt des Lebenslaufs eines (wenn auch inzwischen sehr großen) Teils der Individuen in allen Teilen der Welt prägen.
Zweitens erweisen sich, wie zahlreiche Studien ergeben haben, die Erziehungs- und Lernprozesse im Kontext familialer Generationenbeziehungen als wirksamer im Vergleich zu den Erziehungs- und Lernprozessen im Kontext des Bildungssystems bzw. im Kontext der Beziehungen zwischen Gesellschaftsgenerationen, wirksamer zum Beispiel im Sinne der Übertragbarkeit des Gelernten auf andere als die ursprünglichen Lernkontexte sowie im Sinne der Nachhaltigkeit der Wirkungen des Gelernten im Rahmen der individuellen Lebensspanne. Diese Forschungsbefunde kann man versuchsweise dahingehend interpretieren, dass die Beziehungspraxis und die von dieser geprägten Erziehungs- und Lernprozesse eine Alltagsnähe und eine emotionale Tiefenstruktur (durchaus ambivalenter Natur) aufweisen, die in der Beziehungspraxis im öffentlichen Bildungssystem nicht im selben Ausmaß anzutreffen sind.
1 Familiale Generationenbeziehungen – biologische und kulturelle Grundlagen und Aufgaben
Von familialen Generationenbeziehungen kann man, wie bereits angedeutet, sagen, dass sie in so gut wie allen Geschichtsepochen und Kulturen verbreitet (gewesen) sind und die Lebensläufe aller Individuen geprägt haben bzw. prägen. Diese, wie man sagen könnte, universale Verbreitung, die sich im Übrigen auch auf die nichtmenschlichen Primaten erstreckt, kann man auch dahingehend interpretieren, dass die familialen Generationenbeziehungen nicht nur kulturelle, sondern auch biologische Grundlagen haben und biologische Aufgaben erfüllen. Daraus ließe sich ableiten, dass beides zusammengehören und zusammenwirken kann: biologische und kulturelle Grundlagen, biologische und kulturelle Aufgaben, universale Verbreitung und kulturspezifische Prägung. Am Beispiel von familialen Generationenbeziehungen lässt sich zeigen: Die These von der universalen Verbreitung eines sozialen Phänomens können wir nur dadurch empirisch prüfen, dass wir die Existenz dieses Phänomens in einer möglichst großen Zahl und Vielfalt von kulturellen Räumen und geschichtlichen Epochen nachweisen können. Andererseits führt, wenn man das Beispiel der Generationenbeziehungen heranzieht, die Empirie des interkulturellen und historischen Vergleichs zu der Erkenntnis, dass die untersuchten kulturübergreifenden sozialen Phänomene von kulturspezifischen Vorstellungen und Institutionalisierungsformen modifiziert werden. Um diese Zusammenhänge systematisch zu untersuchen, sind in letzter Zeit einige Konzepte entwickelt und erprobt worden. Zwei dieser Konzepte werde ich im Folgenden vorstellen und in der Perspektive der Generationenbeziehungen kurz erläutern. Im Anschluss daran werde ich auf die Frage des sozialen Wandels familialer Generationenbeziehungen eingehen.
Zwei Konzepte zur Aufklärung über den wechselseitigen Zusammenhang von biologischen und sozio-kulturellen Wurzeln der menschlichen Existenz und Entwicklung
Mithilfe des Konzepts der »kulturellen Natur der menschlichen Entwicklung« beschreibt Rogoff (2003) menschliche Entwicklung als einen kulturabhängigen Prozess. In dieser Perspektive entwickeln sich Individuen als an ihren kulturellen Gemeinschaften Beteiligte, indem sie sich zusammen mit anderen in gemeinsamen Vorhaben engagieren und dabei auf den kulturellen Praktiken früherer Generationen aufbauen. Im Rahmen der empirischen Prüfung ihres Konzepts kann Rogoff (2003) beispielsweise zeigen, dass der zentrale Stellenwert der frühen Mutter-Kind-Beziehung einerseits universal verbreitet zu sein scheint, andererseits aber in verschiedenen kulturellen Gemeinschaften und in verschiedenen geschichtlichen Perioden sich eine große Vielfalt in den Formen der Mutter-Kind-Beziehung und in der Gestaltung dieser Beziehung beobachten lässt. Dies gilt, um nur einige Belege anzuführen, für die Dauer des Stillens sowie Formen der Entwöhnung oder für Formen der Ergänzung der biologischen Mutter (z. B. indem sich mehrere Frauen oder der Vater oder ältere Geschwister oder sogar die gesamte Dorfgemeinschaft an den Betreuungsaufgaben beteiligen) oder deren Substituierung (z. B. durch eine Amme).
Mithilfe des Konzepts der »Koevolution von menschlicher Biologie und Kultur« beschreibt Tomasello (2010), dass und wie menschliche Existenz und Entwicklung in phylogenetischer ebenso wie in ontogenetischer Hinsicht gleichermaßen biologisch und sozial/kulturell begründet sind. In der Perspektive dieses Konzeptes sind die Menschen biologisch daran angepasst, in einem kulturellen Kontext aufzuwachsen und zu leben; außerdem schaffen sie sich eigene kulturelle Welten und passen sich diesen permanent an.
Wenn wir diese Konzepte auf die Untersuchung von Generationenbeziehungen anwenden, so können wir zunächst feststellen, dass es fruchtbar ist, Generationenbeziehungen als ein Produkt der Koevolution von menschlicher Biologie und Kultur zu betrachten. Diese Feststellung gewinnt an Überzeugungskraft, wenn wir uns klar machen, dass der Begriff »Generationenbeziehungen« sowohl auf biologische als auch auf soziale/kulturelle Phänomene und Aufgaben verweist: Dem griechischen Wort »genos« liegt das Verb »genesthai« zugrunde – es meint »ins Dasein gelangen« und umschreibt somit das Überschreiten der Schwelle zum Leben. Durch die Geburt eines Kindes wird eine neue Generation gebildet, die sich von jener der Eltern unterscheidet (vgl. Lüscher/Liegle 2003, S. 36). Während im allgemeinen wissenschaftlichen Diskurs Generationenbeziehungen ganz überwiegend als soziale Phänomene angesprochen werden, scheint deren biologische Bedeutung beispielsweise dann auf, wenn von »generativem Verhalten« oder »generativem Geschehen« die Rede ist.
Dass es fruchtbar ist, Generationenbeziehungen in der Perspektive des Konzepts der Koevolution von menschlicher Biologie und Kultur zu betrachten, ergibt sich des Weiteren aus folgenden Überlegungen: (Familiale) Generationenbeziehungen können als Ausdrucksformen der Institutionalisierung von Aufgaben begriffen werden, welche der Optimierung der Anpassung der Menschen an ihre je spezifische – partiell von ihnen selbst geschaffene – Umwelt dienen. Dabei lassen sich insbesondere drei Aufgaben benennen:
• die Aufgabe, eine neue Generation von Kindern ins Leben zu bringen – durch Zeugung und Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt;
• die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs überlebt – durch angemessene Ernährung, Pflege und Betreuung;
• die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs zur Enkulturation gelangen kann – durch die Teilnahme der Kinder am Alltagsleben der kulturellen Gemeinschaft, das Erlernen der gemeinsamen Sprache und das Hineinwachsen in die Traditionen und Werte, Gewohnheiten und Regeln der Gemeinschaft.
Es läge nahe, mit Blick auf die genannten Aufgaben zu unterscheiden zwischen solchen, die biologisch geprägt sind, und anderen, die eher sozial/kulturell geprägt sind. Indes hat bereits die Erläuterung des Konzepts der »kulturellen Natur« deutlich gemacht, dass beim Menschen auch alle biologischen Phänomene und Prozesse kulturell geprägt werden. Insofern erläutern und bestätigen sich die beiden ausgewählten Konzepte wechselseitig
2 Die Frage nach dem sozialen Wandel von familialen Generationenbeziehungen
In den öffentlichen Debatten stößt man immer wieder auf eine Katastrophenrhetorik, in der mit Blick auf moderne Industriegesellschaften z. B. vom »Krieg der Generationen« die Rede ist (z. B. Schirrmacher 2005). Diese Rhetorik bezieht sich ganz überwiegend auf die Gesellschaftsgenerationen, insbesondere auf die Zukunftsprobleme des sog. Generationenvertrags in der Rentenversicherung. Schon in dieser Hinsicht ist sie unberechtigt; denn viele Experten legen dar, dass die gar nicht zu leugnenden Probleme im Rahmen des bestehenden Systems lösbar sind, wenn man die demographischen Entwicklungen und Parameter in die Konstruktion der Rentenformel einbezieht.
Die Katastrophenrhetorik wird vollends absurd, wenn man sie auf die gelebten Generationenbeziehungen in den Familien überträgt: Alles verfügbare wissenschaftliche Wissen belegt eher das Gegenteil: Zwar gibt es in den wechselseitigen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen eine zunehmende Vielfalt von Formen und Qualitäten. Innerhalb dieser Vielfalt kann jedoch keine Rede sein von Krieg. Im Zeitvergleich sind im Gegenteil in den heutigen familialen Generationenbeziehungen mehr Frieden, weniger dramatische Konflikte, mehr Freundlichkeit, mehr wechselseitige Anerkennung und Unterstützung als in der näheren oder gar ferneren Vergangenheit zu beobachten.
Ein sprechendes Beispiel für den zeitgeschichtlichen Wandel der (familialen) Generationenbeziehungen in der bereits angedeuteten Richtung bietet die aktuelle » Vermächtnisstudie«, die gemeinsam von der Wochenzeitung DIE ZEIT, INFAS und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) durchgeführt worden ist (Allmendinger/Lorenzo/Smid 2016). Die Befunde zum Thementeil » Generationenbeziehungen« sind so unerwartet ausgefallen, dass sie unter dem provokativen Titel » Generation Gibtsnicht« veröffentlicht worden sind (Novotny u. a. 2016): Die Frage, ob gemeinsame Mahlzeiten wichtig seien, haben zwischen 80 Prozent (14–17-Jährige) und 89 Prozent (66 Jahre und älter) zustimmend beantwortet. Vollständig unabhängig von der Generationenzugehörigkeit finden demnach gemäß dem Ergebnis dieser Anfang 2016 publizierten Studie das zentrale Ritual der alltäglichen Beziehungspraxis von Familien, die gemeinsamen Familienmahlzeiten, wichtig.
Die Frage, wie diese gewissermaßen fortschrittliche Entwicklung erklärt werden kann, ist nicht leicht zu beantworten. Ich skizziere zwei Erklärungsversuche. Der eine besagt: Die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft und in der Welt im Ganzen Komplexität, Undurchsichtigkeit und Orientierungslosigkeit zunehmen, lässt das intime Beziehungssystem der Familie in verstärktem Maße zum Ankerplatz der Lebensführung und Lebensgestaltung der Menschen werden und fördert den Zusammenhang und Zusammenhalt zwischen den Familiengenerationen. Ein zweiter Erklärungsversuch besagt: Der zeitgeschichtliche Wandel der Eltern-Kind-Beziehungen – der Wandel zum Beispiel vom »Befehlshaushalt« zum »Verhandlungshaushalt« (vgl. Ecarius 2002) – entschärft den Kampf der jüngeren Generation um Anerkennung, entschärft die Konflikte um Autonomie und Individualität, begünstigt das Selbständigwerden und die allmähliche Ablösung von den Eltern. Es wird gelegentlich gesagt, diese Formen der Liberalisierung seien gleichbedeutend mit einem Verzicht der Eltern auf Erziehung, mit Verwöhnung oder auch Vernachlässigung der Kinder. Die vorliegenden Forschungsbefunde bestätigen dies nicht, jedenfalls nicht als Massenphänomen. Es trifft zwar zu, dass das Gefühl der Unsicherheit in Erziehungsfragen stark verbreitet ist und, ebenso wie die Suche nach Rat und Hilfe, zugenommen hat. Das braucht man aber nicht nur als einen Verlust, man kann es auch als einen Gewinn verbuchen, und zwar in dem Sinne, dass das erzieherische Handeln in verstärktem Maße selbstreflexiv geworden ist. Man kann in diesem Sinne auch die Tendenz erkennen, dass Erziehung heute anders verstanden wird als in früheren Zeiten, nämlich nicht mehr so sehr als Einwirkung, sondern vielmehr – wie es gewissermaßen zum Typ »Verhandlungshaushalt« passt – als Anregung und Herausforderung zur Selbsterziehung (z. B. Winterhager-Schmid 2001) oder, wie ich vorausgreifend sagen könnte: »beziehungspädagogisch« im Sinne einer reziproken sozialen Beziehungspraxis.
Solche Wandlungen in den gelebten Generationenbeziehungen sowie im Erziehungsverständnis sind im Übrigen auch in der Sphäre des Rechts entweder vorbereitet oder bekräftigt worden, dadurch zum Beispiel, dass im Familienrecht nicht mehr von »elterlicher Gewalt«, sondern stattdessen von »elterlicher Sorge« die Rede ist, und dadurch, dass Gewalt in der Erziehung sanktioniert wird.
Über das Gesagte hinaus gibt es in den Beziehungen zwischen Familiengenerationen ein Phänomen, das in der Öffentlichkeit und in den Medien viel zu wenig berücksichtigt oder aber einseitig negativ bewertet wird: Es ist viel die Rede von der alternden Gesellschaft, und dies wird mit Nachteilen für die junge Generation in Verbindung gebracht. Demgegenüber wird häufig übersehen, dass in der gestiegenen Lebenserwartung – und damit in der längeren gemeinsamen Lebenszeit der Familiengenerationen – auch eine Chance der Bereicherung des Aufwachsens von Kindern liegt. Es hat noch keine Kindergeneration gegeben, die so gut wie alle ihre Großeltern (und darüber hinaus auch nicht selten Urgroßeltern) im Rahmen einer so langen gemeinsamen Lebenszeit erlebt haben wie die heutige Kindergeneration – und bei diesem Erleben handelt es sich nicht nur um eine Möglichkeit, sondern um gelebte und erlebte soziale Wirklichkeit: 80 Prozent der Kinder haben regelmäßig Verbindung mit ihren Großeltern, diese wohnen im gleichen Haus, in unmittelbarer Nachbarschaft, am gleichen Ort oder an einem nahegelegenen Ort (vgl. Lauterbach 1998). Bis zum Schuleintritt sind Großeltern nach den Müttern und vor den Erzieherinnen und lange vor den Vätern die wichtigsten Betreuungs- und Bezugspersonen der Kinder.
Mit diesen Hinweisen will ich den Mehrgenerationenverbund nicht verklären. Er ist jedoch eine soziale Tatsache, die – ebenso wie der skizzierte soziale Wandel der Eltern-Kind-Beziehung – das Gerede vom Verfall der Familie, von der Erziehungskatastrophe, vom Erziehungsnotstand oder vom Krieg der Generationen Lügen straft.
3 Eltern-Kind-Beziehungen
Einer der Schlüsselsätze zur Begründung einer »Beziehungspädagogik« lautet nach meiner Auffassung: »Die Familie ist, trotz ihres problematischen Status, der soziale Ort, an dem sich im Regelfall die ersten Schritte der Menschwerdung vollziehen« (Mollenhauer 1983, S. 416). Familie, gekennzeichnet als Lebensgemeinschaft und personorientierte Kommunikationsgemeinschaft, als ein sozialer Ort, der gerade nicht auf Erziehung spezialisiert ist, stellt offenbar eine für die primäre Sozialisation, für die »ersten Schritte der Menschwerdung« (Mollenhauer), für »Soziabilisierung« (Claessens 1962) notwendige soziale Umwelt des Kindes dar. Die Ausbildung der Grundlagen von Handlungsfähigkeit scheint auf das gemeinsame Leben in einer sozialen Figuration vom Typus der Familie angewiesen zu sein. An einige relevante Theoriepositionen, die in der Erziehungswissenschaft rezipiert worden sind, ist in diesem Zusammenhang zu erinnern:
• zum Beispiel die psychoanalytische Entwicklungstheorie: Libidinöse Bindung und Identifikation im Rahmen einer dyadischen Objektbeziehung bilden nach Freud (1953) die Grundlage der Ausbildung des Über-Ichs und der Entwicklung des Ichs; die Bildung von Identität im Lebenszyklus, so Erikson (1966), nimmt ihren Anfang in der Bildung von Urvertrauen im Rahmen einer dyadischen Beziehung und setzt sich fort in einem stetig sich in Gestalt konzentrischer Kreise erweiternden sozialen Raum; Symbiose, so Margaret Mahler (1979), geht der Individuation voraus;
• zum Beispiel die kognitionspsychologische Entwicklungstheorie: Piaget spricht von einer »vollständige(n) Kontinuität« zwischen dem Leben der Eltern und der persönlichen Aktivität des Kindes: »Wie wir im Zusammenhang mit der Magie gesehen haben, muss das Kind, dessen ganze Aktivität von der Wiege an mit einer komplementären Aktivität seiner Eltern verbunden ist, in seinen ersten Lebensjahren mit dem Eindruck leben, es sei fortwährend von wohlwollenden Gedanken und Aktionen umgeben. Es muss ihm so vorkommen, als wäre jede seiner Intentionen seinen Angehörigen bekannt und als würde sie von diesen geteilt« (Piaget 1978, S. 130 und 200);
• zum Beispiel die struktur-funktionalistische Sozialisationstheorie: das Lernen der grundlegenden Rollen von Alter und Geschlecht geschieht nach Parsons zunächst partikularistisch, d. h. durch Identifikation mit der bestimmten Mutter und mit dem bestimmten Vater (Parsons/Bales 1955);
• zum Beispiel Vygotski (2003), der im Rahmen seines kulturhistorischen Ansatzes der Entwicklungspsychologie vom »Ur-Wirgefühl« spricht (zit. in Keiler 2002, S. 277 f.);
• zum Beispiel die evolutionäre Psychologie: im Rahmen seiner »Naturgeschichte des menschlichen Denkens« spricht Tomasello unter dem Aspekt der Ontogenese davon, dass »young children begin collaborating and communicating cooperatively with others with a second-personal orientation – through direct participation with specific other individuals« (Tomasello 2014, S. 144);
• zum Beispiel, schließlich, die systemtheoretische Position Luhmanns: Der familialen Sozialisation kommt eine besondere Bedeutung zu, »weil sie von einem System ausgelöst wird, das darauf eingestellt ist, die gesellschaftliche Inklusion ganzer Personen zu ermöglichen … So wächst man zunächst in eine Welt hinein, in der die Person zählt« (Luhmann 1988, S. 86).
Die Institutionalisierung der Eltern-Kind-Beziehung in Gestalt verschiedener Ausprägungen von »Familie« kann als ein Paradebeispiel für die Koevolution von Biologie und Kultur gelten. Unter Aspekten der biologischen Evolution rückt die Tatsache ins Blickfeld, dass die grundlegende Bedeutung der Mutter- bzw. Eltern-Kind-Beziehung auch für die uns Menschen am nächsten stehenden Primaten gilt, wie Harry und Margaret Harlow am Beispiel von Rhesusaffen nachgewiesen haben (Harlow 1961und 1972; Harlow/Harlow 1977). Aus diesen und weiteren Forschungsbefunden lässt sich schließen, dass sich die Institutionalisierung der Eltern-Kind-Beziehung als vorteilhaft für das Überleben der Primaten und für ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umweltbedingungen erwiesen hat (vgl. z. B. Dunbar 2014). Ohne ein seinerzeit noch nicht verfügbares einschlägiges wissenschaftliches Wissen, eher spekulativ hat Georg Simmel in dieser Perspektive argumentiert, es erscheine ihm »unzweifelhaft, dass der feste Kern, um den die Familie herumgewachsen ist, nicht das Verhältnis zwischen Mann und Weib, sondern zwischen Mutter und Kind ist; dies ist der ruhende Pol in der Flucht der Erscheinungen des Ehelebens, die im wesentlichen überall gleiche Beziehung, während die zwischen den Gatten unendlicher Wandlung fähig ist« (Simmel 1895/1985, S. 126). Auf den damit angedeuteten Zusammenhang zwischen (beziehungs-)pädagogischen und evolutionstheoretischen Denkformen werde ich in Kapitel II/12 kurz und im abschließenden Teil VIII in differenzierter Form zu sprechen kommen.
Unter Aspekten der kulturellen Evolution rücken die Tatsachen ins Blickfeld, dass die sozialen und affektiven Formen der Eltern-Kind-Beziehung eine kulturabhängige große Vielfalt aufweisen (vgl. Keller 2011, Lamm/Keller 2010, Otto/Keller 2012; Rogoff 2003) und dass es jenseits der Eltern-Kind-Beziehung weitere im Verwandtschaftssystem oder auch innerhalb einer Dorfgemeinschaft angesiedelte soziale Beziehungskontexte gibt, wie beispielsweise Kinderspielgruppen, die auch Betreuungs- und Erziehungsaufgaben übernehmen.
Die Überzeugung, dass Familienbeziehungen und Familienerziehung, wie Mollenhauer formuliert hat, die »ersten Schritte der Menschwerdung prägen«, ist insbesondere durch Befunde der » Bindungsforschung« vielfach bestätigt worden (z. B. Ahnert 2014; Grossmann/Grossmann 2003 und 2001).
3.1 »Bindung«: Elementare Formen der Liebe. Sorge (care) als elementare Form von »Erziehung«
Das Konzept »Bindung« beschreibt eine elementare Form der Liebe, die zwischen bzw. jenseits der von Prange (2013) unterschiedenen Formen der » Liebe als Passion« und » Liebe als Aufgabe« anzusiedeln ist: »Bindung« meint eine intime wechselseitige Beziehung, die man insbesondere dann als eine gewissermaßen symbiotische Beziehung kennzeichnen kann, wenn die Rede vom Bindungsgeschehen die Zwei-Einheit von Mutter und Kind während der Schwangerschaft einschließt. Entsprechendes gilt aber auch im Hinblick auf das intime Beziehungsgeschehen des Stillens. Im Konzept der Bindung sind insofern Berührungspunkte zu Pranges Begriff der »Liebe als Aufgabe« anzunehmen, als im Bindungsverhalten der Mutter und anderer bedeutsamer Bezugspersonen des neugeborenen Kindes die Wahrnehmung einer grundlegenden Aufgabe zum Ausdruck kommt; einer Aufgabe, welche bei den nicht-menschlichen Primaten als » Brutpflege« beschrieben wird; eine Verantwortung, welche die umfassende, lebenserhaltende Sorge für das von der Unterstützung durch Erwachsene noch für längere Zeit abhängige neugeborene Kind beinhaltet. Insofern kann man das Bindungsverhalten der Eltern bzw. die »Sorge« um das Kind von seiten der Eltern und weiterer bedeutsamer Bezugspersonen des Kindes als die elementarste Form der Erziehung verstehen; begrifflich wird diese Sorge für Kinder gelegentlich unter dem Begriff der » Betreuung« subsumiert, häufiger jedoch findet in den letzten Jahrzehnten der Begriff »Sorge« (vgl. z. B. Hering/Schröer 2008) sowie der aus dem angelsächsischen Sprachbereich übernommene Begriff »caring« bzw. » care« Verwendung (vgl. z. B.Wolf/Dietrich-Daum 2013). Die Begriffe der Sorge bzw. des caring oder care umschreiben, wie bereits bei der Erläuterung des Bindungskonzeps angedeutet, die umfassende Verantwortung für den von Unterstützung und Hilfe abhängigen Nachwuchs. Diese Form der Verantwortung lässt sich umschreiben als ein auf Angewiesenheit antwortendes Handeln (z. B. Liegle/Liegle 2008, S.109); dies trifft insbesondere für die elterliche Sorge für Kinder in den Anfängen des Lebenslaufs zu. Die Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung ist nach Hans Jonas (1979, S. 85) »die einzige von der Natur gelieferte Klasse völlig selbstlosen Verhaltens, und in der Tat ist dieses … Verhältnis zum unselbständigen Nachwuchs der Ursprung der Idee der Verantwortung überhaupt, und seine ständig fordernde Handlungssphäre ist der ursprünglichste Ort ihrer Betätigung«. Da die nachgeburtliche Sorge für Kinder nicht zuletzt körperliche bzw. leibliche Komponenten aufweist (beispielsweise, abgesehen vom Stillen und anderen Formen der Ernährung, Zuwendung und Zärtlichkeit), kann es nicht überraschen, dass »Mütter« und »Mütterlichkeit« zu weit verbreiteten Metaphern für die Wahrnehmung von Verantwortung, für das Da-Sein für Andere, für »weibliche Moral« (z. B. Noddings 1984) und auch für menschliche Moral im Ganzen (z. B. Hrdy 2010) geworden sind. Mein Vorschlag, in diesem Zusammenhang von einem »auf Angewiesenheit antwortenden Handeln« zu sprechen (vgl. Liegle/Liegle 2008, S. 109), war ausdrücklich auf das Säuglingsalter bezogen. In einer erweiterten, den gesamten Lebenslauf betreffenden Perspektive lässt sich diese Rede vom »antwortenden« Verhalten und Handeln ganz allgemein zu dem Konzept » Erziehung als Antwort« ausbauen (vgl. insbesondere Masschelein 1996 und Ricken 1999, S. 314 ff); dieses Konzept bildet ein fruchtbares Element innerhalb meines Konzepts der Beziehungspädagogik; es geht nämlich davon aus, dass es im Hinblick auf die Theorie, die Erforschung und die Praxis des Erziehens und Lernens fruchtbar ist, alle Formen der Erziehung als Antworten nicht nur auf explizite Fragen, sondern auf Signale und Bedürfnisse, Ansprüche und Rechte der jeweiligen Adressaten, unabhängig von ihrem Lebensalter, zu verstehen.
Die Theoriebildung und Forschung, die sich am Konzept der »Bindung« orientiert, ist insbesondere in ihren Anfängen sehr stark von psychoanalytischem Gedankengut bestimmt worden (vgl. z. B. Ahnert 2014; Grossmann/Grossmann 2003); daraus erklärt sich die Konzentration auf die emotionale (nicht selten unbewusste) Seite des Beziehungsgeschehens zwischen dem neugeborenen Kind und seinen engsten Bezugspersonen (»Objektbeziehungen«). An diese Wurzeln und Akzentsetzungen gilt es anzuschließen, wenn man sich mit Bindungstheorie und Bindungsforschung befasst. Ergänzend will ich jedoch eine Sichtweise ansprechen, welche das Bindungsgeschehen als einen komplexen und dialogisch angelegten Lernprozess interpretiert und diesen Lernprozess als genuine Aufgabe der familialen Generationenbeziehungen begreift. Das in dieser Perspektive entwickelte Konzept des »Generationenlernens« (Liegle/Lüscher 2004) beinhaltet die Annahme, dass die Erfahrung und Gestaltung familialen Generationenbeziehungen spezifische Lernerfahrungen ermöglicht und erfordert. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ist mit der Psychoanalyse ein Theoriegebäude begründet worden, das den frühen nachgeburtlichen Prägungen große Aufmerksamkeit schenkt; hier liegt die Wurzel der so genannten Bindungstheorie. Man kann sie – vereinfachend – auch als eine allgemeine Lerntheorie lesen. Allerdings geht es hier primär um die (»vertikalen«) intimen Beziehungen zwischen Kind und Eltern sowie deren Institutionalisierung in Formen der Familie.
Kennzeichnend für die psychoanalytisch orientierten Ansätze ist deren Affinität zu kausalen Denkfiguren; es wird angenommen, dass frühe Prägungen sich als »Grund« für Verhaltensweisen auch in späteren Lebensphasen erweisen, und dass – umgekehrt – diese mit sukzessiver Offenlegung früherer Lernerfahrungen und deren Sedimentierung erklärt oder jedenfalls gedeutet werden können. Das Bindungsgeschehen ist für das »Generationenlernen« zunächst deshalb relevant, weil es seinen Ausgangspunkt in der Beziehung zwischen Mutter und Kind, also einem Generationenverhältnis, hat; einer der ersten und wichtigsten Forscher zu Fragen der Bindung und der Deprivation hat dieses Beziehungsverhältnis als »Dialog« beschrieben (Spitz 1982).
Die Bindungstheorie und die an diese anschließende Forschung hat überzeugende Belege für die Auffassung erbracht, dass Eltern-Kind-Beziehungen spezifische Merkmale aufweisen können: Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit und Reziprozität, und dass der Erfahrung von Beziehungen, die durch diese Qualitätsmerkmale geprägt sind, eine besondere Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung zukommt, und zwar auch in späteren Lebensphasen (siehe dazu Berman/Sperling 1994 sowie Grossmann/Grossmann 2001). »Verlässlichkeit« meint in diesem Zusammenhang, dass sich das Kind der fürsorglichen Nähe der Eltern sicher sein kann und die Chance hat, Vertrauen in die Welt sowie in die eigene Person (Selbstwertgefühl) zu entwickeln. »Dauerhaftigkeit« beschreibt die Gewissheit, dass die Erfahrung von Verbundenheit zeitliche Kontinuität aufweist und auch im Durchgang durch Krisen fortbesteht. »Reziprozität« ist kennzeichnend für einen Typ von Beziehungen, der auf wechselseitiger Verbundenheit beruht und auf wechselseitiges Geben und Nehmen hin angelegt ist; auf Seiten der Eltern impliziert dies – in Verbindung mit dem Merkmal der Dauerhaftigkeit – die Überzeugung, dass nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft – wenn die Eltern selber in höherem Alter der Fürsorge bedürfen – ihre Liebe und Fürsorglichkeit beantwortet wird.
Die hier vorgenommene Beschreibung von spezifischen Merkmalen der Eltern-Kind-Beziehungen verstehe ich idealtypisch: Ich kennzeichne Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit und Reziprozität als Prinzipien der Gestaltung und Erfahrung von familialen Generationenbeziehungen, unterstelle jedoch nicht, dass alle Eltern-Kind-Beziehungen diese Prinzipien erfüllen. Andererseits sind diese Prinzipien nicht lediglich als Ausdruck subjektiver Empfindungen und Gewissheiten zu betrachten; sie werden im Rahmen der kulturellen Evolution als Anpassungsvorteil bestätigt (vgl. z. B. Gamble/Gowlett/Dunbar 2016; Hrdy 2010; vgl. auch Teil VIII), und sie erfahren durch Formen der rechtlichen Regulierung (elterliche Sorge, wechselseitige Unterstützung) eine institutionelle Unterstützung, die auch ihren Aufgabencharakter bestimmt.
Beim heutigen Stand der Forschung wird außerdem deutlich, dass eine sozio-kulturelle Vielfalt in der konkreten Ausgestaltung der genannten Prinzipien besteht und dass frühe Erfahrungen zwar nachhaltige Konsequenzen zeigen, dass diese aber auch modifiziert oder, bei frühzeitiger Intervention, auch aufgehoben werden können. Knapp zusammengefasst kann man die Prämissen der Bindungstheorie wie folgt umschreiben:
• Beziehungserfahrungen zwischen dem Säugling und seiner Mutter (bzw. anderen festen Bezugspersonen) prägen die Bereitschaft und Fähigkeit des Kindes zur »Exploration« seiner Umwelt (z. B. Grossmann/Grossmann 2006).
• Beziehungserfahrungen zwischen dem Säugling und seinen Bezugspersonen prägen die weitere Persönlichkeitsentwicklung.
• Es lassen sich verschiedene Typen der Beziehungsgestaltung (»sicher«, »unsicher-vermeidend«, »unsicher-ambivalent«, »desorganisiert«) unterscheiden, deren unterschiedliche Qualitäten die spätere Beziehungsfähigkeit beeinflussen.
• Die verschiedenen Bindungsstile, die sich gemäß dieser Theorie in »inneren Repräsentationen« (»Arbeitsmodellen«) niederschlagen, bleiben über die gesamte Lebensspanne relativ konstant.
• Ein bestimmter Bindungsstil kann von einer Generation zur anderen weitergegeben werden.
Unter dem Gesichtspunkt des Generationenlernens ist der zuletzt genannte Gesichtspunkt besonders bemerkenswert. So haben einige Studien gezeigt, dass erwachsene Kinder mit einem sicheren Bindungsstil eine drei- bis viermal so hohe Wahrscheinlichkeit haben, ihren Kindern ebenfalls einen sicheren Bindungsstil zu vermitteln (Fonagy 1996, S. 138), oder dass ein Zusammenhang von 82% zwischen dem Bindungsstil der Mutter und dem des Kindes und von 65% zwischen dem der Großmutter, der Mutter und dem Kind besteht (Benoit/Parker 1994, S. 1454).
Eine interessante und anregende Konkretisierung der Vorstellung, das Bindungsgeschehen in frühester und früher Kindheit könne als ein Lerngeschehen begriffen werden, findet sich in den Überlegungen des bekannten Hirnforschers Wolf Singer ( Kap. II/10