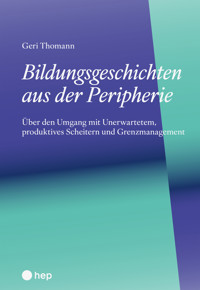
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen. Widersprüchlichkeit ist im Bildungsalltag die Regel und Reibungslosigkeit die Ausnahme. Damit wäre die Entstehung von Komplexität nicht als ungewollter Nebeneffekt einer geordneten oder zu ordnenden Welt zu verstehen, sondern vielmehr als Form der Welt selbst. Umgang mit Unerwartetem und Grenzerfahrungen sind dabei zentrale professionelle Herausforderungen und Scheitern wird in der Retrospektive nicht selten zum bedeutsamen produktiven Wegweiser. Die Peripherie wird dadurch zum neuen Kern. Davon handeln die Geschichten und Texte in diesem Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geri Thomann
Bildungsgeschichten aus der Peripherie
Über den Umgang mit Unerwartetem, produktives Scheitern und Grenzmanagement
ISBN Print: 978-3-0355-2860-2
ISBN E-Book: 978-3-0355-2861-9
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 hep Verlag AG, Bern
hep-verlag.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Umgang mit Unerwartetem
Die Welt ist klein
Improvisieren in der Bildungsarbeit – Verlegenheitslösung oder Kunst des Umganges mit Unerwartetem?
Arbeit mit Metaphern in (Bildungs-)Organisationen
Eine nicht alltägliche Liebeserklärung
Managing the unexpected – Umgang mit Ungewissheiten und Unvorhersehbarem in Organisationen der Bildung und des Gesundheitswesens
Vertrauen und produktives Zweifeln im organisationalen Kontext
Haben Sie heute schon gelernt?
Dilemmata, Paradoxien und Ambivalenzen: Führen als Sicherheitsproduktion in unvorhersehbaren Situationen
Jazz als Metapher für Führung und Organisation – die Illusion der Planbarkeit
In Taka-Tuka scheint immer die Sonne
Produktiv scheitern
Laut knirscht der Schnee
Weshalb die Pädagogik nicht auf Scheitern eingestellt ist
(Produktives) Scheitern in der Hochschulbildung
Können Sie scheitern?
Die Schule riecht
Das Scheitern von Beratungen – Risiko und Verantwortung in pädagogischen Arbeitsfeldern
Innenbilder von Gymnasien: Kultur, Organisation und Scheitern
Wider alles Eigentliche und für den Grund
Grenzmanagement: Über Grenzen, Tore und Brücken
Kea
Peripheriekompetenzen und deren Funktion in der Bewältigung von Unerwartetem in Expert:innenorganisationen
Die Praxis wartet nicht auf Theorien
«Leerer sind Kübellehrer»
Beratung in Erwachsenenbildung und Weiterbildung – Spannungsfelder zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Über Transformationen: Abschließen und Beginnen
Späher:innen und Grenzwächter:innen
Schluss
Schlusspunkt
Der Autor
Für alle, die meine Pädagogik immer wieder produktiv durcheinander- und weiterbrachten: meine beiden Töchter, Vera und Laura, meine Lebensgefährtin, Ursula Gubler Thomann, meine Sonderklassenschüler:innen in Urdorf, die Weiterbildungsteilnehmenden an der aeB Akademie für Erwachsenenbildung, die Klient:innen meiner Beratungen, die Studierenden meiner Beratungsmodule an der Hochschule für Angewandte Psychologie der FHNW, die Mitarbeitenden, Kolleg:innen und Weiterbildungsteilnehmenden an der PH Zürich.
Einleitung
In der Retrospektive beschäftigten mich während meiner beruflichen und privaten pädagogischen Tätigkeit stets dieselben drei Themen: der Umgang mit Unerwartetem und Unvorhersehbarem, das (produktive) Scheitern und die Funktion von Grenzen und Grenzerfahrungen (die ich Grenzmanagement nenne). Im vorliegenden Buch versammeln sich unveröffentlichte und veröffentlichte Texte aus über 30 Jahren Bildungsarbeit. Es handelt sich dabei um Kolumnen, Referate, Blog-Beiträge, Artikel und Beiträge in Sammelbänden. Die Auswahl der Texte erfolgte nach den oben genannten drei inhaltlichen Kriterien. Der Entstehungskontext der Texte steht in engem Zusammenhang mit meinen pädagogischen Aktivitäten, sei dies als Vater von zwei Töchtern, als langjähriger Sonderklassenlehrer/Schulischer Heilpädagoge, als Ausbildner von Erwachsenenbildner:innen und Beratungsfachleuten, als selbstständiger Organisationsberater und Coach oder als Dozent und Führungsperson im Hochschulbereich. Diese unterschiedlichen Kontexte erschweren eventuell gelegentlich die Konsistenzwahrnehmung dieses Lesebuches – manchmal sind die Texte eher theoretisch, manchmal «aus dem Leben gegriffen» (wie die eingestreuten Geschichten). Und doch tauchen für mich dieselben Themen und Herausforderungen in allen beschriebenen Kontexten immer wieder auf. Der für das Lesen notwendige Perspektivenwechsel soll deutlich machen, dass Bildungsarbeit nicht an Stufen, Zeiten oder Kategorien gebunden ist. Der Kontext und die Sprache mögen verschieden sein, der Sinn ist derselbe, Grundfragen und Phänomene bleiben in ihrer Bedeutung und Relevanz gleich.
Die Texte lesen sich gut separat, durcheinander oder lose gekoppelt – manchmal werden Sie als Leser:in Redundanzen entdecken, ich habe sie absichtlich so stehen lassen. Sie ergeben in verschiedenen zusammenstellbaren «Formationen» ein farbiges Bild von sinnvoller, spannender, herausfordernder und bereichernder Bildungsarbeit – voll von Unvorhersehbarkeiten, (scheinbaren) Misserfolgen und Grenzerfahrungen. Eben Bildungsgeschichten aus der Peripherie.
Bei einer Zweitveröffentlichung wurde jeweils die Erlaubnis der Erstherausgeber:innen eingeholt – sofern das betreffende Medium oder die betreffende Organisation noch existiert. Ältere Texte wurden im Wesentlichen nur hinsichtlich Gendering überarbeitet.
Der Pädagogischen Hochschule Zürich danke ich für die Abtretung der Nutzung meiner Texte, die im Rahmen meiner Anstellung entstanden sind.
Bei den Referaten wurden keine Anpassungen oder Kürzungen vorgenommen, sie wurden mit ihrer mündlichen Orientierung in der Originalanlage belassen.
Geri Thomann
Umgang mit Unerwartetem
Über vertauschte Rollen, sich wendende Blätter, Unvorhersehbarkeiten im Bildungsalltag, simultane Wirklichkeiten, Improvisationen nicht nur als Gegenspieler von Geplantem, die Kraft von Metaphern, Variationen des Denkens und Handelns, Knowing in Action, über Geschichten und Erzählungen als (anderes) Tor zur Wirklichkeit, Kinderwirklichkeiten und deren Potenzial, über Vertrauen und Misstrauen in Organisationen, Dilemmata, Paradoxien und Ambivalenzen, Resilienz in Krisensituationen, achtsames Organisieren, den Jazz als Metapher für Führung und das gestohlene Meer.
Die Welt ist klein
Als ich, schon ziemlich nervös geworden, zum dritten Mal hintereinander in den unterirdischen S-Bahn-Hallen des Hauptbahnhofs Zürich meine Kreditkarte in den Automatenschlitz steckte, um nun endlich die richtige Codenummer einzugeben, tippte mich jemand von hinten grob an meine Schulter und fragte: «Ist das Ihre Kreditkarte?» Erschrocken drehte ich mich um und gewahrte vor mir in Uniform, mit Knüppel und Hund – meinen ehemaligen Schüler L. «Oh, hallo, Herr Thomann», stammelte dieser sichtlich verlegen, als er mich erkannte. Die alten Rollen hatten uns schnell wieder und wir sprachen eine Weile miteinander. L. hatte eine verdammt schwierige Schulzeit: Elf Jahre in Sonderklassen, überall der kleinste und schwächste Schüler, geplagt und drangsaliert. In den Jahren bei mir machte ihm vor allem N. zu schaffen. N. war ein kräftiger, schlauer und ziemlich brutaler Bursche. Ich erinnere mich gut daran, wie ich L. wohl dutzende Male aus dem Dornengebüsch vor unserem Schulhaus befreite, in welches N. ihn befördert hatte, bis der Schulhauswart das unselige Gestrüpp endlich entfernte. Übrigens wollte L. immer Polizist werden. N. ging es schon seit längerer Zeit schlecht, er steckte tief im Drogensumpf – das wusste ich. Ich wusste aber nicht, dass L. allabendlich N. aus dem Bahnhofsareal vertrieb – wenn es sein musste, mit Gewalt, wie L. mir sagte. N. bettelte nämlich jeweils sehr aufdringlich um Geld. Mir wurde elend bei dieser Schilderung von L. Die Welt ist klein: Das unterirdische S-Bahn-Areal kam mir vor wie mein altes kleines Schulzimmer in Urdorf. Aus den Kindern L. und N. waren Erwachsene geworden, die sich immer noch bekämpften und einander immer noch irgendwie brauchten – nur die Rollen waren vertauscht; für L. hatte sich «das Blatt gewendet», wie er sich ausdrückte. L. sehe ich seither hin und wieder und ich bin übrigens ehrlich davon überzeugt, dass er seine Arbeit als Wachmann sehr gut macht.>
Aus: «KSH (Konferenz Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Kantons Zürich) informiert», Nr. 4, November 1994.
Improvisieren in der Bildungsarbeit – Verlegenheitslösung oder Kunst des Umganges mit Unerwartetem?
Referat am Konvent der Musikschule Zug vom 16.08.2021
Gegenreden
«Improvisation?
Braucht es für Orientierungslosigkeit neuerdings eine andere Bezeichnung?»
«Improvisation legitimiert nachträglich selbstverschuldete Pannen.»
«Improvisation dient als Feigenblatt für Dilettantismus.»
«Improvisation in der Bildung ist die Folge von Budgetkürzungen.»
«Improvisieren dürfen nur Meister:innen ihres Fachs.»
«Improvisation ist ein intransparentes Mittel zur Einschüchterung und zur Machtausübung: Auf Unvorhersehbares können sich Lernende nicht vorbereiten.»
«Wäre man mit Improvisation auf den Mond gekommen?»
«Improvisation verursacht Chancenungleichheit – die einen können es, die anderen nicht.»
«Improvisation ist Ausweichmanöver sowie Zeichen von Unverbindlichkeit und Verantwortungslosigkeit.»
«Improvisieren führt aufs Glatteis.»
(Aus Thomann und Honegger 2021)
«Ja, mach nur einen Plan
Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch ’nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.»
(Bert Brecht 1975, S. 77)
Einleitung
Liebe Träger:innen der Musikschule Zug, erschrecken Sie nicht – die eben eingeblendeten Zitate sind konstruierte «Gegenreden» und sollen uns im Verlaufe der Beschäftigung mit dem Thema «Improvisieren» als Prüfsteine gegen Ideologisierungen dienen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich auch in meinem Namen zu dieser Veranstaltung und freue mich, hier einen Beitrag leisten zu können, vielen Dank für diese Möglichkeit.
Ich spreche im Folgenden nicht als Musikexperte oder als Musiker zu Ihnen, sondern als Pädagoge und Bildungsexperte. Auch wenn ich mich als leidenschaftlichen Zuhörer und gelegentlichen Amateurmusiker bezeichnen würde. Zugegebenermaßen eher im Genre Jazz. Entschuldigen Sie als Expert:innen in der Vermittlung von Musik daher, dass ich den musikalischen Begriff der Improvisation nicht beleuchte – ich weiß hier schlicht zu wenig. Wahrscheinlich bedeutet Improvisation für Sie als Musiker:innen spontan entstehendes Tonmaterial, das nicht vor dem Spiel schriftlich fixiert worden ist. Ich beschäftige mich aber seit Längerem eher mit der Frage der Bedeutung von Improvisation in der Bildungsarbeit. Wenn nun der Begriff Improvisation fällt, bitte ich Sie somit, nicht in erster Linie an die musikalische Improvisation zu denken, sondern an die Improvisation in Ihrer Bildungsarbeit. Wobei es da trotzdem interessante Verbindungen geben könnte …
Es ist bemerkenswert, dass der Begriff der Improvisation gleichzeitig mit einer bestimmten Tagung Eingang in die Organisations- und Führungstheorien gefunden hat, und zwar durch eine Tagung, die der Organisationswissenschaftler Karl Weick 1995 in Vancouver organisierte. Ich werde ihn hin und wieder in meinem Referat zitieren. Die Tagung hieß «Jazz as a metaphor for organizing in the 21st century». Man sprach damals von einem regelrechten «improvisational turn» in Führungs- und Organisationstheorien und versuchte, Kompetenzen von Jazzcombos auf Führungssituationen zu übertragen.[1]
Wenn Sie also Erfahrungen in musikalischer Improvisation haben sollten, könnte es interessant sein, im Verlaufe meiner Ausführungen oder danach mögliche und unmögliche Transferschlüsse zu Ihrer Unterrichtsgestaltung zu ziehen. Denn um diese geht es heute in erster Linie.
Übersicht
Einleitung
Die Kunst der situativen Programmabweichung – alltägliche pädagogische Praxis
Improvisation in der Bildung
Zugänge zu Improvisation
Improvisationskompetenz
Planungsverhalten für komplexe Bildungssituationen – reflexive Kompetenz als Schlüssel für die Nutzung des Potenzials von Situationen
Fazit: Improvisieren ist keine Verlegenheitslösung und setzt konstruktiven Umgang mit Unerwartetem voraus.
Die Kunst der situativen Programmabweichung – alltägliche pädagogische Praxis
Ich gehe mal davon aus, dass Sie in Ihrem Unterrichtsalltag täglich improvisieren: Eine Schülerin ist krank – verschieben Sie die Stunde, lassen sie sie ausfallen, nehmen Sie spontan einen anderen Schüler an die Reihe? Oder: Ein Schüler hat nicht geübt, was er sollte, Sie müssen das Programm umstellen. Oder: Die tragenden Solist:innen in Ihrem Orchester kommen zu spät, warten Sie oder beginnen Sie schon ohne diese? Oder: Sie müssen während einer Einstiegsphase Ihre neue Schülerin mit ihren Kompetenzen und ihrem Potenzial einschätzen, Dinge ausprobieren, verwerfen, bis die Möglichkeiten deutlich werden. Oder: Ein Schüler ist total überfordert, beginnt zu weinen, erzählt von Schwierigkeiten in der Schule oder der Familie; Sie müssen reagieren. Oder: Eine Schülerin kommt einfach nicht mehr in Ihre Unterrichtsstunden; wie nehmen Sie Kontakt zu ihr oder ihren Eltern auf? Oder: Sie erklären einem Schüler seit drei Monaten den punktierten Viertel und er will es einfach nicht verstehen, obwohl Sie schon alle pädagogischen und methodischen Tricks angewendet haben. Oder: Eine Schülerin soll nach drei Jahren bei der Übertrittsprüfung die Tonleitern spielen und sie kann es einfach nicht, obwohl Sie jede Stunde mit ihr geübt haben. Oder: Sie unterrichten Musik und Bewegung in einer neuen Klasse und realisieren in kurzer Zeit, dass drei Schüler:innen sehr begabt sind und drei andere große Schwierigkeiten zeigen; wie steht es um Ihren Plan?
Die Unvorhersehbarkeit von Situationen ist übrigens nicht nur in Bildungssituationen relevant: Sie gilt auch für administrative, organisatorische und allerlei andere Tätigkeiten.
Improvisation ist also nicht eine Verlegenheitslösung, sondern eine Form von Handlungsvermögen, die durch ein alltägliches, nicht antizipiertes kritisches Ereignis ausgelöst wird und durch improvisierendes Handeln durchaus auch zu neuen Lösungen führen kann. «Managing the unexpected» heißt das gelegentlich; dazu später mehr.
Erinnern Sie sich an eine schwierige, nicht antizipierbare Situation, die durch Ihre improvisierende Handlung eine positive Wendung nahm?
Wenn ich mich als Pädagoge an zentrale und wegweisende Situationen in meinem Berufsleben erinnere – sei es als langjähriger Lehrer von verhaltensauffälligen Schüler:innen, als Dozent, Berater oder als Führungsperson –, gilt es häufig, Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Ebenso muss ich akzeptieren, dass die Reibungslosigkeit sogenannter Kompetenzprofile zwar in pädagogischen Konzepten, Managementratgebern und didaktischen Drehbüchern portiert wird, jedoch in der alltäglichen Wirklichkeit so nicht oder nur selten umsetzbar ist.
Die «Kunst», als Pädagoge situativ vom Programm abzuweichen und adäquat mit Störungen oder mit Unvorhersehbarkeiten umzugehen, hingegen scheint als alltäglich notwendige Kompetenz unabdingbar. Der Plan, Geplantes zu realisieren, ist offensichtlich nicht selten zum Scheitern verurteilt; und dies führt schließlich – gelegentlich mit gemischten Gefühlen – zu improvisierendem Handeln, oder dazu, dass der Plan zumindest spontan variiert und situativ umgesetzt wird.
Ich erinnere mich gut an eine meiner ersten Unterrichtsstunden während meiner Ausbildung zum Volksschullehrer. Für die Ausbildungsverantwortlichen musste ich eine Verlaufsplanung mit den Spalten «Lehrerinterventionen» und «erwartetes Schülerverhalten» skizzieren. Ich erlebte mit Schrecken, dass die Lernenden nicht reagierten, wie von mir erwartet – ich kam gelegentlich nicht einmal zu meinen geplanten Interventionen.
Ab und zu frage ich mich heute, ob die oben beschriebenen didaktischen Vorbereitungsmodelle sich tatsächlich sicherheitsbietend auswirken, oder ob sie nicht eher Variationen negieren und dabei Improvisation verhindern.
Wie bewältigen nun Bildungsfachleute wie wir solche Spannungen, Scheiter-Erfahrungen und Paradoxien? Indem wir präziser und besser planen? Indem wir in unserer Planung mehr Handlungsoptionen berücksichtigen? Oder indem wir «durch Erfahrung klug» werden und weniger planen – dafür mehr improvisieren, Momente und Situationen besser nutzen? Ist solches Improvisieren lernbar?
Improvisation in der Bildung
Improvisieren bedeutet, «etwas ohne Vorbereitung, aus dem Stegreif tun», entlehnt von lat. providere, «vorhersehen», ital. improviso, «unvorhergesehen, unerwartet». Demnach bedeutet «improvisieren», zu handeln, ohne vorherzusehen (vgl. Bormann, Brandstetter und Matzke 2010, S. 7).
Die Improvisation führt als Begriff ein Doppelleben: Während sie in der Kunst (Musik, Tanz, Performance) oft positiv gewertet und auch konzeptionell gefasst wird, gilt sie in anderen Tätigkeitsfeldern (etwa in der Bildung) häufig als Indikator des Mangels (siehe auch die «Gegenreden»); wenn vermeintliche Fehlplanung kompensiert wird, wird dies im Bildungsbereich in der Alltagssprache gern «Improvisieren» genannt.
In der einschlägigen deutschsprachigen pädagogischen Literatur findet sich der Begriff «Improvisation» interessanterweise kaum – mit wenigen Ausnahmen (siehe weiter unten), obwohl sich gesellschaftssoziologische und organisationstheoretische Konzepte in den letzten Jahrzehnten mit Begriffen wie «Risiko», «Unvorhersehbarkeit», «Unsicherheit» oder «Ungewissheit» beschäftigen. Covid-19 hat diese thematische Orientierung beschleunigt.
Im selben Zeitraum dominiert(e) paradoxerweise im Bildungsbereich im Gegensatz dazu die sogenannte «Kompetenzorientierung». Sie kennen wahrscheinlich die Diskussionen um Lehrpläne. Die Kompetenzorientierung betont zwar die Individualität von Lernprozessen, präsentiert sich jedoch konzeptionell als ein standardisiertes und planmäßig zu durchlaufendes, «nach oben» führendes Stufensystem, das wenig Raum für ungeplante und spontane Entwicklungen und Bewegungen bietet – weder für Lehrende noch Lernende. Das Konzept orientiert sich metaphorisch gesehen meist am gelingenden Emporwachsen von niedrigeren zu höheren Kompetenzen. Andere Wege als diese Stufen oder unvorhergesehene Wege, ein zu langes Verweilen auf einer Stufe, Rückschritte, Querschritte ohne «Wachstum» oder gar ein Verlassen oder Auslassen der Treppe sind nicht vorgesehen.[2] Dabei sollen die Lernziele (learning outcomes) dem jeweiligen Kompetenzstand angepasst sein und auch diesem Stand gemäß transparent überprüft werden. Die Handlungsorientierung wird hier durch das Prinzip der Vergleichbarkeit und der Überprüfung ergänzt. Der Aufbau von Kompetenzen erfolgt auch in dieser Denkweise in Stufen. Hoffnungsvoll und mit technologischer Grunderwartung wird eine Steuerung der inneren Entwicklung (des Kompetenzzuwachses) von Lernenden angenommen.
Wo bleibt in diesem Rahmen das Risiko, die Unvorhersehbarkeit oder die Option des Scheiterns? Scheinbare Planbarkeit des zu Lernenden wird offensichtlich im Bildungskontext als Illusion aufrechterhalten, obgleich der Anspruch nie zur Wirklichkeit passt.
Erinnern Sie sich an Rückschritte, Doppelschritte, Querschritte Ihrer Schüler:innen, allenfalls auch an gescheiterte Versuche mit dem «Treppenkonzept»?
Improvisierend zu handeln und zu lernen, mit Unvorhersehbarem umzugehen, war unbestritten bereits vor der Covid-19-Krise in der täglichen Bildungsarbeit eine relevante Konstante – auch wenn dafür pädagogische Modelle weitgehend fehlen.
Immerhin: Classroom-Management-Forscher Walter Doyle (in Dick 1996, S. 74ff.) schlüsselte in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts die Komplexität für Unterrichtssituationen nach verschiedenen Aspekten auf: Er unterschied dabei «simultane Wirklichkeiten». Doyle konstatierte: Lehr-/Lernsituationen nehmen oft einen unerwarteten Verlauf. So erschweren etwa Unterbrechungen oder Ablenkungen, das Unterrichtsgeschehen zu prognostizieren oder längerfristig zu planen. Die Reaktion darauf, wenn planen oder prognostizieren nicht möglich ist, wurde damals nicht explizit «Improvisieren» genannt.
Nachstehende Merkmale (nach Doyle, in Dick 1996, S. 74ff.) schlüsseln die Komplexität für Bildungssituationen konkret nach verschiedenen Aspekten auf, ich habe versucht, diese mit passenden Beispielen zu ergänzen:
Simultane Wirklichkeiten: Merkmale von Komplexität in Bildungssituationen nach Doyle
Multidimensionalität
In Bildungssituationen ist eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. Wir müssen mit einer Fülle von Ereignissen und Situationen klarkommen und «fertigwerden».
Sie unterrichten gerade eine Schülerin in einer Einzelstunde, es klopft an der Tür, ein anderer Schüler entschuldigt sich, eine Mutter einer weiteren Schülerin versucht sie gleichzeitig telefonisch zu erreichen. Zudem will der Musikschulleiter etwas Dringendes mit Ihnen besprechen.
Sie hatten einen anstrengenden Tag und müssen spätabends noch viele E-Mails und Kurznachrichten beantworten, zudem finden Sie in Ihrer Mailbox noch zwei Nachrichten von unzufriedenen Eltern und Sie realisieren, dass Sie vergessen haben, dem Sekretariat das monatliche Planungsformular zuzustellen.
Sie realisieren, dass Ihr modifizierter Probe- und Konzertplan mit den vereinbarten Unterrichtsstunden an der Musikschule kollidiert – zudem wird die Koordination mit der anderen Musikschule immer komplizierter.
Gleichzeitigkeit
In Bildungssituationen geschehen viele Dinge gleichzeitig, was die Regulierung des Unterrichtsgeschehens erschwert.
Die einen Schüler:innen des Orchesters arbeiten aktiv an einer Umsetzungsaufgabe und erwarten ihr Feedback, andere sprechen miteinander über ihre Aktivitäten am Wochenende, die «Hinterbühne» wird zur «Vorderbühne», wieder andere signalisieren Ihnen, dass sie die Aufgabenstellung nicht verstanden haben.
Ein aktuelles gesellschaftliches Ereignis beschäftigt eine Schülerin dermaßen, dass der geplante Unterricht unmöglich wird – und es ist die letzte Stunde vor der Vortragsübung.
Unmittelbarkeit
In Bildungssituationen überstürzen sich die Ereignisse oft, was schnelle Reaktionsfähigkeit erfordert. Selten bleibt Lehrenden Zeit, Entscheidungen sorgfältig abzuwägen.
Eine Schülerin verlässt kommentarlos den digitalen Lernraum.
Ein Schüler bricht während einer Vortragsübung plötzlich in Tränen aus und will nicht über den Grund sprechen.
Eine Gruppe von Schüler:innen erklärt Ihnen in einer Pause, dass sie nach der Pause nicht mehr mit einem bestimmten Schüler zusammenarbeiten/zusammenspielen wollen.
Unvorhersehbarkeit
Bildungssituationen nehmen oft einen unerwarteten Verlauf. Unterbrechungen oder Ablenkungen erschweren es, das Unterrichtsgeschehen zu prognostizieren oder längerfristig zu planen.
Sie stehen eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn vor dem angegebenen Kursraum und realisieren, dass dieser schon besetzt ist.
Ein Schüler weigert sich während einer digitalen Verarbeitungsphase, in einen geplanten Übungschat einzusteigen.
Vor einem Konzert erscheint Ihr Schüler (der spielen sollte) nicht.
Die Eltern melden ihr Kind für die Vortragsübung ab, obwohl Sie die Teilnahme via E-Mail mit den Eltern vereinbart haben.
Ihr Instrument klingt beim Einspielen plötzlich seltsam oder Sie haben es zu Hause vergessen, Ihr Schüler ist bereits da und wartet.
Das Haustier der Schülerin ist gestern verstorben, ist der Unterricht nun möglich?
Öffentlichkeit
In Bildungssituationen exponieren Sie sich vor einem Publikum, das aus Ihrem Lehrverhalten auf Ihre Fähigkeit schließt, Inhalte zu vermitteln oder mit schwierigen Situationen umzugehen.
Als lehrende Person stehen Sie während Lehr-/Lernsituationen auf einer «Bühne», werden detailliert beobachtet und geprüft.
Über Sie als Lehrperson wird auch nach dem Unterricht oder in Pausen gesprochen.
Sie kennen die ganze Familie Ihres Schülers, Ihnen eilt in der Regel ein «Ruf» voraus.
Geschichtlichkeit
In Bildungssituationen treffen sich Lehrende und Lernende teilweise in zeitlich ausgedehntem Rahmen. Einzelne Ereignisse stehen in einem übergreifenden Kontext und haben unter Umständen langfristige Auswirkungen.
Sie übernehmen eine Gruppe (Orchester) von Schüler:innen, die inhaltlich und gruppendynamisch schon einen beträchtlichen Weg hinter sich gebracht hat, Normen sind gesetzt.
Am Ende einer langjährigen Begleitung einer Schülerin tauchen Fragen und ungelöste Probleme der Anfangsphase wieder auf.
Sie übernehmen eine neue Instrumentenklasse und merken, dass Sie an Ihrem Vorgänger gemessen werden.
Lesen Sie die Merkmale von Komplexität kurz durch und lassen Sie einige einschlägige Erfahrungen für sich Revue passieren.
Nun: In der Covid-19-Krise veränderten sich sämtliche Abläufe des öffentlichen Lebens aufgrund staatlich verordneter Interventionen. Diese wirkten sich auch maßgebend auf Bildungsorganisationen aus, ich nehme an, auch auf Ihre Musikschule: Die meisten Bildungsanbieter mussten ihr Präsenzangebot einstellen und auf Distance Learning umsteigen. Dies führte zu Beginn zu teilweise hilflosen, zunehmend aber auch zu kreativen Versuchen, Lehr-/Lernsituationen anzupassen und anders zu gestalten. Inwiefern sich der vormals «gut» organisierte und vielleicht weniger auf Improvisieren eingestellte Normalzustand von «vor Covid-19» wiederherstellen lässt, wissen wir noch nicht. Es scheint eine neue «Normalität» der Gegenwart zu entstehen. Werden wir wieder in ruhigere Fahrwasser gelangen oder wird sich das Fahrwasser beruhigen? Wohl eher nicht.
Ungewissheit spielt stets mit und braucht entsprechende Improvisation – so meine Prämisse; und es braucht Improvisation keineswegs nur, um Restrisiken oder ungeplante Nebenwirkungen zu minimieren. Vielmehr müssen soziale und professionelle (Alltags-)Handlungen in der neuen Situation überprüft und allenfalls modifiziert werden, die «andere» oder mitunter «neue» Gegenwart muss gestaltet werden, ohne dass wir wissen, was die Zukunft genau mit sich bringt. Es geht darum, das Potenzial der Situation (besser) zu nutzen.
Und: Wir können auf unseren Erfahrungen von vor der Pandemie aufbauen.
Der Umgang mit Komplexität ist nicht erst seit der durch die Covid-19-Ära erzwungenen digitalen Offensive bedeutsam, er prägt das Lehr-/Lerngeschehen in unseren Bildungsinstitutionen schon immer tagtäglich.
Was war Ihre bedeutsamste Improvisationserfahrung in der Covid-19-Krise?
Zugänge zu Improvisation
Erster Zugang: Improvisieren als Technologie
Ist Improvisation als unvorhersehbarer Akt eine «Creatio ex nihil», wie es die sogenannt «freie Improvisation» des Jazz der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts behauptete und versuchte (jeder Ton, jeder Klang aus dem Moment und der Situation heraus)? Oder meint Improvisieren eher, Prozesse an den Grenzen von Regeln zu gestalten bis hin zum Regelbruch, der neue Formen und Spielräume eröffnet? Oder ist Improvisation erst vor dem Hintergrund von Ordnungsmustern möglich?
Christopher Dell, Musiker und Improvisationstheoretiker, darf als Vertreter des Ordnungsansatzes gesehen werden. Improvisieren braucht seines Erachtens Ordnung und Technologie. Dell führt in diesem Zusammenhang aus, dass sich die Fähigkeit zu improvisieren darin zeige, mit einer begrenzten Anzahl einfacher Regeln und minimaler Strukturen eine große Anzahl Verhaltens-, Handlungs- oder Kommunikationsvarianten zu generieren (Dell 2012, S. 22). Er charakterisiert Improvisation als Technologie des maximalen «Verschaltens vorhandener Strukturen und Ressourcen» (Dell 2017, S. 135). Improvisationsvermögen wächst in diesem Verständnis mit der Variabilität der Erfahrungen, dem Repertoire, das sich in der Gegenwart in jeder neuen Situation nutzbar machen lässt.
Zweiter Zugang: Improvisieren als Umgang mit Unvorhersehbarem (managing the unexpected)
Mit einem unerwarteten Verlauf umzugehen, lässt sich als «managing the unexpected» bezeichnen, wie es auch Karl Weick und Kathleen Sutcliffe (2016) basierend auf Untersuchungen in sogenannten «high reliability organizations» (Notfallstationen, Rettungssanität etc.) tun. Sie plädieren dafür, sich auf Fehler und Abweichungen zu konzentrieren und von diesen zu lernen, nicht auf Erfolgsrhetorik – dies, um defensive Routinen zu verhindern und Innovation zuzulassen. Es geht ihnen darum, achtsam zu sein und Entscheidungen bei Bedarf rückgängig zu machen, Kritik zuzulassen, inadäquate Muster (eingeübte Inkompetenzen) zu erkennen und zu durchbrechen.
Zwar geht es bei der Arbeit in Bildungsorganisationen selten um Leben und Tod. Anders dagegen rettet in einer Rettungssanität oder Intensivstation mitunter standardisiertes Vorgehen Leben, manchmal tut das jedoch ebenso der Situation angepasstes, von Standards abweichendes Verhalten. Und doch: Unterschätzen Sie – gerade als Musiklehrende – nicht Ihre Wirkung auf das junge Leben Ihrer Schüler:innen.
Dritter Zugang: Improvisieren und Planen – ein kritisches Verhältnis
Vielerorts diskutiert, oftmals schnell abgehandelt und entsprechend mystifiziert ist das Verhältnis von Planen und Improvisieren. Mit Widersprüchlichkeiten umzugehen, gehört zum täglichen Handeln. Auch in der Bildungsarbeit. Planung stellt die eine Kehrseite der Handlungsmünze dar, die Realität die andere.
Mit der Realität umzugehen, fordert jeweils oft Improvisieren oder zumindest ein Umspielen des Planes, Plankorrekturen – wie wir vorher schon gehört haben. Pläne reibungslos durchzuführen, zu realisieren, ist eher die Ausnahme, weil jede Durchführung eines Plans neue Komplexität generiert. Diese erwachsende Komplexität ist kein ungewollter Nebeneffekt einer geordneten oder zu ordnenden Welt. Sie ist vielmehr eine Form der Realität. Indem wir linear, «professionell» und nach Plan handeln, vermeiden wir scheinbar Risiken und Fehler. Durch diese Vermeidungsstrategie jedoch entgeht uns als Handelnden und Reflektierenden das Potenzial der durchkreuzten Pläne, der verlorenen Fassungen und Fehlleistungen: Genau diese könnten jedoch dabei helfen, adäquatere oder bessere Lösungswege zu entdecken.
Karl Weick (in Dell 2012, S. 136) unterscheidet vier Ebenen improvisationaler Performanz:
die Interpretation (Befolgung des Planes),
die minimale Variation (Ausgestalten des Planes),
die Variation (mit improvisierten Aktionen und partieller Abweichung vom Plan) und
die Improvisation (die radikal vom Plan abweicht).
Die Notwendigkeit, sich in Situationen zu entscheiden, wächst dabei mit der Zunahme der improvisierenden Gestaltungsmöglichkeiten (von der Variation bis zur freien Improvisation).
Konkret bedeutet dies: Improvisieren ist kein Gegenspieler von Planen. Improvisieren bedeutet, mit einer minimalen Struktur zu beginnen und handelnd einen Plan zu entwickeln. Planen und Echtzeithandeln stimmen nämlich überein (Dell 2012, S. 135ff.).
Wie würden Sie Ihre alltäglichen unterrichtlichen Improvisationen bezeichnen: als Interpretation, als minimale Variation, als Variation oder als (freie) Improvisation?
Improvisationskompetenz
In unserer effizienz- und qualitätsorientierten Gegenwart sowie spezifisch in pädagogischen Kontexten wird wenig darüber reflektiert, was das Nichterfüllenkönnen von Plänen oder das Nichterreichen von Zielen bedeutet oder bewirkt. Chaos, Unordnung und Disharmonie scheinen in unserer westlichen Kultur negativ belegt, das Projekt «Leben» sollte effizient geplant sein, Überraschungen sind nicht vorgesehen, Ungewissheiten verunsichern.
Gleichzeitig existiert jedoch ein unheimlich reiches und divergierendes Angebot an optionalen Lebensgestaltungsentwürfen, das Umbrüche, Umwege und Perspektivenwechsel ermöglicht und sogar provoziert. Beratungsangebote als Hilfe zur Entscheidungsfindung in bedeutsamen Lebenssituationen florieren. Eine Paradoxie?
Die eigene Planung, die eigenen Vorstellungen von Handlungen und Situationen so zu gestalten, dass Optionen zukünftige situative Flexibilität der eigenen Handlung gewährleisten, könnte eine Kompetenz des Umganges mit Unvorhersehbarkeiten repräsentieren.
Was bedeutet es, im alltäglichen beruflichen Handeln mit Unvorhersehbarem umzugehen? Sollen wir lediglich besser planen, um den Plan verlassen zu können? Oder braucht es Pläne mit der Option des Scheiterns (Risikoanalyse), damit wir in der jeweiligen Situation flexibel sind, um Abweichungen in den Griff zu bekommen oder zu legitimieren? Fordern komplexe Arbeitskontexte eine erhöhte Flexibilität im Handeln? Falls diese Fragen bejaht werden, eine letzte Frage: Wie lässt sich eine spezifische Kompetenz für den Umgang mit Unvorhersehbarkeit und Mehrdeutigkeit herauskristallisieren, eine «Improvisationskompetenz»?
Wo und wann haben Sie gelernt, in Ihrem Unterricht zu improvisieren, wie ist Ihre Improvisationskompetenz entstanden?
Planungsverhalten für komplexe Bildungssituationen – reflexive Kompetenz als Schlüssel für die Nutzung des Potenzials von Situationen
Lehrende sind gezwungen, in Sekundenschnelle Situationen zu identifizieren und wirksame Handlungsweisen auszuwählen. Wahl et al. (1995, S. 61) nennen diese Kompetenzen «Situationsauffassung» und «Handlungsauffassung». Routinierte Expert:innen («reflective practitioners» nach Dewey 1933 und Schön 1983 in Dick 1996, S. 96ff.) ziehen im Sinne eines methodischen Repertoires einzelne oder mehrere Register. Dabei halten sie sich nicht an klischeehafte Automatismen, sondern an eine Art von «knowing in action» (nach Schön 1983): Jeder neue «Registerzug» weitet den Handlungsspielraum aus, indem er durch Analogien und Vergleiche mit anderen Situationen handlungsrelevantes Wissen verdichtet.
Bei wenig erfolgreichem Handeln bleiben oft «veraltete» Prozesse und Strukturen aktiv, obwohl «besseres» Wissen bereits verfügbar wäre. Interessant ist, dass Erfolg offensichtlich Selbstreflexion unnötig macht, was wiederum eine Gefahr birgt, denn unter gewissen Umständen führt eine als erfolgreich erfahrene Problemlösung in einer anderen Situation plötzlich zum Misserfolg.
Was lässt sich nun abschließend zu möglichen Planungsstrategien für komplexe Situationen im Bildungskontext sagen?
Feste gültige Regeln (wie: «Wer wagt, gewinnt») gibt es nicht für sämtliche Problemsituationen.
Planen als Entwurf von reellen Handlungen kann als «Synthese eines Weges durch ein Labyrinth von Möglichkeiten hin zum erwünschten Ziel» (Dörner und Schaub 1995, S. 41) bezeichnet werden.
Bei «internem Probehandeln» (Antizipieren) darf nicht erwartet werden, dass alles reibungslos vonstattengeht.
Häufig wird leider hypothesenbestätigend statt problemgeleitet geplant. Individuelle Erinnerungsspuren und spekulative Vorwegnahmen erschweren es so, Planung zu modifizieren.
Gelegentlich ist Planung wirklich fehl am Platz. In nicht planbaren Situationen zu planen kann sich verheerender auswirken, als wenn man gar nicht plant.
Wichtigste Planungsressource ist die analysierte Erfahrung eigenen Verhaltens in komplexen Situationen.
Planung kann auch heißen, sich (mental) auf unplanbare Situationen vorzubereiten.
Demnach lassen sich zahlreiche praktische Aspekte von Lehr-/Lernsituationen nicht verplanen und viele Widerborstigkeiten nicht vorhersehen; zumindest besitzt jede Planung den Charakter von Vorläufigkeit. Die eigene Planung so zu halten, dass eine zukünftige situative Flexibilität gewährleistet ist, indem Handlungsoptionen aufrechterhalten werden, repräsentiert offensichtlich eine Kompetenz, mit Unvorhersehbarkeit und Mehrdeutigkeit umzugehen. Dies darf auch als eine Art von «Improvisationskunst» bezeichnet werden: Improvisationskunst als eine Fähigkeit, in Situationen anders (als geplant), dafür jedoch angemessen zu agieren.
Fazit: Improvisieren ist keine Verlegenheitslösung und setzt konstruktiven Umgang mit Unerwartetem voraus
Entgegen der landläufigen Meinung ist Improvisieren kein ungeplantes Handeln, keine Verlegenheitslösung; Improvisation ist Denken und Handeln in Optionen und hat situativen und prozessorientierten Charakter. Eine Improvisation beinhaltet, die gegebenen Handlungsräume permanent zu hinterfragen, für das Mögliche offen zu sein und Spielräume zu erweitern. Das bedeutet: Improvisation bessert keine gescheiterten Pläne nach. Improvisation ist konstruktiver Umgang mit Unerwartetem und damit eine zentrale Fähigkeit in komplexer werdenden Umwelten.
Und: Improvisieren lässt sich üben. Dell (2012, S. 121) betont in diesem Zusammenhang, dass sich Organisationen «im Handlungsmodus der Improvisation» organisieren sollen. Eine «improvisierende Organisation» ermögliche einen konstruktiven Umgang mit Unordnung:
«Improvisation erkennt Unordnung an und versucht, mit den Potenzialen, die in einer Situation vorhanden sind, zu arbeiten. Improvisation bedeutet dann, mit den Materialien der Wirklichkeit zu arbeiten und gleichzeitig diese Wirklichkeit mitzugestalten.»
(Ebd., S. 127)
Die Notwendigkeit von situativen Entscheidungen wächst mit der Zunahme der Gestaltungsmöglichkeiten. Konkret impliziert dies: Improvisieren ist kein Gegenspieler von Planen, vielmehr lassen sich Pläne als mögliche Struktur, als Option fassen, man kann sie benutzen, neu arrangieren, umspielen. Entscheidungen werden im Moment getroffen. Ordnung wird damit nicht nur vor, sondern auch während des Prozesses hergestellt. Das ist die Kunst des Umgangs mit Unerwartetem. Und: Immer, wenn Pläne scheitern, eröffnen sich neue Handlungsmöglichkeiten!
Literatur
Bormann, H.-F., Brandstetter, G. und Matzke, A. (Hrsg.) (2010). Improvisieren – Paradoxien des Unvorhersehbaren. Kunst – Medien – Praxis. Bielefeld: transcript.
Brecht, B. (1975). Die Dreigroschenoper. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Dell, C. (2012). Die improvisierende Organisation – Management nach dem Ende der Planbarkeit. Bielefeld: transcript.
Dell, C. (2017). Technologie der Improvisation. In: Stark, W. et al. (Hrsg). Improvisation und Organisation. Bielefeld: transcript, S. 131–141.
Dick, A. (1996). Vom unterrichtlichen Wissen zur Praxisreflexion: das praktische Wissen von Expertenlehrern im Dienste zukünftiger Junglehrer, 2. Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Dörner, D. und Schaub, H. (1995). Handeln in Unbestimmtheit und Komplexität. Organisationsentwicklung, 14(3), 34–47.
Thomann, G. (2019). Ausbildung der Ausbildenden, 5. Auflage. Bern: hep.
Thomann, G. und Honegger, M. (2021). Mit allem rechnen. Improvisieren in der Bildungsarbeit. Bern: hep.
Wahl, D. et al. (1995). Erwachsenenbildung konkret. Mehrphasiges Dozententraining. Eine neue Form erwachsenendidaktischer Ausbildung von Referenten und Dozenten. Weinheim: Deutscher Studien-Verlag.
Weick, K.E. und Sutcliffe, K.M. (2016). Das Unerwartete managen. Wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen, 3. Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
Arbeit mit Metaphern in (Bildungs-)Organisationen
Organisationen und Gesellschaften leben von Mythen, Legenden, Gerüchten und Metaphern, die die Menschen in Form von mündlich überlieferten Geschichten zur Beschreibung ihrer Erfahrungen nutzen. Sie dienen dabei nicht selten der Identitätsbildung.





























