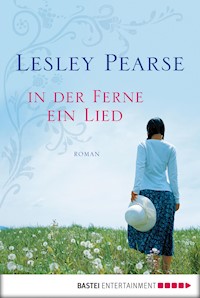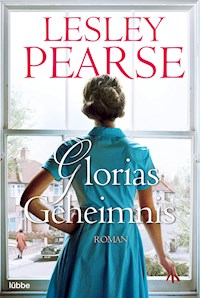7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Laura verband eine tiefe Freundschaft zu Jackie. Doch nun sitzt sie im Gefängnis - sie wird beschuldigt, Jackie ermordet zu haben. Ausgerechnet die Frau, die Laura Zuflucht vor ihrem Stiefvater gewährt und fortan alle Höhen und Tiefen mit ihr durchlebt hatte!
Nach langem Kampf ist Laura schließlich bereit, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Doch da erreicht sie im Gefängnis ein Brief, der die schönen Momente der Vergangenheit wieder lebendig werden lässt: Ihre Jugendliebe Stuart hat sie in all den Jahren nie vergessen und ist fest entschlossen, den Fall aufzuklären und Lauras Unschuld zu beweisen - selbst wenn er dadurch selbst in Gefahr gerät ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 949
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber die AutorinTitelImpressumWidmungDanksagungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20EpilogÜber die Autorin
Lesley Pearse wurde in Rochester, Kent, geboren und lebt seit über 25 Jahren mit ihrer Familie in Bristol. Ihre Romane sind in England stets auf den ersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden.
Lesley Pearse
Bis dein Herzmich findet
Roman
Aus dem Englischen von Hans Link
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Lesley Pearse
Published by arrangement with Lesley Pearse
Titel der englischen Originalausgabe: »Faith«
Originalverlag: Michael Joseph, Penguin Books
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2010/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © shutterstock / Joop Snijder jr.
Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-1234-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Widmung
Gewidmet David Stoyle für sein außerordentlich großzügiges Gebot bei einer Wohltätigkeitsauktion für das Versprechen, als Romanfigur in diesem Buch vorzukommen. Ich hoffe, David, dass Sie mit der Art und Weise zufrieden sind, wie ich Sie hier verewigt habe, und dass Ihre neue Rolle als Anwalt und Superdetektiv Ihnen, Julia und Ihren Kindern gefallen wird. Falls die Figur nicht so umwerfend attraktiv und brillant ausgefallen ist, wie Sie es gern gehabt hätten, entschuldige ich mich dafür – aber der fiktionale David durfte dem Superhelden Stuart leider nicht den Rang ablaufen. Er musste einfach ein durch und durch netter Kerl und guter Kamerad sein, und das sind Sie ja auch in Wirklichkeit.
Danksagung
Mein großer Dank gilt Alan Hamilton von der Strafanstalt Cornton Vale in Stirling, der mir seine Zeit geopfert und mir mit seinem Fachwissen darüber, wie eine Frau die Haft erlebt, geholfen hat.
Als ich ihn aufsuchte, galt seine Tätigkeit vor allem dem Versuch, den verhängnisvollen Verhaltensmustern junger Strafgefangener durch eine moderne Einstellung und eine angemessene Leitung entgegenzuwirken und ihnen Gelegenheit zu geben, sich berufliche Fähigkeiten anzueignen, ihre Kenntnisse zu erweitern und ganz allgemein ihr Interesse zu wecken beziehungsweise zu steigern. Zu Alans Aufgabenbereich gehörten auch Rehabilitationsmaßnahmen, ein neuer Ansatz, für den Cornton Vale im Jahr 2006 mit dem Butler Award belohnt wurde. Soweit ich es verstanden habe, geht es darum, Straftätern zu einem besseren Verständnis der kurzfristigen und langfristigen Folgen ihrer Straftat für die Geschädigten zu verhelfen. Man berücksichtigt dabei nicht nur die eigentlichen Opfer einer Straftat, sondern auch die Familien der Opfer und der Täter, Zeugen, Freunde und Kameraden. Obwohl die Teilnahme an dieser Maßnahme für die Straftäter freiwillig ist, machen die meisten von ihnen dabei mit, und es ist ein lohnender Weg, um zusätzlich zur eigentlichen Bestrafung den angerichteten Schaden zu mildern oder Wiedergutmachung zu leisten.
Viele meiner vorherigen Vorstellungen von einem Frauengefängnis wurden durch meinen Besuch in Cornton Vale infrage gestellt, nicht nur von Alan Hamilton, dessen tiefe Hingabe für die ihm anvertrauten Frauen sehr offensichtlich war. Ich war ebenso beeindruckt vom Mitgefühl und Enthusiasmus aller anderen Mitarbeiter, die ich dort kennenlernte. Ich hatte letztlich das Gefühl, dass ein großer Teil der jungen Straffälligen dort die Hilfe bekommt, die sie benötigen, um einen Rückfall nach ihrer Entlassung zu verhindern.
Ich möchte auch all den lieben Menschen (es sind zu viele, um sie namentlich aufzuführen) in Anstruther, Cellardyke, Crail und Edinburgh danken, die mir Hilfe und Inspiration bei meinem Aufenthalt in Schottland waren, der mich mit dem Hintergrund dieses Romans vertraut machen sollte.
Zum Schluss noch ein dickes und ganz besonderes Dankeschön an Gordon Erasmuson, ohne den ich nicht einmal auf die Idee zu diesem Buch gekommen wäre, geschweige denn es geschrieben hätte. Ihr Glaube an mich, Ihre Ermutigungen, all diese wundervollen kleinen Schottizismen, mit denen Sie mich versorgt haben, und dazu immer wieder Ihr Lachen haben mir mehr geholfen, als Sie es sich jemals vorstellen können. Gott segne Sie, General Gordon.
Kapitel 1
1995
Verdorrter alter Kohlkopf!«, sagte Donna Ferguson laut und schneidend, als sie Laura Brannigan Brokkoli auf den Teller löffelte.
Laura hatte diese spezielle schottische Schmähung stets amüsant gefunden, doch sie unterdrückte jeden Ausdruck von Heiterkeit – denn den hätte Donna, die achtzehnjährige Bedienung hinter der Theke, nur als weiteren Beweis ihrer Demenz angesehen. Aber vermutlich hielt Donna mit ihrem Kampfgewicht von hundertfünfundzwanzig Kilo ohnehin jeden, der mehr Brokkoli und weniger Kartoffelpüree verlangte, für ernsthaft geschädigt.
»Ich mag alt und verdorrt sein, doch Brokkoli hält meinen Verstand scharf und meinen Körper schlank«, gab Laura zurück. »Vielleicht sollten Sie es auch mal versuchen.«
Als sie sich mit ihrem Tablett abwandte, um sich einen Platz im Speisesaal zu suchen, spürte sie die Spannung, die immer dann in der Luft lag, wenn ihre Mitgefangenen glaubten, dass es möglicherweise zu einem Streit oder Kampf kommen würde. Aber wie schon so viele Male zuvor, wenn jemand Laura beleidigt hatte, würden sie auch heute enttäuscht werden. Es war ohne zusätzlichen Ärger schon hart genug, mit fünfzig eine lebenslängliche Haftstrafe für ein Verbrechen zu verbüßen, das sie nicht begangen hatte. Außerdem hatte Laura Mitleid mit Donna: Der jungen Frau blieb bei ihrem Aussehen – wie ein gestrandeter Wal – gar nichts anderes übrig, als sich hart zu geben.
Während sie die etwa dreißig Frauen im Speisesaal betrachtete, dachte Laura darüber nach, wie sehr die Filmemacher sich doch irrten, wenn sie weibliche Gefangene porträtierten. Hier gab es keine Schönheiten mit erotischer Ausstrahlung, und man fand auch nur herzlich wenig Intelligenz. Die Frauen kamen in allen Formen und Größen und jedem Alter daher, von siebzehn bis über sechzig, aber allen gemein waren die stumpfe Haut, das glanzlose Haar und der mutlose Blick. Den gleichen Blick sah sie jedes Mal, wenn sie töricht genug war, in einen Spiegel zu schauen.
»Komm und setz dich zu mir, Law«, rief Maureen Crosby. »Wir alten Kohlköpfe sollten zusammenhalten!«
Jetzt lächelte Laura doch, denn so ein Aufblitzen von Humor war völlig untypisch für Maureen und musste entsprechend gewürdigt werden. Normalerweise war die Zweiundfünfzigjährige aus Glasgow ziemlich mürrisch, blieb gern für sich und ließ sich nur selten auf ihre Umgebung ein.
»Danke, Maureen«, sagte Laura und nahm ihr Angebot an. »War es eine Todsünde, um mehr Brokkoli zu bitten?«
Als Laura zwei Jahre zuvor in Untersuchungshaft nach Cornton Vale, Schottlands einziges Frauengefängnis, gekommen war, hatten nur Maureen und einige wenige andere Gefangene dort keine sarkastischen Bemerkungen über Lauras Alter, ihren englischen Akzent oder ihre beharrliche Behauptung gemacht, es sei ein schrecklicher Fehler, sie wegen Mordes vor Gericht zu stellen. Möglicherweise hatte Maureen sich nur deshalb so verhalten, weil sie ungefähr in ihrem Alter war, wahrscheinlicher war jedoch, dass sie in ihrem eigenen Leben zu viel Elend erfahren hatte, um das eines anderen Menschen noch vermehren zu wollen. Sie hatte Narben auf den Wangen, die von einer Rasierklinge stammten, und ihr Handgelenk stand in einem unnatürlichen Winkel ab, das Ergebnis eines Bruchs, der nie richtig verheilt war. Die meisten ihrer Zähne waren abgebrochen, und sie hatte ein immer wiederkehrendes Rückenproblem.
»Du siehst heute sehr hübsch aus. Erwartest du Besuch?«, fragte Laura, während sie zu essen begann. Maureen war eine massige Frau und schlurfte normalerweise in einem schwarzen Trainingsanzug herum, der weder ihrer rundlichen Figur noch ihrem talgigen Teint schmeichelte. Aber heute trug sie eine elegante graue Hose und eine hellrosa Bluse. Sie hatte sich das graue Haar gewaschen und gefönt und war sogar geschminkt.
»Aye, meine Jenny kommt«, antwortete Maureen, und ihre Stimme, die normalerweise so mutlos klang, wirkte ein wenig fröhlicher.
»Wie schön!«, rief Laura. Maureen hatte ihr einige Wochen zuvor anvertraut, dass ihre Tochter sie nie wiedersehen wolle. Das war nach Maureens Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung gewesen – sie hatte ihren Mann mit einem Wagen überfahren. »Wie kommt es, dass sie ihre Meinung geändert hat?«
Maureen zuckte die Schultern zum Zeichen, dass sie den genauen Grund nicht kannte. »Ich hab getan, was du gesagt hast, und ihr geschrieben und ihr erzählt, welche Gefühle ich für sie habe. Vielleicht war es das.«
Laura nickte. Maureen war drauf und dran gewesen, ihren Ehemann, von dem sie misshandelt wurde, zu verlassen, als sie entdeckte, dass er ihr Geld gestohlen hatte – Geld, das sie gespart hatte, um ihm entfliehen zu können. Am selben Abend hatte er sie abermals verprügelt, und als sie früh am nächsten Morgen von ihrer Putzstelle in einem Büro nach Hause gefahren war, hatte sie ihn aus dem Haus einer Frau kommen sehen. Maureen hatte schon lange den Verdacht gehegt, dass er eine Affäre mit dieser Frau hatte. In einem Anfall von Zorn war sie mit dem Wagen direkt auf ihn zugefahren, hatte ihm beide Beine gebrochen und ihm massive innere Verletzungen zugefügt, von denen er sich wahrscheinlich niemals ganz erholen würde.
Jenny schlug sich auf die Seite ihres Vaters und weigerte sich, die Demütigungen und die Brutalität in Rechnung zu stellen, unter denen Maureen im Laufe der Jahre zu leiden gehabt hatte. Sie gestattete noch nicht einmal ihren jüngeren Geschwistern, ihre Mutter zu besuchen.
»Ich nehme an, dein Mann hat auch ihr gegenüber sein wahres Gesicht gezeigt«, sagte Laura nachdenklich. »Und deine anderen Kinder werden Jenny wahrscheinlich erzählt haben, was er dir in der Vergangenheit angetan hat. Sie wird das alles gegeneinander aufgewogen und begriffen haben, dass du am Ende deiner Kraft und Weisheit warst. Ein Mädchen braucht seine Mutter, und ich bin davon überzeugt, dass sie dich schrecklich vermisst hat.«
»Du bist ein guter Mensch«, erwiderte Maureen unerwartet. »Zuerst hab ich nicht geglaubt, dass du unschuldig warst, aber jetzt tu ich es. Du hast es nicht in dir, jemanden zu töten, erst recht nicht eine alte Freundin.«
Laura lächelte kläglich. Vor zwei Jahren hätte eine solche Bemerkung ihr Hoffnung gemacht; sie hätte geglaubt, dass die Anwälte, die Polizei und die Geschworenen sie im gleichen Licht sehen würden. Aber die Geschworenen hatten sie für schuldig befunden, und ihr Anwalt sah keinen Grund dafür, in Berufung zu gehen.
Jetzt wusste sie, dass alle, die mit dem Fall zu tun gehabt hatten, fest von ihrer Schuld überzeugt waren, und das zu ertragen war das Schlimmste von allem. »Es bedeutet mir viel, dass du mir glaubst«, seufzte sie. »Aber lass uns heute nicht darüber reden. Du musst schon sehr aufgeregt sein wegen deines Besuchs.«
»Das bin ich.« Maureen strahlte. »Einfach ihr hübsches kleines Gesichtchen wiederzusehen, wird genug sein. Sie ist jetzt dreißig, und ein zweites Kleines ist unterwegs. Ich wusste bisher nicht mal, dass ich einen Enkelsohn hatte.«
»Versuche, ihren Vater nicht zu erwähnen«, meinte Laura sanft. »Frag sie nach deinem Enkel, nach ihrer Schwangerschaft und ihrem Zuhause und solchen Dingen. Sie wird verlegen sein wegen der Art, wie sie dich behandelt hat, aber sie muss den Wunsch haben, Brücken zu bauen, sonst würde sie nicht kommen.«
Maureen sah Laura versonnen an. »Warum bekommst du nie Besuch, Law?«, wollte sie wissen. »Eine gute Frau wie du muss jede Menge Freunde gehabt haben.«
»Ich war keine gute Frau«, erwiderte Laura kläglich. »Ich habe Menschen schlecht behandelt und sie benutzt. Jackie war die Einzige, deren Meinung über mich je gezählt hat, und ich habe sie geliebt. Aber jetzt, da ich wegen Mordes an ihr verurteilt wurde, sind die wenigen Menschen, die ich gern als Freunde betrachtet habe, verschwunden, und es ist niemand mehr da, der sich auch nur ein Jota um mich schert.«
Als Laura nach dem Essen in ihre Zelle zurückkam, legte sie sich auf ihr Bett und schloss die Augen. Ihre Mitgefangenen hatten ihre Zellen mit Bildern und Fotos geschmückt, aber abgesehen von einem Bild von einer weißen Rose, das sie aus einer Zeitschrift ausgeschnitten hatte, waren Lauras Wände so nackt wie an dem Tag vor einem Jahr, als man sie nach der Urteilsverkündung hierher gebracht hatte.
Damals war sie zu zornig gewesen, um den Gedanken auch nur in Erwägung zu ziehen, sich häuslich einzurichten, denn das wäre ihr so vorgekommen, als akzeptierte sie ihr Schicksal. In ihren dunkelsten Augenblicken hatte sie das Gitter vor dem Fenster angestarrt und darüber nachgedacht, sich daran zu erhängen. Doch Selbstmord schien mehr ein Eingeständnis von Schuld zu sein als eine Bekräftigung ihrer Unschuld.
Es war eine Form des Protestes, die Zelle trostlos und unpersönlich zu lassen. Laura hatte nichts dagegen, dass sie winzig war – sie hatte in der Vergangenheit in gleichermaßen kleinen Räumen gelebt. Bis zu einem gewissen Maß konnte sie der Enge entfliehen, indem sie Radio hörte und von ihrem Fenster aus zu den Hügeln hinüberblickte. Aber der ständige Lärm um sie herum vermittelte ihr oft das Gefühl, den Verstand zu verlieren.
Im Bravo-Block wurde unablässig gegen Gitterstäbe geschlagen, gesungen, geweint, geschrien, geredet und heiser gelacht. Laura konnte ihre Zelle vor den anderen Frauen schließen, sie konnte sogar dem Rauch und dem Gestank ihrer Zigaretten ausweichen, aber der Lärm war ständig da, und manchmal hätte sie am liebsten geschrien, sie sollten endlich still sein.
Sie konnte sich daran erinnern, wie sehr sie den schottischen Akzent geliebt hatte, als sie seinerzeit nach Schottland gezogen war, doch jetzt schmerzte er ihr in den Ohren; selbst die sanfteren Töne jener, die aus Städten wie Inverness kamen, irritierten sie. Laura hätte alles dafür gegeben, einen Londoner Akzent zu hören, doch nach dreiundzwanzig Jahren in Schottland waren selbst ihrer Sprechweise nur noch geringe Spuren ihrer Londoner Herkunft anzumerken.
Sie stand erschöpft von ihrem Bett auf, um ihre Ohrstöpsel zu suchen. Sie blendeten den Lärm nicht aus, dämpften ihn jedoch zumindest. Laura fand sie auf dem Waschbecken, und als sie sie in ihre Ohren schob, sah sie für einen Moment ihr Gesicht im Spiegel.
Der Anblick verstärkte ihre Niedergeschlagenheit noch, denn ihre Züge spiegelten ihren müden, hoffnungslosen Geisteszustand wider, und ihr Haar hatte die Farbe und Beschaffenheit von schmutzigem Stroh. Als Kind war es mausbraun gewesen, aber während ihres ganzen Erwachsenenlebens hatte sie es sich gefärbt – schwarz, rot, dunkelbraun, blond und einmal sogar pink –, daher war es schwer, sich an die genaue ursprüngliche Farbe zu erinnern. Dennoch wusste sie sehr wohl noch, wie es an dem Tag ausgesehen hatte, als sie Jackie tot aufgefunden hatte, denn tags zuvor war sie beim Friseur gewesen und hatte sich das Haar kurz schneiden und blonde Strähnchen einfärben lassen.
Jetzt fiel es ihr lang und formlos auf die Schultern, daher band sie es stets mit einem Gummiband zu einem Pferdeschwanz zusammen. Und wenn sie es bürstete, konnte sie von den blonden Strähnchen nur noch orangefarbene Spitzen entdecken. Alles andere war von einem hässlichen, ungleichmäßigen Grau.
Glamourös, chic, elegant, perfekt gepflegt – das waren die Ausdrücke, mit denen man sie vor zwei Jahren beschrieben hatte, als sie noch ihren Laden gehabt hatte. Mit ihren eins fünfundsechzig und Kleidergröße sechsunddreißig hatten ihr noch immer die Arbeiter nachgepfiffen, wenn sie an einer Baustelle vorbeigekommen war, und sie war kaum einmal abends ausgegangen, ohne von irgendeinem Mann angesprochen zu werden. Man hatte sie eher auf fünfunddreißig geschätzt als auf Ende vierzig.
Jetzt hätte kein Mann einen zweiten Blick an sie verschwendet. Sie mochte immer noch schlank sein, doch ihre Haut war so grau wie ihr Haar, und ihren braunen Augen, die so oft als leuchtend beschrieben worden waren, fehlte nun jeder Glanz. Selbst wenn sie ein elegantes Kostüm und hochhackige Schuhe anzöge, sich das Haar schneiden und färben ließe und sich schminkte, würde sie niemals mehr so aussehen können, wie sie einst ausgesehen hatte. Es war, als wäre ein Licht in ihr ausgeschaltet worden.
»Brannigan!«
Beim Klang ihres Namens drehte Laura sich um und sah Justizvollzugsbeamtin Beadington – allgemein bekannt als Beady – an der Tür stehen. Laura zog ihre Ohrstöpsel heraus.
»Es ist ein Brief für Sie abgegeben worden«, sagte Beady und hielt ihr ein Blatt Papier hin. »Der Mann war gerade hier und wollte Sie besuchen. Die Beamten am Tor mussten ihn wegschicken, doch sie haben ihm erklärt, er könne schreiben und Sie um eine Besucherkarte bitten.«
Lauras Herz machte einen Satz, als sie die vertraute Handschrift sah. Sie mochte sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben, aber sie war unverkennbar.
»Es ist doch nicht wieder einer von diesen Journalisten, oder?«, fragte Beady. »Sie wissen, wie der Anstaltsleiter dazu steht!«
Laura war zu verblüfft über den Brief in ihrer Hand, um sofort antworten zu können. Sie sah Beady einige Sekunden lang mit leerem Blick an, als wäre sie in einer unbekannten Sprache angesprochen worden.
»Nein. Nein, kein Journalist«, sagte sie, als ihr klar wurde, dass sie antworten musste.
Sie hatte kurz nach ihrer Verurteilung mehreren Journalisten Besucherkarten geschickt in der Hoffnung, sie würden sich ihres Falles annehmen. Fast alle waren gekommen, aber ihre Notlage hatte sie nicht gekümmert; niemand hatte ihr geglaubt, dass sie unschuldig war. In Wirklichkeit waren sie alle nur darauf aus gewesen, mehr Schmutz über sie in Erfahrung zu bringen und etwas über die Reihe von Selbstmorden zu hören, die sich in den letzten Monaten in diesem Gefängnis ereignet hatten. Die Journalisten hatten Laura als Vorwand benutzt, um Sensationsartikel über das Gefängnis zu schreiben, und der Leiter war sehr wütend darüber gewesen, dass sie ihnen unwissentlich Insider-Informationen gegeben hatte.
»Der Brief ist von einem Mann, den ich vor langer Zeit gekannt habe«, sagte Laura schwach. »Es ist ein kleiner Schock!«
»Es heißt, er sei ausgesprochen sexy«, bemerkte Beady mit einem breiten Lächeln.
Laura erwiderte das Lächeln müde. Beady war eine anständige Frau; sie hatte eine harte Schale und konnte wie ein Bulldozer jeden überrollen, der sie in Rage brachte, doch auf diese Weise versuchte sie nur, ihren weichen Kern zu schützen. Laura hatte sie junge Mädchen trösten sehen, wenn deren Partner ihnen den Laufpass gegeben hatten oder ihre Kinder der Fürsorge übergeben worden waren. Beady hatte das Herz am rechten Fleck.
»Er war schon immer sexy«, stimmte Laura traurig zu. »Und er ist ein guter Mann, doch wir Frauen machen uns häufig schuldig, weil wir den wahren Wert eines Mannes erst zu spät erkennen.«
»Er wollte zu Ihnen«, erklärte Beady vielsagend. »Also beschaffen Sie ihm eine Besucherkarte, und zwar dalli.«
Laura schloss ihre Zellentür und setzte sich auf ihr Bett, um den Brief zu lesen.
Liebe Laura,
ich bin gerade erst aus Südamerika nach England zurückgekehrt und war entsetzt, als ich von Jackies Tod erfuhr. Wir mögen einander sehr lange nicht mehr gesehen haben, aber ich kann nicht glauben, dass du sie getötet hast, denn ich weiß, was ihr einander bedeutet habt. Man wollte mir nicht erlauben, dich zu besuchen. Es hieß, ich brauche eine Besucherkarte. Bitte, schicke mir eine in mein Hotel, denn ich kann Schottland nicht wieder verlassen, solange ich nicht mit dir geredet habe.
Stuart
Eine Träne lief Laura ungehindert die Wange hinunter, während sie seine Handschrift anstarrte. Vor zwanzig Jahren hatte er ihr mit Bleistift hingekritzelte Nachrichten geschrieben, häufig verziert mit komischen kleinen Gesichtern. Sie hatte auch eine wunderschöne Beileidskarte bekommen, als Barney gestorben war, und sein tiefer Kummer war eingemeißelt gewesen in jedes Wort. Dieser Brief war förmlicher, geschrieben auf geprägtem Papier des Balmoral Hotel in Edinburgh, ein Beweis dafür, wie weit er jetzt von ihr entfernt war.
Sie konnte ihn an jenem Sommertag 1972 vor sich sehen, als sie ihn auf Castle Douglas kennengelernt hatte. Hochgewachsen, mit nacktem Oberkörper und abgeschnittenen Levis-Shorts, die drohten, ihm von den schmalen Hüften zu rutschen. Haselnussbraunes Haar, das eine Wäsche nötig hatte, war ihm bis auf die Schultern gefallen. Seine nackten Füße waren so braun gewesen wie junge Kastanien, und er hatte das breiteste, wärmste Lächeln gehabt, das sie je gesehen hatte.
Er war einundzwanzig gewesen, immer noch ein unschuldiger Junge voller Überschwang und Glück. Sie war mit ihren siebenundzwanzig Jahren eine berechnende, weltgewandte Frau gewesen, die es hätte besser wissen müssen, als mit ihrem zweijährigen Sohn in eine Hippie-Enklave davonzulaufen. Natürlich hatte sie sich an Strohhalme geklammert – alles war besser gewesen, als in London zu bleiben und die Menschen sehen zu lassen, dass sie es verpfuscht hatte.
In derselben Nacht hatte sie Stuart auf einer Matratze auf dem Boden eines Hauses verführt, das kaum mehr gewesen war als ein Schuppen, und als er am nächsten Morgen erwacht war, hatte er ihr seine Liebe erklärt.
Als Laura nun mit einem Finger über den geprägten Briefkopf strich, konnte sie sich die Kultiviertheit der Welt, in der er jetzt lebte, gut vorstellen: große Doppelbetten, luxuriöse Bäder, schnelle Autos und Designerkleidung. Sie hatte im Laufe der Jahre oft von Jackie von seinen Erfolgen gehört, davon, dass Firmen aus mehreren Ländern Headhunter auf ihn angesetzt hatten, weil sie ihn als Projektmanager wollten. Doch stets hatte er darauf bestanden, diesen Aufstieg aus der Mietskaserne in Edinburgh, in der er aufgewachsen war, nicht durch Intrigen, Härte und Schläue, sondern mit seinem Talent, mit harter Arbeit und absoluter Aufrichtigkeit geschafft zu haben – so wie er es immer gewollt hatte.
Wie anders wäre ihr Leben vielleicht verlaufen, wenn sie nur an ihn geglaubt hätte!
Laura drückte den Brief ans Herz und ließ sich schluchzend in ganzer Länge auf ihr Bett fallen.
1972 war ihr »Sommer der Liebe« gewesen, als für nur wenige kurze Wochen alles wunderschön gewesen war. Kein anderer Mann, weder vorher noch nachher, hatte sie je auf dieselbe Weise berührt, und was sie gehabt hatten, war kostbar und zauberhaft gewesen. Aber sie hatte es zerstört, geradeso, wie sie so oft zuvor und danach so vieles zerstört hatte, was gut in ihrem Leben gewesen war.
Kapitel 2
Laura lag mit Stuarts Brief auf ihrem Bett, und die Freude, die sie beim Empfang seiner Nachricht anfänglich empfunden hatte, war von Scham verdrängt worden. Sie schämte sich weniger der Tatsache, dass sie im Gefängnis saß und er es herausgefunden hatte, sondern vor allem, weil er inzwischen bestimmt auch alles über ihre echte Familie erfahren hatte.
Stuart hatte einige Jahre für Jackie gearbeitet und ihre gesamte Familie kennengelernt, und obwohl das nun lange zurücklag, waren sie doch lose miteinander in Verbindung geblieben. Wenn er erfahren hätte, dass Jackie eines natürlichen Todes gestorben sei, hätte ihn das schon genügend aus der Fassung gebracht; um wie viel ärger musste es gewesen sein, als er die Nachricht erhalten hatte, sie sei von Laura ermordet worden! Gewiss hatte er alles über ihren Fall gelesen, um mehr in Erfahrung zu bringen.
Jedes schmutzige Detail über sie war in der Presse breitgetreten worden, denn die Journalisten waren wie Hyänen gewesen und hatten systematisch ihre Glaubwürdigkeit demontiert, indem sie immer neue unappetitliche Tatsachen über sie und ihre Vergangenheit ans Licht gezerrt hatten.
Laura machte sich keine Sorgen wegen der Dinge, in die sie nach ihrer Trennung verwickelt gewesen war; davon hatte er wahrscheinlich ohnehin vor langer Zeit durch Klatsch und Tratsch gehört. Aber was musste er empfunden haben, als er herausfand, dass sie keine Waise gewesen war, wie sie ihm gegenüber behauptet hatte? Dass sie tatsächlich quicklebendige Eltern und fünf Geschwister hatte – ihre Familie, von ihr selbst fein säuberlich aus ihrem Leben retuschiert. Sie konnte sich vorstellen, wie er sich an das erinnerte, was sie ihm über ihre erfundene Kindheit und Jugend erzählt hatte. Gewiss fragte er sich, warum sie ihm in der Folge niemals die Wahrheit gesagt hatte, selbst wenn sie glaubte, den Rest der Welt belügen zu müssen.
Stuart kam ebenfalls aus einer Arbeiterfamilie, und er hatte nicht gezögert, über jede Leiche in deren Keller zu sprechen. Doch er war stets stolz auf seine Herkunft gewesen und wäre nie so tief gesunken, sie mit einer Tünche von Glamour zu überziehen, um die gesellschaftliche Leiter hinaufzuklettern.
Während ihrer zweijährigen Beziehung hatte es viele Gelegenheiten gegeben, da sie ihm um ein Haar die Wahrheit erzählt hätte. Sie hatte gewusst, dass er ihre Beweggründe zu lügen verstanden hätte; tatsächlich hätte er sie wahrscheinlich umso mehr geliebt, weil er ein mitfühlender Mensch war und immer auf der Seite der Underdogs stand. Laura hatte der Versuchung widerstanden, weil er sie dazu gebracht hätte, auch Jackie gegenüber reinen Tisch zu machen, und er hätte ihr so lange zugesetzt, bis sie Verbindung zu ihrer Mutter aufgenommen hätte. Dafür war sie zu feige gewesen.
Tränen stiegen ihr in die Augen, und sie wischte sie ungeduldig fort. Wenn sie mit sechzehn gewusst hätte, welches Herzeleid die Zukunft für sie bereithielt, hätte sie sich nicht neu erfunden. Aber damals war es lediglich Selbsterhaltung gewesen, kein vorsätzlicher Betrug.
Sie war zwölf, als ihr wirklich dämmerte, dass sie die ganze Welt gegen sich hatte. Es war im Oktober 1957 gewesen, an einem dieser herrlichen Herbsttage, an denen man bemerkt, dass die Blätter an den Bäumen plötzlich in Gold, Rot, Rost und Gelb erstrahlen, obwohl die Sonne warm genug ist, um den Menschen vorzugaukeln, es sei noch Sommer.
Auf der Thornfield Road in Shepherd’s Bush, wo sie zu jener Zeit lebte, standen keine Bäume. Selbst die schmalen Streifen Erde vor den verfallenden drei und vierstöckigen Häusern, die die Bewohner gern ihren »Vorgarten« nannten, enthielten nichts außer überquellenden Abfalleimern, Fahrrädern und Müll. Aber an jenem Tag war Laura in den nahe gelegenen Ravenscroft Park gegangen, hatte über das Fest der Farben dort gestaunt und sich gewünscht, sie hätte in einem der schönen Häuser rings um den Park gelebt.
Sie ging an den meisten Samstagnachmittagen dorthin, doch normalerweise nahm sie Freddy, ihren kleinen Bruder, in seinem Kinderwagen mit und auch ihre Schwestern, Meggie und Ivy, um ihrer Mutter ein wenig Luft zu verschaffen. Doch an jenem Morgen hatte Laura nur einen einzigen Blick auf die dunkle, feuchte, chaotische Kellerwohnung geworfen, in der sie lebten, und sie hatte einen überwältigenden Drang verspürt, das Haus zu verlassen und für eine Weile in einer friedlichen Umgebung allein zu sein.
Sie saß noch immer auf einer Bank im Park und träumte von einem eigenen Zimmer und einem Bad und davon, nie wieder gebrauchte Kleider tragen zu müssen oder von den anderen Mädchen in ihrer Schule ausgelacht zu werden, weil ihre Kleidung nach gebratenem Essen und Moder roch, als ihr plötzlich bewusst wurde, dass es bereits spät am Nachmittag war. Die Sonne hatte sich leuchtend orange gefärbt; sie versank gerade hinter den Bäumen und warf lange Schatten, und plötzlich fror Laura in ihrem Baumwollkleid.
Widerstrebend ging sie nach Hause, wohl wissend, dass ihre Mutter furchtbar wütend sein würde, weil sie den ganzen Tag über fort gewesen war. Als sie auf die Thornfield Road einbog, sah sie Janice Potts und Margaret Jones aus der Schule. Die beiden Mädchen saßen auf der Mauer vor ihrem Haus.
Lauras Magen drehte sich vor Angst um, weil die beiden sie seit Beginn des neuen Halbjahrs im September schikanierten. Sie wusste, dass sie gekommen waren, um mit ihr Streit zu suchen, denn wie die meisten Mädchen im Gymnasium in Holland Park lebten sie weit entfernt vom schäbigen Shepherd’s Bush und hatten keinen Grund, durch ihre Straße zu gehen.
Seit ihrem ersten Tag im Gymnasium war Laura sich wie eine Hochstaplerin vorgekommen, weil fast alle anderen dort elegant und chic waren. Die anderen Mädchen nahmen Tennis und Ballettunterricht, ihre Väter besaßen ein Auto und trugen Anzüge, und sie war sich absolut sicher, dass niemand sonst sich mit einer gebrauchten Schuluniform zufriedengeben musste oder in einem öffentlichen Bad badete. Es machte die Sache nicht besser, dass sie so mager und reizlos war – wann immer sie in einen Spiegel schaute, schauderte sie beim Anblick ihres geflochtenen Haares, das niemals glatt wirkte, weil es so glanzlos und dünn war.
Während des ganzen ersten Jahres auf dem Gymnasium war sie sich darüber im Klaren gewesen, dass die anderen Mädchen hinter ihrem Rücken über sie tuschelten; sie versteckten ihre Bücher und erlaubten ihr niemals, an ihren Spielen auf dem Pausenhof teilzunehmen. Aber seit sie ins zweite Jahr versetzt worden war, war es noch schlimmer geworden.
Als sie am ersten Tag im September wieder in die Schule gegangen war, hatte Brenda Marsh gesagt, sie wolle nicht neben einem »Straßenkind« sitzen. Ein anderes Mädchen hatte gefragt, ob Laura ihren Blazer vom Lumpensammler habe. Von da an schien es, als hätte sich die ganze Klasse verschworen, sie zu quälen. Sie ließen Briefchen auf ihrem Schreibtisch liegen, in denen sie Bemerkungen über ihren muffigen Geruch machten. In den Umkleideräumen der Turnhalle nahmen die Mädchen ihre Bluse oder ihren Pullover zwischen Daumen und Zeigefinger und zuckten zusammen, als wäre das Kleidungsstück irgendwie verseucht. Einmal sah Laura sogar ein Mädchen mit einem Taschentuch einen Stuhl abwischen, auf dem sie zuvor gesessen hatte. Getuschel, Rippenstöße und rüde Gesten verfolgten sie während des ganzen Unterrichts. Auf dem Pausenhof und wenn sie die Schule verließ, riefen die Mädchen ihr grausame Bemerkungen nach und versuchten, ihr ein Bein zu stellen. Jetzt hatten die beiden Rädelsführer herausgefunden, wo sie wohnte, und Laura bekam es mit der Angst zu tun.
»Hey, Stinky Wilmslow! Hast du dich dieses Jahr schon gewaschen?«, rief Janice.
Es war verführerisch, in ein Nachbarhaus zu laufen und um Hilfe zu bitten, aber wenn sie das tat, würden Janice und Margaret ihr am Montag in der Schule abermals auflauern, das wusste Laura. »Ihr könnt mir mal den Buckel runterrutschen«, rief sie trotzig zurück und ging verstockt auf sie zu.
»Hast du immer noch Läuse?«, höhnte Margaret, als sie näher kam.
Dieser Seitenhieb schmerzte Laura, weil sie nie Läuse gehabt hatte. Sie wusch sich auch jeden Tag, obwohl das nicht verhinderte, dass die Gerüche der Wohnung sich an ihre Kleider hefteten. Aber es hatte keinen Sinn zu protestieren; Protest würde den beiden lediglich einen Vorwand liefern, ihr noch weitere Schmähungen an den Kopf zu werfen.
»Wahrscheinlich – und du wirst dir selbst welche fangen, wenn du mich anfasst«, antwortete Laura. Sie hatte das elende Gefühl, von dem sadistischen Duo gleich verprügelt zu werden, und das würde bedeuten, dass sie ihnen zeigen musste, dass gewöhnliche Mädchen wie sie von der Wiege an lernten, sich zu verteidigen.
Als sie sie erreichte, streckte Janice einen Fuß vor, um sie zu Fall zu bringen. Laura reckte die Nase hoch in die Luft und gab vor, es nicht gesehen zu haben, aber schnell wie der Blitz trat sie gegen Janices anderes Bein, sodass diese auf den Gehsteig fiel.
Als Janice vor Schreck und Überraschung aufschrie, sprang Margaret vor, die Finger zu Krallen gebogen und bereit, Lauras Gesicht zu zerkratzen. Laura rammte ihr ein Knie in den Magen, und Margaret prallte zurück und hielt sich den Bauch.
Es war unzweifelhaft eine beeindruckende Zurschaustellung von Überlegenheit des Verstandes, der Schnelligkeit und der List, und beide Mädchen wirkten geziemend benommen und verängstigt. Laura stemmte die Hände in die Hüften und bedachte sie mit einem vernichtenden Blick. »Habt ihr genug?«, fragte sie. »Oder wollt ihr beide noch einen ordentlichen Tritt? Dann könnt ihr nach Hause laufen und euren Mummys etwas vorheulen.«
Sie gaben klein bei ein und flüchteten, und ihre kurzen Röcke flatterten hoch, sodass ihre weißen Beine und ihre dunkelblauen Schlüpfer sichtbar wurden. Sie waren nicht einmal mutig genug, um ihr noch aus einiger Entfernung Schimpfworte an den Kopf zu werfen.
Laura sah ihnen nachdenklich nach. Eigentlich hätte sie sich nach diesem Zwischenfall mächtig fühlen und triumphieren sollen, aber dieses Erlebnis hatte genau den gegenteiligen Effekt. Sie wünschte sich, von den Mädchen gemocht zu werden. Dann könnten sie die Samstagnachmittage gemeinsam bei Woolworth verbringen, sich die Top Twenty der Woche anhören und die Make-up-Auslagen betrachten. Aber das würde jetzt nie mehr möglich sein.
Sie ließ sich an der Mauer von Nummer zwölf, wo sie wohnte, zu Boden sinken, und ihr wurde eines plötzlich mit übergroßer Klarheit bewusst: Um das Stigma, eine Wilmslow zu sein, loszuwerden, brauchte es erheblich mehr, als die Aufnahmeprüfung zu bestehen und in einen gestreiften Blazer zu schlüpfen.
Dabei war sie so stolz gewesen, als sie am Gymnasium angenommen worden war! Sie hatte geglaubt, ihre älteren Brüder seien lediglich neidisch, als sie behauptet hatten, sie würde dort nicht hinpassen. Selbst als klar geworden war, dass ihre Brüder recht hatten, hatte Laura an ihrem unerschütterlichen Optimismus festgehalten und angenommen, ihre Klassenkameradinnen mit der Zeit schon für sich gewinnen zu können.
Aber jetzt wusste sie, dass sie es niemals schaffen konnte. Sie würde nie zu den Partys der anderen Mädchen eingeladen werden oder nach Hause zum Tee; niemand würde sie je in seiner Nähe haben wollen. Es machte ihr nichts aus, dass ihre Eltern kein Geld für die Klassenfahrt nach Frankreich oder für Ballettunterricht hatten, doch Laura glaubte, nicht noch einmal vier oder mehr Jahre ohne einen einzigen Freund in der Schule ertragen zu können.
Die Lehrer hielten sie für klug. Bis jetzt hatte sie sich mit dieser Tatsache getröstet, wenn alles besonders schwarz ausgesehen hatte. Und sie war fest davon überzeugt gewesen, eines Tages etwas Großartiges zu sein – eine Ärztin, eine Wissenschaftlerin oder eine Anwältin. Dann, so hatte sie gehofft, würden all jene, die auf sie herabgeblickt hatten, beschämt sein.
Aber jetzt wurde ihr bewusst, dass Janices und Margarets Vorurteile gegen sie genau das waren, was sie von der ganzen Welt erwarten konnte. Mit einem Vater, der immer wieder im Gefängnis landete, zwei älteren Brüdern, die alle Zeichen aufwiesen, dass sie den gleichen Weg gehen würden, und einem Zuhause, das ein schmutziges Loch war, hatte sie keine echte Chance, es im Leben zu etwas zu bringen.
Laura drehte leicht den Kopf, blickte in die Kellerwohnung hinab und zuckte zusammen, als ihr klar wurde, was Janice und Margaret gesehen haben mussten. Dreckige Fenster, vom Alter vergilbte, löchrige Gardinen und die Mülltonnen für das gesamte vierstöckige Haus, die direkt vor ihrer Wohnungstür standen und einen widerlichen Fäulnisgeruch verströmten. Wenn sie den Schmutz in der Wohnung gesehen hätten, wären sie noch schockierter gewesen. Die Scham über all das schlug wie eine Welle über Laura zusammen und verursachte ihr Übelkeit.
Mit hängenden Schultern ging sie die Betonstufen hinunter zu ihrer Mutter.
»Wo bist du den ganzen Tag gewesen?«, brüllte Mrs. Wilmslow, sobald Laura hereinkam. »Ich habe hier mit den Kindern festgesessen, die sich geprügelt haben, und dem heulenden Baby, und ich hatte nicht einmal eine Minute, um in den Laden zu laufen und mir ein paar Zigaretten zu holen.«
Laura stand in der Tür des Wohnzimmers, das gleichzeitig als Schlafzimmer ihrer Eltern diente, und ihre Laune sank endgültig auf den Nullpunkt. Kein einziger Sonnenstrahl schaffte es jemals hier herein, aus den Armlehnen des Sofas quoll die Füllung, und die Tapete hing schon so lange an den Wänden, dass das Muster, das sie einst besessen hatte, unkenntlich geworden war. Die Luft war vom Zigarettenrauch zum Schneiden dick und roch, als hätte der sechs Monate alte Freddy eine schmutzige Windel. Er lag auf dem Boden und quengelte. Ivy, die Dreijährige, hatte sich Marmelade ins Gesicht geschmiert; ihr Po war nackt. Die fünfjährige Meggie spielte mit ihrer Puppe. Im Raum herrschte absolutes Chaos; wohin man auch sah, überall lagen Spielsachen und benutztes Geschirr. Nicht einmal das Doppelbett war gemacht.
June, Lauras Mutter, war erst zweiunddreißig, eine kleine schlanke Frau mit wasserstoffblondem Haar, blassem Teint und einem abgehetzten Gesichtsausdruck. Wenn sie sich Gesicht und Haare herrichtete, sah sie immer noch sehr hübsch aus, doch diese Mühe machte sie sich selten, es sei denn, sie ging in den Pub. Jetzt hatte sie sich Lockenwickler in die Haare gedreht, also beabsichtigte sie offensichtlich, später auszugehen. Aber sie hatte einen Tomatenfleck auf ihrem Kleid und Löcher an den Ellbogen ihrer Strickjacke.
»Dann geh jetzt und hol dir deine Zigaretten«, gab Laura zurück. Sie war versucht, darauf hinzuweisen, dass ihre Mutter mit den Kleinen einen Spaziergang hätte unternehmen und sich dabei ihre Zigaretten besorgen können, doch sie schluckte diese Bemerkung herunter.
»Die Kinder haben mich die ganze Zeit gefragt, wo du bist.« Die Stimme ihrer Mutter hatte sich in ein mürrisches Jammern verwandelt. »Du hättest ja sogar überfahren worden sein können, so lange warst du weg.«
»Nun, ich bin aber nicht überfahren worden«, entgegnete Laura. »Geh jetzt und hol dir deine Zigaretten, ich werde währenddessen hier Ordnung schaffen und Freddys Windel wechseln – er stinkt.«
Es war merkwürdig, dass ihre Mutter selten fragte, womit Laura oder ihre älteren Brüder sich beschäftigten, wenn sie nicht zu Hause waren. Es war, als interessierte sie nur eins: Sie war ärgerlich, wenn die Kinder nicht da waren, um etwas für sie zu erledigen. Mark war jetzt vierzehn, Paul dreizehn, und in Ermangelung jedweder Disziplin waren sie vollkommen ungebärdig.
»Putz auch den Rosenkohl«, sagte June, bevor sie ihre letzte Zigarette anzündete und das leere Päckchen auf den Boden warf. »Wir werden Eier und Pommes frites zum Tee essen.«
Als ihre Mutter fort war, öffnete Laura das Fenster und entdeckte den Grund, warum Ivy keinen Schlüpfer trug: Er war nass und lag hinter dem Sofa auf dem Boden.
»Du musst das Töpfchen benutzen«, tadelte sie ihre kleine Schwester und suchte nach einer sauberen Unterhose, die sie ihr anziehen konnte. Dann räumte sie alle benutzten Teller und Tassen zusammen und brachte sie in die Küche, nur um feststellen zu müssen, dass die Spüle immer noch mit dem Frühstücksgeschirr vollstand. Stöhnend setzte sie den Kessel auf, um Wasser zu erhitzen, dann lud sie das schmutzige Geschirr auf den Tisch, damit sie Freddy baden konnte.
Mrs. Crispin von oben sagte häufig, June solle sich schämen, weil sie so eine schlechte Mutter war. Sie sei schlampig, faul und überhaupt eine Schande. Laura hasste diese Frau, weil sie ihre Nase in fremde Angelegenheiten steckte, aber die Nachbarin hatte recht.
June Wilmslow war schlampig. Sie war offensichtlich außerstande zu sehen, dass Geschirr gespült werden musste, dass der Stapel Kleider auf einem Stuhl gebügelt werden musste, und statt am Boden liegende Dinge aufzuheben und wegzuräumen, stieg sie einfach darüber. Was das Putzen betraf, stöhnte sie ständig darüber, dass es erledigt werden musste, aber dabei blieb es.
Laura hatte in Hauswirtschaftskunde gelernt, dass eine gute Hausfrau sich einen wöchentlichen Zeitplan erstellen sollte, um all die Arbeiten, die erledigt werden mussten, nach und nach abzuhaken. Sie hatte mehrmals einen solchen Plan für ihre Mutter erstellt, zusammen mit einem Speisezettel für die Woche, sodass June alle Einkäufe auf einmal erledigen konnte, um Zeit zu sparen. Aber obwohl June dies für eine gute Idee hielt, war sie einfach nicht in der Lage, sich daran zu halten. Was sie den ganzen Tag mit sich anfing, war ein Rätsel, denn wenn Laura von der Schule nach Hause kam, war sie es, die unausweichlich ausgeschickt wurde, um die Lebensmittel einzukaufen oder mit der Wäsche in die öffentlichen Bäder zu gehen.
Bill, ihr Vater, machte alles noch schlimmer. Er saß, seit Laura denken konnte, immer wieder mal im Gefängnis. Wenn er dann entlassen wurde, suchte er sich für einige Wochen Arbeit auf Baustellen oder Ähnlichem, aber er verfiel schon bald wieder in alte Gewohnheiten. Die meisten Abende verbrachte er im Pub und schlief dann bis spät in den nächsten Tag hinein, was es für June schwierig machte, einem geregelten Tagesplan zu folgen. Er konnte großzügig und freundlich sein, wenn er Geld hatte, doch wenn nicht genug da war, um sich einige Drinks zu kaufen oder auf die Hunderennbahn zu gehen, war er sehr mürrisch und ließ seine schlechte Laune an June aus.
Lauras Meinung nach war es jedoch die überfüllte, dunkle, feuchte Kellerwohnung, die ihrer Mutter am schlimmsten zusetzte. »Die Wohnung sieht selbst dann nicht besser aus, wenn sie ordentlich und sauber ist«, sagte June häufig erschöpft, »wenn wir nur einen Garten, ein Badezimmer und eine Innentoilette hätten, würde ich mich fühlen, als hätte ich im Lotto gewonnen.«
Laura hatte sie ungezählte Male zum Sozialamt begleitet, um die Leute dazu zu bringen, ihnen ein Haus zu vermitteln. »Es ist doch nicht recht, dass meine ältesten Söhne Mark und Paul in einem Zimmer schlafen müssen, in dem das Wasser an den Wänden hinabläuft«, hatte June dann stets flehentlich erklärt, »und es kann auch nicht richtig sein, dass drei Mädchen im selben Bett schlafen müssen, weil kein Platz für ein zweites Bett ist.« Aber ihr Flehen war immer wieder auf taube Ohren gestoßen.
Laura hatte eine Nachbarin einmal sagen hören, es liege daran, dass Bill die halbe Zeit im Gefängnis säße. Man wolle in den neuen Wohnsiedlungen eben keine »primitiven« Familien haben.
Als hätten sie dafür einen Riecher, kamen Mark und Paul gerade rechtzeitig nach Hause, als ihre Mutter die Pommes frittierte. Sie waren magere Versionen ihres stämmigen Vaters, mit dem gleichen dunkelbraunen Haar, den scharfen Gesichtszügen und dem dreisten Wesen. Laura spürte, dass sie etwas im Schilde führten, da sie verärgert wirkten, als June ihnen erklärte, sie sollten an diesem Abend zu Hause bleiben, um sich um die Kleinen zu kümmern. Sie selbst wollte zu Bill in den Pub hinuntergehen.
»Als er heute Nachmittag zum Fußball ging, hatte er etwas Geld bei sich«, erklärte June. »Er wird nach dem Spiel direkt in den Pub laufen, und wenn ich nicht bei ihm bin, wird er dort bleiben, bis er auch den letzten Penny ausgegeben hat.«
Laura, Mark und Paul tauschten resignierte Blicke. Sie hatten allzu oft mitbekommen, dass ihr Vater spät in der Nacht betrunken ins Haus gestolpert gekommen war, und sie hatten die Streitereien gehört, wenn ihre Mutter am Morgen festgestellt hatte, dass seine Taschen leer waren. Er würde keinen Penny weniger ausgeben, wenn June zu ihm in den Pub ging, aber zumindest kamen sie dann gemeinsam betrunken nach Hause und schmusten miteinander wie die Turteltauben. Das bedeutete gewöhnlich, dass ihre Eltern am Tag darauf erheblich netter zu ihnen waren.
Um halb acht verließ June in ihrem besten, rosafarbenen Kleid das Haus, und ihr Haar sah wirklich hübsch aus, doch kaum war sie fort, da erklärten Mark und Paul bereits, ebenfalls ausgehen zu wollen.
»Wenn du es Mum und Dad erzählst, wird es dir leidtun«, warnte Mark Laura und gab ihr als Bestechung einen Schilling und einen Mars-Riegel.
Laura war recht zufrieden mit dieser Entwicklung; sie wusste ohnehin nicht, warum ihre Eltern immer darauf bestanden, dass die Jungen als Babysitter im Haus bleiben mussten. Schließlich waren sie im Umgang mit den Kleinen völlig nutzlos, und Laura piesackten sie obendrein. Also schärfte sie ihnen an diesem Abend ein, unbedingt vor den Eltern zurückzukommen, oder es würde die Hölle losbrechen. Im Grunde war sie froh darüber, allein zurückzubleiben.
Freddy schlief ein, sobald er sein Fläschchen getrunken hatte, und Ivy und Meggie verschwanden um halb neun in ihrem Bett, sodass Laura den Luxus genießen konnte, ungestört auf dem Bett ihrer Eltern zu liegen und zu lesen.
Um halb elf kehrten ihre Brüder zurück, aber sie gingen direkt in ihr Zimmer, ohne mit ihr zu sprechen. Laura schlüpfte bald darauf zu ihren Schwestern ins Bett und döste bereits, als sie ihre Eltern nach Hause kommen hörte. Offenbar waren sie beschwipst, denn sie lachten viel, und Lauras letzter Gedanke, bevor sie endgültig einschlief, war die Hoffnung, dass Dad beim Pferde- oder Hunderennen gewonnen hatte und sie alle sich am nächsten Tag etwas Besonderes würden leisten können.
Später wurde sie jedoch von einem splitternden Geräusch geweckt, schnell gefolgt vom Aufschrei ihrer Mutter. Einen Moment lang glaubte Laura, ein Einbrecher sei in die Wohnung eingedrungen, aber als sie ihren Vater fluchen und den Flur zur Küche und der Hintertür hinunterrennen hörte, wurde ihr klar, dass es die Polizei sein musste.
Plötzlich erklangen wütende Schreie – sowohl von der Vordertür als auch von der Hintertür her. Ivy und Meggie wachten auf, und ihr erschrockenes Weinen machte den Tumult noch größer. Ihr Vater war offensichtlich geschnappt worden, denn es wurden dumpfe Geräusche laut, während die Polizei ihn an ihrer Schlafzimmertür vorbei durch den Flur zerrte.
»Wohin bringen sie Daddy?«, fragte Meggie, die sich angstvoll an Laura klammerte.
»Es sind nur seine Freunde, die mit ihm was trinken wollen«, log Laura.
Die Polizei kam häufig ins Haus, um ihren Vater abzuholen, aber sie war noch nie zuvor auf diese Weise hereingestürmt oder überhaupt bei Nacht gekommen. Wenn sie darüber nachdachte, benahmen sich die Polizisten normalerweise tatsächlich fast wie Dads Freunde, denn sie saßen nur da und redeten mit ihm. Selbst bei den Gelegenheiten, da sie ihn in einem Streifenwagen fortgebracht hatten, war es niemals beängstigend gewesen, und in den meisten Fällen war Dad binnen weniger Stunden zurückgekehrt und hatte darüber gescherzt.
Jetzt jedoch war es wirklich erschreckend. Sie konnte hören, wie Möbelstücke umgeworfen wurden; Mum weinte, und Dad schimpfte und fluchte. Dann hörte sie, wie einer der Polizisten ihren Vater anschrie und zu erfahren verlangte, wo die Waffe sei, oder er würde die Wohnung in Stücke reißen.
Verängstigt presste Laura ihre kleinen Schwestern fest an sich und zog ihnen allen die Decke über den Kopf. Aber schwere Stiefel trampelten abermals den Flur entlang, diesmal ins Zimmer ihrer Brüder, und nach den Geräuschen zu urteilen, die von dort herüberklangen, durchsuchten die Beamten den Raum.
»Ich weiß nicht, woher sie gekommen ist«, hörte Laura ihren Bruder Mark wenige Minuten später rufen. »Ich hab nichts damit zu tun.«
Vermutlich hatte die Polizei im Jungenzimmer eine Waffe gefunden, überlegte Laura und drückte ihre kleinen Schwestern noch fester an sich. Freddy heulte sich im Wohnzimmer die Seele aus dem Leib, ihre Mutter erging sich in lautstarken Beschimpfungen der Polizisten, und wieder und wieder wurden dumpfe Geräusche laut, wenn ihr Vater versuchte, sich gegen die Beamten zur Wehr zu setzen.
Plötzlich flammte das Licht in ihrem Zimmer auf. »Kommt raus, Mädchen«, sagte ein massiger Polizist mit rotem Gesicht, während er ihnen die Decken wegzog. »Wir müssen auch dieses Zimmer durchsuchen.«
Mit Ivy in den Armen und Meggie, die sich an ihre Taille klammerte, beobachtete Laura hilflos, wie die beiden Polizisten die Matratze hochzogen, unter das Bett schauten und altes Spielzeug, Malbücher und irgendwelchen Müll darunter hervorzogen. Dabei warfen sie Ivys Töpfchen um, und der Urin lief über das Linoleum.
»Was ist das?«, fragte der Polizist, als er einen verschnürten Schuhkarton hervorzog.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Laura wahrheitsgemäß, denn sie hatte den Karton noch nie gesehen.
Der Mann durchschnitt mit einem Taschenmesser die Schnur und öffnete den Karton, und zu Lauras Erschrecken war er voller Geldscheine.
Sie sog scharf die Luft ein, denn sie hatte noch nie im Leben so viel Geld auf einmal gesehen. Ein Zehnpfundschein war ein seltener Anblick für sie, aber hier handelte es sich um ganze Bündel von Zehnern und Zwanzigern, und da der Karton damit vollgestopft war, mussten es insgesamt Hunderte von Pfund sein.
»Wer hat das hier versteckt?«, fragte der rotgesichtige Mann.
»Ich weiß es nicht«, sagte Laura abermals, und plötzlich hatte sie das Gefühl, sich übergeben zu müssen. »Ich wusste nicht, dass es hier war.«
»Belüg mich nicht«, brummte er, trat direkt vor sie hin und beugte sich vor, sodass er ihr in die Augen sehen konnte. »Wie alt bist du?«
»Zwölfdreiviertel«, antwortete sie.
»Das ist alt genug, um zu wissen, was Recht und was Unrecht ist«, erklärte er. »Sag mir, wann dein Dad den Karton hier versteckt hat.«
»Ich weiß es nicht, ich hab es nicht gesehen.« Dann begann sie zu weinen. »Er könnte seit Wochen hier stehen. Das da drunter sind alles alte Sachen.«
Der Polizist schickte sie zurück ins Bett und verließ mit dem Schuhkarton den Raum, und plötzlich verebbten der Aufruhr und die zornigen Stimmen. Laura konnte nicht hören, was gesprochen wurde, weil Freddy so laut weinte, doch sie glaubte, dass ihre Mutter flehentlich auf die Polizisten einredete. Außerstande, es noch länger zu ertragen, stieg sie aus dem Bett, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ihr Vater, Mark und Paul allesamt in Handschellen abgeführt wurden.
»Sie können die Jungen nicht mitnehmen«, schluchzte ihre Mutter. »Sie sind doch noch Kinder – schauen Sie nur, wie viel Angst sie haben!«
Laura hatte die Jungen noch nie zuvor ängstlich erlebt, doch jetzt fürchteten sie sich ganz offensichtlich; ihre Gesichter waren weiß wie Kreide, und sie zitterten wie Espenlaub.
Aber der ältere Mann in Zivil zeigte kein Mitleid. »In einer Besserungsschule kommen sie vielleicht wieder auf den richtigen Weg«, sagte er zu June. »Gehen Sie jetzt zurück zu Ihrem Baby und sehen Sie zu, dass es aufhört zu flennen, bevor es die ganze Nachbarschaft weckt.«
Es waren insgesamt sechs Polizisten: Drei von ihnen führten die Gefangenen die Kellertreppe hinauf, und die letzten drei folgten ihnen, beladen mit Kartons und einem langen, von einem Sack verdeckten Gegenstand.
Laura konnte kaum fassen, was die Polizisten im Wohnzimmer angerichtet hatten: Möbelstücke waren umgeworfen worden, die Matratze lag auf dem Boden, die Gardinen waren zurückgezogen und die Kissen von den Stühlen gerissen worden. Sie nahm Freddy auf den Arm, um ihn zu trösten, und Meggie und Ivy kamen herbeigelaufen; beide weinten heftig.
June trug ihren alten Mantel über ihrem Nachthemd, und das Augen-Make-up war ihr über die Wangen gelaufen. »Bill hat mir versprochen, dass er nichts Ungesetzliches mehr tun würde«, schluchzte sie. »Habe ich im Lauf der Jahre nicht schon genug gelitten?«
»Haben die Polizisten gesagt, was Mark und Paul angestellt haben? Warum hatten sie ein Gewehr?«, fragte Laura. »Sind sie mit Dad auf Raubzüge gegangen?«
»Die Waffe gehörte nicht ihnen, sie gehörte Bill. Sieht so aus, als hätten die kleinen Mistkerle ihre eigenen krummen Dinger gedreht«, jammerte June. »Sie hatten haufenweise Zigaretten in ihrem Zimmer und haben mir niemals auch nur ein paar Päckchen abgegeben.«
Das erklärte recht gut, warum ihre Brüder sich am Abend bei ihrer Heimkehr so verstohlen benommen hatten. Aber Laura war entsetzt darüber, dass ihre Mutter sich mehr über die Tatsache aufregte, dass die Jungen ihr Diebesgut nicht mit ihr geteilt hatten, als darüber, dass sie ebenfalls zu Dieben geworden waren. »In diesem Karton unter unserem Bett war schrecklich viel Geld«, bemerkte sie zögernd. »Hast du davon gewusst?«
»Denkst du, wir hätten Eier und Pommes frites zum Tee gegessen, wenn ich gewusst hätte, dass Geld im Haus war?«, heulte ihre Mutter entrüstet. »Der Mann kann was erleben! Man stelle sich vor, das Geld nicht an einem sicheren Ort zu verstecken und das Gewehr unter unserem Bett liegen zu lassen! Was ist, wenn die Kleinen es gefunden hätten? Die Polizei hat gesagt, Bill hätte ein Postamt überfallen. Ich kenne ihn einfach nicht mehr wieder!«
Laura hatte ihre Mutter unzählige Male in der Vergangenheit erklären hören, sie kenne Bill nicht mehr wieder. Sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass er früher einmal ein ganz anderer Mann gewesen war als der, der nun nur noch zum Schlafen nach Hause kam und sich kaum für seine Familie interessierte. Aber Laura konnte sich nicht daran erinnern, dass er jemals anders gewesen war. Selbst vor der Geburt der letzten drei Kinder, als sie mit ihrer Mutter, Mark und Paul gelegentlich zur Kirmes oder in einen Zirkus gegangen war oder einen Tag am Meer verbracht hatte, war ihr Vater kaum jemals bei ihnen gewesen. Manchmal besah sie sich das Hochzeitsfoto auf dem Kaminsims und versuchte, diesen gut aussehenden dunkelhaarigen Mann mit dem breiten Lächeln mit dem mürrischen übergewichtigen Mann in Einklang zu bringen, der sie anbrüllte, wenn er im Bett lag und seine Ruhe haben wollte. Er aß auch niemals mit der Familie – seine Mahlzeiten wurden über einem Topf mit kochendem Wasser warm gehalten, bis er nach Hause kam. Wenn er sprach, dann war es im Allgemeinen nur ein barscher Befehl, eines der Kinder solle ihm etwas bringen. In Wahrheit konnte Laura sich nicht daran erinnern, dass er sie auch nur ein einziges Mal gefragt hätte, wie sie in der Schule zurechtkomme, oder dass er Freddy auf den Arm genommen oder mit Meggie und Ivy gesprochen hätte.
Laura brachte das Bett ihrer Eltern wieder in Ordnung, und Ivy und Meggie kletterten hinein. Freddy beruhigte sich, nachdem seine Windel gewechselt worden war und er noch ein Fläschchen Milch bekommen hatte, und schlief wieder ein. Laura hätte sich gern ebenfalls schlafen gelegt, konnte es jedoch nicht, während ihre Mutter bleich und angespannt im Raum auf und ab lief und sich eine Zigarette nach der anderen anzündete.
»Sie haben gesagt, die Jungen hätten heute Abend den Zeitungskiosk überfallen«, zischte sie. »Die beiden elenden Burschen konnten nicht mal einen Abend lang bei dir und den Kleinen bleiben! Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass mein Alter die ganze Zeit im Bau sitzt! Jetzt folgen die Jungs auch noch seinem Beispiel! Wie sollen wir nun zurechtkommen? Ich habe nur noch ein paar Pfund in der Tasche.«
»Es wird schon gehen, Mum«, erwiderte Laura in dem Bemühen, sie zu beruhigen. »Wir werden am Montag zum Sozialamt gehen, und vielleicht kann ich Zeitungen austragen.«
Der Gang zum Sozialamt war in Lauras Kindheit ein regelmäßiges Ereignis gewesen, denn sie hatten den Weg jedes Mal antreten müssen, wenn ihr Vater ins Gefängnis gewandert war. Sie fragte sich oft, warum er nicht aufhörte zu stehlen, wenn er doch immer geschnappt wurde.
»Ich kann einfach nicht mehr«, schluchzte ihre Mutter. »Sechs Kinder, eine winzige Wohnung, niemals Urlaub oder ein Tag am Meer. Jetzt muss ich mit eingezogenem Kopf zu dieser Meute unten im Sozialamt gehen, und sie geben mir niemals genug, um davon zu leben. Es ist unerträglich.«
Während der folgenden Monate musste Laura ihrer Mutter recht geben: Es war einfach zu viel, um es ertragen zu können. Mark und Paul hatten nicht nur den Zeitungskiosk überfallen, die Polizei hatte in ihrem Zimmer auch verschiedene andere Gegenstände gefunden, die aus Einbrüchen in Privathäusern stammten. Der Richter war der Meinung, sie hätten einen gehörigen Schock nötig, um ihre Lektion zu lernen, und brummte ihnen zwei Jahre in einer Jugendstrafanstalt auf.
Ihr Vater wurde zusammen mit einem anderen Mann eines bewaffneten Überfalls auf ein Postamt in Uxbridge für schuldig befunden, und sie beide wurden zu zehnjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Es hieß, sie hätten nur deshalb keine achtzehn Jahre bekommen, weil der Waffe der Schlagbolzen gefehlt hatte, sodass sie sie gar nicht hätten benutzen können. Aber ihre Mutter bemerkte, dass zehn oder achtzehn Jahre für sie kaum einen Unterschied machten; sie saß in jedem Fall mit vier Kindern da, die sie ernähren und kleiden musste, und sie glaubte nicht, noch einen weiteren Winter in der feuchten, kalten Wohnung überleben zu können.
Es war die trostloseste Zeit in Lauras Leben. Zuvor war es in der Schule schon schlimm genug gewesen, doch sobald die Zeitungen über die Fälle berichteten, wurden der Hohn und die Gemeinheiten hundert Mal schlimmer. Jemand klebte in der Schultoilette ein Poster an die Wand. Darauf war zu lesen:
Der Vater der stinkenden Wilmslow ist ein Räuber!
Kein Mensch zeigte auch nur einen Funken Mitgefühl für Laura. Ihre Direktorin piesackte sie immer wieder, weil sie nicht die korrekte Uniform besaß und nicht immer ihre Hausaufgaben dabeihatte. Aber wie hätte sie ihre Hausaufgaben machen können, wenn ihre Mutter ständig jammerte, Freddy schrie und Ivy und Meggie sie anflehten, mit ihnen zu spielen? Für die richtige Uniform fehlte ihnen das Geld. Laura musste sich mit dem begnügen, was ihre Mutter auf dem Flohmarkt fand, und sie hatte häufig Hunger, weil das Geld von der Sozialhilfe ihnen zwischen den Fingern zerrann.
Das Leben war für die Wilmslows stets entweder Überfluss oder Hunger gewesen. An einem Tag war ihr Vater mit Bratenstücken, Tüten voller Obst und sogar Zigaretten für einen ganzen Monat nach Hause gekommen. In jenen Zeiten waren sie auf den Markt gegangen und hatten neue Kleider gekauft, und sie hatten Eis essen können, wann immer der Wagen vorbeigekommen war. Aber dann kamen lange Phasen, da sie von Eiern und Pommes frites leben mussten, und wenn ihre Schuhe Löcher in den Sohlen hatten, schnitt June Pappe zurecht und legte sie hinein. Doch eine so lange, gnadenlose Zeit der Entbehrungen wie jetzt hatte es noch nie gegeben. Es kostete zwei Schilling, ihre Kleider in den öffentlichen Bädern zu waschen und zu trocknen, und wenn ihre Mutter befand, dass es nötig sei, war kein Geld mehr für den Stromzähler übrig, und sie mussten bereits bei Einbruch der Dunkelheit ins Bett gehen. Es war Hunger, der Laura schließlich dazu trieb zu stehlen. An einem eiskalten Samstagmorgen kurz nach ihrem dreizehnten Geburtstag im Januar, an dem es zu Hause nichts fürs Abendessen gab als Brot und Margarine, beschloss sie, der Familie etwas Essbares zu beschaffen.
Draußen vor der Metzgerei in der Goldhawk Road stand immer ein Tisch mit in Zellophan verpackten Hähnchen und Eierkartons. Der Laden hatte eine Markise mit Seitenlaschen, und direkt nebenan befand sich ein Zeitungshandel. Laura würde lediglich dort stehen und die Postkarten lesen müssen, auf denen etwas zum Verkauf angeboten wurde, bis sie sich sicher war, dass gerade niemand hinsah. Dann wollte sie mit der Hand unter der Lasche durchlangen, ein Huhn packen, es unter ihrem Mantel verstecken und davongehen.
Niemand sah sie, es war ein Kinderspiel, und als sie nach Hause ging, schämte sie sich nicht. Sie hatte nicht einmal ein schlechtes Gewissen; sie war nur glücklich.
»Das hättest du nicht tun dürfen«, erklärte ihre Mutter, doch sie zog bereits den Zellophanbeutel ab und holte ein Backblech aus dem Schrank. »Ich will nicht, dass mir noch eins meiner Kinder weggenommen wird.«
Aber sobald sie das Huhn in den Ofen geschoben hatte, strich sie Laura zärtlich übers Gesicht. »Du bist ein gutes Kind«, sagte sie. »Ich wünschte, du müsstest mir nicht eine solche Stütze sein, du bist noch viel zu jung.«
Diese Worte des Lobes und die Freude auf Ivys und Meggies Gesichtern, als sie sich später über das gebratene Huhn hermachten, gaben für Laura den Ausschlag. Sie würde ihre Familie in Zukunft versorgen.
Ihre Lehrer hatten immer ihren scharfen Verstand und ihre schnelle Auffassungsgabe gelobt; mit sechs Jahren hatte sie bereits alles lesen und schwere Rechenaufgaben lösen können. Wäre es nicht oft so schwierig gewesen, sich in der überfüllten Wohnung auf ihre Hausaufgaben zu konzentrieren, hätte sie zu den Klassenbesten gezählt. Laura liebte es, mathematische Probleme zu lösen, und ihr kam der Gedanke, dass das Stehlen, ohne sich dabei erwischen zu lassen, ebenfalls ein solches Problem war – sie brauchte es lediglich zu durchdenken, bevor sie handelte.
Irgendwo hatte sie gelesen, es sei Habgier, die die meisten Diebe zu Fall brachte. Daher nahm sie sich vor, niemals etwas zu stehlen, das ihre Familie nicht wirklich brauchte. Auf dem Heimweg von der Schule und an Samstagen sah sie sich in den Läden um und machte sich mit den Menschen vertraut, die darin arbeiteten, und sie prägte sich genau ein, wo alles aufbewahrt wurde.
Ihr Schulregenmantel entpuppte sich bei ihren Diebereien als äußerst nützlich. Wenn sie ihn über dem Arm hatte, konnte sie mühelos ein Päckchen Seifenpulver, eine Toilettenrolle oder eine Tüte Kekse darunter verstecken. Jeden Tag kam sie mit irgendetwas, das sie brauchten, nach Hause, und das einzige Ärgerliche war die Tatsache, dass sie nicht an Käse, Schinken oder Fleisch herankam, weil diese Lebensmittel hinter der Theke aufbewahrt wurden.
Schon bald hatte sie so große Fortschritte gemacht, dass sie Kleider für die Kleinen und Strümpfe und Unterwäsche für ihre Mutter stahl. Und häufig fuhr sie mit der U-Bahn in die Kensington High Street oder in die Oxford Street, wo es eine bessere Auswahl an Waren gab. Sie war stolz darauf, dass sie Dinge von guter Qualität auswählte, und sie kam sich sehr erwachsen vor, weil sie sich um ihre Familie kümmerte.
»Du darfst das nicht mehr tun«, sagte June, wann immer Laura mit irgendetwas nach Hause kam, aber genauso schnell erzählte sie ihr, was die Familie sonst noch benötigte, und Laura verstand den Wink, dass ihre Mutter sich auf sie verließ.
Ein Jahr später waren die Dinge ein wenig besser geworden. June hatte eine Stelle als Putzfrau bekommen und reinigte an zwei Abenden die Woche Büros. Dazu kamen das Geld von der Fürsorge und die Dinge, die Laura mit heimbrachte, sodass sie nicht mehr hungern mussten und die Kleinen gesund und ordentlich gekleidet waren.
Einmal im Monat machte ihre Mutter einen Besuch bei Bill in Wormwood Scrubs, und obwohl sie davon meist in weinerlicher Stimmung heimkam, hatte Laura den Eindruck, dass sie im Allgemeinen weit glücklicher war als zuvor. Während der Sommerferien ging sie häufig mit Laura und den Kleinen in den Park, und zu Hause gab sie sich größere Mühe, sauber und ordentlich zu sein.
»Ich hoffe, du wirst einmal vernünftig genug sein, dir einen Ehemann zu suchen, der einen Beruf hat«, bemerkte sie eines Tages, als sie gerade ihren Frühjahrsputz in der Küche beendet hatten. »Meine Mutter hat immer gesagt, dass Bill ein schlechter Kerl sei und es ein böses Ende mit ihm nehmen werde, aber ich habe ihr nicht geglaubt.«
»Hatte er damals denn gearbeitet?«, fragte Laura.
»Nicht so, dass du es richtige Arbeit nennen würdest, doch es war während des Krieges, und viele Männer wie er, die von der Armee abgelehnt worden waren, gingen hier und da Gelegenheitsarbeiten nach. Ich habe ihn in der Munitionsfabrik kennengelernt, wo ich gearbeitet habe, und ich dachte, er sei ein Gottesgeschenk.«