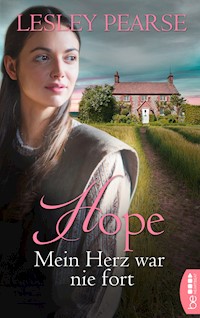7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Gefühle und bewegende Schicksale von Englands Besteller Autorin Lesley Pearse
- Sprache: Deutsch
England 1786. Wegen eines harmlosen Diebstahls wird die junge, mittellose Mary Broad zum Tode verurteilt. Das Schicksal scheint es gut mit ihr zu meinen, als sie bald darauf begnadigt und stattdessen auf einem Gefangenenschiff nach Australien gebracht wird. Was zunächst eine glückliche Fügung zu sein scheint, erweist sich jedoch schnell als harte Prüfung: Die monatelange Überfahrt ist geprägt von Krankheit, Leid und Tod und die unmenschlichen Lebensbedingungen in Australien lassen Mary oftmals verzweifeln. Doch die tapfere Frau hat den unbändigen Willen zu überleben. Zusammen mit ein paar Verbündeten wagt sie schließlich die gefährliche Flucht - getragen einzig und allein von Hoffnung und Liebe.
Basierend auf dem wahren Schicksal einer mutigen Frau - mitreißend erzählt von Englands Nr.-1-Bestseller-Autorin Lesley Pearse.
»Ein dramatischer und mitreißender Roman nach einer wahren Geschichte.« Frankfurter Stadtkurier, Frankfurt
Durch stürmische Zeiten erschien im Original unter dem Titel Remember Me.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 728
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelWidmungDanksagung1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. KapitelPostskriptumNachtragÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
England 1786. Wegen eines harmlosen Diebstahls wird die junge, mittellose Mary Broad zum Tode verurteilt. Das Schicksal scheint es gut mit ihr zu meinen, als sie bald darauf begnadigt und stattdessen auf einem Gefangenenschiff nach Australien gebracht wird. Was zunächst eine glückliche Fügung zu sein scheint, erweist sich jedoch schnell als harte Prüfung: Die monatelange Überfahrt ist geprägt von Krankheit, Leid und Tod und die unmenschlichen Lebensbedingungen in Australien lassen Mary oftmals verzweifeln. Doch die tapfere Frau hat den unbändigen Willen zu überleben. Zusammen mit ein paar Verbündeten wagt sie schließlich die gefährliche Flucht - getragen einzig und allein von Hoffnung und Liebe.
Lesley Pearse
DurchstürmischeZeiten
Aus dem britischen Englischen von Katharina Kramp
Für John Roberts, meinen eigenen Boswell. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich dir bin.
Danksagung
Mein Dank geht an Pam Quick in Sydney, New South Wales, nicht nur für all die Informationen, Bücher und Bilder, die du mir über die Erste Flotte gegeben hast, sondern auch einfach dafür, dass du für mich da warst. Ohne dein aufrichtiges Interesse, deine großzügig bemessene Zeit, deine unermüdliche Hilfe und Unterstützung hätte ich dieses Buch niemals beenden können. Wenn ich zurück nach Sydney komme, schulde ich dir mindestens ein schickes Essen. Gott segne dich.
Während meiner Recherche zu Durch stürmische Zeiten habe ich Dutzende Bücher gelesen. Die besten sind diese hier:
To Brave Every Danger von Judith Cook. Die Wahrheit ist manchmal seltsamer und heldenhafter als eine Geschichte, und Judith Cooks akribisch genau recherchiertes Buch über Mary Bryant aus Fowey ist wirklich inspirierend und ein absolutes Muss für jeden Geschichtsbegeisterten.
Fatal Shore von Robert Hughes. Ein faszinierendes und fabelhaftes Buch über die frühen Jahre Australiens.
The First Twelve Years von Peter Taylor. Erstaunlich informativ, ohne trocken oder langweilig zu werden. Inklusive toller Bilder.
Orphans of History von Robert Holden. Eine zu Tränen rührende Geschichte über die Kinder der Ersten Flotte.
The Floating Brothel von Sian Rees. Die Geschichte einer übergesiedelten Frau, die Passagier an Bord der Juliana war. Schockierend informativ.
Boswell’s Presumptous Task von Adam Sisman. Ein wundervolles Werk über James Boswell.
Dr Johnson’s London von Liza Picard. Wundervoll zu lesen, ein unglaublich lebendiges Bild vom London des achtzehnten Jahrhunderts.
English Society in the Eighteenth Century von Roy Porter.
1. Kapitel
1786
Mary umklammerte das Geländer der Anklagebank, als der Richter in den Gerichtssaal zurückkehrte. Die Fenster waren klein und verschmutzt und ließen kaum Licht herein, aber man konnte die schwarze Kappe auf seiner gelben Perücke erkennen und die erwartungsvolle Stille auf der Empore hören.
»Mary Broad. Sie werden an den Ort zurückgebracht, von dem Sie gekommen sind, und dort gehängt«, erklärte er und sah sie dabei nicht einmal an. »Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein.«
Marys Magen zog sich zusammen, und ihre Beine gaben unter ihr nach. Sie wusste nur zu gut, dass Erhängen die normale Strafe für Straßenraub war, aber in ihr war noch ein wenig Hoffnung gewesen, dass der Richter Gnade walten lassen könnte, weil sie noch so jung war. Sie hätte es besser wissen müssen.
Es war der 20. März 1786, und Mary Broad wurde in ein paar Wochen zwanzig Jahre alt. Sie war in jeder Hinsicht ein durchschnittliches Mädchen, weder besonders groß noch besonders klein, nicht besonders hübsch, aber auch nicht hässlich. Das Einzige, was sie von den anderen Leuten unterschied, denen beim Frühjahrsschwurgericht der Prozess gemacht wurde, war, dass sie eindeutig vom Land kam. Ihr reiner Teint strahlte selbst nach Wochen der Kerkerhaft im Exeter Castle immer noch ein wenig. Ihr dunkles, lockiges Haar war mit einem Band streng zurückgebunden, und ihr Kleid aus gekämmter Wolle war, obwohl inzwischen schmutzig von ihrem Gefängnisaufenthalt, sehr schlicht und zweckmäßig.
Um sie herum wurde es laut, denn der Gerichtssaal von Exeter war voll besetzt. Einige der Anwesenden waren Freunde und Verwandte von anderen Gefangenen, die an diesem Tag ihre Verhandlung haben würden, doch die Mehrheit bestand aus Schaulustigen.
Jedoch waren es keine Mitleidsbekundungen, die man hören konnte, und es war auch nicht Entsetzen über eine so harte Strafe, dem die Anwesenden Ausdruck verliehen. Mary hatte in dem ganzen Raum keinen einzigen Freund. Ein Meer von schmutzigen Gesichtern wandte sich ihr zu. In den Augen glänzte hämische Schadenfreude, und die Bewegung trug den Gestank ihrer ungewaschenen Körper in Marys Nase. Sie warteten auf eine Reaktion von ihr, auf Tränen, Wut oder ein Flehen um Gnade.
Sie wollte aufschreien, um ihr Leben betteln, aber ihre rebellische Seite, die sie überhaupt erst dazu gebracht hatte, jemanden zu bestehlen, drängte sie, wenigstens ihren Stolz zu wahren.
Die Hand eines Wachmanns fiel schwer auf ihre Schulter. Jetzt war es zu spät, jetzt konnte sie nur noch beten.
Mary merkte kaum etwas von der Fahrt zurück ins Exeter Castle, das Gefängnis, in dem sie saß, seit man sie nach ihrer Festnahme in Plymouth hierher gebracht hatte. Sie achtete nicht auf die Eisenfesseln, die an ihren Knöcheln rieben und mit einem weiteren schweren Eisenband um ihre Hüfte verbunden waren. Auch die sieben anderen Gefangenen im Wagen nahm sie kaum wahr und auch nicht das Gejohle der Menge auf der Straße. Mary konnte nur daran denken, dass sie zum Galgen geführt werden würde, wenn sie das nächste Mal den Himmel über sich sah.
Sie hob den Kopf und blickte in die schwache Nachmittagssonne. Als man sie heute Morgen zum Schwurgericht gebracht hatte, hatte die Frühlingssonne sie nach der Dunkelheit in der Zelle beinahe geblendet. Sie hatte sich begierig umgesehen, die neuen Blätter an den Bäumen betrachtet, die sich gerade entfalteten, und das, dumm wie sie war, als gutes Omen gedeutet und wieder Hoffnung geschöpft.
Wie sehr sie sich getäuscht hatte! Sie würde ihr geliebtes Cornwall niemals wiedersehen. Und auch ihre Eltern und ihre Schwester Dolly nicht. Sie konnte nur hoffen, dass sie niemals herausfinden würden, was sie getan hatte. Es war besser, sie glaubten, sie hätte sie verlassen, um in Plymouth oder sogar in London ein neues Leben zu beginnen, als die Schande zu ertragen, wenn sie erfuhren, dass ihr Leben am Galgen geendet hatte.
Ein Schluchzen ertönte, und Marys Blick fiel auf die Frau, die neben ihr saß. Ihr Alter ließ sich nicht schätzen, weil ihr Gesicht von Pockennarben entstellt war und sie sich einen fadenscheinigen braunen Umhang um den Kopf geschlungen hatte, um das zu verbergen.
»Weinen nützt nichts«, meinte Mary und nahm an, dass die Frau ebenfalls gehängt werden sollte. »Zumindest wissen wir jetzt, was uns erwartet.«
»Ich habe nichts gestohlen«, keuchte die Frau. »Ich schwöre, das habe ich nicht. Es waren andere. Sie sind geflohen und haben es mir in die Schuhe geschoben.«
Mary hatte genau diese Geschichte immer wieder von anderen Gefangenen gehört, seit sie im Januar verhaftet worden war. Am Anfang hatte sie den meisten geglaubt, doch inzwischen war sie härter geworden. »Hast du das heute vor Gericht ausgesagt?«, fragte sie.
Die Frau nickte und weinte noch heftiger. »Aber sie meinten, sie hätten einen Zeugen.«
Mary wagte nicht, sich nach der ganzen Geschichte zu erkundigen. Sie wollte ihre Lungen mit klarer Luft füllen und sich den Anblick und die Geräusche der geschäftigen Stadt Exeter einprägen, damit sie sich in der dreckigen, dunklen Zelle daran erinnern konnte, in die sie zurückmusste. Die leidvolle Geschichte der Frau zu hören würde sie nur noch mehr deprimieren. Trotzdem brachte ihr mitfühlendes Wesen es nicht übers Herz, die arme Kreatur zu ignorieren. »Wirst du auch gehängt?«, fragte sie.
Die Frau fuhr herum und sah Mary an. Auf ihrem verwüsteten Gesicht zeigte sich Überraschung. »Nein. Es war nur ein Stück Hammelfleischpastete, das ich gestohlen haben soll.«
»Dann hast du mehr Glück als ich«, seufzte Mary.
Als sie wieder im Castle war, in eine Zelle mit ungefähr zwanzig anderen Gefangenen beiderlei Geschlechts eingesperrt, suchte Mary sich schweigend einen Platz an der Wand, setzte sich und hob die Ketten an ihren Fußfesseln so an, dass sie die Knie anziehen konnte. Sie zog den Umhang eng um sich und lehnte sich an, um über ihre Situation nachzudenken.
Es war eine andere Zelle als die, aus der man sie am Morgen geholt hatte, besser insofern, als frische Luft durch sehr hohe Gitter in der Wand kam. Auch das Stroh auf dem Boden sah etwas sauberer aus, und die Toiletteneimer flossen noch nicht über. Aber es stank immer noch, und mit jedem Atemzug sog man den alles durchdringenden Geruch von Schmutz, Körperflüssigkeiten, Erbrochenem, Schimmel und menschlichem Leiden ein.
Eine unheilvolle Stille erfüllte den Raum. Niemand sprach laut, niemand fluchte oder schrie die Wachmänner an, wie es in der letzten Zelle der Fall gewesen war. Tatsächlich hockten die meisten genau wie sie gedankenverloren oder verzweifelt an die Wand gelehnt da. Mary nahm an, dass ihnen allen das Todesurteil drohte und dass sie genauso benommen davon waren wie sie selbst.
Sie konnte Catherine Fryer oder Mary Haydon nirgends sehen, die Mädchen, mit denen sie gefasst worden war, obwohl sie am Morgen gemeinsam zum Schwurgericht gebracht worden waren. Und sie wusste auch nicht, ob die beiden immer noch auf ihre Verhandlung warteten oder ob sie mit einer milderen Strafe davongekommen waren.
Was auch immer der Grund sein mochte – Mary war froh, dass sie nicht da waren. Sie wollte nicht daran erinnert werden, dass sie ohne die beiden niemals auf den Gedanken gekommen wäre, jemanden zu bestehlen.
Es war zu düster, um die anderen Gefangenen deutlich zu erkennen, denn das einzige Licht kam von einer Laterne im Flur auf der anderen Seite der vergitterten Tür. Aber einem schnellen ersten Blick nach zu urteilen, schien die Zelle sich nicht von denen zu unterscheiden, in denen Mary während der letzten Monate gesessen hatte, sah man einmal davon ab, dass sich in dieser Zelle nun auch Männer unter den Insassen befanden.
Der Altersunterschied zwischen den Gefangenen war groß; er reichte von einem Mädchen von vielleicht sechzehn Jahren, das an der Schulter einer älteren Frau weinte, bis hin zu einem Mann, der vielleicht fünfzig oder sogar älter war. Bei drei Frauen handelte es sich möglicherweise um Huren, denn sie trugen bunte und sogar recht elegante Umhänge, doch die übrigen sahen sehr zerlumpt aus. Frauen mit harten Gesichtszügen, schlechten Zähnen und strähnigem Haar und Männer mit ausgemergelten Gesichtern, die schweigend ins Leere starrten.
Zwei Frauen kannte Mary schon aus der vorherigen Zelle. Birdie, die einen roten Umhang mit einem zerschlissenen Spitzenkragen trug, hatte ihr gestanden, dass sie einen schlafenden Seemann bestohlen hatte. Peg war viel älter, eine der zerlumpten Frauen, aber sie hatte sich standhaft geweigert, etwas über ihr Verbrechen zu erzählen.
Mary ahnte aufgrund der Erfahrungen, die sie in der letzten Zelle gemacht hatte, dass die momentan herrschende Niedergeschlagenheit nicht anhalten würde. Dominante Typen wie Birdie würden sich innerhalb weniger Stunden wieder aufrappeln und den Ton angeben. Viel davon war Angeberei – es war notwendig, stark zu erscheinen, wenn man das Gefängnis überleben wollte. Kämpfen, schreien und bei den Wärtern mehr Essen und Wasser verlangen war ein Weg, den anderen Zelleninsassen zu verdeutlichen, dass man sich nicht herumschubsen ließ.
Mary fragte sich, ob es jetzt noch Sinn machte, sich vor den anderen zu behaupten. Ihr war jedenfalls nicht danach; sie wollte nur wissen, wie viele Tage sie noch leben durfte.
Als sie Mary sah, zog Birdie ihre Ketten hoch und humpelte durch die Zelle zur ihr herüber. »Galgen?«, fragte sie.
Mary nickte. »Du auch?«
Birdie setzte sich neben sie aufs Stroh, und ihr gramerfüllter Gesichtsausdruck bestätigte es. »Dieser Bastard von einem Richter!«, zischte sie. »Der hat doch keine Ahnung, wie es für uns ist. Was nützt es schon, wenn er mich hängen lässt? Wer kümmert sich dann um die Alten?«
Birdie hatte Mary schon bald nach ihrer Ankunft in Exeter erzählt, dass sie zur Hure geworden war, damit ihre alten Eltern nicht verhungern mussten. Aber etwas an ihren bunten Kleidern und ihrem sehr lebhaften Wesen ließ Mary vermuten, dass sie nicht viele moralische Bedenken dabei gehabt hatte. Dennoch war Birdie seit Marys erster Nacht im Gefängnis nett zu ihr gewesen und hatte sie beschützt, und Mary spürte, dass sie im Grunde ihres Herzens eine gute Frau war.
»Ich dachte wirklich, du kämst davon, wo du doch so’n unschuldiges Gesicht hast«, meinte Birdie und streckte ihre schmutzige Hand aus, um damit sanft über Marys Wange zu streichen. »Was ist passiert?«
»Die Dame, die wir bestohlen haben, war im Gerichtssaal«, erzählte Mary traurig. »Sie hat mich wiedererkannt.«
Birdie seufzte mitfühlend. »Na, dann hoffen wir mal, dass sie wenigstens schnell machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf den Tod zu warten.«
Später in jener Nacht lag Mary auf dem dreckigen, mit Stroh bedeckten Boden zwischen ihren Mitgefangenen, die alle fest zu schlafen schienen, und ihre Gedanken wanderten zurück zu ihrem Zuhause und ihrer Familie in Fowey in Cornwall. Sie wusste jetzt, dass sie in glücklichere Umstände hineingeboren worden war als viele der Frauen, die sie seit ihrem Weggang getroffen hatte.
Ihr Vater, William Broad, war ein Seemann, und obwohl es harte Zeiten gegeben hatte, in denen es keine Arbeit für ihn gab, hatte er irgendwie stets dafür gesorgt, dass seine Familie niemals hungerte oder fror. Mary konnte sich daran erinnern, wie sie mit ihrer Schwester Dolly im Bett lag und dem Meer dabei zuhörte, wie es gegen die Hafenwände donnerte, und sich dennoch sicher aufgehoben fühlte, denn wie lange ihr Vater auch auf See war, er ließ immer genug Geld da, um sie bis zu seiner Rückkehr über die Runden zu bringen.
Allein bei dem Gedanken an Fowey mit seinen winzigen Häusern und den Straßen mit dem Kopfsteinpflaster stieg ihr ein Kloß in den Hals. Der Hafen und die Stadt mit ihrem geschäftigen Treiben waren niemals langweilig gewesen, denn sie kannte dort jeden, und die Broads waren eine angesehene Familie. Grace, Marys Mutter, legte großen Wert auf Anstand; sie hielt ihr winziges Haus blitzsauber und versuchte, ihre Töchter in die Hohe Schule des Kochens, Putzens und Nähens einzuweisen. Dolly, Marys ältere Schwester, war die Pflichtbewusste, Folgsame von ihnen und ahmte glücklich das Beispiel der Mutter nach. Ihre Träume drehten sich einzig und allein darum, einen Mann zu finden, Kinder zu haben und einen eigenen Haushalt zu führen.
Mary teilte Dollys Träume nicht. Freunde und Nachbarn sagten oft, dass sie ein Junge hätte werden sollen. Sie führte die Nadel ungeschickt, und Hausarbeit langweilte sie. Am glücklichsten war sie, wenn ihr Vater sie mit zum Fischen auf See nahm, denn sie fühlte sich eins mit dem Meer und konnte das Boot fast genauso gut führen wie er. Sie zog außerdem männliche Gesellschaft vor, denn Männer und Jungen sprachen von aufregenden Dingen, von fernen Ländern, vom Krieg, vom Schmuggeln und von ihrer Arbeit in den Zinnminen. Mary machte sich nichts aus kichernden, einfältigen Mädchen, die sich nur für den neuesten Tratsch und den Preis für ein Haarband interessierten.
Es war ihre Abenteuerlust gewesen, deretwegen sie Fowey verlassen hatte, und sie hatte wirklich geglaubt, ihren Weg machen zu können, wenn sie nur irgendwo anders wäre.
»Du gehst ja nur, weil du noch nie einen Freund hattest und Angst hast, dass dich niemand will«, hatte Dolly beim Abschied nicht besonders freundlich gemeint.
Das stimmte nicht. Mary sehnte sich nicht nach der Ehe. Tatsächlich bemitleidete sie die Mädchen, mit denen sie aufgewachsen war, anstatt sie zu beneiden, denn sie hatten meistens schon ein oder zwei Kinder zu versorgen. Sie wusste, dass ihr Leben härter wurde mit jedem neuen Maul, das sie stopfen mussten, und dass sie immer in der Angst lebten, ihre Männer auf See oder bei einem Minenunglück zu verlieren. Aber das Leben in Cornwall war für alle hart, wenn man nicht zum Adel gehörte. Man musste entweder zur See fahren, in den Minen arbeiten oder dem Adel dienen.
Dolly arbeitete bei den Treffrys in Fowey als Unter-Hausmädchen, doch Mary hatte sich standhaft geweigert, ihrem Beispiel zu folgen. Sie wollte ihre Tage nicht damit verbringen, volle Nachttöpfe auszuleeren oder Feuer zu entfachen und unter der Fuchtel einer gestrengen Haushälterin zu stehen. Sie hatte keine Zukunft darin gesehen. Aber die Alternative war, Fische auszunehmen und einzusalzen, und obwohl ihr diese Arbeit seit ihrer Kindheit vertraut war und sie die Freiheit genoss, sich während des Arbeitens nach Herzenslust mit ihren Kolleginnen unterhalten zu können, so wurde davon doch niemand reich. Man roch ekelerregend, und im Winter war es bitterkalt. Mary hatte sich die gebückte Haltung und die knochigen Finger der Frauen angesehen, die dieser Arbeit schon ihr Leben lang nachgingen, und wusste, dass sie dann früh sterben würde.
Die Matrosen hatten ihr von Plymouth erzählt. Sie sagten, dort gäbe es feine Läden und große Häuser und Möglichkeiten für alle, die fest entschlossen waren, es zu schaffen. Sie hatte gedacht, vielleicht in einem der Läden arbeiten zu können, denn selbst wenn sie nicht lesen und schreiben konnte, so rechnete sie doch verschiedene Posten schneller zusammen als ihr Vater.
Ihre Eltern hatten gemischte Gefühle bei ihrem Weggang. Auf der einen Seite wollten sie Mary zu Hause in Fowey behalten. Doch die Zeiten waren hart, und sie mussten sich anstrengen, um auch die jüngere Tochter durchzubringen. Vielleicht hofften sie auch, dass sie nach ein paar Jahren Arbeit in einem anständigen Beruf einen Mann finden und schließlich heiraten würde.
Mary konnte es damals nicht erwarten, endlich wegzukommen, doch jetzt, da sie auf dem harten, kalten Boden der Gefängniszelle lag und sich an den Tag erinnerte, an dem sie ihr Zuhause verlassen hatte, plagte sie ein schlechtes Gewissen.
Es war sehr früh am Morgen gewesen, an einem wunderschönen Juli-Tag ohne eine Wolke am azurblauen Himmel, und die Sonne hatte bereits ein wenig gewärmt. Ihr Vater war ein paar Tage zuvor nach Frankreich losgesegelt, und Mary hatte darauf bestanden, dass nur Dolly mit ihr zum Hafen gehen sollte, um sie zu verabschieden. Sie wollte keine weiteren Vorträge ihrer Mutter darüber hören, dass sie sich an Bord des Schiffs wie eine Lady benehmen und sich vor Fremden in Acht nehmen sollte.
Ihre Mutter ließ sich ihre Gefühle niemals anmerken, deshalb war Mary ein bisschen irritiert, als sie ihr an der Tür einen Abschiedskuss geben wollte und sie herzlich umarmte.
»Sei ein gutes Mädchen«, sagte Grace, und ihre Stimme brach. »Sprich deine Gebete und stell nichts an.«
Kichernd vor Aufregung lief Mary mit Dolly davon. Erst als sie sich am Ende der schmalen Straße noch einmal umdrehte, erkannte sie, dass ihre Mutter immer noch in der Tür stand und ihnen nachblickte. Sie sah in diesem Moment alt und klein und merkwürdig verletzlich aus, denn sie hatte ihr Haar für den Tag noch nicht aufgesteckt. Es war so grau wie ihr Kleid und ließ sie beinahe mit den Steinen des kleinen Hauses verschmelzen. Obwohl sie das Gesicht ihrer Mutter nicht deutlich sehen konnte, wusste Mary, dass sie weinte. Doch Grace gelang es trotzdem, ihr fröhlich zu winken.
»Ich weiß nicht, warum du glaubst, dass es in Plymouth besser ist als hier«, sagte Dolly gereizt, als sie den Hafen erreichten und das Schiff dort warten sahen. »Ich wette, man könnte um die ganze Welt fahren und würde doch nirgends einen Ort finden, an dem es so schön ist wie hier.«
»Sei nicht so«, entgegnete Mary, weil sie annahm, Dolly wäre eifersüchtig. Ihre Schwester war viel hübscher als sie selbst, mit Augen, die so blau waren wie der Himmel, einer glatten, rosigen Haut und einer hübschen kleinen Stupsnase. Aber Mary hatte das Gefühl, als wünschte Dolly sich oft, mutiger zu sein. Vielleicht litt sie darunter, dass ihr Leben schon so verplant war.
»Ich kann nichts dafür«, erwiderte Dolly kleinlaut. »Ich werde dich so sehr vermissen! Bleib nicht zu lange fort.«
Mary erinnerte sich daran, wie sie ihre Schwester umarmt hatte. »Ich werde ein Vermögen machen und dich dann nachkommen lassen«, hatte sie versprochen. Hätte sie gewusst, dass sie sich niemals wiedersehen würden, hätte sie ihr gesagt, wie sehr sie sie liebte. Doch an jenem sonnigen Morgen konnte sie gar nicht schnell genug auf das Schiff kommen. Es kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, dass sie in Plymouth vielleicht versagen würde.
Was Mary nicht bedacht hatte, war die Tatsache, dass Hunderte von Mädchen jede Woche in Plymouth vom Schiff gingen und nach Arbeit suchten. Und es waren die Hübschen, die lesen und schreiben und gute Referenzen vorweisen konnten, die in den guten Positionen landeten. Sie selbst bekam nur einen Job in einer Hafentaverne, wo sie die Töpfe spülte und den Boden wischte. Ihr Bett bestand aus ein paar Säcken im Keller.
Um Michaelis warf der Wirt sie raus. Er behauptete, sie hätte Geld gestohlen, aber das stimmte nicht. Sie hatte sich nur geweigert, mit ihm zu schlafen. Ohne eine Referenz konnte sie keinen anderen Job finden, und sie war zu stolz, um nach Fowey zurückzugehen und sich anzuhören: »Ich habe es dir doch gleich gesagt.«
In dem Moment, als sie Thomas Coogan unten am Hafen traf, wusste sie, dass sie sich auf direktem Weg in die Hölle befand. Sicher würde sich doch kein anständiges Mädchen von einem völlig Fremden zum Essen einladen lassen. Und sie hätte ihm natürlich auch nicht erlauben dürfen, ihre Hand zu halten, sondern schreiend weglaufen müssen, als er ihr vorschlug, bei ihm zu wohnen, bis sie einen neuen Job gefunden hatte. Aber etwas an seinem schlanken, hübschen Gesicht, dem Funkeln in seinen blauen Augen und den Geschichten, die er von Reisen nach Frankreich und Spanien erzählte, zog sie in seinen Bann.
Thomas hielt sich an keine der Regeln, mit denen Mary aufgewachsen war. Er scherte sich nicht um den König, die Kirche oder irgendwelche anderen Autoritäten. Er benahm sich weltmännisch und legte viel Wert auf sein Äußeres. Und Mary hatte so viel Spaß mit ihm wie noch niemals zuvor.
Das mochte zum Teil daran liegen, dass er sie so zu begehren schien. Er wollte sie im Arm halten und küssen. Kein Mann hatte sie jemals auf diese Weise begehrt. Die meisten sahen nur eine Freundin in ihr. »Du bist hübsch«, sagte Thomas. »Deine grauen Augen erinnern an einen aufkommenden Sturm, und deine Lippen sind zum Küssen gemacht.«
Der erste Tag mit ihm war zauberhaft. Es regnete heftig, und er nahm sie mit in eine Taverne am Hafen und trocknete ihren Umhang am Feuer. Er ließ sie auch zum ersten Mal Rum probieren. Sie mochte den Geschmack nicht oder die Art, wie er ihr in der Kehle brannte, doch es gefiel ihr, dass Thomas sich vorbeugte und ihr mit der Zungenspitze über die Lippen strich.
»An dir schmeckt es wie Nektar«, flüsterte er. »Trink aus, meine Süße, das wird dich wärmen.«
Bei ihm fühlte sie sich so lüstern, ihr ganzer Körper schien zu glühen, und das lag nicht nur am Rum. Es waren seine Schlagfertigkeit, das Gefühl seiner Hand in ihrer, die Ahnung, dass sie kurz davor stand, etwas Gefährliches und doch auch Wundervolles zu tun.
Im Nachhinein hätte ihr natürlich auffallen müssen, dass etwas nicht in Ordnung war, denn er versuchte niemals, mit ihr ins Bett zu gehen. Er küsste sie leidenschaftlich und beteuerte immer wieder, sie zu lieben, aber weiter ging er nie. Damals glaubte Mary in ihrer naiven Art, dass ihn Liebe und Respekt ihr gegenüber so zurückhaltend sein ließen, doch später entdeckte sie dann die Wahrheit.
Thomas Coogan interessierte sich für niemanden außer sich selbst. Er war ein Taschendieb, und als er sie weinend am Hafen sitzen sah, wusste er, dass dieses Mädchen vom Land mit seiner sauberen, unschuldigen Ausstrahlung die ideale Komplizin für ihn war. Es brauchte nur ein paar mitfühlende Worte, um ihr Vertrauen zu gewinnen.
Während der ersten paar Wochen nach ihrem Kennenlernen wäre es Mary niemals in den Sinn gekommen, dass er häufig Brieftaschen, Taschenuhren oder andere wertvolle Dinge mit seiner freien Hand stahl, während sie Arm in Arm vor einem Schaufenster standen oder über den Markt schlenderten. Sie war zu bezaubert von seinem Charme, zu fasziniert von seinen interessanten Freunden und Bekannten und zu beeindruckt von seiner Großzügigkeit, um genauer hinzusehen.
Als es ihr endlich bewusst wurde, war sie so an seine leichte, lustige Lebensweise gewöhnt, dass es ihr egal gewesen wäre, wenn er ihr gestanden hätte, ein Schwerverbrecher zu sein. Als er kurz nach Weihnachten verschwand und sie in der Pension zurückließ, in die er sie gebracht hatte, war sie untröstlich.
Wahrscheinlich hatte die Polizei ihn erwischt, und so schloss sie sich Mary Haydon und Catherine Fryer an. Sie wollte vor den beiden Taschendiebinnen, von denen Thomas so viel gehalten hatte, nicht ihr Gesicht verlieren. Sie schienen so weltgewandt zu sein, so extrem mutig, und außerdem brauchte Mary Geld, um die Miete für Thomas’ Zimmer zu bezahlen, für den Fall, dass er zurückkam.
Zuerst stand sie nur Schmiere, während die anderen beiden auf belebten Straßen und Märkten Brieftaschen stahlen. Manchmal lenkte sie die Leute ab, indem sie vorgab, in Ohnmacht zu fallen, oder indem sie behauptete, man hätte ihr selbst die Brieftasche gestohlen. Aber der Tag kam, an dem Catherine meinte, es würde für Mary Zeit, auch mal ein bisschen was zu riskieren, und als sie die kleine, vornehm angezogene Frau sahen, die mit dem Arm voller Pakete über die Hauptstraße nach Hause ging, schien sie das perfekte erste Opfer zu sein.
Wenn Mary ihren Mut nicht unbedingt hätte beweisen wollen, hätte sie der Frau vielleicht nur ein Bein gestellt und wäre mit einem der Pakete weggelaufen. Aber stattdessen griff sie mit einer Hand nach dem hübschen Seidenhut der Frau und fing alles auf, was diese erschrocken fallen ließ. Dann warf sie die Pakete zu Catherine und Mary Haydon hinüber, bevor sie selbst weglief. Leider verfolgten einige Leute sie, trieben sie in einer Gasse in die Enge und riefen die Polizei.
An die meisten Einzelheiten ihrer Verhaftung und an die Zeit im Gefängnis in Plymouth konnte Mary sich nur noch dunkel erinnern, denn die spätere Reise nach Exeter blendete alles aus. Vier Tage lang war sie in einem offenen Wagen gefahren, an drei andere Frauen gekettet, von denen zwei ihre vermeintlichen Freundinnen waren, die sie den ganzen Weg über beschimpften, weil man sie durch ihre Schuld ebenfalls erwischt hatte. Es war Januar, und der eisige Wind fegte über die trostlosen Moore und fuhr ihnen wie Messer über die Haut. Wenn sie sich erleichtern wollten, mussten sich alle Frauen gleichzeitig hinhocken, während die Wachen ihnen anzügliche Blicke zuwarfen. Jeder einzelne Schritt war Folter, denn die Ketten schnitten in ihre zarte Haut, und sie waren noch nicht daran gewöhnt, ihre Bewegungen zu koordinieren. Nachts wurden sie in den Stall einer Gastwirtschaft gesperrt, und Wasser und Brot waren das Einzige, was sie bekamen. Mary glaubte, vor Kälte zu sterben. Tatsächlich sehnte sie ihren Tod herbei, damit sie den Zorn und die verächtlichen Bemerkungen ihrer Mitgefangenen nicht mehr ertragen musste und das Wissen, dass man für das Verbrechen Straßenraub gehängt wurde.
In ihrer ersten Nacht im Exeter Castle war es Birdie, die sie tröstete und ihr versicherte, dass sie sich an die Ratten, die Läuse, den Dreck und das verschimmelte Brot gewöhnen würde, genauso wie daran, den Toiletteneimer zu benutzen, während alle anderen zusahen. Inzwischen akzeptierte sie all das als Teil des Gefängnislebens und war davon überzeugt, für das, was sie getan hatte, Strafe zu verdienen. Aber sie konnte nicht akzeptieren, dass sie in ein paar Tagen sterben sollte, dass sie niemals mehr als freier Mensch über die Straße laufen, niemals mehr die Wellen an den Strand rollen sehen und niemals mehr einen Sonnenuntergang betrachten sollte.
Und dann weinte sie, weil sie ihre Eltern enttäuscht und ihrer Familie Schande gebracht hatte und weil sie nicht auf ihr Gewissen gehört hatte, obwohl sie doch wusste, dass Stehlen eine Sünde war.
Es war eine wohlbekannte Tatsache, dass ungefähr die Hälfte der zum Tode Verurteilten eine Art Begnadigung erhalten würde. Während der nächsten drei Tage diskutierten Marys Mitgefangene über nichts anderes, und jeder hoffte, zu den Glücklichen zu gehören.
Aber Mary war keine Närrin. Sie wusste, man brauchte draußen Freunde, einen besorgten oder freundlichen Herrn oder eine Herrin, ein Mitglied des Klerus oder einen wohlhabenden Freund, der für einen um Gnade ersuchte. Während die Stunden und Tage langsam verstrichen, wurde klar, wer von ihren Mitgefangenen zu den Glücklichen gehörte. Es waren diejenigen, die etwas Gutes zu essen oder zu trinken, Geld und sogar saubere Kleidung geschickt bekamen.
Mary beobachtete neidvoll das junge Mädchen und die Frau, Nichte und Tante, wie sie jetzt wusste, während sie heiße Fleischpasteten aßen, die ihnen einer der Wachmänner gebracht hatte. Sie waren wegen Diebstahls in einer Pension verurteilt worden, beteuerten jedoch schon seit ihrer Verhaftung ihre Unschuld. Nach den Pasteten und Decken zu urteilen, die sie bekamen, sagten sie vielleicht die Wahrheit, denn ganz mittellos schienen sie nicht zu sein. Zumindest gab es da draußen jemanden, der sie versorgte und sich für ihre Begnadigung einsetzte.
Doch einige Gefangene, diejenigen ohne Hoffnung auf Begnadigung, waren während ihrer letzten Tage sehr heiter geworden. Vielleicht lag es daran, dass in ihren Augen ein schneller Tod dem Elend einer langen Gefängnisstrafe oder einem langsamen Siechtum vorzuziehen war, denn sie waren ständig in Gefahr, an Typhus zu erkranken. Für manche der Gefangenen war es sogar fast so etwas wie eine Ehre, gehängt zu werden. Dann versammelte sich nämlich stets eine große Menschenmenge, um bei den Hinrichtungen zuzusehen. Wenn sie mit Würde und Mut in den Tod gingen und die Bewunderung der gaffenden Leute erlangten, würden sie so etwas wie Helden sein und vielleicht sogar zu einer Legende werden, hofften sie.
Dick Sullion war ein Mann, der das so sah, und er hatte Mary mit seinem Humor und seiner Lebensphilosophie sehr aufgebaut. Wie sie war er wegen »High Toby« verurteilt worden, wie Straßenraub umgangssprachlich genannt wurde. Aber Dicks Verbrechen passte viel eher auf die Beschreibung als Marys, denn Dick hatte an einer abgelegenen Straße auf der Lauer gelegen und auf unvorsichtige Reisende gewartet und ihnen ihre Wertgegenstände und ihre Pferde abgenommen.
Er war ein großer Mann von fast einem Meter achtzig, mit einem rötlichen Gesicht, breiten Schultern und einem nicht zu unterdrückenden Sinn für Humor. Als Mary am ersten Morgen nach ihrer Verurteilung aufgewacht war, hatte er derbe Schanklieder darüber gesungen, dass er betrunken zum Galgen gehen würde. Natürlich hatte sie angenommen, er wäre tatsächlich betrunken, denn diejenigen, die Geld oder Lebensmittel hatten, um die Wachen zu bestechen, konnten sich Tag und Nacht volllaufen lassen. Doch als sie sich aufsetzte, lächelte er sie an, und seine blauen Augen waren klar und strahlten.
»Hat doch keinen Sinn, hier rumzuliegen und Trübsal zu blasen«, meinte er, wie um sein Verhalten zu erklären. »Ich hatte ein gutes Leben, und es ist besser, sie hängen mich auf, als dass ich an einem Ort wie diesem meinen Humor und mein gutes Aussehen verliere.«
»Manche von uns würden lieber schlafen, als darüber nachzudenken«, erwiderte sie.
Mary hatte während der ersten Tage ihrer Gefangenschaft im Januar gelernt, dass es ratsam war, sich starke und schlaue Freunde zu suchen, die einen beschützen konnten, und da Dick aussah, als erfüllte er beide Kriterien, erlaubte sie ihm, sich zu ihr zu setzen, und redete mit ihm.
Sie fand bald heraus, dass Dick kein Geld hatte, um sich zusätzliche Essensrationen zu kaufen. Er hatte alles während der ersten Wochen vor seiner Verhandlung ausgegeben, erzählte er ihr. Doch selbst wenn er ihr die letzten paar Tage nicht mit etwas zu essen oder zu trinken versüßen konnte, so blieb er doch stark und zäh und kannte sich aus, und die Gespräche mit ihm und sein Lachen munterten Mary auf.
Dick kam ebenfalls aus Cornwall. Es tat gut, mit ihm über die Heimat zu reden, und es dauerte nicht lange, bis sie ihm gestand, dass sie sich für ihr Verbrechen schämte und das Gefühl hatte, Schande über ihre Familie gebracht zu haben.
»Darüber solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen«, meinte er, und sein Akzent war so deutlich und tröstlich wie der ihres Vaters. »Wir tun alle das, was nötig ist, um zu überleben. Die Regierung ist schuld, dass wir jetzt hier sitzen. Die hohen Steuern und all das … Sie rauben uns den letzten Penny und leben in Palästen, während wir hungern. Ich habe von denen genommen, die es sich leisten konnten, und du auch. Geschieht ihnen recht, würde ich sagen.«
Mary, die dazu erzogen worden war, ehrlich und gottesfürchtig zu sein, stimmte ihm nicht ganz zu, aber das würde sie nicht zugeben. »Hast du denn keine Angst vorm Sterben?«, fragte sie stattdessen.
Er zuckte die Schultern. »Ich war so oft nah dran, dass es keine Rolle mehr spielt. Was ist Hängen denn schon im Vergleich zum Ausgepeitscht-Werden auf einem Schiff? Hab ich mit sechzehn zum ersten Mal erlebt. Also das ist was, wovor man Angst haben kann; das sind so schlimme Schmerzen, dass man um Erlösung fleht. Hängen geht schnell. Mach dir keine Sorgen, meine Kleine, ich halte deine Hand bis zum Ende.«
Mary ließ sich von Dicks Worten ein bisschen trösten. Wenn sie schon sterben musste, würde sie ihrem Tod mutig ins Auge sehen, beschloss sie.
Vier Tage nach ihrer Verhandlung kam gegen zehn Uhr morgens der Wachmann an die Zellentür und rief nach Nancy und Anne Brown. Das waren die Tante und die Nichte, die wegen Diebstahls verurteilt worden waren. Er erklärte, man habe sie wegen neu aufgetauchter Beweise freigesprochen, und sie könnten gehen.
Trotz ihrer eigenen schlimmen Lage freute Mary sich für die beiden und stand auf, um sie zum Abschied zu küssen. Sie hatte sich während der vergangenen zwei Tage länger mit den zwei Frauen unterhalten und war sicher, dass sie so unschuldig waren, wie sie behaupteten. Sie hatten die Zelle gerade verlassen, als der Wachmann nochmals vier Namen rief, die von drei Männern und Marys.
»Ihr kommt mit mir«, meinte er barsch.
Mary drehte sich entsetzt zu Dick um. Sie war sicher, auf der Stelle zum Galgen geführt zu werden.
Dick legte eine große Hand auf ihre Schulter und drückte sie. »Ich glaube nicht, dass es das ist«, sagte er mit großer Überzeugung. »Am Ende der vierteljährlichen Verhandlungstage gehen sie die Liste durch und suchen Leute für die Deportation aus. Ich schätze, sie haben dich ausgewählt.«
Der Wachmann schrie sie an, ihm jetzt zu folgen, und ließ Mary keine Zeit, sich anständig von Dick oder Birdie zu verabschieden.
Während sie hinter William, Able und John, ihren Mitgefangenen, durch den dunklen Gang schlurfte und ihre Ketten über den groben Steinboden schleiften, hörte sie Dicks Stimme hinter sich. »Sieben Jahre, länger dauert es nicht, bis du frei bist, meine Kleine. Sei mutig und stark, dann geht es schnell vorbei.«
Able, ein krank aussehender Mann um die dreißig, drehte sich zu Mary um. »Was weiß der denn schon?«, meinte er mürrisch. »Ich habe gehört, dass sie keine Leute mehr nach Amerika schicken, jetzt, wo der Krieg vorbei ist.«
Mary hatte dasselbe gehört, als sie in Plymouth gewesen war. Wenn das stimmte, dann war es ein Segen, denn sie war mit den Horrorgeschichten von Seeleuten aufgewachsen, die von den Schrecken in jenem weit entfernten Land berichteten. Strafgefangene wurden dort genauso behandelt wie schwarze Sklaven. Man ließ sie hungern, schlug sie und ließ sie auf dem Land arbeiten, bis sie vor Erschöpfung tot umfielen. Doch wenn man sie nicht nach Amerika schickte, wohin dann? Und würde es dort besser sein?
Als sie im Hof standen, sah Mary die anderen Gefangenen, die dort warteten, darunter Mary Haydon und Catherine Fryer, ihre alten Partnerinnen. Insgesamt waren es fünf Frauen und fünfzehn oder sechzehn Männer. Mary Haydon wandte den Kopf ab und blickte in eine andere Richtung, als sie Mary entdeckte, doch Catherine funkelte sie böse an. Ganz offensichtlich machten die beiden sie also immer noch für ihre missliche Lage verantwortlich.
Ein Richter, oder zumindest nahm Mary an, dass er einer war, weil er eine Perücke und einen Umhang trug, kam die wenigen Stufen in den Hof herunter, flankiert von zwei anderen Männern. Dann las er ihnen aus einem Stück Pergament vor.
Mary konnte nicht verstehen, was er da las. Sie hörte »… durch das Schwurgericht und aus den Gefängnissen unseres Herrn, des Königs …« und dann eine lange Reihe von »Sirs«, die sie alle nicht kannte. Erst als ihr eigener Name fiel, spitzte sie wieder die Ohren. Bei den Worten »Seine Majestät hat sich in seiner unendlichen Güte dazu entschlossen, ihnen seine königliche Gnade zu gewähren« klopfte Marys Herz aufgeregt. Aber als der Richter weiterlas, verwandelte sich ihre Freude wieder in Angst, denn die Begnadigung war, wie Dick schon vermutet hatte, mit einer siebenjährigen Deportation verknüpft.
Nachdem der Richter den Gefängnishof verlassen und die Gefangenen dort mit den Wachen allein gelassen hatte, redeten sie aufgeregt miteinander, und ihre Freude darüber, nicht hängen zu müssen, mischte sich mit der Furcht davor, was die Deportation für sie bedeuten würde.
»Ich habe noch nie jemanden getroffen, der zurückgekommen ist«, sagte ein Mann düster. »Sie müssen alle gestorben sein.«
»Ich kenne einen Mann, der wieder nach Hause gekommen ist«, verkündete ein anderer laut. »Und er hatte sogar die Taschen voller Geld.«
Mary lauschte den hektisch hin und her geworfenen unterschiedlichen Meinungen. Während sie persönlich das Gefühl hatte, dass eine siebenjährige Strafe, wie hart sie auch immer sein mochte, nicht so schlimm sein konnte, wie gehängt zu werden, schien jeder im Hof sich mit dem Thema besser auszukennen als sie. Deshalb hatte es keinen Sinn, selbst etwas dazu zu sagen. Aber als die Frau, die neben ihr stand, zu weinen anfing, legte sie den Arm um sie, um sie zu trösten.
»Das ist besser, als zu sterben«, meinte sie leise. »Wir werden draußen an der frischen Luft sein, und wir können vielleicht sogar entkommen.«
Able, der vor ihr stand, musste ihre Worte gehört haben, denn er drehte sich zu ihr um. Auf seinem Gesicht lag ein spöttischer Ausdruck. »Falls wir nicht schon auf der Reise krepieren«, entgegnete er.
Mary dachte bei sich, dass er wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange zu leben haben würde. Er hatte einen schrecklichen Husten, er war sehr dünn und der Einzige in der Zelle, der es nicht eilig hatte, wenn die tägliche Essensration – schimmeliges Brot – ausgegeben wurde.
»Solange ich noch atme, habe ich auch Hoffnung«, erwiderte sie unerschütterlich.
Weniger als eine Stunde später öffneten sich die Tore des Gefängnishofes, und zwei große, von Pferden gezogene Wagen wurden hereingebracht.
Die Gefangenen hatten sich alle darüber gewundert, warum man sie im Hof stehen ließ, aber niemand hatte erwartet, dass man sie schon an diesem Tag aus dem Exeter Castle wegbringen würde. Doch so war es offensichtlich geplant, und ohne weitere Verzögerungen kettete man sie jeweils zu fünft zusammen und befahl ihnen, in die Wagen zu steigen. Wieder befand sich Mary neben Catherine Fryer und Mary Haydon. Auf ihrer anderen Seite saßen die Frau, die sie vorher getröstet hatte – ihr Name lautete Elizabeth Cole –, und noch eine andere, die Elizabeth Baker hieß. Hinter ihrer Bank hockten fünf Männer, einer davon war Able.
Während der Wagen langsam aus Exeter hinausfuhr, wurde Mary von Catherine Fryer und Mary Haydon ständig beschimpft.
»Das ist deine Schuld«, wiederholte Catherine immer und immer wieder. »Du hast uns das eingebrockt.«
Elizabeth Cole, die sie Bessie nannten, drückte mitfühlend Marys Hand, und schließlich gebot sie den beiden Einhalt. »Haltet endlich die Klappe, ihr zwei«, fuhr sie sie an. »Wir stecken alle zusammen in diesem Schlamassel, ob wir wollen oder nicht. Es hat keinen Sinn, Mary die Schuld zu geben. Ihr wärt doch irgendwann sowieso gefasst worden. Außerdem wollen wir anderen diesen ganzen Mist nicht mehr hören.«
Mary war gerührt über Bessie Coles Einmischung. Bessie sah seltsam aus; sie war rothaarig und sehr dick, mit einem schief stehenden Auge und mehreren fehlenden Zähnen, aber sie war mutig genug gewesen, ihre Meinung zu sagen, und das ließ ahnen, dass sie nicht so unterwürfig war, wie sie aussah.
Die Männer hinter ihnen stimmten alle zu, und vielleicht brachte das die beiden Frauen endlich dazu aufzuhören, denn sie verfielen in Schweigen.
Nach einer Weile stieß einer der Männer in der Reihe hinter ihnen Mary an. »Flirte mit dem Wachmann, damit er dir sagt, wohin wir fahren«, raunte er.
»Warum ich?«, flüsterte sie zurück.
»Du bist die Hübscheste«, erwiderte er.
Bis zu diesem Moment hatte Mary wirklich geglaubt, über keinerlei Vorzüge zu verfügen – sie hatte kein Geld, keinen Besitz, mit dem sie jemanden bestechen konnte, und keine einflussreichen Freunde. Alles, was sie besaß, waren die Kleider, die sie am Leibe trug, und die waren abgetragen und schmutzig. Aber während sie die Reihe der Frauen betrachtete, sah sie, dass sie jünger, gesünder und stärker war als sie alle.
Catherine und die andere Mary hatten schon jahrelang von Diebstahl gelebt, bevor Mary sie kennengelernt hatte. Damals hatte sie sich von ihren farbenprächtigen Kleidern täuschen lassen und geglaubt, sie wären ihr in jeder Hinsicht überlegen. Aber billige Seide machte sich nicht gut, jedenfalls nicht im Gefängnis, und ihre verhärmten Gesichter und ihre graue Haut, der hoffnungslose Ausdruck ihrer Augen und ihre Gossensprache zeigten, was sie tatsächlich waren. Was Bessie und Elizabeth anging, so wusste Mary zwar nicht, was sie verbrochen hatten oder aus welchen Verhältnissen sie stammten, aber sie sahen beide so erschöpft und abgearbeitet aus wie die Ärmsten der Armen daheim in Fowey.
Und auf einmal sah sie ihre Chance. Sie war jung und stark; kein Mann hatte sie bis jetzt berührt. Sie wusste, dass sie schlauer war als die meisten, und sie war entschlossen.
So wartete sie, bis Bessie sich mal erleichtern musste, und als alle Frauen vom Wagen gestiegen waren, stellte Mary sich so hin, dass sie ihre Freundinnen mit ihrem Rock vor den Blicken des Wachmanns abschirmte, und lächelte ihn freundlich an.
»Wohin bringen Sie uns eigentlich?«, fragte sie. »Zurück ins Gefängnis nach Plymouth oder direkt auf ein Schiff nach Amerika?«
Der Wachmann war ein Mann mit einem harten Gesicht, braunen, abgebrochenen Zähnen und einem abgenutzten Hut, den er sich über seine schmalen Augen gezogen hatte.
»Ihr landet auf einem Gefängnisschiff in Devonport«, meinte er mit einem teuflischen Grinsen. »Schätze, viel weiter werdet ihr nicht kommen.«
Mary keuchte auf. Sie hatte vielleicht noch kein Gefängnisschiff gesehen, aber sie kannte deren schrecklichen Ruf. Es waren alte Kriegsschiffe, die an Flussmündungen und Buchten festgemacht waren, die Antwort der Regierung auf überfüllte Gefängnisse. Die Verantwortung dafür war an Privatpersonen übergeben worden, deren einziges Interesse es war, so viel Profit wie möglich aus jedem Gefangenen zu ziehen. Es hieß, dass die Unglücklichen, die dort landeten, entweder verhungerten oder sich im ersten Jahr zu Tode arbeiteten. Denn um einen Nebenerwerb zu haben, zwangen die Betreiber dieser schrecklichen Höllenlöcher die Gefangenen, wie Sklaven an Land zu arbeiten, normalerweise um Befestigungen am Ufer zu bauen.
»Ich dachte, Frauen würden dort nicht hingeschickt«, wandte sie mit zitternder Stimme ein.
»Die Zeiten ändern sich.« Er grinste wieder. »Du putzt dich besser raus, wenn du da lebendig rauskommen willst.«
Mary schluckte und sah ihm in die Augen. Wachen wurden zu hart bestraft, als dass sie es gewagt hätten, jemanden laufen zu lassen, wie »nett« eine Gefangene auch zu ihnen sein mochte. Das wusste Mary. Doch dieser Wachmann glaubte vielleicht, sie wäre dumm genug, sich wider besseres Wissen an ihn heranzumachen in der Hoffnung, er würde ihr im Gegenzug zur Flucht verhelfen.
»Aber der Richter sagte, wir würden deportiert.« Sie zwang ein paar Tränen aus ihren Augen.
»Das werdet ihr auch«, antwortete er, und seine Stimme wurde weicher. »Doch seit dem Krieg können sie niemanden mehr nach Amerika schicken. Sie haben es mit Afrika versucht, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt sprechen alle von einem Ort namens Botany Bay, doch der liegt auf der anderen Seite der Welt.«
Mary erinnerte sich dunkel daran, wie einer der Seeleute in der Hafentaverne, in der sie einmal gearbeitet hatte, etwas über einen Captain Cook erzählt hatte, der für England ein Land am anderen Ende der Welt erobert hatte. Sie wünschte sich jetzt, sie hätte besser zugehört, aber damals war es ihr genauso unwichtig erschienen wie die Frage, ob König George tatsächlich verrückt war oder was die großen Damen zu den Bällen in London trugen. »Glauben Sie, man schickt uns dorthin?«, hakte sie nach.
Er zuckte die Schultern und fuhr die anderen Frauen an, die sich um Mary scharten, um seine Antwort zu hören: »Los, zurück in den Wagen!«, befahl er barsch. »Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit noch ein paar Meilen hinter uns bringen.«
Als sie wieder im Wagen saßen, beschloss Mary, dass es keinen Sinn hatte, an etwas anderes als die Gegenwart zu denken. Es war vielleicht unbequem im Wagen, aber hier draußen in der Frühlingssonne war es allemal angenehmer als in einem stinkenden Gefängnis. Sie würde die Augen nach einer Fluchtmöglichkeit offen halten.
Vor Devonport bot sich ihr bestimmt keine Möglichkeit zur Flucht, überlegte sie. Wenn es die Wachen auf dieser Reise genauso handhaben würden wie die auf dem Weg von Plymouth nach Exeter, dann würden sie und ihre Mitgefangenen die ganze Zeit über aneinandergekettet bleiben.
Doch es gab eine vage Möglichkeit, dass ihnen die Ketten abgenommen wurden, wenn man sie mit dem kleinen Boot hinaus zu dem Gefängnisschiff ruderte. Wenn es so sein sollte, konnte sie ins Wasser springen und wegschwimmen. Mary lächelte in sich hinein. Es war eine sehr vage Hoffnung, aber sicher würde keiner der Wachmänner mit einem solchen Fluchtversuch rechnen. Schließlich konnten die wenigsten Leute schwimmen, selbst Seeleute wie ihr Vater nicht.
Den Gedanken ans Schwimmen empfand Mary als angenehm, weil sie dann den Gefängnisgestank abwaschen und versuchen konnte, einen Küstenabschnitt zu erreichen, den sie gut kannte. Diese Aussicht war jedes Risiko wert, und selbst wenn ihr der Sprung ins Wasser vom Ruderboot aus nicht gelingen würde, konnte sie vielleicht nachts vom Gefängnisschiff springen.
Doch während die Schatten des Nachmittages immer länger wurden und es kälter wurde, verließ Mary wieder der Mut. Selbst wenn sie entkam, wohin sollte sie gehen? Sie konnte nicht zurück nach Cornwall, dort würde man sie sofort wieder verhaften. Und wie sollte sie ohne Geld und in schmutzigen Kleidern und löchrigen Stiefeln irgendwo anders hinkommen?
Als es dämmerte, plagten Mary schreckliche Schmerzen, und sie hatte nur noch den einen Wunsch: sich hinzulegen. Selbst bei der kleinsten Bewegung von ihr oder ihren Mitgefangenen schnitten die Eisenbänder in ihre Knöchel. Sie hatte ein Stück aus ihrem Unterrock gerissen, um es als Polster unter das Eisen zu schieben, doch die Baumwolle war jetzt ganz hart von getrocknetem Blut und rieb an ihren Wunden, anstatt sie zu schützen. Ihr Magen schmerzte vor Hunger, ihr Rücken war so steif, dass sie bezweifelte, überhaupt laufen zu können, und sie zitterte vor Kälte.
Vier Tage später, als der Wagen schließlich Devonport erreichte, waren Marys Mitgefangene zu demoralisiert, um überhaupt auf den Anblick des Gefängnisschiffes zu reagieren, das draußen im Fluss vor Anker lag. Es hatte während der vergangenen zwei Tage ständig geregnet, und sie waren alle völlig durchnässt. Viele von ihnen hatten Fieber, und alle waren erschöpft, weil sie durch die Kälte in den Scheunen und Hütten, in denen man sie hatte übernachten lassen, kaum Schlaf hatten finden können.
Heute hatte sich niemand auf dem Wagen unterhalten. Man hörte nur Stöhnen, Niesen, Husten, Schniefen und das Rasseln der Ketten, während sie alle vergeblich versuchten, eine bequemere Position zu finden. Able war jetzt ernsthaft krank, er konnte nicht mehr aufrecht sitzen, und nach jedem schlimmen Hustenanfall spuckte er Blut.
»Das ist euer neues Zuhause, die Dunkirk«, meinte der Wachmann, der sich auf seinem Sitz umgedreht hatte und nun mit einem bösen Grinsen auf das alte Schiff im Fluss deutete. »Sie ist keine Schönheit, das steht fest, aber ihr seid ja auch nicht besonders schön.«
Mary hatte genauso gelitten wie ihre Mitgefangenen, doch ob es nun daran lag, dass sie die Jüngste und von Anfang an die Gesündeste gewesen war, oder daran, dass ihre Fluchtgedanken sie abgelenkt hatten – sie war jedenfalls die Einzige, die der Anblick des Schiffes wirklich mitnahm.
Mit seinen zu Stümpfen abgesägten Masten und von feinem Flussnebel umgeben, wirkte es wie ein altes Wrack, das auf einen guten Sturm wartete, um darin zerschmettert zu werden. Aber noch schlimmer als der Anblick des Schiffes war der faulige Gestank, der von dort zu ihnen herübergetragen wurde.
Mary zitterte bereits so schlimm, dass ihre Zähne klapperten, doch sie spürte, wie ihr ein noch kälterer Schauer über den Rücken rann, und ihr leerer Magen zog sich zusammen, als müsste sie sich übergeben. Das hier, das spürte sie, würde wirklich die Hölle sein, hundert Mal schlimmer als das Exeter Castle.
Sie hatte geglaubt, die Hölle bereits hinter sich gebracht zu haben, und war froh gewesen, als man sie in die frische Luft und den Sonnenschein hinausgeführt hatte. Aber schon bald hatte sie sich ins Castle zurückgewünscht. Spät in der vergangenen Nacht, als sie vor Kälte und Nässe fror, der Hunger sie plagte und ihr jeder Knochen im Leib schmerzte, hätte sie sogar einen Strick um den Hals akzeptiert, um das alles zu beenden. Und jetzt schien es, als warteten noch schrecklichere Qualen auf sie.
»Nützt nichts, so zu gucken«, spottete der Wachmann und lehnte sich in seinem Sitz zurück, um Mary mit seinem Stock einen Schlag zu versetzen. Er hatte bereits einige von ihnen geschlagen, wenn sie zu lange gebraucht hatten, um auf den Wagen oder von ihm herunterzukommen. »Das da draußen ist die Bestrafung für eure Sünden. Ihr verdient es.«
Ein paar Tage zuvor hätte Mary ihn noch verflucht, ihm ins Gesicht gespuckt oder sogar nach ihm geschlagen, aber ihr Kampfgeist war erloschen.
»Werden wir jetzt dort hinübergebracht?«, fragte sie stattdessen, denn ihr wacher Verstand riet ihr, dass sie sich besser gut mit ihm stellen sollte.
»Nein, dafür ist es zu spät«, antwortete er und berührte die Pferde mit der Peitsche, um ihnen zu bedeuten, wieder anzuziehen. »Ihr schlaft noch eine Nacht in einem alten Lagerhaus.«
Nicht nur die Gefangenen von den beiden Wagen aus Exeter übernachteten in dem ehemaligen Lagerhaus. Sie waren gerade erst hineingegangen und hatten sich auf den dreckigen Boden sinken lassen, als die Türen sich wieder öffneten und ein weiteres Dutzend Gefangener zu ihnen stieß.
Ihr Zustand war noch schlechter als der von Marys Begleitern, denn sie waren den weiten Weg von Bristol gekommen. Ihre Kleidung bestand nur noch aus Lumpen, sie schienen alle zu fiebern, und Mary sah Wundbrand auf einer tiefen Wunde am Bein eines Mannes. Der Gestank war unverkennbar.
Es gab einen schwachen Versuch, sich zu unterhalten; es wurden Fragen gestellt über Freunde, die im Exeter Castle oder Bridewell in Bristol einsaßen, aber eigentlich beschäftigte alle nur die Frage, wie lange sie wohl auf dem Gefängnisschiff bleiben mussten, bis man sie deportierte.
»Ich hab gehört, ein paar Leute sind aus Gravesend geflohen«, behauptete ein grimmig aussehender Mann aus Bristol. »Die Wachen haben das Feuer auf sie eröffnet und ein paar getötet, aber der Rest ist davongekommen. Seitdem bleiben alle in Ketten.«
Bessie, die neben Mary saß, begann zu weinen. »Die könnten uns genauso gut hängen«, schluchzte sie. »Ich ertrage nicht noch mehr.«
Derselbe Gedanke war auch Mary durch den Kopf geschossen, doch als sie Bessies völlige Niedergeschlagenheit sah, schob sie ihn hastig beiseite. »Wir schaffen das schon«, beharrte sie, legte den Arm um die Frau und zog sie dicht an sich. »Uns ist nur kalt, wir sind durchnässt und hungrig. Deshalb können wir nicht mehr klar denken. In ein oder zwei Tagen sieht das alles schon anders aus.«
»Du bist so mutig«, flüsterte Bessie. »Hast du denn gar keine Angst?«
»Nein«, erwiderte Mary ohne Zögern. »Jetzt, wo ich weiß, dass ich nicht gehängt werde, nicht mehr.«
Später in dieser Nacht, während Mary mit den anderen Frauen zusammenlag und verzweifelt versuchte, etwas Wärme an ihren Körpern zu finden, wurde ihr klar, dass sie wirklich keine Angst hatte. Sie war wütend darüber, dass Menschen andere Menschen so grausam behandelten, schämte sich für das Verbrechen, das sie hergebracht hatte, und sorgte sich darüber, was sie wohl als Nächstes erwartete. Aber sie hatte keine Angst. Wenn sie recht darüber nachdachte, hatte sie eigentlich noch nie vor irgendetwas Angst gehabt. Sie hatte sich mit sechs Jahren selbst das Schwimmen beigebracht, indem sie sich immer wieder ins Wasser hatte fallen lassen. Nachdem sie herausgefunden hatte, wie man den Kopf oben behielt, ängstigte sie das Meer nicht mehr. Oder sonst irgendetwas. Sie war diejenige gewesen, die immer Mutproben bestanden und die das Risiko gereizt hatte. Auch als sie damals herausgefunden hatte, wie Thomas seinen Lebensunterhalt verdiente, war sie nicht entsetzt gewesen – es war ihr nur wagemutig erschienen, wie ein großer Spaß.
Sie erinnerte sich daran, dass ihr Vater immer ihre Intelligenz gelobt hatte. Mary war stets klüger als Dolly und ihre gleichaltrigen Freunde gewesen. Sie besaß eine schnelle Auffassungsgabe, interessierte sich dafür, wie Dinge funktionierten, und beschaffte sich die nötigen Informationen. Sie konnte ihren Vater noch hören, wie er in der Nachbarschaft angab. »Fowey ist viel zu langweilig für meine Mary! Ich hab keinen Zweifel daran, dass sie eines Tages heimkommt, nachdem sie in der Fremde ein Vermögen gemacht hat.«
Würde er noch mit erhobenem Kopf durch das Dorf gehen können, wenn ihr registriertes Vergehen und ihre Strafe im Western Flyer bekannt gemacht wurden? Er selbst konnte nicht lesen, doch es gab genug Leute in Fowey, die es konnten und die ihm eine so schockierende Neuigkeit nur zu gerne überbringen würden.
Zu wissen, dass sie nur rund vierzig Meilen von zu Hause entfernt war, ließ Marys Heimweh fast unerträglich werden. Sie konnte ihre Mutter vor sich sehen, wie sie in ihrem Sessel vor dem Kamin saß und irgendetwas nähte. Mary ähnelte ihr äußerlich; sie besaß das gleiche volle, lockige Haar, das ihre Mutter sich dicht um ihren Kopf flocht, und die gleichen grauen Augen. Als Mary klein gewesen war, hatte ihre Mutter sich abends immer die Zöpfe aufgebunden und war mit den Fingern hindurchgefahren, bis ihr das Haar wie ein dunkler, schimmernder Fluss über die Schultern gefallen war. Das verwandelte sie von einer ganz normalen Frau in eine Schönheit, und Mary und Dolly fragten sie oft, warum sie ihr Haar nicht immer offen trug, damit die Leute es bewundern konnten.
»Eitelkeit ist eine Todsünde«, antwortete ihre Mutter dann, doch sie lächelte stets, als freute sie sich über ihr kleines Schönheitsgeheimnis, von dem nur ihre eigene Familie wusste. Ihre Gefühle behielt sie genauso für sich, und die Mädchen hatten schon früh gelernt, ihre Mutter nur anhand ihrer Handlungen einzuschätzen. Wenn sie wütend war, klapperte sie mit den Töpfen und schürte energisch das Feuer; wenn sie sich Sorgen machte, schwieg sie. Sie zeigte ihre Zuneigung nur, indem sie den Mädchen zart über die Wange strich oder kurz ihre Schulter drückte. Doch jetzt, da Mary wusste, dass sie ihre Mutter niemals wiedersehen würde, kamen ihr diese kleinen Gesten so wertvoll und wichtig vor.
Sie erinnerte sich daran, wie ihre Mum sie an jenem letzten Morgen in Fowey umarmt hatte. Sie hatte die Umarmung nicht wirklich erwidert, denn sie hatte so dringend fortgewollt. So würde ihre Mutter sich jetzt an sie erinnern: an eine Tochter, die sorglos kichernd ging … um niemals zurückzukehren.
2. Kapitel
Zum Glück hatte es aufgehört zu regnen, als man den Gefangenen am folgenden Morgen befahl, aus dem Lagerhaus zu kommen. Aber der Himmel war immer noch grau, und der scharfe Wind vom Fluss ließ sie auf der Suche nach Wärme näher aneinanderrücken.
Zum Frühstück hatte es nichts als Wasser und einen Laib altes Brot gegeben, und als Mary hinüber zu dem Gefängnisschiff Dunkirk blickte und erkannte, dass es tatsächlich so heruntergekommen war, wie es gestern in der Dämmerung gewirkt hatte, nahm sie an, dass die Verpflegung dort nicht besser sein würde.
Dennoch war sie etwas zuversichtlicher als am Tag zuvor. Trotz ihrer nassen Kleider hatte sie ziemlich gut geschlafen, und zumindest würden sie heute nicht weiterreisen müssen. Sie dachte, dass eine Flucht im Moment völlig außer Frage stand. Abgesehen von ihren Ketten, von denen sie jetzt bezweifelte, dass man sie ihnen abnehmen würde, waren am Kai viele aufmerksame Marinesoldaten postiert, die alle Musketen trugen.
Dutzende von Booten in allen Größen schwammen auf dem Wasser, brachten Passagiere über den Fluss oder transportierten Waren zu den größeren Schiffen, die im tieferen Wasser ankerten. Mary konnte das Gefängnisschiff heute nicht riechen, aber ob das daran lag, dass der Wind gedreht hatte, oder ob sie sich den Gestank am Vortag nur eingebildet hatte, vermochte sie nicht zu sagen. Es war gut, wieder salzige Luft einzuatmen, und wenn sie ihre Mitgefangenen und ihren Hunger ignorierte und sich nur auf den Anblick des Wassers, die Geräusche und die Gerüche konzentrierte, war es fast, als wäre sie wieder zurück in Fowey.
Gegen Mittag wartete Mary immer noch am Kai; nach wie vor war sie an die anderen Frauen gekettet. Bis jetzt waren mehrere kleine Gruppen von männlichen Gefangenen hinüber zur Dunkirk gerudert worden, und sie hatten sie über die Leiter an Deck klettern und dann aus ihrem Blickfeld verschwinden sehen. Aber das Interesse der Frauen an dieser Prozedur war längst geschwunden. Die meisten versuchten, ihr Aussehen zu verbessern, indem sie ihr Haar kämmten oder flochten oder sich um die Wunden an ihren Knöcheln kümmerten, und diejenigen von ihnen, die Sachen dabeihatten, suchten nach einem anderen Kleid oder einem Unterrock.
Mary besaß nichts außer einem Kamm, der ihr von einer Mitgefangenen in Exeter geschenkt worden war. Deshalb musste sie ihre Verschönerung darauf beschränken, so viele Läuse wie möglich aus ihrem Haar zu entfernen. Man hatte ihnen am Morgen keinen Eimer Wasser zur Verfügung gestellt, sodass sie sich nicht einmal Gesicht und Hände hatten waschen können. Dabei sehnte sie sich danach, ihre schmutzigen Kleider ausziehen und sich von Kopf bis Fuß zu waschen. Seit ihrer Verhaftung war das nicht mehr möglich gewesen, und sie hatte das Gefühl zu stinken.
Die anderen Frauen schienen sich nicht darum zu scheren, wie schmutzig sie waren, doch Mary hatte nach ihrem Weggang von zu Hause auch schnell feststellen müssen, dass die Reinlichkeit, die ihre Mutter sie gelehrt hatte, nicht sehr verbreitet war.
Als sie Bessie anvertraute, wie sie sich fühlte, betrachtete die andere Frau sie misstrauisch. »So schlimm können wir nicht aussehen«, meinte sie. »Die Soldaten da drüben schauen ständig zu uns rüber.«
Mary betrachtete die Gruppe von Männern verstohlen und stellte fest, dass man ihr besondere Beachtung schenkte. Sie fand, dass rote Jacken, eng sitzende weiße Hosen und glänzend polierte Stiefel jedem Mann, wie hässlich er auch war, einen unfairen Vorteil gegenüber Zivilisten verschafften. Aber sie war nicht so dumm zu glauben, dass die Soldaten sie ansahen, weil sie besonders attraktiv war.
Mary war mit Seeleuten aufgewachsen. Wenn sie von einem Schiff kamen, sahen sie sich als Erstes nach einer Frau um, das wusste Mary. Die meisten landeten bei Huren und infizierten sich dadurch ziemlich sicher mit Krankheiten.
Diese Marinesoldaten waren in einer etwas anderen Position als die Matrosen. Sie bewachten die Gefangenen, Männer und Frauen, hier und später auf dem Deportationsschiff. Ganz bestimmt wussten sie, wie wenig Landgang sie erhalten würden. Deshalb hofften sie, unter diesen zerlumpten, demoralisierten Frauen eine zu finden, die ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigte. Ein junges, gesundes Mädchen vom Land erschien ihnen in dieser Hinsicht wohl ideal. Doch Mary würde sich eher in Ketten von der Dunkirk werfen, bevor sie sich auf diese Weise benutzen ließ.