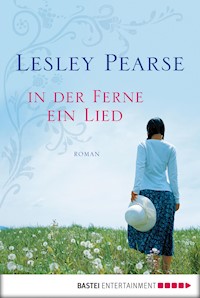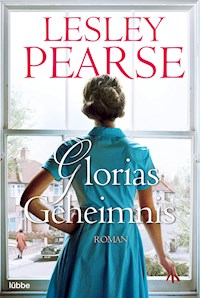9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, 1960: Die Zwillinge Maisy und Duncan wachsen in dem Herrenhaus "Nightingales" in der Nähe eines großen Waldgebietes auf. Dort lernt Duncan Grace Deville kennen, die wie eine Ausgestoßene auf einer Lichtung lebt. Eines Tages verschwindet er auf dem Weg von Grace zurück nach Hause spurlos. Jahre später hat die Polizei den Fall zu den Akten gelegt. Maisy aber kann den Verlust ihres Bruders nicht überwinden und macht sich zusammen mit Grace auf die Suche nach ihm. Denn Maisy weiß in ihrem Herzen, dass Duncan noch lebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26ÜBER DIESES BUCH
England, 1960: Die Zwillinge Maisy und Duncan wachsen in dem Herrenhaus »Nightingales« in der Nähe eines großen Waldgebietes auf. Dort lernt Duncan Grace Deville kennen, die wie eine Ausgestoßene auf einer Lichtung lebt. Eines Tages verschwindet er auf dem Weg von Grace zurück nach Hause spurlos. Jahre später hat die Polizei den Fall zu den Akten gelegt. Maisy aber kann den Verlust ihres Bruders nicht überwinden und macht sich zusammen mit Grace auf die Suche nach ihm. Denn Maisy weiß in ihrem Herzen, dass Duncan noch lebt.
ÜBER DIE AUTORIN
Lesley Pearse wurde in Rochester, Kent, geboren und lebt mit ihrer Familie in Bristol. Ihre Romane belegen in England regelmäßig die ersten Plätze der Bestsellerlisten. Neben dem Schreiben engagiert sie sich intensiv für die Bedürfnisse von Frauen und Kindern und ist Präsidentin für den Bereich Bath und West Wiltshire des Britischen Kinderschutzbundes.
LESLEY PEARSE
Jeden Tagein bisschenZuversicht
Roman
Aus dem Englischen vonLeonie von Reppert-Bismarck und Anja Kirchdörfer
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Lesley Pearse
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Woman in the Wood«
Originalverlag: Michael Joseph, an imprint ofPenguin Random House, UK
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
Unter Verwendung von Motivs von © Irene Lamprakou / Trevillion Images,© Simon Bratt / shutterstock und © dleeming69 / shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7262-5
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils netto ohne UST überall dasselbe.
Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt, gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
KAPITEL1
West London, 1960
Maisy wurde von einem durchdringenden Schrei geweckt. Erschrocken fuhr sie im Bett auf, saß lauschend da und horchte nach draußen. Von dort musste der Schrei gekommen sein. Doch beim zweiten Kreischen erkannte sie, dass das Geräusch aus dem Inneren ihres Hauses zu ihr drang. Es war ihre Mutter, die da so schrie.
Sie eilte zur Tür ihres Schlafzimmers, hinaus auf den Flur, hielt jedoch inne, als sie die Stimme ihres Vaters vom unteren Stockwerk heraufdringen hörte.
»Sei still, Lily. Sonst weckst du noch die Zwillinge und machst ihnen Angst. Es ist doch nur zu deinem Besten.«
Maisys Zwillingsbruder Duncan erschien im Türrahmen seines Schlafzimmers und trat zu ihr an die oberste Stufe. »Was ist da los?«, flüsterte er.
Maisy legte den Finger auf ihre Lippen und bedeutete ihm zu schweigen. Sie hielt ihn am Arm fest, um zu verhindern, dass er die Treppe hinunterrannte. Ihr Vater, Alastair Mitcham, war ein strenger Mann, der Einmischungen nur schwer tolerierte.
»Ich will da nicht hin! Ich will in meinem eigenen Haus gesund werden!«, heulte Lily Mitcham. »Schick mich nicht fort, Alastair!«
Das jämmerliche Flehen trieb Maisy und Duncan die Tränen in die Augen, aber sie waren gerade einmal fünfzehn Jahre alt, hatten Angst vor ihrem Vater und keine Ahnung, was sie tun sollten.
»Wie oft habe ich es schon mit ärztlicher Hilfe für dich versucht? Und jedes Mal passiert das Gleiche«, erwiderte Alastair, und die Kinder hörten Müdigkeit und Resignation in seiner Stimme und wechselten beunruhigte Blicke. »Dir geht’s danach kein bisschen besser. Im Gegenteil, jedes Jahr geht es dir ein wenig schlechter. Wann warst du zuletzt vor der Haustür? Ich glaube, das ist jetzt zwei Sommer her. Selbst hier unten bist du seit über einem Jahr nicht mehr gewesen.«
»Aber mein Rücken und meine Beine …«, protestierte sie.
Alastair schnitt ihr das Wort ab. »Weder dein Rücken noch deine Beine sind das Problem. Und das weißt du auch. Du kannst einen Reitunfall, der an die zwölf Jahre her ist, nicht mehr als Ausflucht benutzen. Ich habe es gründlich satt, Lily. Und die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, damit du dich endlich deinen wirklichen Problemen stellst, ist es, dich an diesen Ort zu schicken. Und jetzt beruhige dich, sonst hole ich die Krankenschwester, die draußen im Krankenwagen wartet, und bitte sie, dir irgendetwas zur Beruhigung zu spritzen.«
Maisy hatte genug gehört. Obwohl sie Angst vor ihrem Vater hatte und ihrem Bruder keine Probleme bereiten wollte, nahm sie ihn an der Hand und zog ihn zur Treppe. Duncan, von ihrem Mut angesteckt, ließ sich willig mitziehen.
»Warum schickst du Mutter fort?«, fragte Maisy, als sie die letzten Stufen der Treppe zum ersten Stock erreicht hatten.
Ihr Vater fuhr herum. Er war vollständig gekleidet, in Anzug und Krawatte, und hatte das leise Tappen ihrer nackten Sohlen offenbar nicht gehört.
»Das geht euch gar nichts an«, schnauzte er. »Und jetzt Abmarsch, zurück ins Bett, sofort.«
»Sie ist unsere Mutter. Und sie geht uns sehr wohl etwas an«, erwiderte Maisy. »Wohin schickst du sie? Und warum mitten in der Nacht? Damit die Nachbarn nichts mitbekommen? Oder hast du gehofft, wir würden nicht aufwachen, damit du so tun kannst, als sei sie bei einer Verwandten in den Ferien?«
Es war das erste Mal, dass Maisy ihrem Vater die Stirn bot. Obwohl er kein gewalttätiger Mann war, strahlte er so viel Strenge und Grimmigkeit aus, dass Duncan und sie ihm stets aufs Wort gehorchten. Jetzt raste ihr Herz, sie zitterte am ganzen Leib, und dennoch war sie entschlossen, sich für ihre Mutter einzusetzen.
»Lasst nicht zu, dass er mich ins Irrenhaus schickt«, wimmerte ihre Mutter. »Es ist grausam und hässlich. Ich will hierbleiben.«
Der Plan ihres Vaters schockierte Maisy. Aber als sie ihre Mutter so vor sich sah, begriff sie auch, warum ihr Vater eine derart drastische Maßnahme ergriff. Sie hatte das Gesicht ihrer Mutter schon lange nicht mehr deutlich gesehen, und so war ihr entgangen, wie schlecht es um sie stand. Ihre Augen quollen fast aus den Augenhöhlen, und sie war so abgemagert, dass sich die gelbliche Haut über ihren Wangen spannte und die Adern auf ihrer Stirn wie mit dicken Wachsmalstiften gezeichnet schienen. Ihr braunes Haar war strähnig und fettig, und ihr Nachthemd starrte vor Dreck. Dass sie Hilfe brauchte, war ganz offensichtlich.
Von klein auf hatten sich die Zwillinge daran gewöhnt, dass ihre Mutter die meiste Zeit im Bett verbrachte. Nie waren sie von ihr zur Schule gebracht worden, nie hatten sie mit ihr einen Ausflug ans Meer oder ein Picknick gemacht, und selbst ein Spielplatzbesuch war nie möglich gewesen. Die Zwillinge kannten nichts anderes und glaubten ihrer Mutter, wenn sie behauptete, ein Reitunfall sei daran schuld.
»Vater, tu’s nicht«, sagte Duncan.
Den Arm seiner Frau weiterhin fest im Griff, wandte sich Mr Mitcham an seine Kinder. »Ich muss es tun. Sie ist krank. Ich wollte nicht, dass ihr davon erfahrt, aber jetzt müsst ihr verstehen, dass sich ihr Zustand ständig verschlechtert und dass ich Angst um sie habe. Erst vor wenigen Tagen hat sie versucht, Gift zu trinken. Gott sei Dank hat Betty sie gesehen und es gerade noch verhindert. Sie hat ihr damit das Leben gerettet. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst passiert wäre.«
Ihre Mutter versuchte, sich dem Griff ihres Mannes zu entwinden, das Gesicht zur Maske eines wilden Tieres verzerrt, die Zähne gefletscht. Maisy wich instinktiv einen Schritt zurück, und Duncan nahm ihre Hand.
»Verstehe«, sagte er, den Blick verängstigt auf seine Mutter gerichtet. »Soll ich dann jetzt vielleicht die Krankenschwester von draußen zu Hilfe holen?«
»Ja, bitte, Duncan, das wird wohl das Beste sein. Und Maisy, läufst du bitte und holst den Bademantel und die Pantoffeln deiner Mutter? Sie hat sich vorhin so heftig gesträubt, dass ich nicht auch noch die Sachen halten konnte.«
Wenige Minuten später sahen die Zwillinge zu, wie eine stämmige Krankenschwester mittleren Alters, die draußen in dem privaten Krankenwagen gewartet hatte, ihrer Mutter ein Beruhigungsmittel spritzte.
Die Wirkung setzte fast sofort ein. Lily hörte auf, sich zu sträuben, entspannte sich und bekam einen leeren Gesichtsausdruck. Alastair half seiner Frau in den Morgenmantel und streifte ihr die Pantoffeln über die Füße. »So ist es besser«, sagte er und küsste sie auf die Wange, sehr zur Beruhigung der Zwillinge, die jetzt das Gefühl hatten, dass er tatsächlich ihr Wohlergehen im Sinn hatte. »Also, Kinder, dann seid so gut, verabschiedet euch von eurer Mutter, und geht dann wieder ins Bett. Und glaubt mir, ganz gleich, was sie sagt, man wird sich in dem Heim gut um sie kümmern, das versichere ich euch. Es ist eine Privatklinik, in der sie die bestmögliche Pflege erhält. Ich werde jetzt dem Krankenwagen in meinem Auto folgen, und es wird sicher einige Stunden dauern, bis ich zurück bin. Aber macht euch keine Sorgen, Betty wird wie immer zum Frühstück hier sein.«
Vom Wohnzimmerfenster aus schauten sie zu, wie die Schwester ihrer Mutter in den Krankenwagen half. Ihr Vater startete den Motor seines Autos und wartete, bis der Krankenwagen losfuhr.
Einen Moment schwiegen die Zwillinge und verharrten wie Statuen am Fenster des dunklen Zimmers.
Obwohl nie jemand offen über den Geisteszustand ihrer Mutter gesprochen hatte, war den Kindern in letzter Zeit immer öfter der Verdacht gekommen, dass ihre seltsame Krankheit einen anderen Grund haben musste als einen Reitunfall, der sich vor langer Zeit ereignet hatte. Alles in ihrem Zuhause lief anders als bei anderen Leuten. Ihre Eltern schliefen in getrennten Schlafzimmern, ihre Mutter nahm ihre Mahlzeiten in ihrem Zimmer ein, und manchmal hörten sie Geschrei und das Geräusch von brechendem Porzellan. Betty, die Hauswirtschafterin, behauptete dann immer, ihrer Mutter sei bestimmt etwas zu Boden gefallen, so wie sie auch die anderen Geräusche stets damit erklärte, dass ihre Mutter Schmerzen litt. Aber nun sahen die Zwillinge all diese Vorkommnisse in einem anderen Licht.
»Das war schrecklich«, sagte Duncan schließlich mit zitternder Stimme. »Nicht nur für Mutter, sondern auch für Vater. Aber so ist es sicher am besten. Wollen wir uns etwas Milch warm machen und dann zurück ins Bett gehen? Es ist erst halb drei.«
»Ich hatte keine Ahnung, dass es so schlimm ist«, sagte Maisy, während sie in die Küche hinuntergingen. »Ich meine, ich wusste zwar, dass sie immer schon kränklich und etwas seltsam war, aber ich wusste nicht, dass sie …« Sie verstummte.
»Verrückt ist?«, ergänzte Duncan. »Nein, ich auch nicht, aber wir kennen es ja auch nicht anders. Ich bin sicher, dass sie im Heim geheilt wird. Und dann wird alles gut.«
Maisy goss etwas Milch in einen Topf und entzündete die Flamme auf dem Gasherd. Ihr Bruder war schon immer der Optimistischere gewesen, dachte sie. Sie neigte eher zum Gegenteil.
Äußerlich sahen sich die Zwillinge ähnlich. Beide hatten tiefblaue Augen und dichtes blondes Haar. Aber Duncan war größer als sie, vielleicht einen Meter siebzig, während sie einen Meter sechzig maß. Er hatte ein kantiges Gesicht und ein energisches Kinn, während Maisy ein herzförmiges Gesicht hatte und ein Grübchen am Kinn. Im Sommer nahm ihre Haut sehr schnell einen goldbraunen Schimmer an, während er zu Sommersprossen neigte.
Ihr Haus lag im Londoner Stadtteil Holland Park. Es ging über drei Stockwerke und hatte sogar einen Keller. Die letzten Verschönerungsmaßnahmen stammten aus der Zeit Edward VII., und das einstmals wunderschöne Haus war im Laufe der Jahre ziemlich heruntergekommen und hatte vor allem unter den Nachkriegsjahren sehr gelitten, als Bau- und Innendekorationsmaterialien schwer zu bekommen gewesen waren. Wie Maisy von Betty wusste, wollte ihr Vater es verkaufen, da es zu groß und zu teuer im Unterhalt war. Betty meinte, am besten wäre es, wenn man das Haus, ähnlich wie bereits bei anderen großen Häusern der Umgebung geschehen, umbauen und in mehrere Wohnungen unterteilen würde. Die Hauswirtschafterin hatte zu allem eine Meinung. Auch im Hinblick auf ihre Mutter. Die hielt sie nämlich für eine Neurotikerin, die nur Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte.
Weil die Situation zu Hause so war, wie sie war, luden weder Duncan noch Maisy je Freunde zu sich ein. Ihnen war klar, dass es peinlich war, eine Mutter zu haben, die ständig im Bett lag, und einen Vater, der sich in sein Arbeitszimmer zurückzog, kaum dass er daheim war. Das hatte zur Folge, dass auch sie selten zu Schulfreunden nach Hause eingeladen wurden. So hatte ihre Welt sehr enge Grenzen. Sie umfasste ihre Privatschule auf der anderen Seite des Parks, Besuche in der Bücherei und als besonderes Ereignis den gelegentlichen Gang ins Kino. Glücklicherweise hatten sie einander, und da sie sich gut verstanden, schien ihnen das ausreichend zu sein.
Es gab noch eine andere nahe Verwandte: Violet Mitcham, ihre Großmutter väterlicherseits. Sie war Witwe, lebte in Burley in der Nähe des New Forest und war ebenso unterkühlt wie ihr einziger Sohn. Alle zwei Jahre kam sie nach London, um ihn und seine Familie zu besuchen. Betty hatte ihnen erzählt, dass Großmutter Mitcham ihre Mutter nie gemocht hatte, weil diese so schwächlich war.
Großmutter Goldney, Lilys Mutter, hatten die Zwillinge dagegen in guter Erinnerung. Lily hatte im Haus ihrer Mutter in Tenterden, Kent, während des Krieges immer wieder Zuflucht gefunden, und die Zwillinge waren dort im Januar 1945 geboren. Betty stammte aus demselben Ort, und als sie nach London zurückkehrten, kam Betty als Hauswirtschafterin mit ihnen. Jeden August verbrachten sie in Tenterden, bis Großmutter Goldie, wie die Kinder sie nannten, an einer Lungenentzündung starb. Da waren Duncan und Maisy acht Jahre alt gewesen.
Ihr Vater arbeitete seit jeher für das Außenministerium. Während des Krieges galt seine Arbeit als so wichtig, dass er nicht eingezogen wurde. Dennoch war er viel unterwegs, weshalb ihre Mutter Monate am Stück in Kent verbrachte und dort auch ihre Kinder zur Welt brachte. Ihr Vater sprach nie über seine Arbeit, deshalb malte Duncan sich gerne aus, sein Vater sei ein Spion. Doch Betty lachte ihn aus und behauptete, er arbeite in einem Büro.
»Was meinst du, was passiert jetzt?«, fragte Duncan und riss Maisy aus ihren Gedanken. »Meinst du, es geht jetzt einfach alles weiter wie gehabt?«
»Warum nicht? Was hat sich schon groß geändert?«, erwiderte Maisy. Natürlich wollte sie ihrer Mutter nicht unrecht tun, aber tatsächlich hatte Lily Mitcham sich äußerst selten um die Kinder gekümmert. »Wir haben sie seit Wochen nicht mehr gesprochen, weil sie immer schläft, wenn wir in ihr Zimmer kommen. Jetzt frage ich mich sogar, ob sie sich nicht oft einfach nur schlafend gestellt hat, weil sie nicht mit uns reden wollte.«
»Aber warum? Und wenn das stimmt, wie hat es so weit kommen können?«
»Ich glaube, ich würde mich auch zurückziehen, wenn ich mit einem Mann wie Vater verheiratet wäre«, sagte Maisy nur halb im Scherz. »Mal im Ernst: Mit ihm zusammen zu sein kann kein Spaß sein. Hast du ihn jemals lachen gehört? Hat er je eine Melodie gepfiffen, einen Witz erzählt oder getanzt?«
»Nein, da hast du recht. Aber lass uns jetzt zurück ins Bett gehen. Wir haben morgen Schule.«
»Warum schwänzen wir nicht einfach mal?«, schlug Maisy vor. »Wir könnten ins West End spazieren, einen Schaufensterbummel machen, nachmittags ins Kino gehen und uns etwas anschauen, was Vater missfallen würde.«
»Er hat gesagt, dass er zurückkommt, wenn er Mutter in diese Klinik gebracht hat. Vielleicht geht er danach gar nicht wieder zur Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir schwänzen sollten.«
Maisy verzog das Gesicht. »Du bist immer so schrecklich vernünftig und gehorsam. Pass auf, dass du nicht so wirst wie er.«
»Also hat er sie wirklich in diese Klinik eingeliefert?«, fragte Betty später, als sie am Frühstückstisch saßen. Ihre Information hatte sie nicht von den Zwillingen, sondern von deren Vater, der ihr einen Zettel hinterlassen hatte. »Ich sage schon seit Monaten, dass sie anständige Hilfe braucht, aber das hat er ja ignoriert, bis zu der Geschichte mit dem Gift.«
Die Zwillinge hatten Betty gegenüber gemischte Gefühle. Sie war eine attraktive Frau Anfang vierzig, mit glänzendem braunem Haar und einer üppigen Figur. Sie hatte reine Haut und nicht einmal um die Augen eine Spur von Falten. Da sie im Leben der Zwillinge eine wichtige Rolle spielte, solange sie denken konnten, war Betty für sie eher eine Tante denn eine Haushaltshilfe. Doch in den letzten zwei Jahren schien es ihnen so, als fühlte sich Betty zunehmend als Herrin des Hauses. Sie nahm sich Freiheiten heraus. Sie trug die Kleidung ihrer Mutter. Sie kommandierte Maisy und Duncan herum, als seien die beiden ihre Kinder, und sie ging ganz entschieden zu vertraut mit ihrem Vater um. Jetzt fragte Maisy sich, ob Betty es nicht vielleicht auf ihn abgesehen hatte und sie aus diesem Grund so zufrieden schien, dass er seine Frau endlich in eine Klinik eingewiesen hatte. Diesen Gedanken behielt sie jedoch lieber für sich. Es würde Duncan nur unnötig aufregen.
Aber eine kleine heimtückische Spitze in Richtung Betty wollte sie sich nicht verkneifen. »Du wirst ja jetzt viel weniger zu tun haben, nicht wahr? Obwohl du, wenn ich daran denke, wie meine Mutter heute ausgesehen hat, vielleicht schon seit einiger Zeit weniger Mühe in ihre Pflege gesteckt hast.«
»Du unverschämte kleine Göre«, erwiderte Betty. »Ich habe dieses schrecklich große Haus zu versorgen. Schon allein das Kochen, Abwaschen und Bügeln für euch und euren Vater nimmt meine gesamte Zeit in Anspruch. Ich kann eure Mutter nicht dazu zwingen, sich zu waschen, saubere Sachen anzuziehen oder zu essen. Du hast keine Ahnung, wie schwierig sie sein kann.«
»Dann ist es ja umso besser, dass sie irgendwohin kommt, wo das Personal mit solchen Problemen umzugehen weiß«, sagte Maisy etwas hochnäsig. »Übrigens, ist das nicht Mutters Strickjacke, die du da trägst?«
Ohne Bettys Antwort abzuwarten, marschierte sie aus der Küche. Sie würde am Abend mit ihrem Vater reden. Offensichtlich war er direkt ins Büro gefahren, denn er war nicht nach Hause zurückgekehrt. Maisy hatte also Zeit, und die beschloss sie zu nutzen, indem sie versuchte, Duncan doch noch zum Schulschwänzen zu überreden.
Die folgenden Tage schienen den Zwillingen reichlich verquer. Im Haus herrschte ungewohnte Ruhe, und ihr Vater widmete ihnen mehr Aufmerksamkeit als sonst. Das hieß, dass er sie täglich über ihre Arbeit in der Schule ausfragte. Betty war fröhlicher, kochte ihre Lieblingsessen und hatte zur Abwechslung das Nörgeln eingestellt. Aber diese Ruhe war auch beunruhigend, weil sie der Auftakt zu etwas Schrecklichem zu sein schien.
Als die Zwillinge zwei Wochen später am Freitag aus der Schule kamen, sahen sie, dass ihr Vater bereits zu Hause war. Er telefonierte gerade in seinem Arbeitszimmer, und im Flur standen zwei gepackte Koffer.
»Ja, die sind gerade zur Tür hereingekommen. Wir fahren los, sowie die beiden sich umgezogen und etwas gegessen haben. Wir müssten gegen acht Uhr da sein«, hörten sie ihn sagen.
Er legte auf und trat in den Flur. »Vermutlich habt ihr gehört, was ich gerade am Telefon gesagt habe. Ich bringe euch heute nach Nightingales, und deshalb müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Also: Auf geht’s, und zwar ein bisschen dalli.«
Die Zwillinge hatten keine Eile. Sie waren nicht erpicht darauf, nach Nightingales zu ihrer Großmutter Mitcham zu fahren. Maisy und Duncan waren seit neun oder zehn Jahren nicht mehr dort gewesen, und die einzige Erinnerung, die sie von der Zeit hatten, war die an eine übellaunige alte Dame, die kein sonderliches Interesse an ihnen zeigte.
»Kann ja sein, dass sie jetzt netter ist, wo wir älter sind«, sagte Duncan, der ewige Optimist.
»Ja, klar, und meine Mutter ist Millionärin«, erwiderte Maisy. »Aber warum nehmen wir für einen kurzen Besuch zwei Koffer mit?«
»Weil’s für immer ist«, sagte Duncan und grinste böse.
Erst als sie hinten im Auto saßen und London hinter sich gelassen hatten, sprach ihr Vater wieder mit ihnen.
»Ich habe beschlossen, dass ihr sozusagen dauerhaft bei eurer Großmutter leben sollt. Eure Schule in Holland Park überzeugt mich nicht, weshalb ich etwas Besseres in der Nähe eurer Großmutter finden werde. Das wird eine Weile dauern, also habt ihr jetzt eben ein bisschen Ferien. Aber nicht nur eure Erziehung ist der Grund für die Veränderung. Ich möchte auch das Haus verkaufen und etwas Kleineres kaufen. Wenn ich eine richtige Schule mit guten Lehrern finde, könnt ihr beide zur Universität gehen.«
Die Zwillinge tauschten entsetzte Blicke aus. Ihnen schien es, als würden sie abgeschoben, genau wie ihre Mutter.
»Ich weiß, dass meine Mutter an Kinder nicht gewöhnt ist, und womöglich denkt ihr, dass es schrecklich für euch sein wird«, fügte er mit sanfterer Stimme hinzu, als hätte er ihr Entsetzen bemerkt. »Aber dem ist nicht so. Ihr werdet von Janice, der Haushälterin, betreut. Und sie ist eine wunderbare, liebevolle Frau, das kann ich euch versichern. Nightingales ist außerdem wunderschön, ihr könnt den New Forest erkunden und andere junge Leute kennenlernen. Ich denke, dass ihr dort viel glücklicher sein werdet als in London.«
Als die Zwillinge schwiegen, fuhr er fort: »Ich weiß, dass die Sache mit eurer Mutter eine böse Überraschung war, auf die jetzt die zweite folgt. Aber ich versuche wirklich, das Beste für euch zu tun. Also, gebt dem Ganzen bitte eine Chance.«
»Ja, Vater«, erwiderten die Zwillinge einstimmig, doch eher pflichtschuldig als mit Überzeugung.
Kurz danach begann es zu regnen, und der Himmel verdüsterte sich. Die Zwillinge dösten ein und wachten erst wieder auf, als das Auto über einen unebenen Weg holperte. Es war zu dunkel, um draußen etwas erkennen zu können.
»Sind wir da?«, fragte Duncan.
»Ja, das ist der Weg zum Haus eurer Großmutter. Höchste Zeit, dass der mal asphaltiert wird. Und Straßenlaternen gibt es hier auch nicht.«
Im Scheinwerferlicht sahen sie das Wort »Nightingales« auf dem Gatter eines Lattenzauns aufblitzen. Das Haus befand sich keine dreißig Meter hinter dem Gatter, doch in der Dunkelheit konnten sie nur den erleuchteten Eingangsbereich und die beiden flankierenden Fenster erkennen.
»So, da wären wir«, sagte Vater. »Sollte eure Großmutter etwas kurz angebunden sein, macht euch nichts daraus. Und bitte benehmt euch, und tut, was man euch sagt.«
Als Maisy mit ihrem Vater das große, gemütliche Wohnzimmer ihrer Großmutter betrat, war ihr erster Eindruck von der alten Dame der grober Unhöflichkeit. Weder machte die Großmutter Anstalten, sich aus ihrem Stuhl zu erheben, um Duncan und sie zu begrüßen, noch lächelte sie oder winkte sie näher, um sie besser sehen zu können. Von Betty wusste Maisy, dass ihre Großmutter erst siebzig Jahre alt war, also keineswegs so alt, dass sie eine Entschuldigung gehabt hätte. Sie war adrett gekleidet in einem altrosafarbenen Twinset und trug eine Perlenkette.
»Schau, Mutter, wie sehr sie gewachsen sind, seitdem du sie das letzte Mal gesehen hast«, sagte ihr Vater.
Maisy schaute ihn überrascht an, als sie den schmeichlerischen Ton in seiner Stimme hörte.
»Also, Alastair, Kinder wachsen nun mal. Das ist doch nichts Neues«, erwiderte sie. »Ich hoffe, du hast sie gewarnt, dass ich keinerlei Unverschämtheiten, Unsinn oder Lärm dulde. Sie werden ihre Mahlzeiten mit Janice in der Küche einnehmen und meine Räumlichkeiten nur betreten, wenn ich sie rufen lasse.«
Maisys Herz wurde schwer. Sie warf Duncan einen Blick zu und sah, dass er ähnlich bestürzt wirkte, wie sie sich fühlte.
Die alte Dame nahm eine kleine Glocke und läutete sie. Innerhalb von Sekunden trat eine ungefähr vierzigjährige, braunhaarige Frau mit einem freundlichen, offenen Gesicht ein und strahlte die Kinder an.
»Janice, bringen Sie mir und meinem Sohn Tee«, sagte Großmutter. »Und nehmen Sie die Kinder mit in die Küche, geben Sie ihnen etwas zu essen, und zeigen Sie ihnen ihre Zimmer.«
Janice schaute Maisys Vater fragend an: »Hätten Sie gerne ein belegtes Brot, eine Suppe oder eine Aufschnittplatte, Mr Mitcham? Sie haben eine weite Fahrt hinter sich, und es heißt, dass Sie noch heute zurückfahren.«
»Ja, das werde ich, Janice. Ein Brot wäre wunderbar. Und vielleicht auch noch ein Stück Ihres denkwürdigen Früchtebrots, wenn Sie welches haben.«
»Ich habe erst gestern eines gemacht«, lächelte sie. »Möchten Sie ein Schinkenbrot?«
Er nickte und wandte sich dann an die Kinder, die er unbeholfen an der Schulter tätschelte. »Ich verabschiede mich jetzt. Seid brav und hört auf eure Großmutter und schreibt mir einmal die Woche.«
Janice führte die Zwillinge durch einen breiten Eingangsbereich mit Steinboden, vorbei an einer riesigen antiken Holztruhe und einer imposanten Standuhr, die laut tickte.
»Und das ist noch gar nichts gegen ihr Stundengeläut«, sagte Janice mit einem kleinen Glucksen. »Da bleibt einem fast das Herz stehen.«
»Erinnert ihr euch an das Haus?«, fragte sie, als sie schließlich die Küche betraten, die am anderen Ende des Gebäudes lag. »Ich weiß, dass ihr bei eurem letzten Besuch erst ungefähr sechs Jahre alt wart, aber Kinder haben ja ein ziemlich gutes Gedächtnis.«
»Ich meine, mich an einen Teich mit Goldfischen zu erinnern«, sagte Duncan.
Janice lächelte. »Das stimmt. Ich bin sicher, der Garten wird euch vertraut sein, wenn ihr ihn seht. Bei eurem letzten Besuch habt ihr die meiste Zeit dort verbracht.«
Der blankgeschrubbte Holztisch in der Mitte der Küche war bereits für das Abendessen gedeckt, das Früchtebrot und ein mit Himbeermarmelade gefüllter Biskuitkuchen standen bereit. »Ich habe schnell noch einen Kuchen gemacht, als ich hörte, dass ihr kommt. Nicht alle Kinder mögen Früchtebrot.«
»Wir essen alles«, sagte Duncan. »Betty, unsere Haushälterin, sagt, wir sind wahre Müllschlucker.«
Janice lachte und tätschelte ihm voller Zuneigung die Wange. »Ich mag euch beide jetzt schon. Gut, dann nehmt Platz. Ich habe mir gedacht, ihr fangt mit einer Gemüsesuppe an, während ich den Tee und das Essen für Mrs Mitcham und euren Vater mache.«
Etwa eine Stunde später hörten Maisy und Duncan den Wagen ihres Vaters davonfahren. Er war nicht mehr in die Küche gekommen, um sich zu verabschieden. Kurze Zeit später hörten sie, wie ihre Großmutter die Treppe hinauf zu ihrem Zimmer ging.
Dass man sie ignorierte, wurde jedoch durch Janice’ Warmherzigkeit und Fröhlichkeit mehr als wettgemacht. Nach einer köstlichen Suppe, Schinkenbroten und Kuchen brachte Janice die beiden über die Hintertreppe direkt von der Küche zu ihren Zimmern.
Beide Räume wirkten etwas vernachlässigt. Janice erzählte, dass während des Krieges verschiedene Offiziere darin gewohnt hatten, aber das störte die Zwillinge nicht. Viel wichtiger war ihnen, dass sie weit entfernt von den Räumen ihrer Großmutter untergebracht waren, eine eigene Treppe hatten und der alten Dame somit nie zu nahe kommen mussten.
Janice behauptete zwar, sie sei gar nicht so streng und kalt, wie sie wirke, und sie habe ihr sogar gesagt, sie vermute, es könne ganz schön sein, mal wieder Kinder im Haus zu haben, die ein wenig Leben mit sich brächten. Doch Maisy vermutete, dass Janice zumindest Letzteres aus Nettigkeit frei erfunden hatte. Duncan und sie mochten Janice jedenfalls sofort. Sie wirkte herzlich und mütterlich, lachte gern und schien sich ehrlich zu freuen, die Kinder im Haus zu haben und sich um sie kümmern zu dürfen.
»Ich liebe es, zu kochen, aber mit nur einer älteren Dame im Haus, die noch dazu wie ein Spatz isst, macht es einfach keinen Spaß«, sagte sie. »Als der arme Mr Mitcham noch lebte, brauchte er sehr viel Hilfe, krank, wie er war. Manchmal hatte ich kaum eine Minute für mich. Aber seit seinem Tod habe ich fast zu viel Zeit, und manchmal wird es etwas langweilig.«
Sie erzählte ihnen, im Schuppen stünden zwei Fahrräder, und sie würde Mr Pike, den Gärtner, bitten, sie für sie herzurichten. Es gebe außerdem einen Bus nach Lyndhurst, aber auch an entferntere Orte wie Southampton oder Bournemouth, wenn sie dorthin wollten. Und bestimmt würden sie unter den jungen Leuten des Ortes bald Freunde finden.
»Wir haben sogar eine echte Hexe hier im Dorf«, sagte sie. »Sie heißt Sybil Leek. Sie ist tatsächlich berühmt, weil sie Bücher über Zauberkunst schreibt, und im Radio ist sie auch zu hören. Wenn ihr nach Burley geht, könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Sie läuft in einem langen schwarzen Mantel herum und hat eine Dohle namens Hotfoot Jackson auf ihrer Schulter sitzen.«
Die Zwillinge starrten sie mit offenem Mund an. Janice lachte. »Wirklich wahr. Das ist nicht erfunden, Ehrenwort. Ich glaube, der New Forest zieht seltsame Menschen geradezu magisch an. Hier lebt noch eine andere Frau, über die es Dutzende von Geschichten gibt, die noch viel faszinierender sind als die über Sybil. Die Frau heißt Grace Deville, und sie lebt ganz abgelegen im Wald in einer kleinen Hütte. Die Leute nennen sie »die Frau im Wald«. Sie trägt nur Männerhosen und mag keinen Besuch. Wer sich versehentlich zu ihrer Hütte verirrt, wird mit der Schrotflinte verjagt. Die wildesten Geschichten kursieren über sie! Ihr wird alles Mögliche nachgesagt: von Irrsinn über Kindstötung bis hin zu Giftmorden. Wahrscheinlich sind das alles nur Gerüchte. Aber Sybil mögen die Leute auch deswegen nicht, weil ihretwegen seltsame Menschen nach Burley kommen, die schwarze Magie gut finden.«
»Oh mein Gott«, keuchte Maisy. »Und wir dachten, Drama gäbe es nur in London.«
»Morgen könnt ihr euch alles selbst anschauen«, sagte Janice. »Jetzt ist Schlafenszeit. Ich habe Wärmflaschen in eure Betten gelegt.« Sie gab beiden einen Kuss auf die Wange. »Schlaft gut.«
KAPITEL2
Duncan bremste so scharf, dass sein Fahrrad auf dem staubigen Waldpfad ins Schlingern geriet. »Ich glaube, das könnte es sein«, rief er Maisy über die Schulter zu und zeigte auf eine Rauchsäule, die über den Bäumen aufstieg. »Janice hat gesagt, sie hat immer ein Feuer brennen.«
Sie waren jetzt seit über einer Woche in Nightingales, und trotz des offensichtlichen Desinteresses ihrer Großmutter stellten die Zwillinge überrascht fest, dass sie dort ziemlich glücklich waren. Sie hatten bereits der Hexe Sybil Leek hinterherspioniert, sie beim Spaziergang mit ihrer zahmen Dohle gesehen, durch ihre Fenster gespäht, um herauszufinden, ob sie einen Hexenkessel und Hexenbücher hatte. Jetzt wollten sie Grace Deville, die Frau im Wald, auskundschaften. Heute war ihre erste Gelegenheit dazu, da Mr Pike, der Gärtner in Nightingales, erst an diesem Morgen ihre Fahrräder fertig repariert hatte und sie ohne Räder nicht so weit in den Wald vordringen konnten.
Maisy bremste und sprang vom Rad. »Es könnte auch das Lagerfeuer eines Holzfällers sein«, sagte sie, den Blick nachdenklich auf die Rauchsäule gerichtet. »Aber lass uns hinfahren und nachschauen.«
Zögernd sahen sie sich um. Der Weg in Richtung Feuer war wenig mehr als eine Schneise, von Tieren ausgetreten und so überwuchert, dass sie ihn mit den Fahrrädern nicht würden entlangfahren können. Selbst wenn sie die Räder schoben, war es unwahrscheinlich, dass sie durchkommen würden. Andererseits zögerten sie, ihre Räder auf dem Hauptpfad zurückzulassen, da sie von ihrer Zeit in London her wussten, dass Sachen, die man einfach irgendwo stehen ließ, in der Regel verschwanden.
»Ich glaube, es ist okay, sie hierzulassen«, sagte Duncan. »Seit wir aus Burley raus sind, haben wir keinen Menschen mehr gesehen. Und wer geht schon in einen Wald, um etwas zu stehlen?«
Maisy lehnte ihr Fahrrad gegen einen Baum und warf ihre Zöpfe zurück. Sie fühlte sich gerade besonders gut. An dem Morgen hatte Janice ihr beim Frühstück gesagt, wie hübsch sie sei. Da sie noch nie so ein Kompliment erhalten hatte, war Maisy zwar etwas skeptisch, freute sich jedoch sehr darüber.
»Was ist, wenn diese Frau wirklich total verrückt ist?«, fragte sie ihren Bruder. »Vergiss nicht, was Janice erzählt hat: Vielleicht geht sie mit ihrer Schrotflinte auf uns los. Sie muss auch ziemlich robust sein, wenn sie seit Jahren hier alleine lebt.«
Duncan beugte sich vor, um sein aufgeschürftes Knie zu begutachten. Am Vortag hatte er es aufgeschlagen, und seitdem beschwerte er sich unentwegt und bitterlich darüber, dass man ihm immer noch zumutete, wie ein kleiner Junge kurze Flanellhosen zu tragen, und dass ihm lange Hosen nur zum Kirchgang und zu formellen Anlässen gestattet wurden.
»Wenn sie Hosen trägt, kann sie nicht verrückt sein und auch keine Hexe«, sagte er leicht irritiert. »Hier Hosen zu tragen ist außerordentlich vernünftig. Außerdem: Warum sollte sie uns angreifen, wenn wir sie in keiner Weise bedrohen?«
»Na ja, wenn selbst unsere eigenen Eltern uns nicht sonderlich mögen«, sagte Maisy, »dann haben wir vielleicht irgendetwas Abstoßendes an uns.«
»Du spinnst doch.« Duncan schnaubte verächtlich. »Wir sind doch nicht hierhergeschickt worden, weil sie uns nicht mögen. Es war doch nur, weil Vater …« Er hielt inne, unsicher, wie er fortfahren sollte.
»Weil Vater das Haus verkaufen und eine Affäre mit Betty haben will und uns dabei nicht gebrauchen kann. Meinst du das?«, fragte Maisy.
»Nein, das meinte ich keineswegs. Warum musst du immer so dramatisch sein? Ich bin froh, hier zu sein. Mir gefällt es hier.«
»Mir gefällt’s hier auch, aber ich wünschte trotzdem, Vater und Großmutter würden richtig mit uns reden und uns erklären, was passiert ist und warum. Wir sind schließlich keine Babys mehr. Als ich versucht habe, Großmutter das zu erklären, meinte sie: ›Kinder soll man sehen und nicht hören, wobei ich es vorziehe, sie auch nicht zu sehen.‹ Dann sagte sie, Vater habe entschieden, dass dies der richtige Ort für uns und die Klinik der richtige Ort für Mutter sei, und dass sie daher keine weiteren Fragen zu dem Thema wünsche.«
Duncan schien leicht akzeptieren zu können, wenn ihm jemand ohne große Erklärung sagte, wo es langging, aber Maisy war anders. Sie wollte wissen, warum ihr Vater keine Zeit mit seinen Kindern verbringen wollte und warum ein Gespräch mit ihm immer darauf hinauslief, dass sie ihm Rede und Antwort standen zu Fragen wie: Welchen Rang hatten sie in ihrer Klasse? Welchen englischen Klassiker lasen sie zurzeit? Konnten sie ihm die Hauptstadt von Brasilien, Albanien, Venezuela oder sonst eines obskuren Landes nennen?
Sie fragte sich, ob er bei der Arbeit Freunde hatte, jemanden, mit dem er normal sprechen konnte oder mit dem er zu Mittag aß oder nach Feierabend etwas trinken ging. Aber wenn es eine solche Person gab, so wurde sie nie erwähnt. Solange Maisy denken konnte, hatte ihr Vater sich jeden Tag, wenn er nicht auf Dienstreise war, morgens um Punkt acht Uhr dreißig auf den Weg zu seinem Büro in Whitehall gemacht. Er verließ das Haus, ging zur U-Bahn-Station Notting Hill Gate und fuhr mit der Tube nach Westminster. Er trug stets einen marineblauen Nadelstreifenanzug, einen Hut auf dem Kopf und einen zusammengerollten Regenschirm unter dem Arm, genau wie abertausend andere Büroangestellte. Nie verabschiedete er sich von ihnen, wenn er auf Dienstreise ging; nie erzählte er ihnen, wo er gewesen war, wenn er zurückkehrte. Nur die Tatsache, dass ihr Vater morgens einen kleinen Koffer mitnahm, zeigte den Zwillingen, dass er auf Dienstreise ging und fortbleiben würde.
An ihre Mutter konnten sich die Zwillinge mit ihren Fragen auch nicht wenden, denn dafür war sie immer zu krank. Sie lag auf ihren Kissen mit jenem leeren Blick, den die Kinder nur zu gut kannten. Bis vor Kurzem hatten Maisy und Duncan gedacht, ihre Krankheit sei auf jenen lang zurückliegenden Reitunfall zurückzuführen, obwohl sie durchaus überlegt hatten, ob ihre Mutter nicht auch an einer anderen Krankheit litt. Sie wunderten sich, warum Betty und ihr Vater ihre Mutter nur so selten von einem Arzt untersuchen ließen. Maisy, die ihren Vater einmal darauf angesprochen hatte, hatte lediglich zu hören bekommen, es sei nicht die Aufgabe von Kindern, die Entscheidungen von Erwachsenen zu hinterfragen.
Wenigstens wusste sie jetzt, was ihrer Mutter fehlte. Und obwohl das schlimm für sie war, konnten sie und Duncan damit umgehen. Schließlich hatten sie einander, und sie hatten Janice. Das Interesse und die liebevolle Art der Haushälterin machten das frostige, distanzierte Verhalten ihrer Großmutter mehr als wett.
»Früher, als wir noch jung waren, habe ich immer Brettspiele mit eurem Vater gespielt«, erzählte Janice ihnen eines Abends. »Als Mrs Mitcham mir sagte, ihr würdet zu uns ziehen, habe ich mich gefreut, dass ich euch wiedersehe. Und ich habe mir gedacht, dass ihr bestimmt Geschichten über euren Vater hören wollt.«
Ihren bisher schönsten Moment seit ihrer Ankunft in Nightingales erlebten die Kinder jedoch, als sie am ersten Morgen in den Garten gingen und das Haus in seiner ganzen Pracht erblickten. Es war aus warmen roten Backsteinen erbaut und hatte an beiden Längsseiten einen spitzen Dachüberhang. Alle Fenster im Obergeschoss waren in das Dach eingelassen. Vom Backstein war allerdings nicht viel zu sehen, da die Fassade fast vollständig von Rosenranken, einer blauen Glyzinie und Geißblatt verdeckt wurde. Janice hatte ihnen erzählt, dass das Haus in der Blütezeit spektakulär aussah und sich Blütenduft durch das ganze Haus zog.
Gemessen an Londoner Verhältnissen war der Garten riesig. Er schien überwiegend aus gepflegtem Rasen und Bäumen zu bestehen. Doch Janice hatte ihnen erklärt, dass sich die Beete nach dem Verblühen der Tulpen und Osterglocken bis in den Herbst hinein in ein einziges Farbenmeer verwandelten.
Nightingales war über zweihundert Jahre alt und befand sich seit über einhundert Jahren im Besitz von Großmutters Familie.
Ihre Großmutter hatten sie seit ihrer Ankunft kaum gesehen. Sie konnten sie fast täglich Klavier spielen hören und sahen sie gelegentlich, wenn die Sonne schien, im Garten herumhumpeln, aber bisher hatte sie noch nicht nach ihnen geschickt.
Zu ihrer Freude nahmen sie die Mahlzeiten mit Janice in der Küche ein, abends spielten sie Karten mit ihr, lasen oder hörten Radio. Gelegentlich überlegten sie, wann sie wohl wieder zur Schule geschickt würden, aber sie fragten Janice nicht, weil sie Angst hatten, ihre Frage könnte an Großmutter weitergeleitet werden, die dies vielleicht als Wunsch der Kinder deuten würde, nach London zurückzukehren. Und das wollten sie keineswegs.
Es fiel ihnen schwer, dies zuzugeben, selbst voreinander. Aber in ihrem Haus in Holland Park hatte immer eine angespannte Atmosphäre geherrscht, als könnte jeden Moment etwas Furchtbares passieren. Dieser Atmosphäre hatten sie nicht entrinnen können, da sie nach der Schule nirgends hindurften und selbst am Wochenende allerhöchstens eine Stunde Ausgang bekamen.
Betty war oft übellaunig, und Rose, das Dienstmädchen, sowie Mrs Gait, die Waschfrau, kamen zwar beide täglich von außerhalb zum Putzen und Waschen zu ihnen, wollten es sich jedoch mit Betty nicht verscherzen und waren deshalb zu nervös, um mit den Kindern zu plaudern. So fühlte sich die Freiheit, die sie in Nightingales genossen, paradiesisch an.
»Wie sprechen wir Grace Deville an, wenn sie zu Hause ist?«, fragte Maisy. »Sollen wir sie fragen, warum sie hier draußen alleine lebt?«
»Sei nicht albern. So etwas beantwortet sie doch nicht«, lachte Duncan sie aus. »Ich weiß, Janice hat erzählt, dass manche Leute glauben, sie sei eine Hexe, aber selbst wenn, dann ist sie sicher nicht so eine wie in Hänsel und Gretel. Sie wird uns weder in einen Käfig sperren noch uns mästen, damit sie uns fressen kann.«
»Ja, aber was ist, wenn sie ihr Baby wirklich umgebracht hat?«
Sie hatten Janice mit Fragen über diese Frau förmlich gelöchert, waren aber von ihren Antworten enttäuscht worden. Entweder wusste Janice tatsächlich nur sehr wenig, oder sie hielt es für falsch, den Kindern davon zu erzählen.
»Janice meint, dass es keinerlei Beweise für so etwas gibt und dass es ihrer Meinung nach nur ein gehässiges Gerücht ist, das von missgünstigen und niederträchtigen Menschen verbreitet wird, die nichts Besseres zu tun haben, als sich Hässlichkeiten auszudenken«, meinte Duncan etwas salbungsvoll. »Aber komm, lass uns jetzt losgehen, uns an sie heranschleichen und sie ausspionieren.«
Es war weiter, als sie gedacht hatten, mehr als einen Kilometer ab der Stelle, an der sie ihre Fahrräder zurückgelassen hatten. Sie gingen schweigend, Duncan vor Maisy, aber beide waren müde, und Maisy wollte gerade vorschlagen, die Sache abzublasen und umzukehren, als der schmale Pfad plötzlich in eine Lichtung mündete.
Vor ihnen auf der Lichtung stand eine Hütte. Bestimmt gehörte sie Grace Deville.
»Oha«, sagte Duncan und streckte einen Arm nach hinten aus, damit seine Schwester nicht an ihm vorbei auf die Lichtung stolperte. »Wir sollten uns verstecken und uns die Sache erst mal von Weitem anschauen.«
Maisy war sofort einverstanden. Sie war sowieso nicht erpicht darauf, sich einer Frau aufzudrängen, die allen Berichten zufolge Menschen nicht mochte.
Sie krochen unter einen üppigen Busch, robbten bäuchlings bis an seinen Rand vor und teilten das dichte Blätterwerk, um hindurchspähen zu können.
Die Holzhütte war hübscher, als Maisy erwartet hatte. Mit der Veranda, zu der ein paar Stufen hinaufführten, erinnerte sie Maisy an das Spielhäuschen ihrer alten Schule. Zwar war die Hütte etwas heruntergekommen – das Dach senkte sich ein wenig in der Mitte, und am Verandageländer fehlten mehrere Pfosten –, aber auf der Veranda stand ein großer Rattansessel mit roten Kissen, davor ein Tischchen mit einigen Büchern, und Maisy fand es so anheimelnd, dass sie selbst gerne dort gelebt hätte.
Strom gab es offensichtlich nicht, aber die Kinder sahen einige Regentonnen, in denen Regenwasser aufgefangen wurde, und nur wenige Meter von der Haustür entfernt floss murmelnd ein kleiner Bach entlang. Hinter der Haupthütte standen einige kleine Außenhütten, von denen eine vermutlich Grace’ Klosett beherbergte. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Hühnerhaus, aus dem Hühner in ein Gehege hinausmarschierten.
»Das sieht aber schön aus«, flüsterte Maisy. »Ich habe das Gefühl, wir sind in einem Fünf-Freunde-Buch, und jeden Moment kann so ein hinkender Mann daherkommen, mit einem seltsam ausgebeulten Sack über der Schulter.«
Duncan kicherte amüsiert. »Es sieht wirklich viel ordentlicher aus, als ich erwartet hätte«, gab er zu. »Schau dir mal an, wie sorgfältig die Holzscheite dort drüben in der kleinen Hütte gestapelt sind. Und auf dem Gemüsebeet gedeiht auch alles ganz prächtig.«
Maisy schaute hinüber zum Gemüsebeet und sah, dass Duncan recht hatte. Überall sah man die ersten Gemüsesprossen ihre Köpfe in ordentlichen Reihen aus der Erde recken, und auf die Stangenbohnen warteten bereits eigens errichtete Lattengerüste. Die Beete sahen ebenso wohlgestaltet und gepflegt aus wie die ihrer Großmutter, die die Arbeit jedoch Mr Pike überließ.
Maisy und Duncan halfen Mr Pike gerne. In London bestand ihr Garten aus einem kleinen Rechteck, auf dem wegen der Schattenlage nur moosversetztes Gras und ein paar immergrüne Pflanzen wuchsen, weshalb die Kinder sich nie dafür interessiert hatten. Doch Mr Pike war ein fröhlicher Mensch, dessen Art, über die unterschiedlichen Bäume und Pflanzen zu reden, den Kindern gefiel. Er hatte ihnen sogar eine Stelle zugewiesen, wo sie selbst etwas anpflanzen durften. Maisy hatte Blumen gesät, Duncan hatte sich für Salat und Radieschen entschieden. Sie konnte es kaum erwarten, mitzuerleben, wie die ersten Pflänzchen aufkeimten.
»Da kommt sie«, flüsterte Duncan. »Ich hoffe, ihr Hund wittert uns nicht und greift uns an. Igitt, sie hat ein totes Kaninchen über dem Arm!«
Die Art, wie das tote Tier über ihrem Arm baumelte, erinnerte Maisy an die Fuchsstola, die ihre Mutter besaß. Deren Glasaugen und Pfoten hatten Maisy immer mit Furcht erfüllt. »Meinst du, sie hat das Tier selbst getötet?«
»Mr Pike hat mir erzählt, dass er Kaninchen in Fallen fängt, aber das hat sie wohl nicht gemacht, sonst hätte sie ihr Gewehr nicht dabei«, meinte Duncan wissend.
Während sie noch sprachen, legte die Frau das Kaninchen auf einen großen Baumstumpf, zog ein Messer aus ihrem Gürtel und begann, das Tier zu häuten. Ihr Hund, ein schwarz-weißer Border Collie, saß auf den Hinterläufen und hielt seinen Blick hungrig auf sie gerichtet.
Auch die Zwillinge ließen die Frau nicht aus den Augen, aber in ihrem Fall aus einer Mischung aus Entsetzen und Faszination. Sie legte das Tier auf die Seite, schlitzte es von der Kehle bis zum Bauch auf und zog dann die Innereien mit bloßen Händen heraus.
»Wie eklig!«, flüsterte Maisy.
Offensichtlich hatte die Frau dies schon Dutzende Male gemacht. Ihre Bewegungen waren fließend und geschickt, routiniert und effizient. Sie legte die Innereien in eine Schüssel und trug sie zu einer seltsam anmutenden Vorrichtung, die in einem Baum hing und aussah wie ein mit Karton verstärktes Musselintuch. Dann stellte sie die Schüssel mit den Innereien hinein.
»Ich glaube, das ist für den Hund gedacht«, flüsterte Duncan. »Es sei denn, sie benutzt die Organe später für schwarze Magie.«
Zurück am Baumstumpf machte sich die Frau daran, das Kaninchen in Stücke zu schneiden, ehe sie ihre blutigen Hände am Bach wusch.
»Sie ist nicht so alt, wie ich gedacht habe«, flüsterte Maisy. »Sie sieht aus, als sei sie ungefähr in Mutters Alter.«
»Mutter ist erst achtunddreißig, aber sie wirkt älter«, wisperte Duncan zurück. »Nach dem, was Janice gesagt hat, muss diese Frau so Ende vierzig sein, aber so sieht sie wirklich nicht aus. Überhaupt habe ich sie mir ganz anders vorgestellt.«
Maisy vermutete, dass er ein ähnliches Bild wie sie im Kopf gehabt hatte: das eines alten Weibleins mit Hakennase, ungepflegtem Haar und schwarzen Zähnen. Aber diese Frau sah ganz anders aus.
Sie hatte ihr graues, langes Haar mit einem Band oder einem Stück Stoff im Nacken zusammengebunden. Ihre Haut war hell und makellos, ihre Figur schlank und ihre Bewegungen die einer Zwanzigjährigen. Sie trug eine dunkle Männerhose und ein grünes Hemd, beides ziemlich abgetragen, sowie ein dickes Paar braune Wanderstiefel.
Sie war weder hübsch noch hässlich, sah eindeutig weder nach Hexe noch verrückt aus. Nun verschwand sie im Haus, das Kaninchen unter dem Arm, den Hund auf den Fersen.
»Sollen wir sie ansprechen?«, fragte Maisy ihren Bruder.
»Wir könnten zurück zum Pfad schleichen und dort außer Sichtweite warten, bis sie wieder rauskommt. Dann unterhalten wir uns so laut, dass sie uns hört, und tun so, als hätten wir uns verlaufen. Wenn wir auf die Lichtung treten, geben wir uns ganz überrascht, sie dort zu sehen. Vielleicht lässt sich so eine Unterhaltung anfangen.«
Maisy schaute ihren Bruder anerkennend an. Er schien immer genau zu wissen, was in einer bestimmten Situation zu tun war.
Sie mussten nur etwa sechs Minuten warten, ehe die Frau wieder aus dem Haus trat. Duncan legte seiner Schwester die Hand auf die Schulter als Zeichen, dass sie ihm folgen sollte. »Hör mal, da fließt irgendwo ein Bach«, sagte er mit lauter Stimme. »Da können wir etwas trinken, und wenn von dort kein Weg zurück nach Burley führt, müssen wir eben schauen, dass wir den Pfad zurückgehen, den wir gekommen sind.«
Als ihr Bruder weiter in Richtung Lichtung ging, nahm Maisy den Faden auf. »Wir hätten eigentlich zum Mittagessen zurück sein sollen, also lass dir bloß nicht einfallen, noch irgendwas anderes unternehmen zu wollen. Wir kriegen sonst mächtig Ärger.«
Mit diesen Worten hatten sie die Lichtung erreicht und taten so, als hätten sie die Frau noch nicht bemerkt, die gerade ihr Gemüsebeet jätete.
»Oh, guten Tag«, rief Duncan schon im nächsten Moment aus. »Tut mir leid, wenn ich Sie störe, aber wie kommen wir auf dem schnellsten Weg zurück nach Burley?«
Der Border Collie schaute auf und knurrte bedrohlich.
»Geht den Weg zurück, den ihr gekommen seid«, erwiderte die Frau, und ihre kurz angebundene Art signalisierte, dass sie von Maisy und Duncan die sofortige Beherzigung ihrer Aufforderung erwartete.
»Tut mir leid«, sagte Duncan. »Wir sind neu hier und wollten nur die Gegend ein bisschen erkunden. Wir wollten Sie nicht stören. Dürften wir ein bisschen Wasser aus dem Bach dort trinken? Wir sind ziemlich durstig.«
»Ja, aber zügig, und dann verschwindet«, sagte die Frau. Sie warf ihrem Hund, der sich verteidigungsbereit gemacht hatte, einen Blick zu. »Alles gut, Toby.«
Die Zwillinge gingen zögernd auf den Bach zu, knieten sich hin und schöpften eine Handvoll Wasser. Maisy wünschte, sie hätten auf dem Absatz kehrtgemacht, da diese seltsame Frau sich keinerlei Mühe gab, entgegenkommend zu sein.
Duncan schien jedoch seinen Plan, sie zum Plaudern zu überreden, noch nicht aufgeben zu wollen. »Was für ein wunderschönes Fleckchen Erde, auf dem Sie hier leben«, meinte er fröhlich, nachdem er aufgestanden war. »Aber im Winter muss es ziemlich hart sein, nicht wahr?«
»Sag mal, bist du schwer von Begriff?«, fragte die Frau. »Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich lege auf Gesellschaft keinen Wert und auf Geplapper noch viel weniger. Ihr habt was zu trinken bekommen, jetzt geht.«
»Es tut uns leid, wenn wir Sie belästigt haben«, sagte Duncan und schenkte ihr sein breitestes Lächeln, mit dem er andere Menschen sonst immer für sich gewann.
Dieses Mal zeigte es jedoch keine Wirkung. Die Frau wandte sich ab und widmete sich wieder ihrer Harke und dem Unkrautjäten. Duncan warf seiner Schwester einen Blick zu, offensichtlich ratlos.
»Wenigstens haben wir sie gesehen«, sagte Maisy, kaum dass sie sich wieder auf dem Waldweg befanden. »Aber ich war ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Ich dachte, sie wohnt in einer heruntergekommenen Hütte mit verwilderten Katzen und sieht furchterregend aus.«
Duncan lachte. Seine Schwester hatte schon immer eine rege Phantasie gehabt. »Wir könnten ja noch mal herkommen und ihr richtig hinterherspionieren«, schlug er vor. »Wer weiß, vielleicht erwischen wir sie dabei, wie sie einen ahnungslosen Reisenden verscharrt!«
KAPITEL3
»Setzt euch«, befahl ihnen die Großmutter. »Auf das Sofa, damit ich euch richtig sehen kann.« Sie zeigte auf das Sofa, das ihr gegenüber stand und auf die große Fensterfront schaute.
Fünf Wochen waren vergangen, und dies war das erste Mal, dass ihre Großmutter sie zu sich gebeten hatte. Zwar waren sie ihr gelegentlich im Garten oder in der Küche begegnet, wenn sie Janice irgendwelche Anweisungen gab, aber dort war sie immer kurz angebunden gewesen und hatte nie gefragt, wie es ihnen ging oder wie sie ihre Zeit verbrachten.
Kaum hatte Janice ihnen gesagt, dass ihre Großmutter sie sehen wollte, begannen Maisy und Duncan sich zu sorgen, dass es um ihre Rückkehr nach London gehen sollte. Sie wollten nicht zurück, wussten aber, dass Einwände zwecklos waren, und so setzten sie sich stumm wie geheißen auf das Sofa. Die Sonne schien ihnen in die Augen, sodass sie die alte Dame gar nicht richtig sehen konnten, aber vielleicht hatte sie das absichtlich so inszeniert.
Wie sie wussten, war ihre Großmutter erst siebzig, doch mit ihrem zerfurchten Gesicht und ihrem schlohweißen Haar, das sie in einem Knoten trug, wirkte sie älter. Abgesehen davon, war sie stets hübsch und pfiffig gekleidet, so auch heute: Sie trug ein blaues Kleid mit passender, spitzenbesetzter Strickjacke. Ihre Kleidung unterstrich das Blau ihrer Augen, die zwar kalt, aber sehr schön waren und erahnen ließen, dass sie einmal eine Schönheit gewesen sein musste. Doch mittlerweile ging sie, außer zur Kirche, nur noch selten aus dem Haus. Dabei hatte Janice ihnen versichert, dass ihre Großmutter durchaus in der Lage war, meilenweit zu laufen, wenn sie es wollte.
»Wie ihr ja wisst, ist eure Mutter in ein Irrenhaus eingeliefert worden. Natürlich wird es heute so nicht mehr genannt, deshalb werde ich fortan von einem Pflegeheim sprechen«, begann sie ohne weitere Umschweife.
Duncan und Maisy nickten.
»Leider wurde bei der Untersuchung eurer Mutter festgestellt, dass sie bis auf Weiteres wird dort bleiben müssen.«
Die Zwillinge blickten sie ungläubig an. »Aber warum denn?«, fragte Duncan. »Wir dachten, sie würde nur für ein paar Wochen dort sein.«
»Die Probleme eurer Mutter bestehen schon seit Langem. Sie war noch nie ein froher Mensch«, sagte Großmutter mit einem Seufzer. »Ich war von Anfang an gegen diese Ehe, weil ich sehen konnte, dass sie einen Knacks hatte, und im Laufe der Jahre ist ihr der Zugang zur Realität immer weiter entglitten. Nachdem sie versucht hat, Gift zu nehmen, hatte euer Vater keine andere Wahl, als sie irgendwo unterzubringen, wo sie rund um die Uhr beobachtet werden kann. Eine solche Verantwortung kann man keinem Bediensteten zumuten.«
»Aber Mutter ist nicht verrückt«, brach es aus Maisy hervor. Sie wusste zwar, dass sie an etwas Ernstem litt, konnte jedoch nicht akzeptieren, dass es sich dabei um Irrsinn handeln sollte. »Ich glaube nicht, dass sie Gift geschluckt hat. Wir haben nur Bettys Aussage darüber gehört.«
»Du bist ein Kind«, erwiderte die Großmutter. »Was weißt du schon über solche Dinge? Ich kenne Betty nur aus den Berichten meines Sohnes, aber er vertraut ihr vollkommen.«
»Ich glaube, Mutter geht es jetzt so schlecht, weil sie von zu Hause fortgebracht wurde und weiß, dass wir hier sind«, sagte Duncan mit störrischer Miene.
Die alte Dame schürzte die Lippen. »Eurem Vater zufolge hat sie kaum wahrgenommen, dass sie nicht mehr zu Hause ist, und hat auch nicht nach euch gefragt. So viel zu ihrem Realitätssinn.«
»Das glaube ich nicht, dass sie nicht nach uns gefragt hat«, sagte Maisy, zunehmend aufgebracht. Ein paar Tränen liefen ihr die Wange hinunter.
»Beantworte mir eine Frage, Maisy: Wann habt ihr zuletzt länger als ein paar Minuten mit eurer Mutter verbracht?«, fragte ihre Großmutter mit hochgezogenen Augenbrauen.
Die Zwillinge schauten sich an. Seit Weihnachten hatte ihre Mutter die Zeit fast ausschließlich auf ihrem Zimmer verbracht. Wenn die Zwillinge von der Schule kamen, suchten sie sie in ihrem Zimmer auf, aber oft war ihre Mutter zu schläfrig, um mit ihnen zu sprechen.
»Letzten Sommer ging es ihr noch gut«, verteidigte Duncan sie. »Wir haben einen Nachmittag mit ihr im Hyde Park verbracht.«
Die alte Dame ließ sich mit ihrer Erwiderung Zeit. Sie schien nach den richtigen Worten zu suchen.
»Jedes Kind sollte in der Lage sein, sich an mehr als eine Situation im Jahr zu erinnern, in der es Zeit mit seiner Mutter verbracht hat«, meinte sie schließlich. »Ihr beiden habt euch so sehr an ihre sogenannte ›Krankheit‹ gewöhnt, dass ihr sie nicht in Frage stellt. Meiner Meinung nach hätte eure Mutter schon vor langer Zeit eingewiesen werden müssen, ehe ihr durch sie womöglich noch Schaden genommen hättet.«
»Sie hätte uns nie etwas angetan«, brach es aus Maisy hervor. »Du kennst sie doch gar nicht. Du hast uns nur ein Mal besucht, und das ist Jahre her.«
»Untersteh dich, so mit mir zu reden, Kind«, fuhr ihre Großmutter sie an. »Du verstehst nichts von dem, was sich zwischen Erwachsenen abspielt. Belassen wir es einfach dabei, dass eure Mutter und ich uns nicht verstanden haben. Deshalb hatte ich auch solche Vorbehalte, als euer Vater mich bat, euch bei mir wohnen zu lassen. Ich war der Meinung, es sei besser, wenn er seine Frau einweist, damit ihr in eurem Zuhause bleiben und eure Schule weiterhin besuchen könnt. Aber euer Vater bestand darauf, dass es euch guttäte, in Janice’ Obhut zu kommen.«
Sie hielt inne und fixierte die beiden mit durchdringendem Blick. »Ich muss sagen, dass er so weit wohl recht gehabt hat. Man merkt kaum, dass ihr im Haus seid, und alle Bediensteten sagen mir, dass ihr reizende, höfliche Kinder seid. Auch weiß ich, dass Janice euch sehr liebgewonnen hat. Seid ihr glücklich hier?«
Duncan fragte sich, wie sie es fertigbrachte, ihnen erst zu erklären, dass ihre Mutter ins Irrenhaus abgeschoben worden war, um sie im nächsten Atemzug zu fragen, ob sie glücklich seien.
»Wir waren es, bis du uns die Sache mit Mutter erzählt hast«, erwiderte er, während er offensichtlich um Fassung rang. Den Gedanken, dass seine Mutter geistig labil war, hatte Duncan gerade noch ertragen können, aber die Aussicht, dass sie nie wieder gesund werden würde, war unerträglich.
»Ich muss euch die Wahrheit sagen, so unschön sie auch ist«, sagte die Großmutter in weicherem Ton. »Ich weiß, dass ich nicht unbedingt mütterlich veranlagt bin. Euer Vater war schon sehr früh in einem Internat, also habe ich nie gelernt, wie man mit jungen Leuten redet. Aber ihr beiden scheint mir vernünftig und intelligent zu sein, und deshalb ist es an der Zeit, Pläne für eure Zukunft zu machen. Dazu gehört auch das Thema Schule.«
»Wir könnten aber auch eine Anstellung finden und unseren Lebensunterhalt selbst verdienen«, schlug Maisy vor. »Wir sind schließlich schon fünfzehn.«
Großmutter überraschte sie mit einem Lächeln, das ihr Gesicht weicher wirken und die Zwillinge ahnen ließ, dass sie nicht immer die kalte, strenge Frau war, die sie in ihr sahen.
»Für meine Enkel wünsche ich mir etwas Besseres, als dass sie auf einem Hof oder in einem Laden arbeiten«, sagte sie. »Euer Vater sähe es gerne, wenn ihr studiert, und deshalb habe ich einen Lehrer für euch engagiert. Mr Dove ist kriegsversehrt und sitzt im Rollstuhl, aber früher hat er an einer der besten Schulen Englands unterrichtet und war dort sehr hoch angesehen. Ihr werdet jeden Morgen nach Burley zu ihm nach Hause gehen und mittags zurückkommen. Die Nachmittage habt ihr frei, außer, Mr Dove gibt euch Hausaufgaben. Wie klingt das?«
So unerwartet kam die Frage nach ihrer Meinung, dass sie einander hilflos ansahen.
Maisy erholte sich zuerst. »Das klingt sehr gut, Großmutter. Danke.«
»Gut, dann ist das abgemacht«, sagte sie. »Ich werde heute Abend Mr Dove anrufen und vorschlagen, dass ihr am Montag mit dem Unterricht beginnt. Ich hoffe, ihr seid fleißig, besteht eure Prüfungen und geht irgendwann zur Universität. Habt ihr schon eine Vorstellung, was ihr später einmal machen wollt?«
»Ich wäre gerne Anwalt«, sagte Duncan.
»Und du, Maisy?« Sie schaute ihre Enkelin durchdringend an.
Duncan hatte schon öfter geäußert, dass er Anwalt werden wollte, aber Maisy hatte noch nie etwas anderes im Sinn gehabt, als zu heiraten und Kinder zu bekommen. Doch sie ahnte, dass ihre Großmutter von einem solchen Mangel an Ehrgeiz nicht beeindruckt wäre.
»Wissenschaftlerin«, sagte sie. »Ich würde gerne Heilmittel gegen schreckliche Krankheiten erfinden.«
Großmutter entließ sie ohne weiteren Kommentar.
Als sie wieder im Garten waren, wandte sich Duncan an Maisy. »Wissenschaftlerin?«, fragte er. »Wie kommst du denn darauf?«
»Keine Ahnung.« Sie zuckte mit den Achseln. »Irgendwas Tolles musste ich schließlich sagen.«
Sie schlenderten durch den von Mauern umgebenen Küchengarten ans andere Ende der Anlage, wo man auf einer Bank im Windschutz der Mauer gemütlich in der Sonne sitzen konnte, auch wenn es kalt war, wie an diesem Tag.
»Ich glaube nicht, dass Mutter wirklich verrückt ist«, brach es aus Duncan nach langem Schweigen hervor. »Wenn sie es wäre, hätten wir das längst bemerkt. Ich wette, Papa will sie nur loswerden, damit er eine andere Frau finden kann.«
»Vielleicht hast du recht, aber er hat, glaube ich, noch nie etwas getan, was darauf hindeutet. Ich habe schon überlegt, ob Betty ihn sich angeln will, aber er scheint Mutter wirklich sehr ergeben zu sein. Ich meine, er geht immer direkt zu ihr, wenn er von der Arbeit kommt.«
»Aber wir wissen nicht, wie es zwischen ihnen ist, wenn sie alleine sind«, argumentierte Duncan. »Vielleicht hat er ständig herumgemeckert und sie so unglücklich gemacht, dass sie darüber ein wenig verrückt geworden ist. Ich glaube eher, dass er sich ein lustiges Leben machen will, ohne Frau und Kinder.«
»Glaubst du wirklich, er ist der Typ Mann, der es ›lustig‹ haben will?«
Duncan lachte glucksend. Seit ihrem zehnten oder elften Lebensjahr machten die Zwillinge immer wieder Witze über die ernste, humorlose Art ihres Vaters. »Nein, eigentlich nicht.«
»Wer weiß, was der Grund für ihre Krankheit ist«, sagte Maisy. »Ich würde ja schon verrückt, wenn ich niemanden hätte, der mich schätzt, der mich zum Lachen bringt, mit dem ich Spaß haben kann.«
Wieder verfielen sie in Schweigen. Dann seufzte Duncan schwer. »Nur gut, dass wir einander haben. Stell dir mal vor, wir wären Einzelkinder. Schrecklich. Trotzdem glaube ich nicht, dass Mutter verrückt ist, und sowie ich eine Idee habe, wie sich das beweisen lässt, hole ich sie aus dieser Klinik heraus. Aber ich bin froh, dass wir hierbleiben können. Was hältst du von einem Lehrer im Rollstuhl?«
»Na ja, schneller als er sind wir auf jeden Fall«, kicherte Maisy. »Komm, lass uns Janice fragen, wer er ist. Ich wette, sie weiß alles über ihn.«
Janice stand in der Küche und putzte Gemüse fürs Mittagessen. Als die Kinder hereinkamen, ließ sie ihre Arbeit fallen und breitete die Arme aus, um ihnen den Trost zu geben, den sie nach der verstörenden Nachricht über ihre Mutter bestimmt brauchten.
Die Zwillinge flogen ihr in die Arme und vergruben die Gesichter an ihrem weichen, molligen Hals, der nach Vanille duftete. Bei der Umarmung musste Maisy wieder weinen, und auch Duncan schniefte.
»Es tut mir wirklich leid wegen eurer Mama. Mit so etwas umzugehen ist schwer, besonders in eurem Alter. Aber wenn es euch irgendwie tröstet, kann ich sagen, dass ich für meinen Teil froh bin, wenn ich euch noch ein wenig länger um mich habe, bis es eurer Mutter besser geht. Und ich glaube übrigens fest daran, dass sie eines Tages wieder gesund wird.«
Sie wischte ihnen die Tränen ab, machte ihnen eine Tasse Tee und schnitt ihnen je eine dicke Scheibe Früchtebrot ab.
Duncan fragte sie nach Mr Dove.
»Er ist ein herzensguter Mensch und soll auch ein wunderbarer Lehrer sein«, sagte sie. »Er ist eurer Großmutter sehr dankbar, weil er dachte, dass er nie wieder unterrichten könnte. Er ist erst Ende dreißig, und seine Frau hat ihn verlassen, als klar war, dass er nie wieder würde laufen können.«
Maisys Augenbrauen schossen in die Höhe. »Wirklich? Wie schrecklich! Aber wie kommt er denn alleine zurecht?«